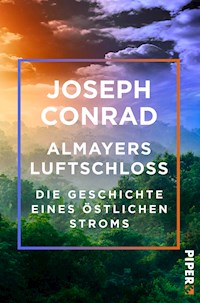
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gebannt von seinen eigenen Trugbildern stolpert der glücklose Kaufmann immer mehr in Abgrund - Joseph Conrads Erstlingsroman, in der all die Zutaten seines Meisterwerks »Herz der Finsternis« schon zu erkennen sind. Eigentlich möchte der glücklose, aber von großen Träumen erfüllte Kaufmann Almayer Borneo, diesen Ort der Dunkelheit, verlassen, um mit mit seiner Tochter Nina anderswo ein besseres Leben zu führen. Aber geschäftliche Misserfolge und seine Verbissenheit in große Pläne halten ihn inmitten des gefährlichen Dschugelgebietes fest. Es sind Luftschlösser, die Almayer baut und eitle Träume, die sich nie erfüllen werden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzt aus dem Englischen von Klaus Hoffer
Neuauflage einer früheren Ausgabe
ISBN 978-3-492-97957-3
© Piper Verlag GmbH, München 2017
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Almayer´s Folly. A Story of an Eastern River«, T. Fisher Unwin, London 1895
© der deutschsprachigen Ausgabe: Haffmans Verlag AG, Zürich 1992, 2000
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Vorbemerkung des Autors
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
ANHANG
Nachbemerkung des Übersetzers
Anmerkungen
Dem Andenken von T. B.[1] gewidmet
Qui de nous
n’a eu sa terre promise
son jour d’extase
et sa fin en exil
AMIEL
Vorbemerkung des Autors
In einer Kritik an jener Spezies Literatur, die sich ferne Länder zum Revier auserkoren hat und fremde Völker als ihr Wild, das sie im Palmenschatten und im grellen Licht schutzlos der Sonne ausgesetzter Küstenstreifen jagt, die unter ehrenwerten Kannibalen spielt und unter geistig-seelisch anspruchsvolleren Vorstreitern unserer grandiosen Tugenden –, in einer solchen Kritik also (ließ man mich wissen) habe eine in der Welt des geschriebenen Wortes hochgeschätzte Dame[2], ihre Mißbilligung eben dieser Literatur mit den Worten Ausdruck verliehen, die Erzählungen, die sie hervorbringe, seien »entzivilisiert«. Und mit diesem Satz, so darf ich annehmen, wird aus verächtlicher Ablehnung nicht nur über diese Erzählungen der Stab gebrochen, sondern zugleich auch über die fremden Völker und die fernen Länder.
Das Urteil einer Frau: intuitiv, gescheit, zauberhaft treffsicher – ja unfehlbar. Ein Richtspruch ohne alle Gerechtigkeit. Die Richterin und Rezensentin scheint zu glauben, daß in jenen fernen Landen Freude nichts als Kampfgeschrei und Kriegstanz, Pathos nichts als Heulen sei und grausiges Blecken zugefeilter Zähne und daß man sämtliche Probleme mit Revolverlauf oder Assagaispitze löse. Dem ist jedoch nicht so. Aber die dergestalt irrende Richterin mag als Entschuldigung die irreführende Art des Beweismaterials anführen.
Das Gemälde des Lebens (hier wie dort) wird mit der gleichen Detailtreue gezeichnet und mit den gleichen Farbtönen gemalt. Nur daß das geblendete Auge in der grausamen Heiterkeit des Himmels, unter dem gnadenlosen Glanz der Sonne die zarteren Feinheiten übersieht, bloß die groben Umrißlinien wahrnimmt und die Farben ihm im unveränderlichen Licht grell und nuancenlos erscheinen. Nichtsdestoweniger ist es das nämliche Gemälde.
Und es gibt Bande zwischen uns und jenen fernen Menschen. Ich rede hier von Männern und Frauen aus Fleisch und Blut – und nicht von jenen betörenden, anmutigen Schattenwesen, die sich durch unsern Dreck und Qualm bewegen und auf denen der schwache Abglanz des Glorienscheins unserer Tugenden liegt, die sich alle Feinnervigkeit und Kultiviertheit und alle Weltklugheit zu eigen gemacht haben – und doch kein Herz ihr eigen nennen, weil sie bloß Schattenwesen sind.
Jene hegen (wahrscheinlich) nur für die Unsterblichen Sympathie, für die Engel in der Höhe und die Teufel in der Tiefe. Ich bin’s zufrieden, daß meine Sympathie den Gewöhnlichsterblichen gilt – wo sie auch leben: ob in Häusern oder Zelten, unter einer Nebeldecke auf den Straßen oder im Dschungel hinter einer schwarzen Reihe düsterer Mangroven, die die grenzenlose Einsamkeit der See säumt. Denn auf ihrem Land – wie auf unserem auch – ruht der unergründliche Blick des Allmächtigen. Ihre Herzen müssen – wie die unsern – die Last der Himmelsgaben tragen: den Fluch der Tatsachen und den Segen der Illusionen, das bittere Kraut ihrer Weisheit und die trügerische Tröstung ihrer Luftschlösser.
1895 J.C.
Erstes Kapitel
»KASPAR! Makan[3]!«
Die nur zu bekannte, durchdringende Stimmeriß Almayer[4] aus seinem Traum von einer grandiosen Zukunft zurück in die unerfreuliche Realität der gegenwärtigen Stunde. Und eine unerfreuliche Stimme obendrein. Er kannte sie schon seit vielen Jahren, und mit jedem Jahr gefiel sie ihm weniger. Gleichviel. All das würde nun bald ein Ende haben.
Er scharrte nervös mit den Füßen, nahm aber ansonsten keine Notiz von dem Ruf. Seine beiden Ellbogen lagen auf der Balustrade der Veranda auf, während er wieder starr hinaus auf den großen Strom sah, der – unbekümmert und hastig – unter seinen Augen dahinfloß. Zur Zeit des Sonnenuntergangs betrachtete er ihn gerne – vielleicht weil die sinkende Sonne zu dieser Stunde ein leuchtendes Gold auf die Wasser des Pantai[5] warf, und mit Gold befaßte sich Almayer in Gedanken häufig: Gold, das ihm zur Seite zu schaffen mißlungen war; Gold, das andere zu beschaffen verstanden hatten – auf unredliche Weise, versteht sich – oder Gold, das er, durch sein eigenes redliches Bemühen, für sich und Nina noch zu beschaffen gedachte. Er tauchte ganz ein in seinen Traum von Reichtum und Macht, fernab dieser Küste, an der er so viele Jahre verbracht hatte – vergessen all die bittere Mühe und Plage, angesichts dieses Traums von nobler, großartiger Belohnung. Sie würden in Europa leben, er und seine Tochter. Sie würden reich und angesehen sein. Niemand würde in Gegenwart ihrer strahlenden Schönheit und seiner immensen Reichtümer an ihr Mischlingsblut denken. Und indem er zum Zeugen ihrer Triumphe würde, würde er noch einmal jung werden und die fünfundzwanzig Jahre kräftezehrenden Lebenskampfes an dieser Küste vergessen, wo er sich als Gefangener fühlte. Das alles war zum Greifen nah. Wenn nur endlich Dain[6] wieder da wäre! Und er mußte bald wieder da sein – im eigenen Interesse, um seines eigenen Anteils willen. Er hatte sich nun schon mehr als eine Woche verspätet! Vielleicht kehrte er heute nacht zurück.
Solche Gedanken gingen Almayer durch den Kopf, während er von der Veranda seines neuen und schon wieder verrotteten Hauses – dieses jüngsten Mißgriffs seines Lebens – auf den breiten Strom hinausblickte. An diesem Abend war seine Oberfläche nicht wie aus Gold, weil ihn die Regenfälle hatten anschwellen lassen, und er wälzte unter Almayers zerstreuten Blicken die wütenden und schlammigen Wassermassen vor sich her, die zerkleinertes Treibholz und große, abgestorbene Baumstämme mit sich führten und ganze Bäume samt Wurzeln, Ästen und Blattwerk, zwischen denen die Flut Strudel bildete und wütend aufbrauste.
Einer dieser dahintreibenden Bäume war gleich neben dem Haus an dem sanft abfallenden Ufer gestrandet, und Almayer vergaß seinen Traum und beobachtete ihn mit schläfrigem Interesse. Der Baum schwang inmitten des zischenden und schäumenden Wassers träge herum, und nachdem er sich schon bald von seinem Hindernis gelöst hatte, glitt er wieder stromabwärts, drehte sich langsam um die eigene Achse, und dabei reckte er – wie eine Hand, die er in stummem Protest gegen die überflüssige Brutalität des Flusses zum Himmel erhoben hatte – einen langen, entblößten Ast in die Höhe. Almayers Interesse am Schicksal des Baumes nahm plötzlich zu. Er beugte sich vor, um zu sehen, ob er an der Landzunge weiter unten vorbeikommen würde. Er kam vorbei. Almayer richtete sich auf und überlegte, daß der Baum nun freie Bahn haben würde, bis hinunter ans Meer, und er beneidete dieses seelenlose Ding, das in der immer tiefer werdenden Dunkelheit immer kleiner und unkenntlicher wurde, um sein Schicksal. Als er es schließlich ganz aus den Augen verloren hatte, fragte er sich, wie weit es wohl in die See hinaustreiben würde. Würde die Strömung es nach dem Norden hinauftragen oder in den Süden hinunter? Wahrscheinlich nach Süden – bis in die Sichtweite von Celebes, vielleicht sogar bis Makassar!
Makassar! Almayers lebhafte Vorstellungskraft ließ ihn den Baum auf seiner imaginären Reise überholen, aber sein Erinnerungsvermögen, das an die zwanzig oder mehr Jahre hinter dem gegenwärtigen Augenblick zurückblieb, ließ vor seinen Augen das Bild eines jungen und schlanken Almayer wiedererstehen, wie er, bescheiden, ganz in Weiß, an der staubigen Anlegestelle von Makassar vom holländischen Postschiff an Land gegangen war – in der Absicht, in den Godons[7] des alten Hudig[8] um die Gunst des Schicksals zu buhlen. Das war ein wichtiger Abschnitt in seinem Leben gewesen – der Anfang einer neuen Existenz. Sein Vater, ein kleiner Bediensteter im Botanischen Garten von Buitenzorg, war selbstverständlich höchst erfreut darüber, seinen Sohn in einer solchen Firma unterzubringen, und der junge Mann war alles andere als abgeneigt, den todbringenden Küsten Javas und den kärglichen Annehmlichkeiten des elterlichen Bungalows den Rücken zu kehren, wo der Vater tagein, tagaus über die Dummheit der eingeborenen Gärtner murrte und die Mutter aus den Untiefen ihrer Chaiselongue dem verlorenen Glanz Amsterdams, wo sie aufgewachsen war, und ihrer gesellschaftlichen Stellung als Tochter eines ortsansässigen Tabakhändlers nachtrauerte.
Almayer hatte sein Zuhause leichten Herzens und noch leichterer Brieftasche zurückgelassen, gut in Englisch und in Arithmetik, ganz darauf aus, die Welt zu erobern, und ohne den geringsten Zweifel daran, daß ihm das auch gelingen würde.
Wie er nun, jene zwanzig Jahre später, in der dumpfen, erdrückenden, für Borneo so charakteristischen Abendhitze dastand, rief er sich in einem Gefühl wohliger Wehmut das Bild von Hudigs geräumigen und kühlen Lagerhallen in Erinnerung, mit ihren langen, geraden Alleen aus Ginkartons und Baumwollballen, dem großen Tor, das lautlos auf und zu schwang, dem nach der gleißenden Helle der Straße so angenehmen Halbdunkel im Inneren, den kleinen, von Geländern umgebenen Gevierten zwischen Bergen von Handelsgütern, in denen die chinesischen Bürokräfte – immer adrett, distanziert und mit trauerumflortem Blick – Aufzeichnungen machten, flink, schweigend inmitten der lärmenden Arbeitsbrigaden, die im Takt zu einer gesummten Melodie, die in einem verzweifelten Aufschrei ausklang, Fässer rollten oder Kisten umschichteten. Am oberen Ende, gegenüber dem großen Tor, hatte man einen größeren Platz durch ein Geländer abgetrennt, der hell erleuchtet und wo der Lärm auf Grund der Entfernung gedämpft war, so daß er vom zarten und unausgesetzten Geklimper von Silbergulden übertönt wurde, die andere verschwiegene Chinesen abzählten und unter der Aufsicht von Mr. Vinck, dem Kassier und Genius loci, der rechten Hand des Prinzipals, die hier die Geschicke lenkte, zu Stößen aufschichteten.
In diesem offenen Geviert arbeitete Almayer an seinem Tisch, unweit einer kleinen grüngestrichenen Tür, neben der immer ein Malaie mit roter Schärpe und Turban stand und von dessen Hand eine kurze, von oben herabbaumelnde Schnur mit der Regelmäßigkeit einer Maschine auf und ab bewegt wurde. Die Schnur betätigte auf der anderen Seite der grünen Tür, wo sich das sogenannte »Privatbüro« befand und wo der alte Hudig – der Prinzipal – auf seinem Thron saß und geräuschvolle Audienzen hielt, einen Punkah[9]. Ab und zu flog die kleine Tür auf und gewährte der Außenwelt, durch einen Schleier bläulichen Tabakrauches hindurch einen Blick auf einen langen Tisch, der mit Flaschen unterschiedlichster Form und hohen Wasserkrügen beladen war, und auf Rohrsessel, in denen, hingelümmelt, lärmende Männer Platz genommen hatten, während der Prinzipal seinen Kopf herausstreckte und, die Hand auf der Türschnalle, Vinck vertraulich etwas zubrummte; oder aber er erteilte einen Befehl, der den Speicher hinunterhallte, oder er erspähte einen unschlüssig zaudernden Fremden, den er mit einem freundlichen Brüllen begrüßte: »Willkommen, Gapitan! Wo gommen herr? Bali, hä? Haben Bonies[10] mitgebracht? Ich wollen Bonies! Wollen alle, die Sie haben – ha! ha! ha! Gommen Sie rein!« Dann wurde der Fremde hineingezogen, die Tür unter einem Schwall von Schreien geschlossen, und wieder füllte der übliche Lärm den Raum – der Gesang der Arbeiter, das Rumpeln der Fässer, das Kratzen eiliger Federn. Und über all dem ertönte das Geklimper schwerer Silberstücke, die unablässig durch die gelben Finger wachsamer Chinesen glitten.
Zu dieser Zeit ging Makassar vor Leben und Betriebsamkeit über. Es war der Ort auf der Insel, wohin es alle jene Teufelskerle zog, die, nachdem sie ihre Schoner an der australischen Küste in Schuß gebracht hatten, auf der Suche nach Gold und Abenteuern den Malaiischen Archipel überfallen hatten. Draufgängerisch, gewissenlos und geschäftstüchtig, wie sie waren, und einem Scharmützel mit Seeräubern, auf die man hier noch an so mancher Küste stieß, keineswegs abgeneigt, dazu immer darauf aus, schnell zu Geld zu kommen – so fanden sie sich in der Bucht zu einem der üblichen »Rendezvous« ein, das dem Geschäft und dem Amüsement diente. Die holländischen Kaufleute nannten diese Männer englische Hausierer; unter ihnen gab es allerdings zweifellos auch ein paar Gentlemen, für die diese Art des Lebens ihren eigenen Reiz hatte, die meisten aber waren Seeleute. Der von allen anerkannte König hieß Tom Lingard[11] – er, den die Malaien, ob nun Ehrenmänner oder Betrüger, schweigsame Fischer oder verwegene Galgenvögel, den »Rajah-Laut[12]« – den König der Meere – nannten.
Almayer war noch keine drei Tage in Makassar und hatte schon von ihm gehört; er hörte von seinen gerissenen Transaktionen erzählen, von Liebschaften und verzweifelten Kämpfen mit Sulu-Piraten, zu denen die romantische Geschichte eines Kindes (eines Mädchens) gehörte, das der siegreiche Lingard entdeckte, als er nach einem längeren Kampf mit Piraten seinen Fuß auf eine Prau gesetzt hatte, deren Besatzung er über Bord schickte. Dieses Mädchen, so wußte man zu berichten, hatte Lingard an Kindes Statt angenommen und nannte es »meine Tochter«, die er gerade in einem Kloster auf Java erziehen ließ. Er hatte einen heiligen Eid geschworen, sie vor seiner Rückkehr in seine Heimat mit einem Weißen zu verheiraten und ihr all sein Geld zu hinterlassen. »Und Geld hat Captain Lingard massenhaft«, erklärte Mr. Vinck, den Kopf zur Seite geneigt, feierlich: »Emen Haufen Geld – mehr als Hudig!« Er machte eine Pause, damit sich die Zuhörer von ihrem Staunen über eine derart unglaubliche Behauptung erholen könnten, und fügte noch mit flüsternder Stimme hinzu: »Wissen Sie – er hat einen Strom entdeckt.«[13]
Das war es! Einen Strom hatte er entdeckt! Das war die Tat, die den alten Lingard so himmelhoch über das gemeine Volk seefahrender Abenteurer erhob, die tagsüber mit Hudig Geschäfte machten und nachts Champagner tranken, spielten, ihre Lieder grölten und sich unter der großen Veranda des Sunda Hotels mit Mischlingsmädchen vergnügten. Auf diesem Fluß, dessen Mündungsarme er allein kannte, pflegte Lingard seine ausgewählte Ladung aus Baumwollwaren, Messinggongs, Gewehren und Schießpulver hinaufzubringen. Die Flash, seine Brigg, die er persönlich befehligte, verschwand bei solchen Gelegenheiten in aller Stille des Nachts von der Reede, während seine Trinkkumpane noch die Folgen ihres mitternächtlichen Gelages ausschliefen, nachdem Lingard, dem selbst keine noch so große Menge Alkohol etwas anhaben konnte, dafür gesorgt hatte, daß sie betrunken unter den Tischen lagen, bevor er an Bord ging. Viele hefteten sich ihm an die Fersen, um jenes sagenhafte Land zu finden, in dem es Kautschuk und Rohr, Perlmuscheln und Vogelnester, Pech und Damaragummi im Überfluß gab, aber die kleine Flash segelte in jenen Gewässern jedem Schiff auf und davon. Ein paar von ihnen erlitten auf den verborgenen Sandbänken und Korallenriffen Schiffbruch, büßten ihre gesamte Habe ein und retteten mit Mühe und Not das nackte Leben vor dem grausamen Zugriff dieser sonnenbeschienenen, lächelnden See; andere ließen sich entmutigen; und viele Jahre lang bewahrten die grünen, friedfertig scheinenden Inseln, die die Pforten zum gelobten Land bewachten, mit der unbarmherzig heiteren Gelassenheit der tropischen Natur ihr Geheimnis. Und so kam und ging Lingard – einmal heimlich, dann wieder vor aller Augen – auf seine Expeditionen, wurde wegen seiner Kühnheit und der Riesenprofite seiner riskanten Unternehmungen in Almayers Augen zum Helden, erschien er Almayer als ein wirklich großer Mann, wenn er ihn die Lagerhalle heraufkommen sah und er Vinck ein »Wie geht’s?« zubrummte oder Hudig, den Prinzipal, polternd mit einem »Hallo, alter Pirat! Gibt es Sie immer noch?« begrüßte – dem Vorgeplänkel zu den Transaktionen hinter der kleinen grünen Tür. Oft hielt Almayer in der abendlichen Stille der verlassenen Lagerhalle, wenn er seine Papiere wegsperrte, bevor er mit Mr. Vinck, in dessen Haushalt er lebte, die Heimfahrt antrat, inne, um dem Lärm einer hitzigen Diskussion im Privatbüro zu lauschen, und dann hörte er das tiefe und monotone Knurren des Prinzipals, das vom Brüllen Lingards unterbrochen wurde – wie der Kampf zweier Bulldoggen um einen Röhrenknochen. Aber für Almayers Ohren hörte sich das wie ein Kampf von Titanen an – wie ein Krieg der Götter.
Es verging etwa ein Jahr, als Lingard, der im Zuge seiner Geschäfte wiederholt mit Almayer zu tun gehabt hatte, plötzlich und für den Beobachter eher unbegreiflich – an dem jungen Mann Gefallen zu finden schien. In feuchtfröhlicher Runde pries er ihn noch spät nachts beim Umtrunk im Sunda Hotel in den höchsten Tönen, und eines schönen Morgens glaubte Vinck nicht richtig zu hören, als ihm Lingard erklärte, er wolle »diesen jungen Mann unbedingt als Frachtaufseher haben, als eine Art Kapitänsschreiber, der mir den Papierkram abnimmt«. Hudig stimmte zu. Almayer, der in sich die natürliche Sehnsucht des jungen Mannes nach Abwechslung verspürte, war alles andere als abgeneigt, und nachdem er seine Siebensachen gepackt hatte, ging er auf eine jener langen Kreuzfahrten an Bord der Flash, auf denen der alte Seemann in der Regel fast alle Inseln des Archipels anlief.[14] Die Monate flogen vorbei, und Lingards Freundschaft schien noch zu wachsen. Oft, wenn die schwache nächtliche, von den aromatischen Dünsten der Inseln geschwängerte Brise die Brigg sachte unter dem friedlichen und glitzernden Himmel vor sich her trieb und er mit Almayer auf Deck auf und ab ging, öffnete der alte Seemann vor seinem wie hypnotisierten Zuhörer sein Innerstes. Er erzählte von früher, von Gefahren, denen er entronnen war, von den Riesengewinnen, die sich in seinem Gewerbe machen ließen, von neuen Schachzügen, von denen er sich in Zukunft noch größere Profite versprach. Oft hatte er auch seine Tochter erwähnt, jenes Mädchen, das er in der Prau der Piraten gefunden hatte, und wenn er von ihr sprach, so stets in der eigentümlich anmutenden Rolle des zärtlichen Vaters. »Sie muß jetzt schon ein richtiges Fräulein sein«, sagte er dann. »Es ist ja nahezu vier Jahre her, seit ich sie zum letztenmal sah. Verdammich, Almayer, ich glaub, wir laufen auf dieser Fahrt noch Surabaya an.« Und nach solch feierlicher Erklärung verschwand er immer kopfüber in seiner Kajüte und brummte vor sich hin: »Es muß etwas geschehen – muß was geschehen.« Öfter als einmal überraschte er Almayer damit, daß er rasch vor ihn hin trat, sich, als wollte er etwas sagen, mit einem kräftigen »Hem!« räusperte, um sich unvermittelt wieder abzuwenden und schweigend über die Schiffswand zu lehnen, von wo er dann stundenlang, und ohne sich zu bewegen, das Glimmern und Glitzern der phosphoreszierenden See entlang der Schiffswand betrachtete. Es war in der Nacht vor ihrer Ankunft in Surabaya, als einer dieser Versuche der Vertrauensbildung von Erfolg gekrönt war. Nachdem er sich geräuspert hatte, fing er an zu reden, und mit seiner Rede verfolgte er ein ganz bestimmtes Ziel: Er wolle, daß Almayer seine Adoptivtochter heirate. »Und glaub nur ja nicht, du könntest kneifen, bloß weil du weiß bist!« brüllte er unvermittelt los, bevor der verdatterte junge Mann auch nur den Mund aufmachen konnte. »Damit kommst du bei mir nicht durch. Kein Mensch wird die Hautfarbe deiner Frau auch nur wahrnehmen. Dafür sind die Dollarbündel nämlich zu dick. Und bis ich einmal tot bin, werden sie noch um einiges dicker sein – merk dir das! Millionen werden das sein, Kaspar! Millionen, sag ich dir! Und alles für sie – und für dich, wenn du tust, was man dir sagt.«
Almayer war von diesem unerwarteten Vorschlag überrumpelt. Er zögerte, und eine Weile sagte er gar nichts. Er hatte die Gabe einer starken und lebendigen Vorstellungskraft, und in diesem Augenblick sah er in gleißendem Licht Berge funkelnder Gulden aufblitzen und sah all die Möglichkeiten eines Lebens im Überfluß vor sich. Das Ansehen, ein Leben in wohligem Nichtstun – für das er sich so gut geschaffen fühlte – seine Schiffe, seine Lagerhallen, seine Waren (der alte Lingard würde ja nicht ewig leben), und als Krönung alles dessen erstrahlte in der Ferne der Zukunft wie ein Märchenschloß das prächtige Amsterdamer Herrenhaus, jenes irdische Paradies seiner Träume, in dem er – mit Hilfe des alten Lingard und dessen Geldes zum König unter gewöhnlichen Menschen gemacht – seinen Lebensabend in unbeschreiblichem Glanz verbringen würde. Und was die andere Seite der Medaille betraf – die lebenslängliche Gemeinschaft mit einer Malaiin, dieser Hinterlassenschaft eines Boots voller Piraten –, so war da in ihm bloß das etwas vage Bewußtsein von Scham, weil er ein Weißer war. Immerhin: Vier Jahre klösterlicher Erziehung; und abgesehen davon – vielleicht segnete sie gütigerweise das Zeitliche. Er fiel immer auf die Butterseite – und Geld vermag viel! Man mußte es einfach durchstehen! Warum auch nicht? Er hatte die unbestimmte Vorstellung, er würde sie irgendwo unter Verschluß halten, egal wo – nur außerhalb seiner glanzvollen Zukunft. Es war doch kein Problem, eine Malaiin loszuwerden, letztlich doch nur eine Sklavin (in seinen östlichen Wertvorstellungen) – Kloster hin, Trauungspomp her.
Er hob den Kopf und trat vor den gespannt wartenden, aber auch wutentbrannten Seemann.
»Ich werde – selbstverständlich – was immer Sie wünschen, Captain Lingard.«
»Sag Vater zu mir, mein junge. Sie tut’s auch«, sagte der alte Abenteurer, milder. »Aber verdammt will ich sein, wenn ich nicht geglaubt habe, du wolltest kneifen. Merk dir das Kaspar: Ich krieg immer, was ich will. Also wär’s sinnlos gewesen. Aber du bist ja kein Narr.«
Er erinnerte sich gut an diesen Augenblick – an den Blick, den Tonfall, die Worte und was sie bewirkt hatten – an das gesamte Szenario. Er erinnerte sich an das schmale, windschiefe Deck der Brigg, die schweigend im Schlaf daliegende Küste, die glatte, schwarze Oberfläche der See, über die der aufgehende Mond ein goldenes Band gelegt hatte. Er erinnerte sich an all das, und er erinnerte sich an das Gefühl wahnsinniger Freude – beim Gedanken daran, welches Vermögen ihm in die Hände fallen würde. Er war damals kein Narr gewesen, und er war auch heute keiner. Die Umstände hatten sich gegen ihn verschworen; das Vermögen war verloren, aber die Hoffnung war noch da.
Er zitterte vor Kälte in der nächtlichen Luft, und plötzlich wurde er sich der tiefen Finsternis bewußt, die mit dem Untergang der Sonne über den Fluß hereingebrochen war und die Konturen des gegenüberliegenden Ufers ausgelöscht hatte. Nur das Feuer aus dürren Ästen, das vor dem umfriedeten Kampong[15] des Rajahs angezündet worden war, warf sein Licht auf die zottigen Stämme der nahen Bäume und einen Streifen schimmernden Rots bis zur Flußmitte, wo Treibholz in undurchdringlichem Dunkel meerwärts eilte. Er erinnerte sich undeutlich daran, irgendwann im Laufe des Abends von seiner Frau[16] gerufen worden zu sein. Wahrscheinlich zum Abendessen. Aber ein Mann, der gerade dabei ist, den Trümmerhaufen der Vergangenheit in der Morgenröte neuer Hoffnungen zu betrachten, kann seinen Hunger nicht danach richten, wann der Reis gar ist. Dennoch – es war Zeit, nach Hause zu gehen; es wurde allmählich spät.
Er schritt behutsam über die losen Planken zur Leiter. Eine Eidechse stieß, aufgeschreckt durch den Lärm, einen Klageruf aus und verschwand blitzartig im hohen Ufergras. Durch die Vorsicht, die Almayer walten lassen mußte, um auf dem unebenen Boden, auf dem sich Steine, verfaulende Bretter und roh gezimmerte Tragbalken zu einem unentwirrbaren Durcheinander auftürmten, nicht zu stürzen, wurde er nachhaltig an die Realitäten des Lebens erinnert, und so paßte er höllisch auf, als er nun über die Leiter hinunterkletterte. Als er den Weg zum Haus einschlug, in dem er wohnte – »mein altes Haus«, nannte er es –, machte sein Ohr weit draußen auf dem dunklen Fluß das Platschen von Paddeln aus. Er hielt inne, überrascht und alarmiert, daß noch zu so später Stunde und bei so schwerem Hochwasser jemand auf dem Fluß sein sollte. Jetzt konnte er die Paddel ganz genau hören – und sogar einen raschen, gedämpften Wortwechsel, das heftige Keuchen von Männern, die mit der Strömung kämpften und auf das Ufer zustrebten, auf dem er stand. Und es war ganz in der Nähe – aber es war zu dunkel, als daß man unter dem überhängenden Ufergebüsch etwas erkennen konnte.
»Bestimmt sind das Araber«, brummte Almayer bei sich und starrte in die geradezu körperliche Finsternis. »Was wollen die denn jetzt, um diese Zeit? Der verdammte Abdulla[17] führt wieder etwas im Schilde!«
Das Boot war nun ganz nah.
»Heda, Mann!« rief Almayer laut.
Der Klang der Stimmen verstummte, aber die Paddel arbeiteten so wild drauflos wie zuvor. Dann zitterte der Busch vor Almayer, und das krachende Geräusch von Paddeln, die in das Kanu fielen, hallte durch die stille Nacht. Sie hielten sich nun an dem Busch fest, aber Almayer konnte über dem Ufer kaum einen undeutlichen, dunklen Umriß von Kopf und Schultern eines Mannes ausmachen.
»Bist du’s, Abdulla?« fragte Almayer unsicher.
Eine tiefe Stimme gab Antwort:
»Tuan[18] Almayer spricht zu einem Freund. Hier ist kein Araber.«
Almayers Herz tat einen Satz.
»Dain!« rief er aus. »Endlich! Endlich! Was hab ich Tag und Nacht auf dich gewartet. Ich hatte dich beinah schon aufgegeben.«
»Nichts hätte mich davon abhalten können, hierher zurückzukommen«, stieß der andere fast leidenschaftlich hervor. »Nicht einmal der Tod«, fügte er flüsternd hinzu.
»Das sind Worte eines Freundes, und sie tun gut«, sagte Almayer herzlich. »Aber du bist zu weit heroben. Fahr weiter hinunter bis zum Landesteg. Deine Leute können ja bei mir im Kampong Reis kochen, während wir im Haus miteinander reden.«
Die Einladung blieb unbeantwortet.
»Was ist denn?« fragte Almayer unruhig. »Mit der Brigg ist doch hoffentlich alles in Ordnung?«
»Wo die Brigg ist – da kann kein Orang Blanda[19] heran«, sagte Dain mit einem düsteren Beiklang in der Stimme, der Almayer in seinem Überschwang entging.
»Das ist gut«, sagte er. »Aber wo sind deine Leute? Du hast ja bloß zwei von ihnen mit dir.«
»Hör zu, Tuan Almayer«, sagte Dain. »Die Sonne des morgigen Tages soll mich in deinem Haus willkommen heißen, und dann wollen wir miteinander sprechen. Doch nun muß ich zum Rajah.«
»Zum Rajah? Weshalb denn? – Was willst du bei Lakamba[20]?«
»Tuan, morgen wollen wir uns wie zwei Freunde unterhalten. Doch heute nacht muß ich noch zu Lakamba.«
»Dain, du wirst mich doch nicht jetzt, wo alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, im Stich lassen?« flehte Almayer.
»Bin ich nicht zurückgekommen? – Aber zu deinem und zu meinem Besten muß ich erst noch zu Lakamba.«
Der schemenhafte Umriß des Kopfes verschwand unvermittelt. Der Matrose im Bug ließ los, so daß der Busch mit einem peitschenden Geräusch zurückschnellte und Almayer, der sich vorgebeugt hatte, um besser zu sehen, mit schlammigem Wasser bespritzte. Kurz darauf schoß das Kanu hinaus in den Lichtstreifen, der vom hohen Feuer auf dem gegenüberliegenden Ufer auf den Fluß fiel und die Umrisse zweier Männer sichtbar werden ließ, die sich über ihre Arbeit beugten, und dann eine dritte Figur im Heck des Boots, die, auf dem Kopf einen riesigen runden Hut, der wie ein ins Phantastische übertriebener Pilz aussah, das Steuerpaddel schwenkte.
Almayer sah dem Kanu nach, bis es ganz aus der Lichtbahn geglitten war. Gleich darauf drang über das Wasser das Murmeln vieler Stimmen an sein Ohr. Er konnte die Fackeln sehen, die aus dem brennenden Haufen gezogen wurden und momentlang das Tor im Pfahlzaun sichtbar machten, um das sie sich drängten. Dann gingen sie offenbar hinein. Die Fackeln verschwanden, und das zerstreute Feuer flackerte nur noch schwach und unregelmäßig.
Almayer strebte mit weit ausholenden Schritten und voll innerer Unruhe heimwärts. Dain hatte bestimmt nicht vor, ihn hereinzulegen. Das war absurd. Dain und Lakamba hatten beide viel zuviel Interesse am Gelingen seines Plans. Sich auf Malaien zu verlassen zeugte von wenig Verstand; aber andererseits – auch Malaien besitzen ein gewisses Maß an Vernunft und wissen ihre Interessen zu wahren. Letztlich würde alles – mußte alles gut werden. Als er mit seinen Überlegungen an diesem Punkt angelangt war, befand er sich am Fuße der Stufen, die zur Veranda seines Hauses führten. Von hier unten konnte er beide Arme des Flusses sehen. Der Hauptarm des Pantai verlor sich in vollständiger Dunkelheit, denn das Feuer vor dem Kampong des Rajahs war zur Gänze erloschen, aber entlang des Armes in Richtung Sambir[21] sah er, soweit das Auge reichte, die lange Reihe malaiischer Häuser, die ans Ufer drängten und zwischen deren Bambuswänden hier und da schwach ein Licht aufblitzte oder auf deren über dem Fluß errichteten Plattformen da und dort eine rußende Fackel brannte. Weiter draußen, wo die Insel in einer niedrigen Landzunge auslief, erhob sich, hoch über den Wohnstätten der Malaien, eine dunkle Masse von Gebäuden. Mit solidem Fundament, auf festem Grund erbaut, mit einer Menge Platz rundum und übersät von vielen starken weißen Lichtern, die an Petroleum und gläserne Lampenzylinder denken ließen, standen sie da – das Haus und die Godons von Abdulla ben Selim, dem großen Handelsherrn von Sambir. Für Almayer hatte dieser Anblick etwas zutiefst Ekelhaftes, und er schüttelte seine Faust in Richtung dieser Gebäude, die in ihrem unübersehbaren Reichtum kalt, unverschämt und voll Hochmut zu ihm herübersahen, weil sein Stern gesunken war.
Er erklomm langsam die Stufen zu seinem Haus.
In der Mitte der Veranda stand ein runder Tisch. Die zylinderlose Petroleumlampe auf ihm warf ihr grelles Licht auf die drei Innenwände. Die vierte, dem Fluß zugewandte Seite war offen. Zwischen den roh behauenen Säulen, die das steil aufragende Dach trugen, hingen zerrissene Schilfrohr-Jalousien. Es war keine Zwischendecke da, und das unangenehm grelle Licht der Lampe wurde in der Höhe zu einem sanften Dämmerlicht gemildert, das sich im Dunkel der Dachsparren verlor. Die Stirnseite wurde von der Türöffnung eines Mittelganges, die von einem roten Vorhang verdeckt war, in zwei Hälften geteilt. Das Zimmer der Frauen führte auf diesen Gang, durch den man auf den Hinterhof und zum Küchenschuppen kam. Eine weitere Türöffnung befand sich in einer der Seitenwände. Die halb verblaßten Worte »Büro: Lingard & Co.« waren auf der staubigen Tür, die so aussah, als wäre sie sehr lange Zeit nicht mehr geöffnet worden, immer noch lesbar. An der anderen Seitenwand stand ein Schaukelstuhl aus Bugholz, und neben dem Tisch und verstreut über die ganze Veranda standen verloren vier hölzerne Lehnstühle, die aussahen, als würden sie sich der Schäbigkeit ihrer Umgebung schämen. In einer Ecke lag ein Haufen gewöhnlicher Matten, und quer darüber war lose eine Hängematte gespannt. In der anderen Ecke schlief, den Kopf in ein Stück roten Kattun gewickelt und zu einer formlosen Masse zusammengesunken, ein Malaie, einer von Almayers Haussklaven – »meine eigenen Leute«, pflegte er sie zu nennen. Eine respektable und repräsentative Ansammlung von Nachtfaltern tanzte zum aufgeregten Summen herumschwärmender Moskitos rund um die Lampe. Leise schreiende Eidechsen flitzten an den Balken des mit Palmblättern gedeckten Daches entlang. Ein Affe, der an einem der Verandapfosten festgekettet war und sich bereits unter dem Vordach zur Ruhe begeben hatte, guckte vor und grinste Almayer an, wobei er sich zu einem Bambussparren des Dachstuhls emporschwang und einen Schauer aus Staub und Flocken dürren Laubs niedergehen ließ, die langsam auf den schäbigen Tisch sanken. Der Boden war uneben und übersät von verwelkten Pflanzen und getrockneter Erde. Über all dem lag ein Hauch Verwahrlosung und Elend. Große rote Flecken auf Fußboden und Wänden zeugten von ebenso regelmäßigem wie hemmungslosem Betelnußkauen. Die leichte Brise, die vom Fluß herüberwehte und die zerlumpten Jalousien sanft hin und her bewegte, trug von den jenseitigen Wäldern den schwachen, ekelerregenden Duft verrottender Blumen herüber.
Die Verandadielen knarrten laut unter Almayers schwerem Schritt. Der Schläfer in der Ecke bewegte sich unruhig und murmelte unverständliche Worte. Hinter dem Vorhang vor der Türöffnung raschelte es leise, und auf malaiisch fragte eine sanfte Stimme: »Bist du’s, Vater?«
»Ja, Nina[22]. Ich bin hungrig. Schläft denn schon alles in diesem Haus?«
Almayer plauderte munter drauflos und ließ sich mit einem Seufzer der Zufriedenheit in den Lehnstuhl fallen, der dem Tisch am nächsten stand. Nina Almayer trat hinter der zugehängten Türöffnung vor, hinter ihr ein altes malaiisches Weib, das sich damit zu schaffen machte, einen Teller mit Reis und Fisch, einen Krug voll Wasser und eine Flasche Genever auf den Tisch zu stellen. Nachdem sie ein Trinkglas mit Sprung und einen Blechlöffel vor ihrem Herrn und Meister aufgedeckt hatte, verschwand sie lautlos. Nina stand neben dem Tisch, auf dem sie sich mit einer Hand leicht aufstützte, während die andere teilnahmslos an ihrer Seite herabbaumelte. Ihr Gesicht war der Dunkelheit draußen zugekehrt, durch die ihre traumverlorenen Augen ein verzauberndes Bild aufzufangen schienen, und trug einen Ausdruck ungeduldiger Erwartung. Für einen Mischling war sie groß; von ihrem Vater hatte sie das ebenmäßige Profil geerbt, das durch das Kantige der unteren Gesichtspartie (dem Erbe ihrer Vorfahren mütterlicherseits – der Sulu-Piraten) eine leichte Korrektur erfuhr, so daß es straffer wirkte. Ihr fester Mund mit den leicht geöffneten Lippen, zwischen denen das Weiß ihrer Zähne durchschimmerte, verlieh dem ungeduldigen Gesichtsausdruck einen undefinierbaren Zug von Wildheit. Und doch lag in ihren dunklen und makellosen Augen der Ausdruck jener zärtlichen Sanftmut, die malaiischen Frauen eigen ist, aber daneben blitzte in ihnen eine überlegene Intelligenz auf; ihr Blick war ernst, weit offen und unbeirrbar, so als zeige sich ihm etwas, das für alle anderen Augen unsichtbar blieb. So stand sie da – ganz in Weiß, hoch aufgerichtet, biegsam, graziös und selbstvergessen, die niedrige, aber breite Stirne von einer glänzenden Fülle langen schwarzen Haars gekrönt, das in schweren Flechten über ihre Schultern fiel und durch den Kontrast dieses kohlschwarzen Farbtons mit der Blässe ihres olivenfarbenen Gesichts dieses noch blasser erscheinen ließ.
Almayer fiel gierig über seinen Reis her, aber nach ein paar Mundvoll hielt er, den Löffel in der Hand, inne und musterte seine Tochter neugierig.
»Hast du vor einer halben Stunde ein Boot vorbeifahren gehört, Nina?« fragte er.
Das Mädchen blickte rasch zu ihm hin, trat aus dem Lichtkreis und stellte sich mit dem Rücken zum Tisch.
»Nein«, sagte sie langsam.
»Es war ein Boot da. Endlich! Dain selbst war da – auf dem Weg zu Lakamba. Ich weiß es; er hat es mir gesagt. Ich hab mit ihm gesprochen, aber er wollte heut nacht nicht mehr herkommen. Er hat gesagt, er kommt morgen.«
Er schluckte noch einen Löffelvoll hinunter, dann sagte er:
»Heute nacht bin ich beinahe glücklich, Nina. Ich seh mich am Ende eines langen Wegs, und er führt uns aus diesem elenden Sumpf. Bald sind wir von hier fort – ich und du, meine liebe Kleine – und dann –«
Er erhob sich vom Tisch und starrte vor sich hin, so als betrachte er ein bezauberndes Traumbild.
»Und dann«, fuhr er fort, »werden wir glücklich sein – du und ich. Wir werden weit weg von hier als reiche und angesehene Leute leben und das Leben hier vergessen – die ganze Plackerei, das ganze Elend!«
Er trat zu seiner Tochter und fuhr ihr mit der Hand zärtlich übers Haar.
»Es ist schlimm, wenn man sich auf einen Malaien verlassen muß«, sagte er, »aber ich muß zugeben, dieser Dain ist durch und durch ein Gentleman. Durch und durch«, wiederholte er.
»Hast du ihm gesagt, daß er herkommen soll, Vater?« forschte Nina, ohne ihn anzusehen.
»Aber sicher. Und übermorgen brechen wir auf«, sagte Almayer fröhlich. »Wir dürfen keine Zeit verlieren. Freust du dich, meine Kleine?«
Sie war fast so groß wie er selbst, aber er erinnerte sich gerne an die Zeit, da sie noch klein gewesen war und sie füreinander noch alles bedeutet hatten.
»ja, ich freu mich«, sagte sie sehr leise.
»Natürlich«, sagte Almayer eifrig, »hast du keine Vorstellung davon, was dir bevorsteht. Ich war ja selbst nie in Europa, aber ich habe meine Mutter so oft davon erzählen gehört, daß ich mir einbilde, schon alles zu wissen. Wir werden leben – einfach herrlich. Du wirst sehen.«
Wieder stand er schweigend neben seiner Tochter, versunken in die Betrachtung dieser betörenden Vision. Dann drohte er der schlafenden Siedlung mit der geballten Faust.[23]
»Ah, mein guter Abdulla«, schrie er, »wir werden ja sehen, wer nach all diesen Jahren den kürzeren zieht.«
Er blickte den Fluß hinauf und bemerkte gelassen: »Noch ein Gewitter. Recht so! Heut nacht bringt mich kein Donner der Welt um den Schlaf, das weiß ich! Gute Nacht, meine Kleine«, flüsterte er und küßte sie zärtlich auf die Wange. »Du siehst ja heute nacht nicht gerade glücklich aus – aber morgen machst du bestimmt ein fröhlicheres Gesicht, hm?«
Nina hatte ihrem Vater zugehört, ohne eine Miene zu verziehen, und ihre halb geschlossenen Augen starrten weiter in die Nacht hinaus, die nun noch schwärzer wurde – dank einer Gewitterwolke, die sich langsam über die Hügel herabgesenkt hatte, die Sterne zum Verlöschen brachte und Himmel, Wald und Strom zu einer einzigen Masse beinahe greifbarer Finsternis verschmelzen ließ. Die schwache Brise war abgeflaut, aber das entfernte Donnerrollen und blasse Wetterleuchten waren Vorboten des nahenden Sturms. Mit einem Seufzen wandte sich das Mädchen zum Tisch um.
Almayer lag jetzt in seiner Hängematte und war schon halb eingeschlafen.
»Nimm die Lampe mit, Nina«, murmelte er schläfrig. »Es wimmelt hier von Moskitos. Geh schlafen, mein Töchterchen.«





























