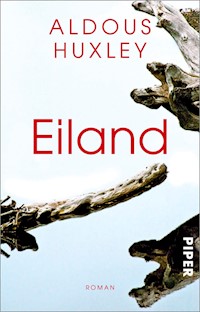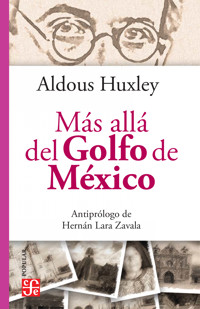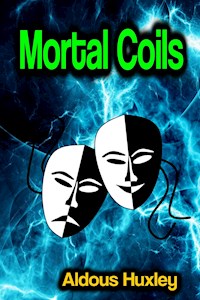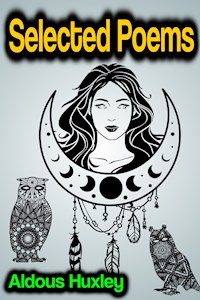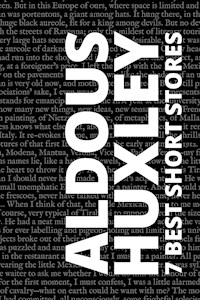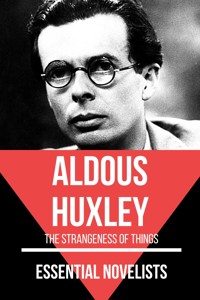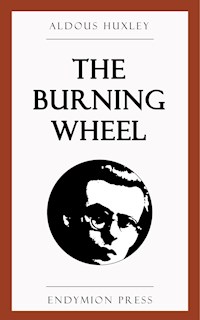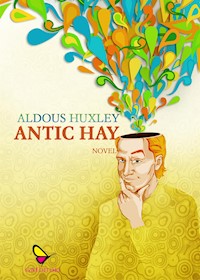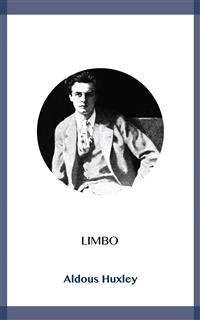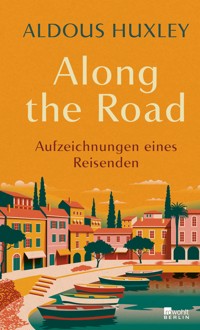
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit «Along the Road» lernen wir Aldous Huxley, den Autor der visionären Dystopie «Schöne neue Welt», von einer bisher kaum bekannten Seite kennen: als großen Reiseschriftsteller. Huxley führt uns durch das Europa der Zwanziger, eine Welt im Umbruch, in der eine neue Mobilität auf alte Formen des Reisens prallt. Auch Huxley erliegt dem Reiz der Geschwindigkeit, wenn er mit seinem 10-PS-Citroën in Oberitalien an kunstbeflissenen deutschen Wandervögeln vorbeirauscht. Zugleich folgen wir einem humorvollen Flaneur, der im Zugabteil dritter Klasse den Geschichten der Menschen lauscht, sich mit großer Lust am Unerwarteten am liebsten von völlig veralteten Reiseführern durch Amsterdam, Paris oder Rom leiten lässt und einfach eine grün getönte Brille aufsetzt, wenn es den Weiten Südfrankreichs mal etwas an Frische fehlt. Er sucht nach verborgenen Kulturschätzen, ist auf den Spuren Bruegels oder Botticellis, in Konzerten oder Theatern, beim Pferderennen in Siena und an den Küsten Italiens. Und zwischen Elba, lombardischen Renaissancestädten und der traumschönen Landschaft der Toskana entdeckt er eine verloren geglaubte Welt. Eine sinnenfrohe Schule des Sehens, eine einzigartige Gebrauchsanweisung für Reisende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Aldous Huxley
Along the Road
Aufzeichnungen eines Reisenden
Über dieses Buch
Mit «Along the Road» (1925), das in dieser Ausgabe erstmals auf Deutsch vorliegt, lernen wir Aldous Huxley, den Autor der visionären Dystopie «Schöne Neue Welt», von einer bisher kaum bekannten Seite kennen: als großen Reiseschriftsteller. Huxley führt uns durch das Europa der Zwanziger, eine Welt im Umbruch, in der eine neue Mobilität auf alte Formen des Reisens prallt. Auch Huxley erliegt dem Reiz der Geschwindigkeit, wenn er mit seinem 10-PS-Citroën in Oberitalien an kunsteifrigen deutschen Wandervögeln vorbeirauscht. Zugleich folgen wir einem humorvollen Flaneur, der im Zugabteil dritter Klasse den Geschichten der Menschen lauscht, sich mit großer Lust am Unerwarteten gern von völlig veralteten Reiseführern durch Amsterdam, Paris oder Rom leiten lässt und einfach eine grün getönte Brille aufsetzt, wenn es den Weiten Südfrankreichs mal etwas an Frische fehlt. Er sucht nach verborgenen Kulturschätzen, ist auf den Spuren Brueghels oder Piero della Francescas, in Kirchen oder Theatern, beim Pferderennen in Siena und an den Küsten Italiens. Und zwischen Elba, lombardischen Renaissancestädten und der traumschönen Landschaft der Toskana entdeckt er eine verloren geglaubte Welt. Eine sinnenfrohe Schule des Sehens, eine einzigartige Gebrauchsanweisung für Reisende.
Vita
Aldous Huxley, geboren 1894 im englischen Godalming/Surrey, arbeitete nach dem Studium als Journalist und Kunstkritiker und machte sich als scharfzüngiger Satiriker einen Namen. Huxley war ein begeisterter Reisender und verbrachte in den 1920ern längere Aufenthalte in Italien. «Along the Road», die Aufzeichnungen eines Reisenden, erschien 1925. Nach seinem Welterfolg «Schöne Neue Welt» zog er 1937 nach Kalifornien, wo er u.a. Drehbücher schrieb. Er starb 1963 in Hollywood. Mit seinem vielfältigen Werk zählt Huxley zu den bedeutendsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts.
Impressum
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1925 unter dem Titel «Along the Road. Notes and Essays of a Tourist» bei Chatto & Windus, London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2024
Copyright © 2023 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Copyright © 1925, 1952 by Aldous Huxley
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung alaver/Adobe Stock
ISBN 978-3-644-01813-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Teil IGrundsätzliches zum Reisen
Warum nicht lieber zu Hause bleiben?
Die einen sind beruflich unterwegs, die anderen treibt die Sorge um ihre Gesundheit, doch sind es weder die Kranken noch die Geschäftsleute, die die Grandhotels und die Taschen ihrer Besitzer füllen, sondern jene, die, wie es so schön heißt, zum Vergnügen reisen. Das, wonach Epikur, der nur unterwegs war, wenn er verbannt wurde, in seinem Garten suchte, wollen unsere Touristen im Ausland finden. Finden sie denn ihr Glück? Wer die Orte besucht, an denen sie weilen, wird merken, dass ihm diese Frage mit einer gewissen Dringlichkeit gestellt wird. Die Antwort wird eher Nein sein, denn Touristen sind im Allgemeinen ein recht trübseliger Haufen. Ich habe schon bei Beerdigungen fröhlichere Gesichter gesehen als auf dem Markusplatz. Nur wenn sie sich verbrüdern, wenn sie eine flüchtige Stunde lang so tun können, als wären sie zu Hause, wirken die meisten Touristen tatsächlich glücklich. Man fragt sich, warum sie dann verreisen.
In Wahrheit reisen die wenigsten Reisenden gern. Sie nehmen die Mühen und Kosten des Reisens nicht aus Neugier oder zum Vergnügen auf sich oder weil sie schöne, unbekannte Dinge sehen wollen, sondern aus einem gewissen Dünkel. Die Leute reisen aus dem gleichen Grund, der sie Kunst sammeln lässt: weil es die bessere Gesellschaft tut. Es gehört dazu, an bestimmten Orten auf der weiten Welt gewesen zu sein, und war man einmal dort, ist man allen überlegen, die nicht dort waren. Außerdem liefert einem das Reisen Gesprächsstoff für zu Hause. So arg viele Themen gibt es nicht, als dass man sich die Gelegenheit, seinen Bestand zu vermehren, entgehen lassen könnte.
Um diesen Dünkel zu rechtfertigen, hat man eine ganze Reihe von Mythen entwickelt.Die Orte, die besucht zu haben gesellschaftlich als chic gilt, werden mit einem schillernden Strahlenglanz umgeben, bis sie denen, die nicht dort waren, so märchenhaft vorkommen, als handelte es sich um Babylon oder Bagdad. Die Reisenden wiederum haben ein gesteigertes Interesse daran, diese Märchen zu pflegen und zu verbreiten. Wenn nämlich Paris und Monte Carlo wirklich so phantastisch sind, wie es die Einwohner von Bradford oder Milwaukee, von Tomsk oder Bergen annehmen – dann ist doch das Verdienst der Reisenden, die diese Orte tatsächlich aufgesucht haben, nur umso größer und ihre Überlegenheit über die Stubenhocker noch bedeutender. Genau deshalb und weil sie außerdem die Hotelbesitzer und die Kreuzfahrtunternehmen finanzieren, werden diese Märchen so eifrig am Leben erhalten.
Es gibt kaum einen erbärmlicheren Anblick als unerfahrene Reisende, die mit diesen Mythen groß geworden sind und verzweifelt die äußere Realität mit dem Märchen in Einklang zu bringen versuchen. Wegen dieser Mythen und wegen ihres Dünkels sind sie aufgebrochen. Wenn sie sich jetzt eingestehen müssten, dass sie von der Wirklichkeit enttäuscht sind, müssten sie auch zugeben, dass sie dumm genug waren, auf diese Märchen hereinzufallen, was das Verdienst, die Wallfahrt auf sich genommen zu haben, doch erheblich schmälern würde. Zweifellos haben die meisten von den Hunderttausenden Angelsachsen, die die Pariser Nachtklubs und Tanzsäle bevölkern, tatsächlich ihren Spaß daran, aber bestimmt nicht alle. Insgeheim sind sie gelangweilt und finden es ein wenig abstoßend. Sie sind jedoch in dem Glauben an dieses märchenhafte Gay Paree aufgewachsen, wo alles so wahnsinnig aufregend ist, eigentlich der einzige Ort, wo man das sogenannte wahre Leben beobachten kann. Deshalb mühen sie sich mit aller Kraft, nun selber lustig zu sein, wenn sie in Paris sind. Nacht für Nacht drängeln sich in den Tanzsälen und Bordellen ernsthafte junge Landsleute von Ralph Waldo Emerson und Matthew Arnold, eifrig bemüht, dieses Leben, nicht standfest zwar und auch nicht ganzheitlich, durch die immer dichteren Nebel von Heidsieck und Roederer in sich aufzunehmen.
Noch entschlossener zeigen sich ihre Begleiterinnen, denn den meisten (es sei denn, sie sind besonders «modern») steht kein Roederer zur Seite, um Paris lustig zu finden. An einem Herbstmorgen bot sich mir um fünf Uhr in der Früh in einer boîte am Montmartre der denkbar traurigste Anblick: An einem Tisch in der Ecke des Saales saßen drei unbegleitete junge Amerikanerinnen, die mutig das Leben auf eigene Faust kennenlernen wollten. Vor ihnen auf dem Tisch standen die üblichen Champagnerflaschen, doch sie zogen es vor, vielleicht aus Prinzip, Limonade zu trinken. Die Jazzkapelle spielte monoton weiter, der müde Drummer nickte über seinem Schlagzeug ein, der Saxophonist gähnte in sein Instrument. Die Gäste verließen paarweise und in torkelnden Gruppen das Lokal. Doch die drei jungen Mädchen blieben verbissen sitzen, unbeugsam der Erschöpfung, der Langeweile trotzend, die sich unübersehbar auf ihren reizenden Kindergesichtern abzeichnete. Als ich bei Sonnenaufgang davonging, saßen sie noch immer da. Ich malte mir aus, welche Geschichten sie wohl zum Besten geben würden, wenn sie nach Hause kämen! Und wie neidisch sie die daheimgebliebenen Freunde machen würden. «Paris ist einfach wunderbar …»
Den Parisern trägt das Märchen einige Hundert Milliarden gutes Geld ein. Sie machen kein Geheimnis daraus, Geschäft ist Geschäft. Aber wenn ich der Manager eines dieser Tanzlokale auf dem Montmartre wäre, würde ich meinen Kellnern vermutlich nahelegen, ihre vorgeschriebene Fröhlichkeit mit mehr Überzeugung zu spielen. «Männer», würde ich sagen, «ihr solltet wenigstens so tun, als würdet ihr an das Märchen glauben, von dem wir alle leben. Lächelt, seid fröhlich. Der Gesichtsausdruck, den ihr spazieren führt, diese Mischung aus Müdigkeit, größter Verachtung für eure Gäste und zynischer Eilfertigkeit, kann niemanden begeistern. Vielleicht sind die Gäste irgendwann nüchtern genug, um es zu merken, und was wird dann aus uns?»
Paris und Monte Carlo sind jedoch keineswegs die einzigen Orte, an die es die Pilger zieht, es gibt auch noch Rom und Florenz. Dort gibt es Museen, Kirchen und Ruinen sowie Läden und Casinos. Und der Dünkel, der verlangt, dass man sich für Kunst zu interessieren hat, oder genauer gesagt, dass man die Orte aufgesucht haben muss, an denen Kunst zu sehen ist, herrscht fast ebenso tyrannisch wie der Dünkel, der es gebietet, all jene Orte zu besichtigen, an denen sich das echte Leben beobachten lässt.
Am Leben sind wir alle mehr oder weniger interessiert – selbst an dem ziemlich übel riechenden Teil, der sich am Montmartre findet. Doch ist das Interesse an Kunst – oder jedenfalls der Art Kunst, die in Museen und Kirchen gezeigt wird – keineswegs allgemein verbreitet. Daher ist der Fall der armen Touristen, die, weil ihr Dünkel es verlangt, nach Rom und Florenz reisen, sogar noch mitleiderregender als der jener, die aus dem gleichen Grund nach Paris und Monte Carlo fahren. Touristen, die eine Kirche «mitnehmen», tragen die Maske pflichtschuldigen Interesses, doch welche Mattigkeit, welche vollkommene Geisteserschöpfung blickt ihnen allzu oft aus den Augen! Innerlich spüren sie diese Erschöpfung sogar noch stärker, weil sie sich verpflichtet fühlen, hingerissene Aufmerksamkeit zu simulieren, ja sogar in geheuchelte Begeisterung auszubrechen, wenn etwas im Baedeker mit Sternen ausgezeichnet ist. Irgendwann kommt der Moment, in dem Körper und Geist diesen Strapazen nicht mehr gewachsen sind. Dann weigert sich der Bildungsphilister kategorisch, sich den Anforderungen des guten Geschmacks zu unterwerfen. Erschöpft und trotzig, wie er ist, schwört der Tourist, dass er sich keine einzige Kirche mehr antun wird. Stattdessen verbringt er seine Tage in der Hotellobby und liest die europäische Ausgabe der Daily Mail.
Ich weiß noch, wie ich in Venedig Zeuge einer solchen Rebellion wurde. Ein Traghetto-Unternehmen warb für Nachmittagsausflüge nach Torcello. Wir hatten unsere Plätze gebucht und fuhren zur vereinbarten Zeit in Gesellschaft von sieben oder acht weiteren Touristen los. Das pittoresk-heruntergekommene Torcello erhob sich aus der Lagune. Die Bootsleute legten an einem vermodernden Steg an. Einen halben Kilometer landeinwärts durch die Felder befand sich die Kirche. Sie beherbergt einige der schönsten Mosaiken in ganz Italien. Wir gingen an Land – alle mit Ausnahme eines willensstarken amerikanischen Ehepaars, das auf die Auskunft hin, auf dieser Insel gebe es schon wieder eine Kirche zu sehen, beschloss, in aller Ruhe im Boot zu warten, bis die anderen zurückkämen. Ich bewunderte ihre Entschlossenheit und Ehrlichkeit. Gleichzeitig kam es mir ein wenig traurig vor, dass sie eigens hierhergefahren waren und so viel Geld für das Vergnügen ausgegeben hatten, in einem Motorboot an einem verrottenden Steg zu hocken. Sie waren doch erst in Venedig. Ihr italienisches Martyrium hatte noch kaum begonnen. Padua, Ferrara, Ravenna, Bologna, Florenz, Siena, Perugia, Assisi und Rom mit all ihren unzähligen Kirchen und Bildern mussten alle noch besichtigt werden, ehe sie endlich das gebenedeite Neapel erreichen würden und die Passage zurück über den Atlantik machen durften. Arme Sklaven, dachte ich, und was für ein unerbittlicher Sklavenhalter!
Wir bezeichnen solche Menschen als Reisende, weil sie nicht zu Hause bleiben. Aber sie sind keine echten, keine geborenen Reisenden, denn sie reisen nicht um des Reisens willen, sondern weil sie einer Konvention folgen. Vollgesogen mit Märchen und phantastischen Hoffnungen brechen sie auf und kommen, ganz gleich ob sie es sich eingestehen oder nicht, enttäuscht zurück. Da ihr Interesse an der Wirklichkeit nicht besonders ausgeprägt ist, sehnen sie sich nach Mythologischem, während sie von den Fakten, mögen sie auch noch so seltsam, schön und abwechslungsreich sein, nur enttäuscht sein können. Nur die Gesellschaft der Mitreisenden, mit denen sie sich von Zeit zu Zeit zusammenschließen, um in der fremden Wildnis eine kleine heimatliche Oase zu bilden, verbunden mit dem Bewusstsein, dass sie einer gesellschaftlichen Pflicht Genüge getan haben, hält sie angesichts der deprimierenden Wirklichkeit des Reisens einigermaßen bei Laune.
Der echte Reisende ist hingegen so sehr an der Wirklichkeit interessiert, dass er es nicht nötig hat, an Märchen zu glauben. In seiner Neugier ist er unersättlich, er schätzt, was er nicht kennt, gerade weil es ihm nicht vertraut ist, und er genießt Schönheit, ganz gleich in welcher Form. Selbstverständlich wäre es unsinnig zu behaupten, dass er nie gelangweilt ist, schließlich ist es praktisch unmöglich, sich auf Reisen nie zu langweilen. Für den Touristen bringt fast jeder Tag unvermeidlich eine Menge Leerlauf. So braucht es schon sehr viel Zeit, um überhaupt von einem Ort an den anderen zu gelangen. Und wenn die Sehenswürdigkeiten besichtigt sind, merkt der Besichtiger, wie erschöpft er ist und dass er nichts Besonderes zu tun hat. Wenn man zu Hause seinen üblichen Gewohnheiten nachgeht, wird einem nie langweilig. Ennui ist im Grunde ein Feriengefühl. (Ist es nicht die chronische Krankheit der Müßiggänger?) Deshalb findet der echte Reisende Langeweile eher angenehm als schmerzhaft. Sie ist das Symbol seiner Freiheit – seiner exzessiven Freiheit. Wenn sie sich meldet, akzeptiert er die Langeweile, aber nicht philosophisch, sondern fast genießerisch.
Für den geborenen Reisenden ist das Reisen wie ein bedrängendes Laster. Wie alle Laster ist es herrschsüchtig und verlangt von seinem Opfer Zeit, Geld, Energie und den Verzicht auf Bequemlichkeit. Es stellt Forderungen, und der geborene Reisende gibt, und zwar gern. Die meisten Laster, das sei in Klammern hinzugefügt, verlangen beträchtliche Selbstaufopferung. Es wäre ein gewaltiger Irrtum, wollte man annehmen, ein lasterhaftes Leben sei ein Leben endlosen Vergnügens. Es ist vielmehr – wenn man es ernsthaft betreibt – fast so anstrengend und schmerzlich wie das von Christian in der «Pilgerreise von dieser in die kommende Welt». Der wesentliche Unterschied zwischen Christian und dem lasterhaften Menschen besteht darin, dass der Erste zum Ausgleich für seine Mühsal etwas bekommt – im Hier und Jetzt in Form eines gewissen spirituellen Wohlbefindens, ganz zu schweigen von dem, was ihm wohl in diesem leider problematischen Jerusalem auf der anderen Flussseite zuteilwerden mag –, während der andere nichts bekommt, abgesehen vielleicht von der Gicht und der progressiven Lähmung der Geisteskranken.
Das Laster des Reisens, so viel ist richtig, führt nicht notwendig zu diesen beiden speziellen Erkrankungen oder überhaupt zu Krankheiten, es sei denn, es treibt einen bis in die Tropen. Jedenfalls keine körperlichen Krankheiten, denn Reisen ist kein Laster des Körpers, den es quält, sondern des Geistes. Wer reist um des Reisens willen, ist wie der plan-lose Leser – süchtig nach geistiger Hemmungslosigkeit.
Wie alle lasterhaften Menschen verfügt der Leser wie der Reisende über ein ganzes Arsenal an Rechtfertigungen, mit denen er sich verteidigen kann. Lesen und Reisen, heißt es, bereichere den Geist, rege die Phantasie an, fördere die Bildung und so weiter. Das sind lauter fadenscheinige Argumente, die niemanden groß beeindrucken. Denn auch wenn es zutrifft, dass für manche planloses Lesen und zielloses Reisen ganz besonders bildend wirkt, ist das nicht der Grund, warum die Mehrheit der echten Leser und Reisenden ihrer Neigung folgt. Wir lesen und reisen eben nicht, um unseren Geist zu erweitern und zu bereichern, sondern um ihn auf die angenehmste Weise zu vergessen. Wir lesen und reisen doch, weil es von den vielen Möglichkeiten, das Denken zu ersetzen, die angenehmste ist. Ein kultivierter und ziemlich ausgefallener Ersatz. Deshalb entspricht er nicht unbedingt jedermanns Begriff von Unterhaltung. Der geborene Leser oder Reisende gehört zu jenen eher anspruchsvollen Geistern, die die Ablenkung, die sie brauchen, nicht beim Wetten, Mah-Jongg, Trinken, Golf oder Foxtrott finden.
Dann gibt es noch wenige, ganz wenige, die bewusst und nach einem festgelegten System reisen und natürlich auch lesen. Diese Klasse ist moralisch bewundernswert. Ihr gehören im Allgemeinen Leute an, die es in der Welt zu etwas bringen, wenn auch keineswegs immer. Denn manche haben die besten Absichten und einen guten Charakter, aber leider kein Talent. Einige der ausschweifendsten und ziellosesten Reisenden und Leser verstehen es, aus ihren Lastern Nutzen zu ziehen. Dr. Johnsons beherrschendes Laster war das planlose Lesen; er las jedes Buch, das ihm unterkam, und keines zu Ende. Seine Verdienste sind dennoch keineswegs gering. Dann gibt es die leichtsinnigen Reisenden wie William Beckford, die in der Welt herumgekommen und ihrer zufälligen Neigung gefolgt sind, was sich am Ende ähnlich gut ausgewirkt hat.Tugend belohnt sich selber, aber die Trauben, von denen die Begabung weiß, wie sie zu pflücken sind – sind sie nicht ein wenig sauer?
Für mich ist Reisen ein reines Laster. Die Versuchung, mich im Reisen zu verlieren, ist für mich ähnlich unwiderstehlich wie alles verschlingend, quer durcheinander und ohne Ziel und Zweck zu lesen. Natürlich nehme ich mir gelegentlich vor, mich zu bessern. Dann entwerfe ich Pläne für eine nutzbringende, ernsthafte Lektüre; ich versuche aus meinen schweifenden Fahrten systematische Touren durch die Kunst- und Kulturgeschichte zu machen. Besonders erfolgreich bin ich damit aber nicht. In kürzester Zeit falle ich in meine schlechten Gewohnheiten zurück. Eine beklagenswerte Schwäche! Ich versuche mich mit der Hoffnung zu trösten, dass sich vielleicht sogar aus meinen Lastern ein Nutzen ziehen lässt.
Wandervögel
Blond, barhäuptig und das Gesicht vom Sonnenbrand dunkler als die Haare, stapfen sie über die staubigen Straßen. Sie tragen kurze Hosen, ihre Tiroler Knie sind braun. Mit klobigen nagelbeschlagenen Stiefeln klicken sie metallisch über die Steinplatten der Kirchen, in die sie als gewissenhafte Kunstforscher hineindrängen. Sie kommen mit Rucksack, in der Hand einen Wanderstock, manchmal auch einen kräftigen Schirm; ich habe sie schon gesehen, wie sie den Aufstieg zur Viale dei Colli in Florenz mit der Eisaxt bewältigten. Sie sind die Wandervögel, und sie kommen, wie ihr romantischer und völlig unironisch verwendeter Name, dieser wahrhaft Schiller’sche Name, überdeutlich verrät, aus Deutschland. Viele von ihnen gehen den ganzen Weg zu Fuß, von Berlin über die Alpen nach Tarent und wieder zurück, ohne Geld, nur mit Wasser und Brot, und übernachten in einer Scheune oder am Straßenrand. Abenteuerlustige, zähe Jugend! Ich kann sie nur aus tiefstem Herzen bewundern, ja, ich beneide sie sogar, weil ich gern ihre Energie besäße, diese Zähigkeit. Aber ich folge ihnen nicht nach. «The saints of old», heißt es in einem Kirchenlied,
Went up to Heaven
With sorrow, toil and pain.
Lord, unto us may strength be given
To follow in the train.
Die Heil’gen fahren zum Himmel auf,
der Leiden war’n genug.
Herr, gib uns Kraft, auf dass wir auch
nachfolgen in dem Zug.
Ich muss gestehen, dass mir sogar der Zug als Fortbewegungsmittel zu unbequem geworden ist. Ich würde deshalb bei diesem Lied gern die letzten beiden Zeilen verbessern: «Lord, unto us may wealth be given to follow in the car.» (Herr, mache uns reich genug, auf dass wir im Auto folgen Dir.) Das Gebet wurde erhört, teilweise wenigstens, denn ob ein Citroën mit zehn PS wirklich als Auto gelten kann, ist noch die Frage. Die Besitzer von Napiers, Vauxhalls, Delages oder Voisins werden es bestimmt bestreiten, aber ich bestehe auch nicht darauf. Für den 10-PS-Citroën spricht vor allem, dass er fährt. Nicht besonders schnell, das stimmt, aber beständig und verlässlich befördert er einen auf seine bescheidene, unprätentiöse Art. Dieses eine Exemplar hat uns mehrere Tausend Kilometer über italienische, französische, belgische und holländische Straßen getragen, was, wie alle wissen, die diese Straßen kennen, doch einiges besagt.
Wenn ich denn über die nötige Herzensstärke verfügte, würde ich jetzt aufhören, mich über Citroëns zu verbreiten und mich wieder erhabeneren Themen zuwenden. Aber die Versuchung, über Autos zu reden, ist für einen Autobesitzer einfach zu groß. Bevor ich den Citroën kaufte, gab es nichts, was mich weniger interessiert hätte, jetzt interessiert mich nichts mehr. Stundenlang kann ich mich mit anderen Autobesitzern über Motoren unterhalten. Ich habe auch nicht die geringsten Bedenken, Menschen, die nicht Auto fahren, endlich mit diesem herrlichen Thema anzuöden. Ich verschwende viel kostbare Zeit mit dem Lesen von Automagazinen, verfolge mit großer Leidenschaft die Berichte von Autorennen und beuge mich mit großem Ernst über technische Anleitungen, die ich nicht verstehe. Es ist der reine Wahnsinn, aber herrlich.
Die geistigen Auswirkungen, die der Besitz eines Autos mit sich bringt, sind, wie ich feststelle, nicht unbedingt segensreich. Strenge Gewissenserforschung und Gespräche mit anderen Autofahrern haben mir nämlich gezeigt, dass der Besitz eines Autos den Charakter verdirbt. Das fängt schon damit an, dass jeder Autobesitzer lügt. Er kann einfach nicht die Wahrheit über sein Fahrzeug sagen. Er übertreibt bei der Geschwindigkeit, bei den Kilometern, die er mit einer Tankfüllung schafft, bei der Leistung am Berg. Im Eifer des Redens habe auch ich mich in dieser Hinsicht versündigt, und zwar mehr als einmal. Ich habe sogar kaltblütig und boshaft berechnend glatte, abgefeimte Lügen von mir gegeben. Ein besonders schlechtes Gewissen habe ich deshalb nicht. Ich bin kein Kasuist, aber ich glaube, dass eine Lüge, von der man gar nicht erwartet, dass sie geglaubt wird, zu den lässlichen Sünden zählt. Wie der Fischer setzt der Autofahrer gar nicht voraus, dass man ihm seine Prahlerei glaubt. Ich selber gebe schon lange nichts mehr auf das, was mir die anderen erzählen. Mein letzter Rest Vertrauen löste sich in Luft auf, als mir ein Belgier erzählte, die Strecke von Brüssel nach Ostende sei ohne Weiteres in zwei Stunden zu bewältigen; er würde da regelmäßig fahren und brauche nie länger. Ich glaubte ihm und schaute nicht in den Autoatlas. Hätte ich nachgeschaut, hätte ich festgestellt, dass die Entfernung zwischen Brüssel und Ostende weit über hundert Kilometer beträgt, dass die gesamte Strecke gepflastert ist, und zwar mit schlechtem Pflaster, und dass man unterwegs drei große Städte und ungefähr zwanzig Dörfer durchquert. Wir fuhren also am späten Nachmittag los und kamen natürlich erst weit nach Einbruch der Dunkelheit an. Wenn mir heute also jemand erzählt, wie lange man von einem Ort zum anderen braucht, schlage ich auf die Angabe je nach Charakter dreißig bis sechzig Prozent auf. Damit komme ich der Wahrheit ziemlich nahe.
Es gibt eine weitere schreckliche Sünde, die durch den Besitz eines Autos, insbesondere eines kleinen Autos, gefördert wird, und das ist der Neid. Welch bittere Unzufriedenheit erfasst den Mann der zehn PS, wenn der mit vierzig PS geräuschlos vorbeischießt! Wie leidenschaftlich er den Besitzer des größeren Wagens hasst! Neid und Habgier fressen an ihm. In einer ebenen Landschaft gibt es weniger zu beneiden als in einer hügeligen. Im Flachland hält sich das kleine Auto so wacker, dass das Selbstwertgefühl seines Besitzers nicht beeinträchtigt wird. Erst in einem bergigen Land wie Italien, wo die Straßen ständig fünfhundert und tausend Meter hochlaufen und wieder herunterführen, gedeiht die Todsünde des Neides in all ihrer Pracht. Hier nämlich muss sich das kleine Auto seiner Kleinheit aufs Jämmerlichste bewusst werden. Die Überlegenheit von vierzig über zehn PS wird schmerzhaft deutlich.
Es war auf dem Mont Cenis, wo wir unsere schlimmste Demütigung erfahren mussten und schwärzester Neid unsere Seele erfüllte. Wir waren in Turin aufgebrochen. Auf den ersten fünfzig Kilometern verläuft die Straße vollkommen eben. Wir flogen nur so dahin, die kleineren Fiats durften unseren Staub fressen. Plötzlich erhoben sich aus der Ebene vor uns die Alpen wie eine riesenhafte, unregelmäßige Mauer. Susa liegt am Ende eines langen, vollkommen flachen Tals, das mitten in die Berge hineinführt. Man durchquert die Stadt, und dann, ohne Vorwarnung, beginnt ganz plötzlich der Anstieg, und der ist besonders steil. Ohne Unterbrechung steigt die Straße die nächsten fünfundzwanzig Kilometer immer weiter an. Die Passhöhe liegt bei mehr als zweitausend Metern über dem Meeresspiegel. Der Citroën musste in den zweiten Gang, und dabei blieb es; langsam schnauften wir die lange Strecke hinauf. Wir hatten kaum mehr als einen Kilometer geschafft, als wir einen Lärm hörten, der aus dem Tal hochstieg, ein Lärm wie von einer ganzen Batterie Maschinengewehre. Er wurde lauter und immer lauter. Eine Minute später donnerte ein riesiger roter Alfa-Romeo-Sportwagen, der eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Sieger des Europäischen Grand Prix hatte, mit einer Geschwindigkeit von mindestens achtzig Stundenkilometern an uns vorbei. Am Steuer saß offensichtlich ein Genie, denn wir konnten beobachten, wie das rote Monster vor uns eine Haarnadelkurve nach der anderen bewältigte, ohne auch nur einmal langsamer zu werden. Nach weiteren dreißig Sekunden war es verschwunden. Sein Lärm hallte Ehrfurcht gebietend in den Bergen wider, donnergleich. Wir schnauften langsam weiter. Nach einer halben Stunde begegneten wir dem roten Schrecken erneut bei der Abfahrt, und wie beim Hochfahren zeigte er in jeder Kurve seine Verachtung für die Gesetze der Dynamik. Wir waren uns sicher, dass wir ihn nicht wiedersehen würden. Doch als wir vor dem italienischen Zoll warteten, während ein Beamter unsere Ausweise kontrollierte – eine Prozedur, die wie an jeder Grenze ihre Zeit beansprucht –, hörten wir in der Ferne einen vertrauten Ton. Binnen weniger Minuten wurde dieser Ton ohrenbetäubend. Wie eine riesige rote Rakete, hinter sich eine Rauchwolke, erschien der Alfa Romeo an der Spitze seiner weißen Staubfahne. «Das sind Testfahrten im gebirgigen Terrain», erläuterte uns der wachhabende Offizier. Wir setzten uns wieder in Bewegung. Die Zollstation befindet sich erst auf halber Höhe, wir hatten also noch weitere tausend Meter bis zum Gipfel zu bewältigen. Gemächlich, im zweiten Gang, machten wir uns an den Aufstieg. Wir hatten die Zollstation gerade einen Kilometer hinter uns, als uns der Alfa Romeo ein zweites Mal von oben entgegenkam. Er verschwand und nahm jede Menge Hass, Neid und allerlei unchristliche Verwünschungen mit sich.
Der Anstieg wollte nicht enden. Wir erreichten die Höhe der Kiefernwälder. Die Hänge neben und vor uns waren kahl, in nicht allzu großer Entfernung, auf den näher gelegenen Gipfeln auf der anderen Talseite waren einzelne Schneefelder zu sehen. Obwohl wir angeblich Sommer hatten, war die Luft ungewöhnlich scharf und beißend. Ein strammer Wind wehte, im Schatten war es spürbar kalt, der Motor lief trotzdem heiß.
Die Herberge und die Hotels auf dem Mont Cenis stehen am Ufer eines Sees in der Mitte eines kleinen Plateaus, das wie ein Wunder an Flachheit zwischen den umgebenden schroffen Felshängen liegt. Zur italienischen Seite endet diese Platte zwischen den Bergen abrupt und scheint in die Tiefe zu stürzen. Die letzten einhundertfünfzig bis zweihundert Meter bis zum Plateau hinauf ist die Straße aus dem Felsen gehauen und noch einmal besonders steil. Wir hatten ungefähr die Hälfte dieser allerletzten Zickzackkurven hinter uns gebracht, als plötzlich mit Donnergetöse der scharlachrote Alfa Romeo am unteren Ende des Steilhangs, an dem wir uns mühsam hocharbeiteten, hinter einem Felsvorsprung auftauchte, der den herannahenden Lärm gedämpft hatte. Brüllend raste er hinter uns her, ein wildes Tier, das seine Beute jagte. Als wir eben auf dem Gipfel ankamen, erreichte uns das Monster, überholte und raste auf der ebenen Strecke weiter. Die Demütigung war vollkommen. Neid und Missvergnügen kochten in uns hoch wie das Wasser im Kühler unseres jämmerlichen kleinen Gefährts. «Wenn wir bloß ein richtiges Auto hätten», sagten wir. Und wir sehnten uns danach, den leidenschaftlichen Neid durch die nicht weniger böswilligen, unchristlichen Leidenschaften Stolz und Verachtung zu ersetzen, also zu jenen zu gehören, die nicht überholt werden, sondern die anderen jauchzend überholen. «Da her auch das hertz der Menschen vol arges wird/vnd Torheit ist in jrem hertzen die weil sie leben/Darnach müssen sie sterben.» Als wir das Hotel erreichten, hatte der Alfa Romeo gewendet und war dabei, sich an die dritte Abfahrt zu machen. «Was für ein hässliches Auto», sagten wir.
So viel zu den moralischen Folgen, wenn man ein kleines Auto hat. Wir versuchten es mit guten Argumenten: «Immerhin», sagten wir, «hat uns die kleine Kiste gute Dienste geleistet. Sie hat uns über schlechte Straßen, gewaltige Hügel hinauf und wieder hinunter und durch die verschiedensten Länder befördert. Sie hat uns nicht nur räumlich bewegt, quer über die Landkarte, sondern auch durch die Zeiten – von Epoche zu Epoche –, durch die Kunstgeschichte, durch viele Sprachen und Gebräuche, durch Philologie und Anthropologie. Sie hat für große und ganz unterschiedliche Arten von Vergnügen gesorgt. Sie kostet nicht viel, benimmt sich gut und ist in ihren Gewohnheiten so verlässlich wie Immanuel Kant. Auf ihre bescheidene Weise ist sie ein Ausbund an Tugend.» Das alles sagten wir uns und noch mehr in dieser Tonlage, und es war tröstlich. Dennoch lauerten tief unten in unserem Herzen weiter Neid und Unzufriedenheit, zusammengerollte Schlangen, jederzeit bereit, den Kopf zu erheben, wenn uns an einem Berg vierzig PS überholen würden.
Hier mag mancher einwenden, dass der Besitzer eines kleinen Autos keineswegs der einzige Neider ist. Die Wandervögel, die sich mit bestenfalls sechs Kilometern pro Stunde schwitzend den Hang hocharbeiten, werden mit ihrem Neid keinen Unterschied zwischen dem 10- und dem 40-PS-Mann machen. Obwohl, einige vielleicht schon. Aber wir sollten nicht vergessen, dass es Fußgänger gibt, die gehen, weil sie lieber gehen, als sich anstrengungslos von einer Maschine befördern zu lassen. Als Jugendlicher versuchte ich mir vorzumachen, ich würde Gehen jeder anderen Fortbewegungsart vorziehen. Ich merkte jedoch schnell, dass das nicht zutraf. Kurze Zeit gehörte ich zu denen, die den Naturburschen spielen (davon gibt es recht viele), mit Autostopp reisen und in kleinen Pubs Bier trinken, weil man das so macht. Schließlich jedoch musste ich mir und auch den anderen eingestehen, dass ich keiner dieser Wanderburschen war, dass ich körperliche Anstrengung oder überhaupt Unbequemlichkeit nicht mochte und dass ich nicht vorhatte, noch länger das Gegenteil zu behaupten. Gleichwohl hege ich nach wie vor den größten Respekt für die, die sich dem aussetzen. Mutmaßlich gehören sie einer höheren menschlichen Klasse an als die heutzutage vorherrschende faule, nach Bequemlichkeit suchende Brut. Zu den großen Vorzügen des technischen Fortschritts gehört, dass wir alles schnell, einfach und bequem verrichten können. Das ist ohne Zweifel sehr angenehm, und doch bezweifle ich, dass es in einem moralischen Sinn gesund ist. Es ist nicht einmal für den Körper gesund. Krebs tritt am häufigsten in jenen Hochzivilisationsländern auf, wo die Menschen am meisten essen und sich am wenigsten bewegen. Die Krankheit breitet sich mit jedem Erweiterungsbau einer von Henry Fords Fabriken aus.
Trotzdem ziehe ich es vor, mit dem Auto zu folgen. Vor den Wandervögeln, die wir unterwegs überholen, lüpfe ich mit dem Ausdruck größter Hochachtung den Hut. Doch tief drinnen sage ich mir die Worte des Mönchs in den «Canterbury Tales» vor: «Wie Augustin es will? Was hilft’s der Welt?/Soll er sich plagen, wenn’s ihm gefällt!»
Der Blick des Reisenden
Ich könnte eine Reihe guter und bester Gründe dafür anführen, warum ich großen Dinnerpartys, Soiréen, Gedränge, Zusammenrottungen, gepflegter Konversation und Bällen nichts abgewinnen kann. Das Leben dauert nicht lang genug, und mit derlei verschwendet man nur Zeit; das Spiel lohnt den Einsatz nicht. Unverbindliches Geplauder ist wie Schnaps, es kitzelt die Nerven, ist aber ohne größeren Nährwert. Das sind ernst zu nehmende Einwände, und zudem sind sie noch wahr und leuchten mir auch ein. Mein letztgültiges Argument aber gegen größere Versammlungen und für die Einsamkeit und für kleine, intimere Begegnungen ist allerdings ein persönliches – eines, das nicht meinen Kopf, sondern meine Eitelkeit überzeugt: Ich glänze nicht in Gesellschaft, ja, ich schimmere nicht einmal. Unterbelichtet zu sein und das auch noch zu wissen, ist demütigend.
Diese Unfähigkeit, in Gesellschaft zu brillieren, liegt ausschließlich an meiner grenzenlosen Neugier. Ich kann meinem Gegenüber nicht zuhören oder mir eine Antwort überlegen, weil ich nicht anders kann, als alle anderen Unterhaltungen in meiner Hörweite zu belauschen. Mein Gesprächspartner sagt also irgendetwas sehr Intelligentes über Henry James und rechnet damit, dass ich, sobald er fertig ist, mit einer klugen, feinsinnigen Bemerkung antworte. Aber die beiden Frauen links von mir erzählen sich Klatschgeschichten über eine mir wohlbekannte Person. Der Mann mit dem lauten Organ am anderen Ende des Raums wägt die Vorzüge verschiedener Automarken gegeneinander ab. Der Physikstudent am Kamin behandelt die Quantentheorie. Der hoch angesehene irische Rechtsanwalt erzählt in seiner unnachahmlichen Art Anekdoten aus seiner Praxis. Hinter mir tauschen ein Junge und ein Mädchen ihre Ansichten über die Liebe aus, während ich einzelnen Bemerkungen aus der Gruppe in der hinteren Ecke entnehmen kann, dass über Politik gesprochen wird. Ich bin von unbezähmbarer Neugier besessen, ich muss unbedingt alles genau hören, was da geredet wird. Skandale, Motoren, Quanten, irische Schoten, Liebe und Politik, das alles erscheint mir bei Weitem interessanter als Henry James, und jedes einzelne Thema für sich ist interessanter als alle anderen. Wie ein Vogel in einem Glaskäfig flattert die Neugier hilflos hin und her. Das Ganze läuft dann darauf hinaus, dass ich, da ich bei dem, was er sagt, nicht zuhöre und zu sehr abgelenkt bin, um eine zusammenhängende Antwort zu geben, meinem Gesprächspartner wie ein Idiot vorkommen muss, während es mir die schiere Anzahl der Gegenstände meiner unverschämten Neugier unmöglich macht, auch nur einen davon angemessen zu würdigen.
Dabei ist diese exzessive promiske Neugier, die sich für einen Mann, der sich in Gesellschaft bewähren will, so fatal auswirkt, wertvolles Kapital für den, der einfach nur zuschauen will, ohne am Treiben seiner Mitmenschen Anteil zu nehmen. Für den Reisenden, der, ob freiwillig oder nicht, gezwungen ist, sich als unbeteiligter Beobachter zu geben, ist Neugier schlicht unerlässlich. Ennui, sagt Baudelaire, ist «fruit de la morne incuriosité», die Folge eines betrüblichen Mangels an Neugier. Ein Tourist ohne Neugier ist zur Langeweile verdammt.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: