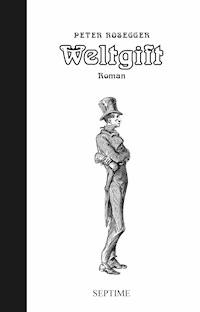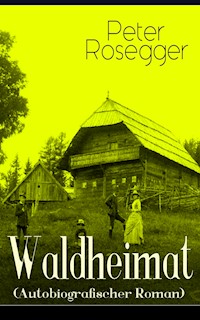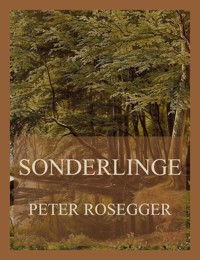5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Arena Kinderbuch-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Voller Natürlichkeit berichtet Peter Rosegger von seinen Erlebnissen als Kind einer armen Waldbauernfamilie in der Steiermark vor etwa 150 Jahren. Kaum zu glauben, wie abenteuerlich es damals war, nur die Zutaten für den Weihnachtsschmaus zu beschaffen! Die Geschichten vom Waldbauernbuben sind nach dem Jahreslauf und seinen Festen geordnet, wobei auf die Advents- und Weihnachtszeit ein besonderer Schwerpunkt gelegt wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Peter Rosegger
Als ich noch der Waldbauernbub war
Der Herausgeber
Friedrich Stephan, geboren 1944, ist Lehrer für Englisch und Latein und Lehrerausbilder für Englisch im Ruhestand. Er betreut die von seiner verstorbenen Frau Freya Stephan-Kühn begründete umfangreiche historische Kinderbuchsammlung Stephan-Kühn, in der sich viele deutsche und internationale Kinderbuchklassiker befinden. Für die Reihe der ARENA-Kinderbuchklassiker hat er mehrere englische Texte neu ins Deutsche übersetzt, andere gekürzt und bearbeitet. Darüber hinaus engagiert er sich im Bundeswettbewerb Fremdsprachen und als Großvater.
1. Auflage 2013 © by Arena Verlag GmbH, Würzburg 1996 Alle Rechte vorbehalten Einbandillustration: Klaus Steffens Herausgegeben von Friedrich Stephan ISBN 978-3-401-80288-6
www.arena-verlag.de
Inhalt
Vorwort
Weihnachten
Als ich Christtagsfreude holen ging
Ums Vaterwort
In der Christnacht
Der erste Christbaum in der Waldheimat
Ostern
Als ich nach Emmaus zog
Pfingsten
Als ich um Hasenöl geschickt wurde
Fronleichnam
Der Fronleichnamsaltar
Sonnenwende (21. Juni)
Dreihundertvierundsechzig und eine Nacht
Peter und Paul (29. Juni)
Als ich auf den Taschenfeitel wartete
Sommer
Als ich das erste Mal auf dem Dampfwagen saß
Mariä Himmelfahrt (15. August)
Vom Urgroßvater, der auf der Tanne saß
Michaelistag (29. September)
Weg nach Maria Zell
Herbst
Als wir zur Schulprüfung geführt wurden
Allerheiligen (1. November)
Als ich das Ofenhückerl war
Martinstag (11. November)
Wie ich dem lieben Herrgott mein Sonntagsjöppel schenkte
Vorwort
von Freya Stephan-Kühn
Als Peter Rosegger am 31. Juli 1843 in Alpl bei Krieglach in der Obersteiermark zur Welt kam, hätte sicher niemand gedacht, dass das kleine Kind in der Wiege einmal ein berühmter Schriftsteller werden würde. Dass er, der älteste von sieben Geschwistern, das Vieh hüten und den Vater beim Pflügen unterstützen würde, schon eher, denn er wurde in eine arme Bergbauernfamilie hineingeboren.
Aber er war ein Knabe mit einem wachen Blick für seine Umwelt. So konnte er später, als er begann, Geschichten und Gedichte zu schreiben, so lebendig und mit einem Blick für das Bemerkenswerte im Alltäglichen von seinen Jugenderlebnissen in der »Waldheimat« berichten, dass er im gesamten deutschsprachigen Raum auch außerhalb Österreichs Anklang fand. Pädagogen nahmen seine Texte oft und gern in Lesebücher auf; als Volks-Rosegger standen Sammelbände mit seinen Geschichten unter dem Titel »Als ich noch der Waldbauernbub war« in vielen deutschen Bücherschränken.
Roseggers gesammelte Werke, 1913–1916, zwei Jahre vor seinem Tod herausgegeben, umfassen vierzig Bände. Das meiste ist heute allenfalls noch Spezialisten bekannt, aber die Erzählungen aus seiner Jugendzeit wurden zu Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur und sind es bis heute geblieben. Zugegeben, das sind keine Geschichten, die man aufschlägt und in einem Zug zu Ende liest. Es ist die Sprache des 19. Jahrhunderts und für die Norddeutschen hält sie manche überraschende Wendung und neue Vokabel wie »Germ« (Hefe) oder »Taschenfeitel« (Taschenmesser) bereit. Aber niemand, der sich auf die Lektüre einlässt, kann sich dem Charme, der Lebendigkeit und der Natürlichkeit dieser Erzählungen entziehen. Man lässt sich gerne entführen in die Mitte des 19. Jahrhunderts und erlebt staunend und amüsiert mit, wie der kleine Peter mit seinem Paten, dem Knierutscher Johann, seine erste Begegnung mit der noch neuen Eisenbahn und deren Tarifsystem macht, in dem Preise und Leistungen nicht ausgehandelt werden, sondern festgesetzt sind. Wir erfahren, wie allgegenwärtig der liebe Gott und seine Heiligen sind, wie aber die Anfechtungen des Bösen, etwa in Form des Kartenspiels, noch viel reizvoller, aber auch gefährlicher sein können. Wir erleben das raue, karge Leben des Bergwinters und zugleich die unendliche Geborgenheit, die ein Ofen spenden kann. Wir werden Zeuge des schwierigen Prozesses, in dem die Eltern, besonders der Vater, und das Kind ihre Rollen finden, und der trotz der Krisen bedingungslosen und unerschütterlichen Liebe, die eine intakte Familie ihren Mitgliedern zu geben imstande ist. Wir nehmen Anteil, wenn der »Waldschulmeister« seine Kinder zur Schulprüfung nach Krieglach führt und glänzend mit ihnen abschneidet, wenn er auch über den kleinen Peter Rosegger entschuldigend sagen muss: »Das ist halt von den Schwächeren einer.« Wir feiern mit dem Waldbauernbuben und seiner Familie Weihnachten und denken darüber nach, wie ein Nichts, das wir uns jeden Tag leisten können, den Alltag damals in einen himmlischen Glanz einzutauchen vermochte. Wir versetzen uns in den Buben, der über dem sehnsüchtigen Verlangen nach einem »Taschenfeitel« die tatsächlichen Freuden übersieht, der als ältester seinen Ruf unter den Geschwistern wahren muss und der, ums »Hasenöl« geschickt, wichtige Erfahrungen in Bezug auf Sein und Schein macht. Kurz, wir erleben, wenn auch in einer anderen Zeit und unter anderen Umständen, eigentlich alle Probleme mit, die uns selbst berühren. Wir, das sind die – so Peter Rosegger in dem 1897 erschienenen Sammelband »Waldjugend« – »jungen Leute von 15 bis 70 Jahren«, wobei man die Altersgrenze an beiden Seiten ruhig noch ein wenig ausdehnen sollte.
Die Weihnachtserzählungen Roseggers stehen, da sie am schnellsten ein Eintauchen in die Welt des Verfassers ermöglichen, nicht zufällig am Anfang dieser Ausgabe. Peter Rosegger selbst und sein Verlag, der L. Staackman Verlag in Leipzig, haben die Erzählungen, die nach und nach ohne erkennbares Prinzip erschienen sind, mehrfach in Sammelbänden unter bestimmte, recht allgemeine Mottos wie »Waldjugend« oder »Als ich noch der Waldbauernbub war« gestellt. Die Auswahl in der Arena-Kinderklassikerreihe wurde unter dem Gesichtspunkt vorgenommen, ein Jahr im Leben des Waldbauernbuben zu dokumentieren. Und in der christlich-katholischen Umgebung, in der der Junge aufwächst, sowie angesichts der Bedeutung, die das Weihnachtsfest dort hatte, ist es nur folgerichtig, wenn wir für unsere Auswahl nicht das Kalender-, sondern das Kirchenjahr zugrunde legen, das im Advent beginnt. Die Gliederung nach dem Jahreslauf passt sehr gut in Peter Roseggers Zeit. Denn vor etwa hundertfünfzig Jahren spielte der Jahresablauf eine viel entscheidendere Rolle als heute, wo zu Beginn des Jahres die Schokoladenosterhasen und im August die Christstollen zu kaufen sind.
Peter Rosegger vermittelt auch den Menschen um die Jahrtausendwende die Erfahrung, dass die Geborgenheit einer Familie und die natürliche Neugier, die menschliche und natürliche Umwelt zu erfahren und zu begreifen, weder durch einen Dampfwagen noch durch einen Intercity, weder durch »Hasenöl« noch durch »Risiken und Nebenwirkungen«, weder durch den im Kopf auszurechnenden Wochenlohn eines Tagelöhners noch durch den Umgang mit Taschenrechner oder Computer ersetzt werden können.
So hoffe ich, dass möglichst viele Leserinnen und Leser von 10 bis 100 Jahren den Waldbauernbuben durch das Jahr begleiten werden. Damit dies auf möglichst echte Weise geschieht, sind die Geschichten nur da, wo allzu viele Erklärungen nötig gewesen wären, geringfügig gekürzt oder bearbeitet worden. Im Übrigen sind sie ganz in der Sprache und dem Stil Peter Roseggers belassen – ein Leseerlebnis, das sich lohnt!
Weihnachten
Als ich Christtagsfreude holen ging
In meinem zwölften Lebensjahre wird es gewesen sein, als am Frühmorgen des heiligen Christabends mein Vater mich an der Schulter rüttelte: Ich solle aufwachen und zur Besinnung kommen, er habe mir was zu sagen. Die Augen waren bald halb offen, aber die Besinnung! Als ich unter Mithilfe der Mutter angezogen war und bei der Frühsuppe saß, verlor sich die Schlaftrunkenheit allmählich und nun sprach mein Vater: »Peter, jetzt höre, was ich dir sage. Da nimm einen leeren Sack, denn du wirst was heimtragen. Da nimm meinen Stecken, denn es ist viel Schnee, und da nimm eine Laterne, denn der Pfad ist schlecht und die Stege sind vereist. Du musst hinabgehen nach Langenwang. Den Holzhändler Spreitzegger zu Langenwang, den kennst du, der ist mir noch immer das Geld schuldig, zwei Gulden und sechsunddreißig Kreuzer für den Lärchbaum. Ich lass ihn bitten drum; schön höflich anklopfen und den Hut abnehmen, wenn du in sein Zimmer trittst. Mit dem Gelde gehest nachher zum Kaufmann Doppelreiter und kaufest zwei Maßel Semmelmehl und zwei Pfund Rindschmalz und um zwei Groschen Salz und das tragst heim.«
Jetzt war aber auch meine Mutter zugegen, ebenfalls schon angekleidet, während meine sechs jüngeren Geschwister noch ringsum an der Wand in ihren Bettchen schliefen. Die Mutter, die redete drein wie folgt: »Mit Mehl und Schmalz und Salz allein kann ich kein Christtagsessen richten. Ich brauch dazu noch Germ um einen Groschen, Weinbeerln um fünf Kreuzer, Zucker um fünf Groschen, Safran um zwei Groschen und Neugewürz um zwei Kreuzer. Etliche Semmeln werden auch müssen sein.«
»So kaufest es«, setzte der Vater ruhig bei. »Und wenn dir das Geld zu wenig wird, so bittest den Herrn Doppelreiter, er möcht die Sachen derweil borgen und zu Ostern wollt ich schon fleißig zahlen. Eine Semmel kannst unterwegs selber essen, weil du vor Abend nicht heimkommst. Und jetzt kannst gehen, es wird schon fünf Uhr, und dass du noch die Achtuhrmesse erlangst zu Langenwang.«
Das war alles gut und recht. Den Sack band mein Vater mir um die Mitte, den Stecken nahm ich in die rechte Hand, die Laterne mit der frischen Talgkerze in die linke und so ging ich davon, wie ich zu jener Zeit in Wintertagen oft davongegangen war. Der durch wenige Fußgeher ausgetretene Pfad war holperig im tiefen Schnee und es ist nicht immer leicht, nach den Fußstapfen unserer Vorderen zu wandeln, wenn diese zu lange Beine gehabt haben. Noch nicht dreihundert Schritte war ich gegangen, so lag ich im Schnee und die Laterne, hingeschleudert, war ausgelöscht. Ich suchte mich langsam zusammen und dann schaute ich die wunderschöne Nacht an. Anfangs war sie ganz grausam finster, allmählich hub der Schnee an, weiß zu werden und die Bäume schwarz, und in der Höhe war helles Sternengefunkel. In den Schnee fallen kann man auch ohne Laterne, so stellte ich sie seithin unter einen Strauch und ohne Licht ging’s nun besser als vorhin.
In die Talschlucht kam ich hinab, das Wasser des Fresenbaches war eingedeckt mit glattem Eise, auf welchem, als ich über den Steg ging, die Sterne des Himmels gleichsam Schlittschuh liefen. Später war ein Berg zu übersteigen; auf dem Passe, genannt der »Höllkogel«, stieß ich zur wegsamen Bezirksstraße, die durch Wald und Feld hinabführt in das Mürztal. In diesem lag ein weites Meer von Nebel, in welches ich sachte hineinkam, und die feuchte Luft fing an, fernen Lärm an mein Ohr zu tragen, denn im Tale hämmerten die Eisenwerke, rollte manchmal ein Eisenbahnzug über dröhnende Brücken.
Nach langer Wanderung ins Tal gekommen zur Landstraße, klingelten Schlittengeschelle, der Nebel ward grau und lichter, sodass ich die Fuhrwerke und Wandersleute, die für die Feiertage nach ihren Heimstätten reisten, schon auf kleine Strecken weit sehen konnte. Nachdem ich eine Stunde lang im Tale fortgegangen war, tauchte links an der Straße im Nebel ein dunkler Pfad auf, rechts auch einer, links mehrere, rechts eine ganze Reihe – das Dorf Langenwang.
Alles, was Zeit hatte, ging der Kirche zu, denn der Heilige Abend ist voller Vorahnung und Gottesweihe. Bevor noch die Messe anfing, schritt der hagere gebückte Schulmeister durch die Kirche, musterte die Andächtigen, als ob er jemanden suche. Endlich trat er an mich und fragte leise, ob ich ihm nicht den Blasebalg für die Orgel ziehen wolle, es sei der Messnerbub krank. Voll Stolz und Freude, allso zum Dienste des Herrn gewürdigt zu sein, ging ich mit ihm auf den Chor. Während ich die zwei langen Lederriemen abwechselnd aus dem Kasten zog, in welchen jeder derselben allemal wieder langsam hineinkroch, orgelte der Schulmeister und seine Tochter sang allso:
»Tauet, Himmel, den Gerechten,
Wolken, regnet ihn herab!
Also rief in bangen Nächten
Einst die Welt, ein weites Grab.
In von Gott verhassten Gründen
Herrschten Satan, Tod und Sünden.
Fest verschlossen war das Tor
Zu dem Himmelreich empor.«
Ferner erinnere ich mich, an jenem Morgen nach dem Gottesdienste in der dämmerigen Kirche vor ein Heiligenbild hingekniet zu sein und gebetet zu haben um Glück und Segen zur Erfüllung meiner bevorstehenden Aufgabe. Das Bild stellte die Vierzehn Nothelfer dar – einer wird doch dabei sein, der zur Eintreibung von Schulden behilflich ist. Es schien mir aber, als schiebe während meines Gebetes auf dem Bilde einer sich sachte hinter den andern zurück.
Trotzdem lief ich guten Mutes hinaus in den nebeligen Tag, wo alles emsig war in der Vorbereitung zum Feste, und ging dem Hause des Holzhändlers Spreitzegger zu. Als ich daran war, zur vorderen Tür hineinzugehen, wollte der alte Spreitzegger, soviel ich mir später reimte, durch die hintere Tür entwischen. Es wäre ihm gelungen, wenn mir nicht im Augenblicke geschwant hätte: Peter, geh nicht zur vorderen Tür ins Haus wie ein Herr, sei demütig, geh zur hinteren Tür hinein, wie es dem Waldbauernbub geziemt. Und knapp an der hinteren Türe trafen wir uns.
»Ah, Bübel, du willst dich wärmen gehen«, sagte er mit geschmeidiger Stimme und deutete ins Haus, »na, geh dich nur wärmen. Ist kalt heut!« Und wollte davon.
»Mir ist nicht kalt«, antwortete ich, »aber mein Vater lässt den Spreitzegger schön grüßen und bitten ums Geld.«
»Ums Geld? Wieso?«, fragte er. »Ja, richtig, du bist der Waldbauernbub. Bist früh aufgestanden heut, wenn du schon den weiten Weg kommst. Ruh dich nur aus. Und ich lass deinen Vater auch schön grüßen und glückliche Feiertage wünschen; ich komm ohnehin ehzeit einmal zu euch hinauf, nachher wollen wir schon gleich werden.«
Fast verschlug’s mir die Rede, stand doch unser ganzes Weihnachtsmahl in Gefahr vor solchem Bescheid.
»Bitt wohl von Herzen schön ums Geld, muss Mehl kaufen und Schmalz und Salz und ich darf nicht heimkommen mit leerem Sack.«
Er schaute mich starr an. »Du kannst es!«, brummte er, zerrte mit zäher Gebärde seine große rote Brieftasche hervor, zupfte in den Papieren, die wahrscheinlich nicht pure Banknoten waren, zog einen Gulden heraus und sagte: »Na, so nimm derweil das, in vierzehn Tagen wird dein Vater den Rest schon kriegen. Heut hab ich nicht mehr.«
Den Gulden schob er mir in die Hand, ging davon und ließ mich stehen.
Ich blieb aber nicht stehen, sondern ging zum Kaufmann Doppelreiter. Dort begehrte ich ruhig und gemessen, als ob nichts wäre, zwei Maßel Semmelmehl, zwei Pfund Rindsschmalz, um zwei Groschen Salz, um einen Groschen Germ, um fünf Kreuzer Weinbeerln, um zwei Groschen Zucker, um zwei Groschen Safran und um zwei Kreuzer Neugewürz. Der Herr Doppelreiter bediente mich selbst und machte mir alles hübsch zurecht in Päckchen und Tütchen, die er dann mit Kordel zusammen in ein einziges Paket band und an den Mehlsack so hängte, dass ich das Ding über der Achsel tragen konnte, vorne ein Bündel und hinten ein Bündel.
Als das geschehen war, fragte ich mit einer nicht minder tückischen Ruhe als vorhin, was das alles zusammen ausmache.
»Das macht drei Gulden fünfzehn Kreuzer«, antwortete er.
»Ja, ist schon recht«, hierauf ich, »da ist derweil ein Gulden und das andere wird mein Vater, der Waldbauer in Alpel, zu Ostern zahlen.«
Schaute mich der bedauernswerte Mann an und fragte höchst ungleich: »Zu Ostern? In welchem Jahr?«
»Na nächst’ Ostern.«
Nun mischte sich die Frau Doppelreiterin, die andere Kunden bediente, drein und sagte: »Lass ihm’s nur, Mann, der Waldbauer hat schon öfter auf Borg genommen und nachher alles mal ordentlich bezahlt. Lass ihm’s nur.«
»Ich lass ihm’s ja, werd ihm’s nicht wieder wegnehmen«, antwortete der Doppelreiter. Das war doch ein bequemer Kaufmann! Jetzt fielen mir auch die Semmeln ein, welche meine Mutter noch bestellt hatte.
»Kann man da nicht auch fünf Semmeln haben?«, fragte ich.
»Semmeln kriegt man beim Bäcker«, sagte der Kaufmann.
Das wusste ich nun gleichwohl, nur hatte ich mein Lebtag nichts davon gehört, dass man ein paar Semmeln auf Borg nimmt, daher vertraute ich der Kaufmännin, die sofort als Gönnerin zu betrachten war, meine vollständige Zahlungsunfähigkeit an. Sie gab mir zwei bare Groschen für Semmeln, und als sie nun noch beobachtete, wie meine Augen mit den reiffeuchten Wimpern fast unablösbar an den gedörrten Zwetschgen hingen, die sie einer alten Frau in den Korb tat, reichte sie mir auch noch eine Hand voll dieser köstlichen Sache zu: »Unterwegs zum Naschen.«
Nicht lange hernach, und ich trabe mit meinen Gütern reich und schwer bepackt durch die breite Dorfgasse dahin. Überall in den Häusern wurde gemetzgert, gebacken, gebraten, gekellert; ich beneidete die Leute nicht; ich bedauerte sie vielmehr, dass sie nicht ich waren, der mit so großem Segen beladen gen Alpel zog. Das wird morgen ein Christtag werden! Denn die Mutter kann’s, wenn sie die Sachen hat. Ein Schwein ist ja auch geschlachtet worden daheim, das gibt Fleischbrühe mit Semmelbrocken, Speck, Würste, Nieren-Lümperln, Knödelfleisch mit Kren, dann erst die Krapfen, die Zuckernudeln, das Schmalzgebackene mit Weinbeerln und Safran! – Die Herrenleut’ da in Langenwang haben so was alle Tag, das ist nichts, aber wir haben es im Jahr einmal und kommen mit unverdorbenem Magen dazu, das ist was! – Und doch dachte ich auf diesem belasteten Freudenmarsch weniger noch ans Essen als an das liebe Christkind und sein hochheiliges Fest. Am Abend, wenn ich nach Hause komme, werde ich aus der Bibel davon vorlesen, die Mutter und die Magd Mirzel werden Weihnachtslieder singen; dann, wenn es zehn Uhr wird, werden wir uns aufmachen nach Sankt Kathrein und in der Kirche die feierliche Christmette begehen bei Glocken, Musik und unzähligen Lichtern. Und am Seitenaltar ist das Krippel aufgerichtet mit Ochs und Esel und den Hirten und auf dem Berg die Stadt Bethlehem und darüber die Engel, singend: Ehre sei Gott in der Höhe! – Diese Gedanken trugen mich anfangs wie Flügel. Doch als ich eine Weile die schlittenglatte Landstraße dahingegangen war, unter den Füßen knirschenden Schnee, musste ich mein Doppelbündel schon einmal wechseln von einer Achsel auf die andere.
In der Nähe des Wirtshauses »Zum Sprengzaun« kam mir etwas Vierspänniges entgegen. Ein leichtes Schlittlein, mit vier feurigen, hoch aufgefederten Rappen bespannt, auf dem Bock ein Kutscher mit glänzenden Knöpfen und einem hohen Hut. Der Kaiser? Nein, der Herr Wachtler vom Schloss Hohenwang saß im Schlitten, über und über in Pelze gehüllt und eine Zigarre schmauchend. Ich blieb stehen, schaute dem blitzschnell vorüberrutschenden Zeug eine Weile nach und dachte: Etwas krumm ist es doch eingerichtet auf dieser Welt. Da ist ein starker Mann drin und lasst sich hinziehen mit so viel überschüssiger Kraft und ich vermag mein Bündel kaum zu schleppen.
Mittlerweile war es Mittagszeit geworden. Durch den Nebel war die milchweiße Scheibe der Sonne zu sehen; sie war nicht hoch an dem Himmel hinaufgestiegen, denn um vier Uhr wollte sie ja wieder unten sein, zur langen Christnacht. Ich fühlte in den Beinen manchmal so ein heißes Prickeln, das bis in die Brust heraufstieg, es zitterten mir die Glieder. Nicht weit von der Stelle, wo der Weg nach Alpel abzweigt, stand ein Kreuz mit dem lebensgroßen Bilde des Heilands. Es stand, wie es heute noch steht, an seinem Fuß Johannes und Magdalena, das Ganze mit einem Bretterverschlag verwahrt, sodass es wie eine Kapelle war. Vor dem Kreuze auf die Bank, die für kniende Beter bestimmt ist, setzte ich mich nieder, um Mittag zu halten. Eine Semmel, die gehörte mir, meine Neigung zu ihr war so groß, dass ich sie am liebsten in wenigen Bissen verschluckt hätte. Allein, das schnelle Schlucken ist nicht gesund, das wusste ich von anderen Leuten und das langsame Essen macht einen längeren Genuss, das wusste ich schon von mir selber. Also beschloss ich, die Semmel recht gemächlich und bedächtig zu genießen und dazwischen manchmal eine gedörrte Zwetschge zu naschen.
Es war eine sehr köstliche Mahlzeit; wenn ich heute etwas recht Gutes haben will, das kostet außerordentliche Anstrengungen aller Art; ach, wenn man nie und nie einen Mangel zu leiden hat, wie wird man da arm!
Und wie war ich so reich damals, als ich arm war!
Als ich nach der Mahlzeit mein Doppelbündel wieder auflud, war’s ein Spaß mit ihm, flink ging es voran. Als ich später in die Bergwälder hinaufkam und der graue Nebel dicht in den schneebeschwerten Bäumen hing, dachte ich an den Grabler-Hansel. Das war ein Kohlenführer, der täglich von Alpel seine Fuhr’ ins Mürztal lieferte. Wenn er auch heute gefahren wäre! Und wenn er jetzt heimwärts mit dem leeren Schlitten des Weges käme und mir das Bündel auflüde! Und am Ende gar mich selber! Dass es so heiß sein kann im Winter! Mitten in Schnee und Eisschollen schwitzen! Doch morgen wird alle Mühsal vergessen sein. Derlei Gedanken und Vorstellungen verkürzten mir unterwegs die Zeit.
Auf einmal roch ich starken Tabakrauch. Knapp hinter mir ging – ganz leise auftretend – der grüne Kilian. Der Kilian war früher einige Zeit lang Forstgehilfe gewesen, jetzt war er’s nicht mehr, wohnte mit seiner Familie in einer Hütte drüben in der Fischbacher Gegend, man wusste nicht recht, was er trieb. Nun ging er nach Hause. Er hatte einen Korb auf dem Rücken, an dem er nicht schwer zu tragen schien, sein Gewand war noch ein jägermäßiges, aber hübsch abgetragen, und sein schwarzer Vollbart ließ nicht viel sehen von seinem etwas fahlen Gesichte. Als ich ihn bemerkt hatte, nahm er die Pfeife aus dem Mund, lachte laut und sagte: »Wo schiebst denn hin, Bub?«
»Heim zu«, meine Antwort.
»Was schleppest denn?«
»Sachen für den Christtag.«
»Gute Sachen? Der tausend sapperment! Wem gehörst denn zu?«
»Dem Waldbauern.«
»Zum Waldbauer willst gar hinauf! Da musst dich dranhalten.«
»Tu’s schon«, sagte ich und hielt mich dran.
»Nach einem solchen Marsch wirst gut schlafen bei der Nacht«, versetzte der Kilian, mit mir gleichen Schritt haltend.
»Heut wird nicht geschlafen bei der Nacht, heut ist Christnacht.«
»Was willst denn sonst tun als schlafen bei der Nacht?«
»Nach Kathrein in die Mette gehen.«
»Nach Kathrein?«, fragte er. »Den weiten Weg?«
»Um zehn Uhr abends gehen wir vom Haus fort und um drei Uhr früh sind wir wieder daheim.«
Der Kilian biss in sein Pfeifenrohr und sagte: »Na, hörst du, da gehört viel Christentum dazu. Beim Tag ins Mürztal und bei der Nacht in die Mette nach Kathrein! So viel Christentum hab ich nicht, aber das sage ich dir doch: Wenn du dein Bündel in meinen Buckelkorb tun willst, dass ich es dir eine Zeit lang trag und du dich ausrasten kannst, so hast ganz recht, warum soll der alte Esel nicht auch einmal tragen!«
Damit war ich einverstanden, und während mein Bündel in seinen Korb sank, dachte ich: Der grüne Kilian ist halt doch ein besserer Mensch, als man sagt.
Dann rückten wir wieder an, ich huschte frei und leicht neben ihm her.
»Ja, ja, die Weihnachten!«, sagte der Kilian. »Da geht’s halt drunter und drüber. Da reden sich die Leut’ in eine Aufregung und Frömmigkeit hinein, die gar nicht wahr ist. Im Grund ist der Christtag wie jeder andere Tag, nicht einen Knopf anders. Der Reiche, ja, der hat jeden Tag Christtag, unsereiner hat jeden Tag Karfreitag.«
»Der Karfreitag ist auch schön«, war meine Meinung.
»Ja, wer genug Fische und Butter und Eier und Kuchen und Krapfen hat zum Fasten!«, lachte der Kilian.
Mir kam sein Reden etwas heidentümlich vor. Doch was er noch Weiteres sagte, das verstand ich nicht mehr, denn er hatte angefangen, sehr heftig zu gehen, und ich konnte nicht recht nachkommen. Ich rutschte auf dem glitschigen Schnee mit jedem Schritt ein Stückchen zurück, der Kilian hatte Fußeisen angeschnallt, hatte lange Beine, war nicht erschöpft – da ging’s freilich voran.
»Herr Kilian!«, rief ich.
Er hörte es nicht. Der Abstand zwischen uns wurde immer größer, bei Wegbiegungen entschwand er mir manchmal ganz aus den Augen, um nachher wieder in größerer Entfernung, halb schon von Nebeldämmerung verhüllt, aufzutauchen. Jetzt wurde mir bang um mein Bündel. Kamen wir ja doch schon dem Höllkogel nahe. Das ist jene Stelle, wo der Weg nach Alpel und der Weg nach Fischbach sich gabeln. Ich hub an zu laufen; im Angesichte der Gefahr war alle Müdigkeit dahin, ich lief wie ein Hündlein und kam ihm näher. Was wollte ich aber anfangen, wenn ich ihn eingeholt hätte, wenn ihm der Wille fehlte, die Sachen herzugeben und mir die Kraft sie zu nehmen? Das kann ein schönes Ende werden mit diesem Tage, denn die Sachen lasse ich nicht im Stich, und sollte ich ihm nachlaufen müssen bis hinter den Fischbacher Wald zu seiner Hütte!
Als wir denn beide so merkwürdig schnell vorwärts kamen, holten wir ein Schlittengespann ein, das vor uns mit zwei grauen Ochsen und einem schwarzen Kohlenführer langsam des Weges schlich. Der Grabler-Hansel. Mein grüner Kilian wollte schon an dem Gespann vorüberhuschen, da schrie ich von hinten her aus Leibeskräften: »Hansel! Hansel! Sei so gut, leg mir meine Christtagssachen auf den Schlitten, der Kilian hat sie im Korb und er soll sie dir geben!«
Mein Schrei muss wohl sehr angstvoll gewesen sein, denn der Hansel sprang sofort von seinem Schlitten und nahm eine tatbereite Haltung ein. Und wie der Kilian merkte, ich hätte hier einen Bundesgenossen, riss er sich den Korb vom Rücken und schleuderte das Bündel auf den Schlitten. Noch knirschte er etwas von »dummen Bären« und »Undankbarkeit«, dann war er auch schon davon.
Der Hansel rückte das Bündel zurecht und fragte, ob man sich draufsetzen dürfe. Das bat ich, nicht zu tun.
Also tat er’s auch nicht, wir setzten uns hübsch nebeneinander auf den Schlitten und ich hielt auf dem Schoß sorgfältig mit beiden Händen die Sachen für den Christtag. So kamen wir endlich nach Alpel. Als wir zur ersten Brücke gekommen waren, sagte der Hansel zu den Ochsen: »Oha!« und zu mir: »So!« Die Ochsen verstanden und blieben stehen, ich verstand nicht und blieb sitzen. Aber nicht mehr lange, es war ja zum Aussteigen, denn der Hansel musste links in den Graben hinein und ich rechts den Berg hinauf.
»Dank dir’s Gott, Hansel!«
»Ist schon gut, Peterl.«
Zur Zeit, da ich mit meiner Last den steilen Berg hinanstieg gegen mein Vaterhaus, begann es zu dämmern und zu schneien. Und zuletzt war ich doch daheim.
»Hast alles?«, fragte die Mutter am Kochherd mir entgegen.
»Alles!«
»Brav bist. Und hungrig wirst sein.«
Beides ließ ich gelten. Sogleich zog die Mutter mir die klingend hart gefrorenen Schuhe von den Füßen, denn ich wollte, dass sie frisch eingefettet würden für den nächtlichen Mettengang. Dann setzte ich mich in der warmen Stube zum Essen.