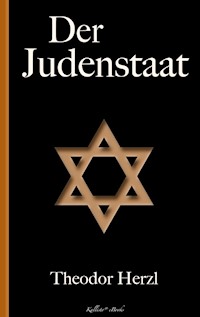Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem utopischen Roman "Altneuland" (1902) entwarf Theodor Herzl detailliert seine Vision des "Judenstaates". Aus dem Mit- und Gegeneinander fundamentalistischer und aufgeklärter Kräfte entsteht darin eine moderne, pluralistische und optimistische Gesellschaft. Die heutige Situation macht es notwendig, diese Vision wieder kennenzulernen. Für das Verständnis des Zionismus und im Kampf gegen den israelbezogenen Antisemitismus ist "Altneuland" ein Schlüsseltext.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dem Andenken meines Vaters Jakob Herzl, geb. 17. April 1836, gest. 9. Juni 1902, und meiner Schwester Pauline Herzl, geb. 10. März 1859, gest. 7. Februar 1878 gewidmet.
Bearbeitet und herausgegeben von Andrea Livnat
Inhaltsverzeichnis
Vorwort von Eva Ehrlich
»Wenn Ihr wollt, ist es kein Märchen...« – Zur Einführung
Erstes Buch: Ein gebildeter und verzweifelter junger Mann
Zweites Buch: Haifa 1923
Drittes Buch: Das blühende Land
Viertes Buch: Passah
Fünftes Buch: Jerusalem
Vorwort
Als haGalil 1995 seine Arbeit aufnahm, wurde relativ bald deutlich, dass das Internet das effektivste Werkzeug zur Artikulation und Verbreitung von Antisemitismus ist. Heute sind Hetze und antisemitische Hassrede im Internet alltäglich geworden. Der Kampf um die Wahrheit umso schwieriger.
Es war stets unsere Überzeugung, dass es für die Auseinandersetzung mit Antisemitismus wichtig ist, das Judentum in seiner ganzen Vielfalt zu zeigen. Das gilt auch für Israel und seine Gesellschaft, in deren pluralistischer Realität es vielfältigste Meinungen und Positionen gibt.
Heute stellen Diffamierungen des Zionismus und des Staates Israel, der sogenannte israelbezogene Antisemitismus, einen erheblichen Teil der antisemitischen Propaganda, auch im Internet.
Differenziertere Positionen können auch durch die Kenntnis von Quellentexten entstehen. Theodor Herzls Altneuland gehört zu den Grundlagentexten, um den Zionismus in seiner historischen Entwicklung zu verstehen. Schon Herzl habe die arabische Bevölkerung aus Palästina vertreiben wollen, ist beispielsweise ein oft wiederholtes antizionistisches Mantra. Die Lektüre von Altneuland beweist das Gegenteil.
Zum 120. Jahrestag seines Erscheinens möchten wir daher die Quelle in einer überarbeiteten Neuausgabe wieder sprechen lassen. Altneuland bleibt Inspiration für die Vision eines friedlichen und toleranten Miteinanders. Wenn wir es nur wollen.
Eva Ehrlich, München, Oktober 2022
»Wenn Ihr wollt, ist es kein Märchen...« Zur Einführung
»Gleich allen anderen Völkern, ist es das natürliche Recht des jüdischen Volkes, seine Geschichte unter eigener Hoheit selbst zu bestimmen. Demzufolge haben wir, die Mitglieder des Nationalrates, als Vertreter der jüdischen Bevölkerung und der zionistischen Organisation, heute, am letzten Tage des britischen Mandats über Palästina, uns hier eingefunden und verkünden hiermit kraft unseres natürlichen und historischen Rechtes und aufgrund des Beschlusses der Vollversammlung der Vereinten Nationen die Errichtung eines jüdischen Staates im Lande Israel – des Staates Israel.«1
Mit diesen denkwürdigen Worten proklamierte David Ben Gurion am Nachmittag des 14. Mai 1948 den Staat Israel. Die Unabhängigkeitserklärung fasst in wenigen Sätzen die Geschichte des jüdischen Volkes zusammen, vom Exil in der Diaspora und der nie gewichenen Hoffnung auf Rückkehr in die Heimat, über die Anfänge der Besiedelung in den vorangegangenen Jahrzehnten, die zionistische Bewegung und die Balfour-Erklärung von 1917 bis hin zur Schoah. Nur ein Name wird ausdrücklich genannt: Theodor Herzl, »der Prophet des Staates«, auf dessen Ruf hin der erste Zionistenkongress zusammentrat. Nach den erfolgreichen und erschöpfenden Tagen des Kongresses notierte Herzl Ende August 1897 in sein Tagebuch:
»Fasse ich den Baseler Kongreß in ein Wort zusammen – das ich mich hüten werde, öffentlich auszusprechen – so ist es dieses: in Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sagte, würde mir ein universales Gelächter antworten. Vielleicht in fünf Jahren, jedenfalls in fünfzig wird es jeder einsehen.«2
Tatsächlich vergingen nur wenig mehr als 50 Jahre bis David Ben Gurion den Staat Israel proklamierte, jenen Staat, den Herzl in seiner programmatischen Schrift Der Judenstaat als »Lösung der Judenfrage« dargestellt hatte. Und jenen Staat, den Herzl in seinem utopischen Roman Altneuland bis ins kleinste Detail erträumt hatte.
Als Herzl 1904 starb, war die Verwirklichung seiner Vision noch in weiter Ferne. Geht man heute durch die Straßen Tel Avivs, jener Stadt, die nach der hebräischen Übersetzung von Altneuland benannt ist, und sieht die Mischung aus westlichem und orientalischem Lebensstil, scheint es unwirklich, dass ausgerechnet ein Wiener Journalist den Anstoß für die entscheidende Veränderung der jüdischen Nationalbewegung gab, der den Zionismus auf eine politische Ebene bringen konnte. Und doch waren es Herzls Vision, sein politisches Geschick und sein Charisma, die die zionistische Bewegung als politische Kraft etablierten.
Theodor Herzl wurde 1860 in Budapest in eine akkulturierte Familie, die eine weltbürgerliche deutsche Kultur pflegte, geboren. Nach der jüdischen Volksschule besuchte Theodor die städtische Oberrealschule und schließlich das evangelische Gymnasium. Nach dem Tod der Schwester zog die Familie 1878 nach Wien. Obwohl zu einer Schriftstellerlauf bahn entschlossen, schrieb sich Theodor für ein Jurastudium an der Universität Wien ein, während dem er erste Begegnungen mit dem Antisemitismus machte.
1884 graduierte Herzl und trat wenig später die praktische Ausbildung im Staatsdienst in Wien und Salzburg an. Gleichzeitig begann er vermehrt zu schreiben und entschied sich schließlich, trotz zunächst bescheidenem Erfolg, die Schriftstellerei ganz zum Beruf zu machen. Der Entschluss folgte nicht zuletzt daraus, da ihm als Jude eine Karriere im österreichischen Beamtenwesen versagt blieb, als freier Rechtsanwalt wollte Herzl jedoch nicht tätig werden.
Ab 1885 erschienen seine Feuilletons und Erzählungen in verschiedenen Zeitungen, zugleich setzte er seine Arbeit an Theaterstücken fort, die zunehmend Anerkennung fanden und schließlich an österreichischen und deutschen Bühnen gezeigt wurden. Die Feuilletons eines Italienaufenthaltes öffneten ihm endgültig die Tore zur journalistischen Welt. Im Juli 1889 heiratete er Julia Naschauer und wurde im Laufe der folgenden Jahre Vater von drei Kindern, Pauline, Hans und Trude.
Die entscheidende Wende in Herzls Leben trat ein, als ihm der Posten des Korrespondenten in Paris für die Neue Freie Presse angeboten wurde. Herzl sagte sofort zu und nahm Ende Oktober 1891 seine Arbeit auf. Er berichtete nun regelmäßig über das parlamentarische Leben, über die sozialen Probleme des Landes und zunehmend auch über den Antisemitismus. Überlegungen zur »Lösung der Judenfrage« brachten Herzl zunächst auf die Idee einer Massenkonversion:
»Am helllichten Tage, an Sonntagen um zwölf Uhr, sollte in feierlichen Aufzügen unter Glockengeläute der Übertritt stattfinden in der Stefanskirche. Nicht verschämt, wie es einzelne bisher getan, sondern mit stolzen Gebärden.«3
Im November 1894 schrieb Herzl sein Stück Das Ghetto, später umbenannt in Das neue Ghetto, das einen Wendepunkt in seinem Verständnis des Antisemitismus ausdrückt. Es zeigt deutlich den Bruch mit der Überzeugung, Juden könnten durch Assimilation als gleichberechtigt in die Gesellschaft integriert werden. Für den Protagonisten, er stirbt im Duell, kann es kein gutes Ende geben, dies sollte Herzl erst später entwerfen. Im Dezember berichtete Herzl für die Neue Freie Presse über den Dreyfus-Prozess in Paris,4 im Januar 1895 über die öffentliche Degradierung des Offiziers. Er sah Dreyfus seine Unschuld beteuern und hörte die »Tod dem Juden« -Rufe in den Straßen. In ihm reifte ein Gedanke, eine Idee, ein Plan zur »Lösung der Judenfrage«.
Herzl schrieb an Baron Maurice de Hirsch, einer der größten Philanthropen der jüdischen Welt, und konnte ihn im Juni treffen. Von Herzls Idee hielt Hirsch jedoch nichts. Herzl ließ sich nicht beirren und arbeitete weiter an seiner Skizze, die schließlich am 14. Februar 1896 unter dem Titel Der Judenstaat – Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage erscheinen sollte.
Damit war der Start für einen neun Jahre währenden Kampf Herzls für die zionistische Sache gegeben. Herzl hatte viele Widerstände zu überwinden, nicht nur von außen, auch aus den »eigenen« Reihen. Vielen sprach seine Idee, die zwar keine neue war, aber erstmals von einem westeuropäischen assimilierten Juden formuliert und mit einem klar strukturierten Programm unterlegt wurde, aus dem Herzen, doch zunächst schlug ihm erbitterte Ablehnung entgegen. Seine Gegner waren assimilierte Juden, Anhänger anderer zionistischer Strömungen und Juden aus den religiösen Reihen. In Wien war es zunächst die Jugend- und Studentenbewegung, die Herzl begeistern konnte. Kadimah, Ivria, Unitas und andere Vereine unterstützten ihn und gaben ihm ein Forum für Vorträge und Reden. In Osteuropa konnte seine Idee eines »Judenstaates« sehr viel schneller Anhänger gewinnen und die Massen in einem Ausmaß mobilisieren, das Herzl selbst überraschte. Am10. März 1896 berichtete er in seinem Tagebuch von einem begeisterten Brief aus Sofia. Der dortige Großrabbiner halte ihn für den Messias. Im Juni hielt Herzls Zug dann auf der Durchreise in Sofia an. Eine »ergreifende Szene« erwartete ihn, wie er nachträglich festhielt. Vor dem Gleis hatte sich eine Menschenmenge angesammelt, eine deutsche und eine französische Ansprache wurden verlesen, Blumen überreicht.
»In diesen und den folgenden Ansprachen wurde ich als Führer, als das Herz Israels usw., in überschwänglichen Worten gefeiert.«5
Herzl befand sich nun ununterbrochen auf Reisen, um weitere Unterstützung zu gewinnen und Zugang zu den Herrschern Europas zu finden. Unterdessen schlug er den Wiener Zionisten, die sich mittlerweile zu einem Aktionskomitee zusammengeschlossen hatten, vor, einen allgemeinen Zionistenkongress einzuberufen. Nachdem die Herausgeber der Neuen Freien Presse nicht bereit waren, Berichte über die zionistischen Aktivitäten in ihrem Blatt zu veröffentlichen, entschloss sich Herzl, eine eigene Zeitung zu gründen. Die Welt erschien erstmals am 4. Juni 1897, »ein Judenblatt«, das »dem jüdischen Volke eine Wehr und Waffe sein«6 soll, wie es im Programm hieß. Herzl setzte sich schließlich gegen alle Widerstände und Bedenken durch und konnte im August 1897 den ersten Zionistenkongress in Basel einberufen.7
Die Idee eines Kongresses war »wie der Morgenstern, der einem wundervollen Frühlingsmorgen den ewigen Maienglanz verleiht«, schrieb Ben Ami, der russische Schriftsteller Mordechai Rabinowicz, in seinen Erinnerungen, »wohl dem, der diesen Frühling mit erlebt hat.«8
Joseph Klausner verglich die Stimmung des Ersten Kongresses mit der Begeisterung, die während der Offenbarung am Sinai herrschte.9 Ben Ami, der am Abend zuvor mit Herzl zusammengekommen war und nun über dessen Veränderung erstaunt war, zog ebenfalls historische Vergleiche:
»Vor uns erscheint eine wunderbar erhabene königliche Figur, mit hoheitsvollen, tiefen Augen, die eine stille Trauer verraten. Es ist nicht mehr der elegante Dr. Herzl aus Wien, es ist ein aus dem Grabe erstandener königlicher Nachkomme Davids, der vor uns erscheint, in der Größe und Schönheit, mit der Phantasie und Legende ihn umwoben haben.«10
Der Kongress verabschiedete das »Basler Programm«, das »für das jüdische Volk die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina« anstrebte und legte das Fundament für die Zionistische Organisation, deren oberstes Organ der Kongress selbst war. In den folgenden Jahren bemühte sich Herzl unermüdlich, die Sache weiter voranzutreiben. Er traf mehrmals mit dem Großherzog Friedrich von Baden zusammen, erhielt eine Audienz bei Kaiser Wilhelm II. in Konstantinopel, reiste nach Palästina und traf dort den deutschen Kaiser erneut, sprach mit dem türkischen Sultan, dem Papst und dem italienischen König. Er nutzte jede Minute seiner Zeit, reiste fast ununterbrochen, verließ schließlich die Zeitung und das »geregelte« Leben und opferte auch sein Privatvermögen für die zionistische Sache.
Im Frühjahr 1903 erhielt Herzl schließlich von britischer Seite das Angebot, eine autonome jüdische Ansiedlung in Uganda zu errichten, ein Vorschlag, den Herzl zunächst abgelehnt hatte. Nachdem das Kishinev-Pogrom die Notlage der Juden in Osteuropa erneut dramatisch verdeutlicht hatte, sah sich Herzl in der Pflicht, die Verhandlungen mit der englischen Regierung erneut aufzunehmen. Mit der Genehmigung der Zionistischen Exekutive präsentierte er den »Uganda-Vorschlag« im August 1903 auf dem sechsten Zionistenkongress. Auch wenn Herzl betonte, dass das ultimative Ziel des Zionismus, eine Heimstätte in Palästina zu errichten, dadurch nicht berührt sei, verursachte der Uganda-Vorschlag vehemente Opposition und sorgte für Aufruhr auf dem Kongress, vor allem unter den russischen Delegierten, die darin einen Verrat an Eretz Israel sahen. Erst im April 1904 konnte Herzl die Auseinandersetzungen um den Uganda-Plan beenden und die Einheit der zionistischen Bewegung wieder herstellen. Herzls Gesundheitszustand hatte sich im Frühjahr 1904 dramatisch verschlechtert. Sein Herzleiden war mittlerweile so weit fortgeschritten, dass er sich nicht mehr erholen konnte. Nach seiner Rückkehr nach Wien, fuhr er Anfang Juni mit einer Lungenentzündung in den Kurort Edlach, wo er schließlich am 3. Juli 1904 verstarb. Herzls Tod bedeutete für Viele mehr als nur Abschied von einem politischen Führer.
»Mit dem Tode Herzls haben wir den einzigen konkreten Juden verloren; das lebende Symbol unserer ehemaligen bodenfesten Vergangenheit, unserer schwankenden, weit abliegenden Zukunft. Wir haben ein herrliches lebendiges Symbol begraben müssen.«11
Isidor Eliaschoff fasste in Worte, was viele empfanden: Herzl war im Laufe der neun Jahre seiner Aktivität für die zionistische Sache zu einer Legende geworden, zum Symbol der jüdischen Erneuerung und der nationalen Unabhängigkeit.
Herzls Judenstaat ist eine programmatische Schrift, die die praktischen Schritte zur »Lösung der Judenfrage« aufzeigt. »Ich erfinde nichts, das wolle man sich vor allem und auf jedem Punkte meiner Ausführungen deutlich vor Augen halten«, betonte Herzl in der Vorrede, »ich erfinde weder die geschichtlich gewordenen Zustände der Juden noch die Mittel zur Abhilfe.«12 Es schien Herzl angebracht, sich deutlich gegen die »Behandlung als Utopie« abzugrenzen. Es wäre zwar keine Schande »eine menschenfreundliche Utopie geschrieben zu haben«, die Lage der Juden in verschiedenen Ländern sei jedoch arg genug, »um einleitende Tändeleien überflüssig zu machen«. »Um den Entwurf vor dem Verdacht der Utopie zu schützen«, wollte Herzl »auch sparsam sein mit malerischen Details der Schilderung«. Die »menschenfreundliche Utopie« sollte er noch vorlegen.
Seit 1898 schrieb Herzl an einem Roman, der schließlich 1902 unter dem Titel Altneuland veröffentlicht wurde und der die unterschiedlichen Aspekte von Herzls Persönlichkeit vereint, sein schriftstellerisches Talent, seine juristische Expertise, seine Technikbegeisterung und sein Interesse an den brennenden sozialen Fragen seiner Zeit. Altneuland wurde innerhalb der zionistischen Bewegung zunächst eher kritisch gesehen.13 Aber Herzl hielt unbeirrt an seinem Glauben über den Nutzen des Romans für die Bewegung fest und veranlasste, dass möglichst bald Übersetzungen erstellt wurden, etwa ins Englische, Jiddische und vor allem Hebräische, deren Titel zum Namensgeber für die erste jüdische Stadt, Tel Aviv, wurde.14 Bis heute ist das Motto von Altneuland, »Wenn ihr wollt ist es kein Märchen«, ein gängiges Schlagwort in Israels kollektivem Gedächtnis.15
Heute, 120 Jahre nach seinem Erscheinen, ist es ein erstaunliches Erlebnis, Altneuland zu lesen. Dies ist nicht der Ort, einen Vergleich zwischen Herzls Utopie und der Realität Israels anzustellen. Tatsache ist, dass Herzl bereits viele Probleme, mit denen sich der Staat Israel heute konfrontiert sieht, thematisierte. Politischer Extremismus, religiöser Fundamentalismus, vor allem aber Toleranz und Gleichberechtigung sind zentrale Fragen, die in Herzls „neuen Gesellschaft« verhandelt werden. Diese gleichberechtigte Gesellschaft seines utopischen Altneulands ist letztlich Herzls Antwort auf den Antisemitismus.
Herzl lässt sich jedoch nicht in die eine oder andere Schublade stecken. Versuche, ihn heute als Proto-Postzionisten16 anzuführen, sind genauso fehl am Platz, wie ihn als Verteidiger der angeblich wahren zionistischen Werte darzustellen, wie es von Seiten der Rechten geschieht17. Seine Vision kann jedoch weiterhin Inspiration sein, auch heute noch, denn Diskussionen um die Zukunft des Zionismus werden weiterhin geführt werden müssen.
Herzl kann nur im Kontext seiner Zeit verstanden werden; vor ihrem Hintergrund entwickelte er eine Vision, die weit über den Zeitgeist hinaus, die jüdische Gemeinschaft bis heute bewegt. In diesem Sinne kann man sich nur der Empfehlung des Jüdischen Volksblattes von 1902 in einer Rezension von Altneuland anschließen:
»Herzl schreibt schön, schreibt hinreißend schön.Will man ihn verstehen, soll man ihn lesen; die aufgewendete Zeit wird keiner bereuen.«18
Andrea Livnat
Tel Aviv, Oktober 2022
1 Die Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel, https://bit.ly/3VtUUgw
2 Tagebucheintrag vom 30. August 1897, in: Theodor Herzl, Gesammelte zionistische Werke. Berlin 1934, Band III, S. 23.
3 Tagebucheintrag, Pfingsten 1895, in: Herzl, Gesammelte zionistische Werke, Band II, S. 8.
4 Alfred Dreyfus, der seinerzeit der einzige Jude im französischen Generalstab war, wurde im Oktober 1894 der Spionage für Deutschland verdächtigt. In einem geheimen Militärgerichtsverfahren wurde er für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Januar 1895 wurde Dreyfus in einer öffentlichen Zeremonie degradiert. Die Pariser Öffentlichkeit begleitete die Zeremonie mit antisemitischen Ausbrüchen gegen Dreyfus und die Juden, »Tod dem Juden«-Rufe hallten durch die Stadt.Dreyfus beteuerte fortwährend seine Unschuld, wurde jedoch verbannt. Drei Jahre später, weitere Ermittlungen waren in der Zwischenzeit getätigt und wieder eingestellt worden, erreichte die Affäre einen neuen Höhepunkt, als der Schriftsteller Emile Zola seinen berühmten offenen Brief »J’accuse« veröffentlichte. Im Sommer 1898 wurde der Fall schließlich neu aufgerollt und das Urteil annulliert. In einem zweiten Prozess wurde Dreyfus erneut schuldig gesprochen, zu zehn Jahren Haft verurteilt, wovon er fünf bereits hinter sich hatte und schließlich begnadigt wurde. 1906 wurde er schließlich rehabilitiert und später befördert. Die Affäre zog eine der tiefsten innenpolitischen Krisen des Landes nach sich.
5 Tagebucheintrag vom 17. Juni 1896, in: Herzl, Gesammelte zionistische Werke, Band II, S. 421 f.
6Die Welt, I. Jahrgang, Nr. 1, 4. Juni 1897, S. 1.
7 Herzl wollte den Kongress eigentlich in München abhalten, scheiterte jedoch am Widerstand der dortigen jüdischen Gemeinde, siehe: Michael Brenner, Warum München nicht zur Hauptstadt des Zionismus wurde – Jüdische Religion in der ersten zionistischen Generation, in: Michael Brenner/Yfaat Weiss (Hg.), Zionistische Utopie - israelische Realität. Religion und Nation in Israel, München 1999.
8 Ben Ami: Erinnerungen an Theodor Herzl, in: Zionistisches Zentralorgan Die Welt. Herzlnummer, Bd. 18, Heft 27, 1914, S. 687.
9 Jacob Allerhand, Messianische Elemente im Denken und Wirken Theodor Herzls, in: Norbert Leser (Hrsg.), Theodor Herzl und das Wien des Fin de siècle, S. 71.
10 Ben Ami: Erinnerungen an Theodor Herzl, in: Zionistisches Zentralorgan Die Welt. Herzlnummer, Bd. 18, Heft 27, 1914, S. 692.
11 Isidor Eliaschoff, So sehe ich ihn..., in: Ost und West (Illustrierte Monatsschrift für Modernes Judentum) Herzl-Nummer. August-September 1904, S. 552.
12 Theodor Herzl, Der Judenstaat, http://www.zionismus.info/judenstaat/01.htm
13 Siehe Julius H. Schoeps: Theodor Herzl 1860–1904.Wenn Ihr wollt, Ist es kein Märchen. Eine Text-Bild-Monographie.Wien 1995, S. 157.
14 Der Übersetzer Nahum Sokolow wählte als Titel den poetischen, aus der Bibel, Ezekiel 3:15, entnommenen Begriff »Tel Aviv« (Hebr. für Frühlingshügel) anstatt einer wortgetreuen Übersetzung. Siehe: Michael Brenner, Geschichte des Zionismus. München 2002, S. 22.
15 Andrea Livnat, Der Prophet des Staates. Theodor Herzl im kollektiven Gedächtnis des Staates Israel. Frankfurt a.M. 2011, S. 286f.
16 Z.B. bei Tom Segev, Elvis in Jerusalem. Die moderne israelische Gesellschaft, Berlin 2003.
17 Z.B. bei Yoram Hazony, The Jewish State. The Struggle for Israels Soul, New York 2000.
18Jüdisches Volksblatt, Beilage zu Nr. 46, 5.12.1902.
Erstes Buch: Ein gebildeter und verzweifelter junger Mann
Erstes Kapitel
Dr. Friedrich Löwenberg saß in tiefer Melancholie an dem runden Marmortische seines Kaffeehauses. Es war eines der alten gemütlichen Wiener Cafés auf dem Alsergrunde. Er kam seit Jahren dahin, schon als Student. Mit der Regelmäßigkeit eines Bureaukraten pflegte er um die fünfte Nachmittagsstunde einzutreten. Der blasse, kranke Kellner begrüßte ihn ergebenst. Löwenberg machte eine höfliche Verbeugung vor der ebenfalls blassen Kassiererin, mit der er nie sprach. Dann setzte er sich an den runden Lesetisch, trank seinen Kaffee, las alle Zeitungen durch, die ihm der Kellner beflissen brachte. Und wenn er mit den Tages- und Wochenzeitungen, Witzblättern und Fachjournalen fertig war, was nie weniger als anderthalb Stunden in Anspruch nahm, kamen die Gespräche mit Freunden oder die einsamen Träume.
Das heißt: ehemals waren es Plaudereien gewesen, jetzt waren es nur noch Träumereien, denn die zwei guten Gesellen, die jahrelang mit ihm diese eigentümlich leeren und charmanten Abendstunden im Café Birkenreis verbracht hatten, sie waren beide in den letzten Monaten verstorben. Beide waren älter gewesen als er, und es war wie der eine, Heinrich, in seinem Abschiedsbrief an Löwenberg schrieb, bevor er sich eine Revolverkugel in die Schläfe schoß: »es war sozusagen chronologisch begreiflich, daß sie früher verzweifeln als er«. Der andere, Oswald, war nach Brasilien gezogen, um für eine Ansiedlung jüdischer Proletarier tätig zu sein, und dort war er unlängst dem gelben Fieber erlegen.
So kam es, daß Friedrich Löwenberg seit einigen Monaten einsam an dem alten Tische saß und, wenn er sich durch den Zeitungshaufen durchgeschlagen hatte, vor sich hinträumte, ohne eine Ansprache zu suchen. Er war zu müde, neue Bekanntschaften zu schließen, als wäre er nicht dreiundzwanzig Jahre alt, sondern ein Greis gewesen, der schon zu oft hatte von lieben Leuten Abschied nehmen müssen. Da saß er und starrte in den leichten Dunst hinein, der die ferneren Winkel des Saales verschleierte.
Um den Billardtisch standen mit langen Stöcken und kühnen Stoßgeberden einige junge Leute. Die waren nicht unvergnügt, obwohl sie sich in ähnlicher Lage befanden, wie er: es waren angehende Ärzte, neugebackene Doktoren der Rechte, absolvierte Techniker. Die höheren Studien hatten sie vollendet, und zu tun gab es nichts. Die meisten waren Juden und pflegten zu klagen, wenn sie nicht gerade Billard oder Karten spielten, wie schwer es »in dieser Zeit« sei, das Fortkommen zu finden. Einstweilen vertrieben sie sich diese Zeit mit endlosen Spielpartien. Löwenberg bedauerte und beneidete zugleich diese Gedankenlosen. Sie waren eigentlich nur bessere Proletarier, Opfer einer Anschauungsweise, die vor zwanzig oder dreißig Jahren in den mittleren Schichten der Judenschaft geherrscht hatte. Die Söhne sollten etwas anderes werden, als die Väter gewesen. Los vom Handel, von den Geschäften. Da hatte ein Massenauszug des Nachwuchses nach den »gebildeten« Berufen stattgefunden.
Das Ende war ein jammervoller Überfluss an studierten Leuten, die keine Beschäftigung fanden, zu bescheidener Lebensführung nicht mehr taugten, in Ämtern nicht unterschlüpfen konnten, wie ihre christlichen Kollegen, und sozusagen auf dem Markte lagen. Dabei hatten sie Standespflichten, ein kümmerlich hochmütiges Standesbewusstsein und recht mittellose Titel. Die einiges Vermögen besaßen, konnten es langsam aufzehren, oder sie lebten aus der väterlichen Tasche weiter.
Andere lauerten auf die »gute Partie«, mit der hübschen Aussicht, Eheknecht im Solde eines Schwiegervaters zu werden. Die dritten unternahmen eine rücksichtslose und nicht immer reinliche Konkurrenz in Berufen, welche eine vornehmere Lebenshaltung erforderten. So daß man das wunderliche und traurige Schauspiel hatte, sie, die nicht einfache Kaufleute sein wollten, als »Akademiker« Geschäfte machen zu sehen: Geschäfte mit geheimen Krankheiten oder unerlaubten Prozessen. Manche wurden aus Not Journalisten und handelten mit öffentlicher Meinung. Noch andere tummelten sich in Volksversammlungen herum, hausierten mit wertlosen Schlagworten, um bekannt zu werden und parteiliche Beziehungen zu ergattern, die später Nutzen bringen mochten.
Keinen dieser Wege wollte Löwenberg gehen.
»Du taugst nicht fürs Leben«, hatte der arme Oswald ihm vor der Abreise nach Brasilien in grimmiger Laune gesagt, »denn du ekelst dich vor zu vielen Dingen. Man muss was hinunterschlucken können, zum Beispiel Ungeziefer, Unrat. Davon wird man dick und kräftig, und man bringt es zu etwas. Aber du, du bist nichts als ein feiner Esel. Geh’ in ein Kloster, Ophelia!... Daß du ein anständiger Mensch bist, wird dir niemand glauben, weil du ein Jud’ bist... also was? Du wirst mit den paar Groschen Erbteil früher als mit deiner Rechtspraxis fertig werden. Dann wirst du doch etwas anfangen müssen, wovor du dich ekelst — oder dich aufhängen. Ich bitte dich, kauf dir einen Strick, solange du noch einen Gulden hast. Auf mich kannst du nicht rechnen. Erstens werde ich nicht hier sein, zweitens bin ich dein Freund.« Oswald hatte ihn bereden wollen, mit nach Brasilien zu gehen. Friedrich Löwenberg aber konnte sich dazu nicht entschließen. Den heimlichsten Grund seiner Weigerung nannte er freilich dem Freunde nicht, der damals hinauszog, um auf fremder Erde früh den Tod zu finden. Es war ein blonder, schwärmerischer Grund, ein äußerst süßes Geschöpf. Nicht einmal den beiden vertrauten Freunden wagte er von Ernestinen zu sprechen. Er fürchtete die Scherze über sein zartestes Gefühl. Und nun waren die beiden Guten nicht mehr da. Er konnte sie nicht mehr, auch wenn er wollte, um ihren Rat und ihre Teilnahme bitten. Denn es war eine schwere, schwere Sache. Er wollte sich vorstellen, waswohl die beiden dazu gesagt hätten, wenn sie nicht von ihm gegangen wären, sondern noch dasäßen auf ihren alten Plätzen an dem runden Lesetische. Er schloss die Augen ein wenig und träumte das Gespräch.
»Meine Freunde, ich bin verliebt — nein, ich liebe...«
»Armer Kerl!« würde Heinrich sagen.
Oswald aber: »Eine solche Dummheit sieht dir ganz ähnlich, lieber Friedrich.«
»Es ist mehr als eine Dummheit, meine lieben Freunde, es ist schon ausgewachsener Wahnsinn. Denn Herr Löffler, ihr Vater, wird michwahrscheinlich auslachen, wenn ich ihn um die Hand Ernestinens bitte. Ich bin nichts als ein Advokaturskandidat mit vierzig Gulden Monatsgehalt. Ich habe nichts, gar nichts mehr. Die letzten Monate waren mein Ruin. Die wenigen hundert Gulden, die noch von meinem Erbe übrig waren, sind aufgezehrt. Ich weiß ja, daß es ein Unsinn war, mich so von allem zu entblößen. Aber ich wollte in ihrer Nähe sein, ihre Anmut sehen, ihre holde Stimme hören. Da musste ich im Sommer den Kurort besuchen, wo sie war, und nun Theater, Konzerte. Ich mußte mich auch gut kleiden, um in ihre Gesellschaften zu kommen. Und jetzt habe ich nichts mehr und liebe sie noch immer so, nein, mehr als je.«
»Und was willst du tun?« würde Heinrich fragen.
»Ich will ihr sagen, daß ich sie liebe, und will sie bitten, ein paar Jahre auf mich zu warten, bis ich mir eine Existenz geschaffen habe.«
Da hörte er im Traume Oswalds höhnisches Lachen: »Jawohl, lass warten! So unvernünftig ist Ernestine Löffler nicht, daß sie auf einen Hungerleider warten wird, bis sie verblüht ist. Hahaha!«
Aber das Lachen erscholl wirklich neben Friedrich Löwenberg, und er öffnete bestürzt die Augen, Herr Schiffmann, ein junger Bankbeamter, den Friedrich im Löfflerschen Hause kennengelernt hatte, stand vor ihm und lachte herzlich: »Scheinen gestern spät ins Bett gegangen zu sein, Herr Doktor, daß Sie jetzt schon schläfrig sind.«
»Ich habe nicht geschlafen«, sagte Friedrich verlegen.
»Na, heute wird es auch lange dauern. Sie gehen doch zu Löfflers?«
Herr Schiffmann setzte sich ungezwungen an den Lesetisch.
Friedrich konnte den Burschen nicht sonderlich leiden. Dennoch ließ er sich seine Gesellschaft gefallen, weil er mit ihm von Ernestinen reden durfte und öfters durch ihn erfuhr, in welches Theater Ernestine gehen werde. Herr Schiffmann hatte nämlich feine Beziehungen zu Theaterkassierern und verschaffte Sperrsitze selbst zu den unzugänglichsten Vorstellungen.
Friedrich sagte: »Ja, ich bin heute auch zu Löfflers eingeladen.«
Herr Schiffmann hatte eine Zeitung in die Hand genommen und rief aus: »Das ist doch sonderbar!«
»Was denn?«
»Diese Annonce!«
»Ah, Sie lesen auch die Annoncen?« sagte Friedrich, ironisch lächelnd.
»Wie heißt: auch?« erwiderte Schiffmann. »Ich lese hauptsächlich die Annoncen. Die sind das Interessanteste in der Zeitung — vom Börsenbericht abgesehen.«
»So? Ich habe den Börsenbericht noch nie gelesen.«
»Nun ja, Sie! ... Aber ich ich brauche nur einen Blick auf den Kurszettel, so sag’ ich Ihnen die ganze europäische Lage. Dann kommen aber gleich die Annoncen. Sie haben keine Ahnung, was da alles drin steht. Das ist, wie wenn ich auf einen Markt geh’. Da gibt es eine Menge Sachen und Menschen zu verkaufen. Das heißt: zu verkaufen ist ja eigentlich alles in der Welt — nur der Preis ist nicht immer zu erschwingen... Wenn ich da hereinschau’ in den Inseratenteil, erfahr’ ich immer, was es für Gelegenheiten gibt. Alles soll man wissen, nichts soll man brauchen... Aber da seh’ ich schon seit ein paar Tagen eine Annonce, die ich nicht versteh’.«
»Ist sie in einer fremden Sprache?«
»Da sehen Sie her, Doktor!« Schiffmann hielt ihm das Blatt hin und deutete auf eine kleine Anzeige, die so lautete:
»Gesucht wird ein gebildeter und verzweifelter junger Mann, der bereit ist, mit seinem Leben ein letztes Experiment zu machen. Anträge unter N. O. Body an die Expedition.«
»Ja, Sie haben recht«, sagte Friedrich, »das ist ein merkwürdiges Inserat. Ein gebildeter und verzweifelter junger Mann! Solche sind vielleicht zu finden. Aber der Nachsatz macht die Sache schwerer. Wie verzweifelt muß einer sein, wenn er mit seinem Leben ein letztes Experiment wagen soll.«
»Er scheint ihn auch nicht gefunden zu haben, der Herr Body. Ich seh’ die Annonce immer wieder. Wissen möcht’ ich aber doch, wer dieser Body mit dem sonderbaren Geschmack ist.«
»Das ist niemand.«
»Wie heißt niemand?«
»N. O. Body — nobody. Niemand auf Englisch.«
»Ah, so... Ans Englische hab’ ich nicht gedacht. Alles soll man wissen, nichts soll man brauchen ... Aber es wird Zeit, wenn wir nicht zu spät zu Löfflers kommen wollen. Grad’ heute muß man pünktlich sein.«
»Warum gerade heute?« fragte Löwenberg.
»Bedaure, kann ich nicht sagen. Bei mir ist Diskretion Ehrensache ... Aber Sie können sich auf eine Überraschung gefasst machen ... Kellner, zahlen!«
Eine Überraschung? Friedrich empfand plötzlich eine unbestimmte Angst.
Als er mit Schiffmann das Kaffeehaus verließ, bemerkte er einen Knaben von etwa zehn Jahren außen in der Türnische. Der Junge hatte in seinem dünnen Röckchen die Schultern hoch hinaufgezogen, die Arme verschränkt an den Leib geklemmt, und er stampfte mit den Füßen den leicht herangewehten Schnee dieses geschützten Winkels. Das Hüpfen nahm sich beinahe possierlich aus. Aber Friedrich sah, daß das arme Kind in den zerrissenen Schuhen bitterlich fror. Er griff in die Tasche, suchte beim Scheine der nächsten Laterne drei Kupferkreuzer aus dem Kleingelde hervor und gab sie dem Knaben. Dieser nahm sie, sagte leise mit fröstelnder Stimme »Dank!« und lief schnell davon.
»Was? Sie unterstützen den Straßenbettel?« sagte Schiffmann indigniert.
»Ich glaube nicht, daß dieser Kleine sich zum Vergnügen im Dezemberschnee herumtreibt... Mir scheint auch, es war ein Judenjunge.«
»Dann soll er sich an die Kultusgemeinde wenden oder an die israelitische Allianz und nicht am Abend bei Kaffeehäusern herumstehen!«
»Regen Sie sich nicht auf, Herr Schiffmann, Sie haben ihm doch nichts gegeben.«
»Mein lieber Doktor«, sagte Schiffmann bestimmt, »ich bin Mitglied des Vereines gegen Verarmung und Bettelei. Jahresbeitrag ein Gulden.«
Zweites Kapitel
Die Familie Löffler wohnte im zweiten Stock eines großen Zinshauses in der Gonzagagasse. Im Erdgeschosse befand sich die Tuchniederlage der Firma »Moriz Löffler und Komp.« Als Friedrich und Schiffmann in das Vorzimmer traten, bemerkten sie an der Menge der schon dahängenden Winterröcke und Mäntel, daß die Gesellschaft heute zahlreicher sein mußte als gewöhnlich. »Ein ganzes Kleidergeschäft«, meinte Schiffmann.
Im Salon waren einige Leute, die Friedrich schon kannte. Fremd war ihm aber der kahlköpfige Herr, der neben Ernestinen am Klavier stand und ihr ganz vertraulich zulächelte. Das junge Mädchen streckte dem Ankömmling liebenswürdig die Hand entgegen: »Herr Doktor Löwenberg, lassen Sie sich vorstellen. Das ist Herr Leopold Weinberger.«
»Mitchef der Firma Samuel Weinberger und Söhne in Brünn«, ergänzte Papa Löffler nicht ohne Feierlichkeit und Wohlwollen. Die beiden Herren reichten einander erfreut die Hände, und Friedrich nahm bei dieser Gelegenheit wahr, daß Herr Weinberger, der Mitchef der Brünner Firma, beträchtlich schielte und eine sehr feuchte Handfläche hatte.
Das mißfiel Friedrich nicht, weil es den ersten, blitzartigen Gedanken verscheuchte, von dem er bei seinem Eintritte befallen worden war. Ernestine mit einem solchen Menschen — das war einfach unmöglich. Wie sie jetzt dastand, schlank, anmutig, das holde Haupt lieblich geneigt, entzückte sie seine Augen. Er mußte sich aber ein wenig zurückziehen, denn andere Gäste kamen und wurden begrüßt. Nur Herr Leopold Weinberger aus Brünn behauptete sich einigermaßen zudringlich an Ernestinens Seite. Friedrich erkundigte sich bei Schiffmann. »Dieser Herr Weinberger ist wohl ein alter Bekannter des Hauses?«
»Nein«, sagte Schiffmann, »sie kennen ihn erst seit vierzehn Tagen, aber es ist eine feine Tuchfirma.«
»Was ist fein, Herr Schiffmann, das Tuch oder die Firma?« fragte Friedrich belustigt und getröstet. Denn ein Mensch, den man erst seit vierzehn Tagen kannte, war doch sicherlich kein Bräutigam.
»Beides«, erwiderte Schiffmann. »Samuel Weinberger und Söhne kriegen so viel Geld wie sie wollen — für vier Percent. Hochprima... Überhaupt geht es heute hier nobel zu. Sehen Sie: der Magere dort mit den Glotzaugen, das ist Schlesinger, der Prokurist von Baron Goldstein. Er ist ein zuwiderer Mensch, aber sehr beliebt.«
»Warum?«
»Wie heißt, warum? Weil er der Prokurist von Baron Goldstein ist... Kennen Sie den mit dem grauen Backenbart? Auch nicht? Ja, von wo kommen Sie denn? Das ist der Großspekulant Laschner, einer der bedeutendsten Börsianer. Der spielt Ihnen mit ein paar tausend Effekten wie gar nichts. Jetzt ist er gerade sehr reich. Mir gesagt! Ob er nächstes Jahr noch etwas haben wird, weiß ich nicht. Heute hat seine Gemahlin die größten Brillantenboutons... die anderen sind ihr auch alle darauf neidig.«
Frau Laschner saß in einer Ecke des Salons mit mehreren ebenfalls stark geputzten Damen, und sie sprachen leidenschaftlich von Hüten. Die übrigen Gruppen waren noch in der kühlen Stimmung vor dem Nachtmahl. Auch schienen einige von der bevorstehenden Überraschung unterrichtet zu sein, die Schiffmann im Kaffeehaus angedeutet hatte. Sie machten diskrete Mienen und flüsterten miteinander.
Friedrich fühlte sich unbehaglich, ohne recht zu wissen warum. In dieser Gesellschaft spielte er nächst Schiffmann die unbedeutendste Rolle. Sonst hatte er das nie bemerkt, weil Ernestine mit ihm zu bleiben pflegte, wenn er kam. Aber heute wandte sie keinen Blick und kein Wort an ihn. Herr Weinberger aus Brünn mußte ein sehr anregender Plauderer sein. Noch etwas empfand Friedrich als Demütigung des Schicksals. Er und Schiffmann waren die einzigen, die nicht im Frack oder Smoking erschienen waren, sondern im Salonrock. Dadurch waren sie auch äußerlich als die Parias des Abends gekennzeichnet. Am liebsten wäre er weggegangen, aber dazu fand er nicht den Mut.
Der große Salon war schon überfüllt. Man schien aber noch jemanden zu erwarten. Friedrich wandte sich mit einer Frage an seinen Elendsgenossen. Schiffmann wußte es auch wirklich, denn er hatte soeben eine Bemerkung der Hausfrau erlauscht: »Man wartet nur noch auf Grün und Blau.«
»Wer ist das?« fragte Friedrich.
»Was? Sie kennen Grün und Blau nicht? Die zwei geistreichsten Menschen von Wien? Es gibt doch keine Gesellschaft, keine Hochzeit, keinen Polterabend, oder was immer, ohne Grün und Blau. Manche sagen. Grün ist der Geistreichere; manche sagen, Blau. Grün ist mehr auf Wortspiele eingerichtet, Blau macht sich mehr über die Leute lustig. Blau hat darum auch schon mehr Pätsch’ bekommen, aber das geniert ihn nicht. Er hat das richtige Gesicht dafür. Seine Wangen werden nicht rot, wenn man sie ohrfeigt... In den besseren jüdischen Kreisen sind die zwei Herren sehr beliebt. Nur kann einer den anderen nicht ausstehen — natürlich, sie sind ja Konkurrenten.«
Eine kleine Bewegung im Salon. Herr Grün war eingetreten, ein langer hagerer Mensch mit rötlichem Bart und auffallend weit vom Kopf abstehenden Ohren, die Herr Blau die »uneingesäumten Ohren« nannte, weil ihr oberer Rand nicht der Muschel zu gefaltet war, sondern flach auslag.
Ernestinens Mutter ging dem berühmten Witzbold mit einem liebenswürdigen Vorwurf entgegen: »Warum kommen Sie erst jetzt, Herr Grün?«
»Ich hab’ nicht später kommen können«, antwortete er humoristisch. Die es hörten, lächelten dankbar. Doch über die Züge des Humoristen flog ein Schatten: Blau war erschienen.
Herr Blau, ein mittelgroßer Mann von etwa dreißig Jahren, hatte ein glattrasiertes Gesicht, und auf der stark gebogenen Nase saß ihm ein Kneifer. »Ich war im Wiedener Theater«, sagte er, »bei der Première. Nach dem ersten Akt bin ich weggegangen.«
Die Mitteilung erregte Interesse. Damen und Herren scharten sich um Blau, der weiter berichtete: »Der erste Akt ist zum allgemeinen Erstaunen nicht durchgefallen.«
Frau Laschner rief ihrem Gatten herrisch zu: »Moriz, ich will morgen dazu gehen.«
Blau fuhr fort: »Die Freunde der Librettisten haben sich ausgezeichnet unterhalten.«
»So gut ist die Operette?« fragte Schlesinger, der Prokurist des Baron Goldstein.
»Nein — so schlecht!« erklärte Blau. »Die Freunde der Verfasser unterhalten sich doch nur, wenn das Stück schlecht ist.«
Man ging zu Tisch. Der große Speisesaal war noch zu klein für die heutige Gesellschaft. Man saß dicht gedrängt, Ernestine neben Herrn Weinberger. Friedrich und Schiffmann hatten am untersten Ende der Tafel Platz nehmen müssen. Anfänglich gab es mehr Tellergeklapper und Klirren von Eßzeug als Gespräche. Herr Blau rief seinem Konkurrenten über den Tisch zu: »Grün — essen Sie nicht so laut! Man hört seinen eigenen Fisch nicht.«
»Sie sollten keinen Fisch essen, sondern Neidhammelkeule.«
Die Anhänger des Herrn Grün lachten über diesen Witz. Die Anhänger des Herrn Blau fanden ihn matt.
Aber die Aufmerksamkeit der Tafelrunde wurde von den beiden Witzbolden abgelenkt, als ein älterer Herr, der neben Frau Löffler saß, mit etwas lauterer Stimme sagte: »Bei uns in Mähren wird die Lage auch schlecht. In den kleineren Landstädten sind die Leute wirklich in Gefahr. Sind die Deutschen schlecht aufgelegt, schlagen sie den Juden die Fenster ein. Sind die Tschechen schief gewickelt, brechen sie bei den Juden ein. Die armen Leute fangen an auszuwandern. Aber sie wissen nicht, wohin sie sollen.«
»Moriz!« schrie in diesem Augenblick Frau Laschner, »ich will übermorgen ins Burgtheater.«
»Gib jetzt Ruh!« antwortete der Börsenmann. »Doktor Weiß erzählt uns, wie es bei ihnen in Mähren aussieht. Auf Ehre nicht schön.«
Samuel Weinberger, der Vater des Herrn Leopold Weinberger, mischte sich ein: »Herr Doktor, Sie als Rabbiner sehen etwas zu schwarz.«
»Weiß sieht immer schwarz!« sagte einer der Spaßmacher, aber der Witz fiel ins Leere.
Samuel Weinberger fuhr fort: »Ich fühl’ mich in meiner Fabrik ganz sicher. Wenn man bei mir Spektakel macht, ruf ich die Polizei oder geh’ zum Platzkommando. Wenn das Gesindel nur die Bajonette sieht, hat es schon Respekt.«
»Das ist aber doch ein trauriger Zustand«, meinte Rabbiner Weiß mit Sanftmut.
Der Advokat Doktor Walter, der ursprünglich Veiglstock geheißen hatte, bemerkte: »Ich weiß nicht mehr, wer gesagt hat: Mit Bajonetten kann man alles machen; nur sich darauf setzen kann man nicht.«
»Ich seh’ schon«, rief Laschner, »wirwerden alle wieder den gelben Fleck tragen müssen.«
»Oder auswandern«, sagte der Rabbiner.
»Ich bitte Sie, wohin?« fragte Walter. »Ist es vielleicht anderswo besser? Sogar im freien Frankreich haben die Antisemiten die Oberhand.«
Doktor Weiß aber, der arme Rabbiner einer mährischen Kleinstadt, der entschieden nicht wusste, in welchen Kreis er da geraten war, wagte eine schüchterne Einwendung: »Es gibt seit einigen Jahren eine Bewegung, man nennt sie die zionistische. Die will die Judenfrage durch eine großartige Kolonisation lösen. Es sollen alle, die es nicht mehr aushalten können, in unsere alte Heimat, nach Palästina gehen.«
Er hatte ganz ruhig gesprochen und nicht wahrgenommen, wie die Gesichter um ihn her sich allmählich zum Lächeln verzogen, und er war daher ordentlich verdutzt, als das Gelächter beim Worte Palästina plötzlich losbrach. Es war ein Lachen in allen Tonarten. Die Damen kicherten, die Herren brüllten und wieherten. Nur Friedrich Löwenberg fand diesen Heiterkeitsausbruch brutal und ungeziemend gegen den alten Mann.
Blau benützte die erste Pause im allgemeinen Gelächter, um zu erklären: »Wenn es in der neuen Operette einen einzigen solchen Witz gegeben hätte, wär’ uns wohl gewesen.«
Grün schrie: »Ich werde Botschafter in Wien.«
Erneutes Gelächter. Einige riefen dazwischen: »Ich auch, ich auch.«
Da sagte Blau ernst: »Meine Herren, alle können es nicht werden. Ich glaube, die österreichische Regierung wird so viele jüdische Botschafter nicht annehmen. Sie müssen sich um andere Posten umsehen.«
Der alte Rabbiner war aber sehr verlegen und sah nicht mehr von seinem Teller auf, indessen die Humoristen Grün und Blau sich mit einer wahren Lust auf den spaßigen Stoff warfen. Sie teilten das neue Reich ein, schilderten die Zustände. Am Schabbes wird die Börse geschlossen sein. Der König wird den Männern, die sich um das Vaterland oder um die Börse herum Verdienste erworben haben, den Davidsorden oder den Orden vom »fleischigen Schwert« verleihen. Wer aber soll König sein?
»Jedenfalls Baron Goldstein«, sagte der Witzbold Blau.
Herr Schlesinger, der Prokurist dieses berühmten Bankiers, bemerkte unwillig: »Ich bitte, die Person des Herrn Baron von Goldstein nicht in die Debatte zu ziehen, wenigstens nicht in meiner Gegenwart.«
Fast alle Anwesenden gaben ihm durch Kopfnicken ihre Zustimmung zu erkennen. Der witzige Herr Blau beging wirklich manchmal Taktlosigkeiten. Die Person des Herrn Baron Goldstein in die Debatte zu ziehen, das ging denn doch ein bisschen zu weit.
Herr Blau aber fuhr fort: »Justizminister wird Herr Doktor Walter. Er bekommt den Adelsstand mit dem Prädikate ›von Veiglstock‹. Walter Edler von Veiglstock.«
Man lachte. Der Advokat errötete über seinen Vatersnamen und rief dem Witzling zu: »Sie haben schon lang keine fremde Hand in Ihrem Gesicht gespürt.«
Grün, der Wortwitzige, aber Vorsichtigere, flüsterte seiner Nachbarin eine Silbenkombination zu, in der das Wort Ohrfeiglstock vorkam.
Frau Laschner erkundigte sich: »Wird es Theater auch geben in Palästina? Sonst geh’ ich nicht hin.«
»Gewiß, gnädige Frau«, sagte Grün. »Bei den Festvorstellungen im Hoftheater von Jerusalem wird die ganze Israelite versammelt sein.«
Der Rabbiner Weiß meinte nun schüchtern: »Über wen machen Sie sich lustig, meine Herren? Über sich selbst?«
»Nein, ernst werden wir uns nehmen!« sagte Blau.
»Ich bin stolz, daß ich ein Jud’ bin«, erklärte Laschner, »denn wenn ich nicht wär’ stolz, wär’ ich doch auch ein Jud’. Also bin ich lieber gleich stolz.«
In diesem Augenblick gingen die beiden Stubenmädchen hinaus, eine andere Schüssel zu holen. Die Hausfrau bemerkte: »Wenn die Dienstboten dabei sind, sollte man lieber nicht über jüdische Sachen reden.«
Blau erwiderte sofort: »Entschuldigen, gnädige Frau, ich hab’ nicht gewußt, daß Ihre Dienstboten nicht wissen, daß Sie Juden sind.«
Einige lachten.
»Nun ja«, sagte Schlesinger mit Autorität; »aber man muß es doch nicht an die große Glocke hängen.«
Champagner wurde hereingebracht. Schiffmann stieß seinen Nachbar Löwenberg mit dem Ellbogen: »Jetzt wird’s losgehen!«
»Was wird losgehen?« fragte Friedrich.
»Haben Sie’s denn noch immer nicht heraus?«
Nein, Friedrich hatte es noch immer nicht erraten. Aber im nächsten Augenblick wurde ihm die Gewißheit.
Herr Löffler klopfte mit dem Messer an sein Glas und erhob sich. Stille trat ein. Die Damen lehnten sich zurück. Der Humorist Blau schob noch schnell einen Bissen in den Mund, er kaute, während Papa Löffler sprach: »Meine hochverehrten Freunde! Ich bin in der angenehmen Lage, Ihnen eine freudige Mitteilung zu machen. Meine Tochter Ernestine hat sich mit Herrn Leopold Weinberger aus Brünn, Mitchef der Firma Samuel Weinberger und Söhne, verlobt. Das Brautpaar soll leben. Hoch!«
Hoch! Hoch! Hoch! Alle hatten sich erhoben. Die Gläser klangen. Dann ging man um den Tisch herum, zu den Eltern, zum Brautpaare, Glück wünschend. Auch Friedrich Löwenberg machte diesen Weg mit, obwohl er eine Wolke vor den Augen hatte. Eine Sekunde lang war er vor Ernestine gestanden und hatte mit zitternder Hand sein Glas dem ihrigen genähert. Sie sah flüchtig über ihn hinweg.
Dann war die Stimmung an der Tafel fröhlich geworden. Ein Trinkspruch folgte dem anderen. Schlesinger hielt eine würdevolle Rede. Grün und Blau zeigten sich auf der Höhe ihrer humoristischen Aufgabe, Grün verrenkte in seinem Toast noch mehr Silben als gewöhnlich, und Blau machte allerlei taktlose Anspielungen. Die Gesellschaft geriet in die beste Laune.
Friedrich hörte das alles nur undeutlich, wie aus der Ferne, und es war ihm zumute, als befände er sich in einem dichten Nebel, in dem man nichts sieht und schwer Atem holen kann.
Das Mahl ging zu Ende. Friedrich hatte den einzigen Gedanken, fortzukommen, weit weg von all diesen Leuten. Er kam sich überflüssig vor in diesem Zimmer, in dieser Stadt, in der Welt überhaupt. Aber als er sich in dem kleinen Gedränge nach der Tafel unauffällig hinausdrücken wollte, kam ihm Ernestine in den Weg. Lieblich war ihre Stimme, als sie ihn anhielt: »Sie haben mir noch nichts gesagt, Herr Doktor!«
»Was soll ich Ihnen sagen, Fräulein Ernestine? ... Ich wünsch’ Ihnen Glück. Ja, ja — ich wünsche Ihnen viel Glück zu dieser Verlobung.«
Aber da war schon der Bräutigam wieder neben ihr, legte den Arm mit der Sicherheit des Besitzers um ihre Taille und zog sie fort. Sie lächelte.
Drittes Kapitel
Als Friedrich Löwenberg in die Winternachtluft hinaustrat, legte er sich die Frage vor, was das Widerlichere gewesen sei: die Besitzergebärde des Herrn Weinberger aus Brünn, oder das Lächeln des jungen Mädchens, das er bisher so bezaubernd gefunden hatte. Wie? Seit vierzehn Tagen erst kannte der »Mitchef« die Holde, und er durfte seine schwitzende Hand auf ihren Leib legen. Welch ein ekelhafter Handel. Es war der Zusammenbruch einer feinen Illusion. Der Mitchef hatte offenbar Geld, und Friedrich hatte keines. In diesem Kreise, wo man nur für Vergnügen und Vorteil Sinn hatte, war Geld alles. Und doch war er auf diesen Kreis der jüdischen Bourgeoisie angewiesen. Mit diesen Leuten und leider auch von diesen Leuten mußte er leben, denn sie stellten die Klientel einer zukünftigen Advokatenpraxis vor.
Wenn es hoch kam, wurde man Rechtsbeistand eines Mannes wie Laschner — von dem phantastischen Glücksfalle, daß man einen Kunden wie Baron Goldstein bekam, gar nicht zu träumen. Die christliche Gesellschaft und eine christliche Klientel gehörten zum Unzugänglichsten in der Welt.Also was? Entweder sich dem Löfflerschen Kreise einfügen, dessen niederes Lebensideal teilen, die Interessen zweifelhafter Geldmenschen vertreten und zum Lohne für solche brave Aufführung nach so und so viel Jahren auch eine Kanzlei besitzen, mit dem Anspruch auf die Hand und Mitgift eines Mädchens, das nach vierzehntägiger Bekanntschaft den Erstbesten heiratet. Oder, wenn einem das alles zu ekelhaft war, die Einsamkeit und Armut.
Er war in solchen Gedanken wieder vor dem Café Birkenreis angelangt. Was sollte er auch jetzt schon zu Hause in seinem engen, Stübchen anfangen? Es war zehn Uhr. Schlafen gehen? Ja, wenn es kein Erwachen mehr gäbe...
Vor der Tür des Kaffeehauses wäre er beinahe über einen kleinen Körper gestolpert. Auf der Stufe des Einganges hockte ein Knabe, Friedrich erkannte ihn: es war derselbe Junge, den er vor wenigen Stunden beschenkt hatte. Barsch ließ er ihn an: »Was? Du bettelst da schon wieder?«
Der Knabe erwiderte mit fröstelnder Stimme: »Ich wart’ auf mein Taten.« Dann stand er auf und hüpfte wieder und schlug die Arme übereinander, um sich zu erwärmen. Friedrich war so unglücklich, dass er für das frierende Kind kein Mitleid empfand.
Er trat in den qualmigen Raum ein und setzte sich auf seinen gewohnten Platz am Lesetisch. Um diese Stunde war das Kaffeehaus schwach besucht. Nur in den Winkeln einige verspätete Spieler, die sich voneinander nicht trennen konnten und immer wieder die letzten Runden ankündigten, an die sich die allerletzten und unwiderruflich letzten sowie die »Schuft mein Name« letzten anschlössen.
Eine Weile saß Friedrich und starrte vor sich hin, dann kam ein schwatzhafter Bekannter an den Tisch heran. Friedrich flüchtete sich hinter eine Zeitung und tat, als ob er lese. Aber wie er in das Blatt hineinsah, fiel sein Blick zufällig wieder auf die Anzeige, von der Schiffmann vor einigen Stunden gesprochen hatte:
»Gesucht wird ein gebildeter und verzweifelter junger Mann, der bereit ist, mit seinem Leben ein letztes Experiment zu machen. Anträge unter N. O. Body an die Expedition.«
Wie sonderbar. Jetzt passte die Anrufung auf ihn. Ein letztes Experiment! Das Leben war ihm ohnehin verleidet. Bevor er es wegwarf wie sein armer Freund Heinrich, konnte er immerhin noch etwas damit unternehmen. Er ließ sich vom Kellner einen Kartenbrief geben und schrieb an N. O. Body diese wenigen Worte:
»Ich bin Ihr Mann. Doktor Friedrich Löwenberg, IX. Hahngasse 67.«
Während er den Brief zuklebte, kam von hinten jemand an ihn heran: »Zahnbürsteln, Hosenträger, Hemdknöpf’ gefällig?« Friedrich scheuchte den zudringlichen Hausierer mit einem barschen Wort weg. Der zog sich seufzend zurück, mit einem ängstlichen Blick nach dem Kellner, der ihn vielleicht hinausweisen würde. Da bereute Friedrich, dass er den armen Menschen eingeschüchtert hatte, rief ihn zurück und warf ihm ein Zwanzighellerstück in das Hausiererkistchen.
Der Mann hielt ihm seinen Trödel hin: »Ich bin kein Bettler... Sie müssen etwas kaufen, sonst kann ich das Geld nicht behalten.« Um ihn loszuwerden, nahm Friedrich einen Hemdknopf aus dem Kästchen. Jetzt erst dankte der Mann und ging weg. Friedrich sah ihm gleichgültig nach, wie er zu dem Kellner trat und diesem das eben erhaltene Geldstück gab. Der Kellner holte aus einem Korb altgebackene Brote hervor und lieferte sie dem Hausierer aus, der sie hastig in seine Rocktasche stopfte.
Friedrich erhob sich, um wegzugehen. Als er vor der Tür des Kaffeehauses stand, sah er den frierenden Jungen wieder, diesmal mit dem Hausierer, der ihm die harten Brötchen übergab. Das war also der Vater des Knaben.
»Was macht Ihr da?« fragte Friedrich.
»Ich geb ihm die Kipfeln, gnädiger Herr«, sagte der Hausierer; »daß er sie soll zu Haus tragen zu mein’ Weib. Es ist heut’ mei’ erste Losung.«
»Ist das wahr?« forschte Friedrich.
»So soll es nicht wahr sein, wie es wahr ist«, sagte der Mann stöhnend. »Überall werfen sie mich heraus, wenn ich handeln will. Wenn man ein Jud is, soll man lieber gleich in die Donau gehen.«
Friedrich, der noch kurz vorher mit dem Leben abgeschlossen hatte, sah plötzlich eine Gelegenheit, sich zu betätigen, jemandem nützlich zu sein. Eine Ablenkung seiner Gedanken. Er steckte den Kartenbrief in einen Postkasten. Dann ging er mit den beiden weiter und ließ sich vom Hausierer erzählen: »Wir sind von Galizien hergekommen. In Krakau hab’ ich gewohnt in ein’ Zimmer mit noch drei Familien. Wir haben gelebt von der Luft. Hab’ ich mir gedacht, schlechter kann es nit mehr werden, und bin mit mei’Weib und meine Kinder hergekommen. Hier is es nit schlechter, aber auch nit besser.«
»Wieviel Kinder haben Sie?«
Der Hausierer begann im Gehen zu schluchzen: »Fünfe hab’ ich gehabt, drei sind mir gestorben, seit wir hier sind. Jetzt hab’ ich nur den da und das kleine Mädel, was noch an der Brust is... David, lauf nit so schnell.«
Der Knabe drehte sich um: »Die Mutter war so hungrig, wie ich ihr die drei Kreuzer von dem Herrn da gebracht hab’.«
»So? Sie waren der gute Herr?« sagte der Hausierer und haschte nach Friedrichs Hand, um sie zu küssen.
Friedrich zog die Hand rasch zurück: »Was fällt Ihnen denn ein?... Sag’ mein Junge, was hat deine Mutter mit den paar Kreuzern angefangen?«
»Milch hat sie geholt für Mirjam«, sagte der kleine David.