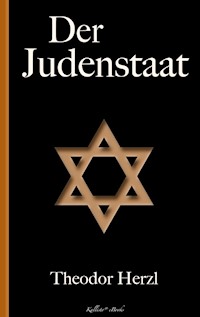Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hirnkost
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Wiederentdeckte Schätze der Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Der Judenstaat ist ein Weltbedürfnis, folglich wird er entstehen.« Theodor Herzl (1860–1904), Journalist, Dramatiker, Science-Fiction-Autor, Aktivist und Visionär, ist vor allem als der Mann in Erinnerung, der die politische Plattform schuf, auf der 44 Jahre nach seinem Tod der Staat Israel gegründet wurde. Nach langem Zögern entschloss er sich 1902, seiner politischen Utopie auch eine literarische Form zu geben. »Herzl erweckt vor unseren Augen die bisweilen glanzvolle, meist aber elende Welt der Juden um 1900 im Habsburger Reich zum Leben. Er schildert fast schon auf Dickens'sche Weise die soziale Not seiner Gegenwart, er wirft einen Blick in die nicht immer so glamouröse Wiener Kaffeehauskultur, und er lässt uns die Zwangslage der aufstrebenden jüdischen Bildungsschicht miterleben, die trotz Emanzipation und Assimilation in einer Sackgasse steckt und, gerade wo sie erfolgreich wird, mit latentem oder offenem Antisemitismus konfrontiert wird.« Karlheinz Steinmüller in seinem Vorwort
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Originalausgabe
© 2023 Hirnkost KG, Lahnstraße 25, 12055 Berlin;[email protected];
http://www.hirnkost.de/Alle Rechte vorbehalten, 1. Auflage April 2023
Die Erstauflage des RomansAltneulanderschien 1902 bei Herman Seemann Nachfolger, Leipzig. Nur im E-Book:Der Judenstaaterschien 1896 bei M. Breitenstein’s Verlags-Buchhandlung, Leipzig/Wien; die ErzählungenDas lenkbare Luftschiff(1896) undDer Unternehmer Buonaparte(1900) erschienen erstmals in Theodor Herzl:Philosophische Erzählungen, Gebrüder Paetel, Berlin 1900.
Vertrieb für den Buchhandel:
Runge Verlagsauslieferung;[email protected]
Privatkunden und Mailorder:
https://shop.hirnkost.de/
Herausgeber:Hans Frey
Lektorat:Klaus Farin
Korrektorat:Christian Winkelmann-Maggio
Layout: benSwerk
ISBN:
PRINT: 978-3-949452-43-7
PDF: 978-3-949452-45-1
EPUB: 978-3-949452-44-4
Hirnkost versteht sich als engagierter Verlag für engagierte Literatur.
Mehr Infos:www.hirnkost.de/der-engagierte-verlag
Dieses Buch erschien als Band V der Reihe »Wiederentdeckte Schätze der deutschsprachigen Science Fiction«. Alle Titel und weitere Informationen finden Sie hier:
https://shop.hirnkost.de/produkt/schaetze/
Theodor Herzl ·1860–1904
Theodor (Binyamin Ze’ev) Herzl war ein österreichischer Schriftsteller, Journalist und zionistischer Politiker. In Budapest geboren, orientierte sich Herzls Erziehung durch seine Mutter Jeanette Herzl an deutscher Kultur und Sprache, wie es für die meisten Jüdinnen und Juden im deutschen Sprachraum selbstverständlich war. Ab 1878 studierte er in Wien Jura und war für mehrere Jahre Mitglied der Studentenverbindung Albia, die er aber wegen antisemitischer Äußerungen anderer Verbindungsstudenten noch vor seiner Promotion im Jahre 1884 wieder verließ. 1889 heiratete er Julie Naschauer.
Von 1891 bis 1894 war Herzl Korrespondent der Wiener Neuen Freien Presse in Paris und berichtete von dort über die Dreyfus-Affäre. Unter dem Eindruck dieser Affäre und antisemitischer Ausschreitungen in Frankreich veröffentlichte er 1896 sein Werk Der Judenstaat, in dem er die These entwickelt, dass die Gründung eines eigenen jüdischen Staates notwendig und durchführbar sei. 1897 organisierte er mit Oskar Marmorek und Max Nordau den 1. Zionistischen Weltkongress in Basel und wurde zum Präsidenten der Zionistischen Weltorganisation gewählt. Das dort verabschiedete Basler Programm bildete die Grundlage für zahlreiche Verhandlungen (u. a. mit Kaiser Wilhelm II. und dem türkischen Sultan Abd ül-Hamid II.) mit dem Ziel, eine »Heimstätte des jüdischen Volkes« in Palästina zu schaffen. Ebenfalls im Jahre 1897 veröffentlichte Herzl das Theaterstück Das neue Ghetto und gründete in Wien Die Welt als monatlich erscheinende Informationsschrift der zionistischen Bewegung. 1899 gründete Herzl den ›Jewish Colonial Trust‹, dessen Aufgabe der Ankauf von Land in Palästina war, damals noch Teil des Osmanischen Reiches.
In seinem utopischen Roman Altneuland entwarf Herzl sein idealistisches Bild eines künftigen jüdischen Staates in Palästina. Er formulierte darin einen Entwurf für seine politische und gesellschaftliche Ordnung eines jüdischen Staates und vertrat auch die Auffassung, die in Palästina lebenden Araber würden die neuen jüdischen Siedler freudig begrüßen. Die Benennung der Stadt Tel Aviv (Frühlingshügel) wurde von Herzls Roman inspiriert.
benSwerk
geboren 1970, lebt in Berlin. Studierte Werbegrafik und freie Kunst. Wenn sie nicht für Hirnkost layoutet, porträtiert sie das kleine Volk und andere Wesenheiten der Anderswelt, ersinnt Orakelkarten oder gestaltet andere Bücher – mit Vorliebe in den Bereichen WeirdFiction oder Phantastik.www.benswerk.com
Klaus Farin
geboren 1958 in Gelsenkirchen, lebt seit 1980 – Punk sei Dank – in Berlin-Neukölln. Nach Tätigkeiten als Konzertveranstalter und -Security, Buchhändler und Journalist nun freier Autor und Lektor, Aktivist und Vortragsreisender. Bis heute hat Farin 29 Bücher verfasst und weitere herausgegeben, zuletzt gemeinsam mit Rafik Schami:Flucht aus Syrien – neue Heimat Deutschland?und mit Eberhard Seidel:Wendejugend. Er ist Vorsitzender der StiftungRespekt!und ehrenamtlich Geschäftsführer des Hirnkost Verlags. Weitere Infos:https://klausfarin.de/ueber-klaus-farin/biographie.
Hans Frey
geboren 1949, Germanist, Lehrer und Ex-NRW-Landtagsabgeordneter, ist in seinem »dritten Leben« Autor und Publizist. Seine Spezialität ist die Aufarbeitung der Science Fiction. Bisher veröffentlichte er ein umfangreiches Werk über Isaac Asimov, das SachbuchPhilosophie und Science Fictionund Monographien über Alfred Bester, J. G. Ballard und James Tiptree Jr. Seit 2016 arbeitet er an einer Literaturgeschichte der deutschsprachigen SF. Drei Bände sind bislang bei Memoranda erschienen (Fortschritt und Fiasko,Aufbruch in den AbgrundundOptimismus und Overkill). Für die ersten beiden Bände erhielt er den Kurd Laßwitz Preis 2021.
Emanuel Lottem
geboren 1944 in Tel Aviv, gilt seit Mitte der Siebzigerjahre als eine zentrale Persönlichkeit in der israelischen Science-Fiction- und Fantasy-Szene. Als Übersetzer ins Hebräische übertrug er einige der wichtigsten Genrewerke, unter anderem Frank Herberts Dune, und gab andere heraus. Als Mitbegründer und Vorstandsmitglied der Israeli Society of Science Fiction and Fantasy sowie Vorsitzender des Redaktionsausschusses des Magazins Fantasia 2000 trägt er maßgeblich zur Lebendigkeit der israelischen SF/F-Szene bei.
2023 erschien bei Hirnkost die von ihm und herausgegebene Anthologie.
Karlheinz Steinmüller
geboren 1950, Diplomphysiker, promovierter Philosoph und einer der angesehensten deutschen Futurologen. Er interessiert sich sowohl als Zukunftsforscher als auch als Science-Fiction-Autor für die ferne Zukunft der Menschheit. 1979 erschien sein erster ErzählbandDer letzte Tag auf der Venus; es folgten weitere Erzählungen und Romane wieAndymon, die er gemeinsam mit seiner Frau Angela Steinmüller schrieb. Zuletzt erschien der EssaybandErkundungenim Memoranda Verlag.
Christian Winkelmann
geboren 1963, studierte Geschichte, Publizistik und Skandinavistik, bereiste zwischendurch und anschließend die halbe Welt, wirkte 20 Jahre als Privatlehrer und ist heute in Berlin im Verlagswesen tätig. Er schrieb u. a. Bücher über Erfindungen und Kultur der deutschsprachigen Länder sowie Brasilien.
Inhalt
Impressum
Zum Geleit
Vorwort
Altneuland
Erstes Buch
Zweites Buch
Drittes Buch
Viertes Buch
Fünftes Buch
Nachwort Des Verfassers
Nachwort
Der Judenstaat
Vorrede
Einleitung
Allgemeiner Teil
Die Jewish Company
Ortsgruppen
Unsere Seelsorger
Society of Jews und Judenstaat
Schlusswort
Das lenkbare Luftschiff
Der Unternehmer Buonaparte
Wenn ihr wollt,
ist es
kein Märchen
Zum Geleit
Wir leben in einer Gegenwart des radikalen Umbruchs, der alle Bereiche der menschlichen Zivilisation durchdringt. Die Probleme scheinen uns über den Kopf zu wachsen. Wir brauchen kluge Ideen, tragfähige Lösungen, vielleicht sogar Utopien, die neue Perspektiven aufzeigen.
Vielleicht ist es gerade in dieser aufwühlenden Situation auch hilfreich, einmal innezuhalten und zurückzublicken. Denn vieles, was uns heute beschäftigt, ist nicht wirklich neu. Schon vor über einhundert Jahren machten sich Autoren und Autorinnen Gedanken über das Klima, über Armut, Wohnen, Ernährung und das Bildungssystem, ob und inwieweit Technik einen Motor für den Fortschritt oder eine existenzielle Gefahr darstellen kann (beispielsweise Atomkraft, Geoengineering, Gentechnik). Vor allem die Autoren und Autorinnen der einst »Zukunftsliteratur« genannten Science Fiction entwarfen wie in keinem anderen Genre gesellschaftliche Utopien und Dystopien, die noch heute so gegenwärtig wirken, als wären sie gerade erst entstanden. Sie sind trotz oder vielleicht gerade wegen ihres oberflächlich antiquiert wirkenden Charmes heute noch mit Gewinn und Genuss zu lesen. Vierzig Perlen aus der deutschsprachigen Science Fiction möchte Ihnen diese Edition im Laufe der nächsten Jahre präsentieren.
Jedes Buch der Edition enthält den Roman selbst sowie in einigen Fällen ergänzende Texte der jeweiligen Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Umrahmt werden die Originaltexte von einem Vorwort namhafter Autoren und Autorinnen der Gegenwart und einem historisch-analytischen Nachwort von anerkannten Expertinnen und Experten, das vornehmlich die literaturhistorischen und zeitgeschichtlichen Hintergründe des Textes beleuchtet.
Parallel zur gedruckten Version erscheinen ePubs in allen Formaten und Vertriebsoptionen, die in der Regel zusätzliche ergänzende Materialien (etwa dazugehörige weitere Romane, Sachbücher und Essays der Autoren und Autorinnen, zeitgenössische Rezensionen und andere Leserstimmen sowie weitere Analysen) enthalten und so vor allem für die wissenschaftliche Beschäftigung eine wertvolle Bereicherung darstellen. Damit werden nicht nur die Originaltitel wieder einem größeren Lesepublikum zugänglich gemacht, sondern auch der Forschung in bislang einzigartiger Weise sowohl historisches Quellenmaterial als auch aktuelle Analysen aufbereitet zur Verfügung gestellt.
Besonderen Wert legen wir auf die Gestaltung. Auch sie soll zum Lesen einladen, denn die von uns herausgegebenen Werke haben es allemal verdient, neue Leser und Leserinnen zu finden. So werden die Werke nicht einfach als Faksimile reproduziert, sondern komplett neu Korrektur gelesen und gesetzt.
Wir, der Verleger Klaus Farin (*1958) und der Herausgeber Hans Frey (*1949), beide Sachbuchautoren, kennen uns schon seit Jugendjahren. Wir stammen beide aus dem Herzen des Ruhrgebiets, aus Gelsenkirchen, engagier(t)en uns für eine bessere, gerechtere Gesellschaft und sind seit unserer Jugend leidenschaftliche Science-Fiction-Leser. Als wir uns nach Jahren zufällig in Berlin wiedertrafen, wurden sofort Pläne geschmiedet. Angeregt durch die deutschsprachige SF-Literaturgeschichte von Hans Frey im Memoranda Verlag wurde die Idee geboren, eine langfristig angelegte Reihe mit wichtigen, aber fast vergessenen Originaltexten der deutschsprachigen Science Fiction zu veröffentlichen.
Aus dieser Idee ist Realität geworden. Die Reihe leistet einen wesentlichen Beitrag zur lebendigen Aufarbeitung und Bewahrung bedeutender Werke der deutschsprachigen SF. Zudem ist sie ein einzigartiges Dokument für die Vielfalt und Vielschichtigkeit des über die Jahre gewachsenen Genres.
Wahr bleibt indes auch: Ohne engagierte Leser und Leserinnen, die die Bücher kaufen und sich an ihnen erfreuen, kann das Projekt nicht gelingen. Empfehlen Sie es bitte weiter. Abonnieren Sie die Reihe. Wir unterbreiten Ihnen ein verlockendes Angebot. Greifen Sie zu!
Hans Frey, Klaus Farin
Vorwort
von Karlheinz Steinmüller
»Mit den Ideen, Kenntnissen, Mitteln, die heute am 31. Dezember1902 im Besitze der Menschheit sind, könnte sie sich helfen.Man braucht keinen Stein der Weisen, kein lenkbares Luftschiff. AllesNötige ist schon vorhanden, um eine bessere Welt zu machen.Und wissen Sie, Mann, wer den Weg zeigen könnte? Ihr!Ihr Juden! Gerade weil’s euch schlecht geht. Ihr habtnichts zu verlieren. Ihr könntet das Versuchsland für die Menschheitmachen – dort drüben, wo wir waren, auf dem alten Bodenein neues Land schaffen. Altneuland!«
Die Botschaft von Altneuland erreicht uns noch heute. Das Buch, vor einhundertzwanzig Jahren geschrieben, ist eine fesselnde und mehr noch eine berührende Lektüre, nicht nur, aber auch deshalb, weil man den Roman, ob man will oder nicht, im Bewusstsein der Schoah liest. Zugleich aber rührt seine Faszination auch daher, dass sich Theodor Herzls Vision vom Altneuland zumindest teilweise im Staat Israel realisiert hat. Welch anderer utopischer Roman kann Ähnliches von sich behaupten?
Trotz des historischen Abstands, trotz der Weltkriege und der politischen Umwälzungen, die uns von der Epoche Herzls trennen, hat Altneuland seinen Charme und seine Kraft nicht verloren. Herzl erweckt vor unseren Augen die bisweilen glanzvolle, meist aber elende Welt der Juden um 1900 im Habsburger Reich zum Leben. Er schildert fast schon auf Dickens’sche Weise die soziale Not seiner Gegenwart, er wirft einen Blick in die nicht immer so glamouröse Wiener Kaffeehauskultur und er lässt uns die Zwangslage der aufstrebenden jüdischen Bildungsschicht miterleben, die trotz Emanzipation und Assimilation in einer Sackgasse steckt und, gerade wo sie erfolgreich wird, mit latentem oder offenem Antisemitismus konfrontiert wird.
Man spürt, dass hier ein versierter Schriftsteller am Werk ist, ein Bühnenautor und weltläufiger Journalist, einer, der es versteht, den Stoff zu arrangieren, Dialoge zu Pointen zu führen und Personen in Szene zu setzen – und der auch Humoristisches, das ins Boulevardtheater passen würde, nicht ausspart. Üblicherweise zeichnen sich Utopien, zumal die Staatsromane aus Herzls Zeit, durch eine gewisse Trockenheit aus; es sind Abhandlungen, bestenfalls Essays, eingebettet in eine karge Rahmenhandlung, die die gesellschaftspolitischen Ideen hintereinander vorführt. Auch Herzl hatte Mühe, alle Elemente seines Zukunftsentwurfs in einem Roman unterzubringen. Es gelingt ihm, denn seine Figuren sind überzeugend, lebensnah, im Einzelfall nahe an der Karikatur, und man folgt seiner Hauptperson gern beim zweimaligen Besuch im Heiligen Land, einmal in Herzls Gegenwart und einmal in der Zukunft des Jahres 1923.
Mit welcher Liebe führt uns Herzl den Frühling Palästinas, der ja auch der Frühling einer Gesellschaft ist, vor Augen! Gesäumt von Zypressen und Eukalyptusbäumen grüßen weiße Paläste am Ufer die Reisenden, die sich dem Land von See her nähern. Fast lautlos gleiten elektrische Schwebebahnen durch die hellen, geschäftigen Städte mit ihren Theatern und Handelshäusern, Gewerbegebieten und Schulen. Juden und Araber wohnen hier friedlich nebeneinander, Kirchen und Moscheen stehen neben den Synagogen. Juden aus aller Welt wandern in ihr gelobtes Land – nach Eretz Israel. Aber nicht nur sie kommen. Menschen jeglicher Nationalität und Glaubensrichtung sind hier im modernsten, fortschrittlichsten Staat der Welt willkommen. Ein Staat im Sinne von Hierarchie und Regiment will das umgewandelte Palästina jedoch nicht sein. Die Bürger sind vielmehr Mitglieder einer umfassenden Genossenschaft, in der alle Angelegenheiten einsichtig geregelt werden. Diese Genossenschaft – »eine mittlere Form zwischen Individualismus und Kollektivismus« – organisiert die Zuwanderung, betreibt den Aufbau und bildet zahllose weitere Genossenschaften für Landwirtschaft, Konsum, Bildung. Selbst die Zeitungen sind genossenschaftlich organisiert und schon daher einer qualitativ hochwertigen Berichterstattung verpflichtet. Drüben, auf dem alten Kontinent, führten die Juden im Golus – dem Elend der Zerstreuung – noch ein miserables Leben. Auch wenn sie versuchten, sich anzupassen, blieben sie doch stets Menschen zweiter Klasse. Und viele junge Leute fanden trotz guter Ausbildung keine Anstellung. Hier aber ist ihr Talent willkommen! Hier können sie das Land grün und fruchtbar machen wie zu Abrahams Zeiten!
Theodor Herzl trifft mit dieser Utopie den Zeitgeist und bringt zugleich die Sehnsüchte seiner Glaubensgenossen auf den Punkt. Denn er kennt ihre Situation nur zu gut. Auch er hat zuerst daran geglaubt, dass die Juden im Zuge einer bewusst gewählten Assimilation eine gleichberechtigte Aufnahme als Bürger finden könnten. Persönliche Erlebnisse als Student, als Theaterautor und Feuilletonist in Wien und später als Korrespondent in Paris haben ihn aber vom Gegenteil überzeugt. Selbst im liberalen Frankreich musste er erfahren, wie sich im Prozess gegen den jüdischen Hauptmann Dreyfus, dem zu Unrecht Verrat vorgeworfen wurde, ein tief sitzender Antisemitismus Bahn brach. In Paris hat Herzl erkannt: Auf dem Wege der Assimilation ist die erwünschte Befreiung der Juden nicht zu erreichen. Er sieht nur einen Ausweg: einen eigenständigen Judenstaat. Fortan arbeitet er unermüdlich auf dieses Ziel hin, gewinnt Unterstützer und stößt auf Ablehnung.
Im Jahr 1896 führt Herzl seine Vision in dem Buch DerJudenstaat genauer aus. 1897 beruft er den ersten Zionistischen Weltkongress nach Basel ein und wird zum ersten Präsidenten der Zionistischen Weltorganisation gewählt. »In Basel habe ich den Judenstaat gegründet«, kann er verkünden. 1898 besucht er Palästina. Verhandlungen mit dem türkischen Sultan, zu dessen Reich Palästina gehört, mit dem Deutschen Kaiser Wilhelm II. und dem Papst bleiben jedoch erfolglos. Trotz solcher Rückschläge und trotz vieler Widerstände gelingt es Herzl und seinen Mitarbeitern, den Zionismus, der für das jüdische Volk die Schaffung einer »völkerrechtlich gesicherten Heimstätte« in Palästina anstrebt, zu einer Massenbewegung zu machen.
Lange hat Herzl gezögert, seine Ideen in Romanform zu kleiden: Würde eine fiktive Gestaltung die hehre Idee der Neugründung eines Judenstaats nicht verkleinern, gar als spinnerte Tagträumerei der Lächerlichkeit preisgeben? Wo schon Der Judenstaat, durch und durch sachlich argumentierend, vielen als Jules-Verne’sches Märchen und abstruses Traktat galt! Was würden seine Freunde und Weggefährten davon halten, dass er seiner mehrmals bekundeten Ablehnung von Utopienmalerei untreu wird?
Im Unterschied zu anderen Verfassern von Staatsromanen seiner Zeit, die oft im Klein-Klein von Idealvorstellungen stecken blieben, hat Herzl klare Vorstellungen davon, wie der Weg zur Verwirklichung beschritten werden könnte. Er setzt nicht auf Revolution, auf die radikale Umstülpung aller Verhältnisse. Er vertraut darauf, dass das Neue aus dem Alten heraus entstehen kann, ja, bewährte Elemente und Ansätze übernehmen muss. Allerdings braucht er ein aus seiner Sicht unerschlossenes – und zugleich uraltes – Stück Land, ohne verkrustete Institutionen und festgefressene Interessen. Das ist seine Grundidee: fast von null zu beginnen und alle fortschrittlichen technischen, organisatorischen, finanziellen Möglichkeiten der Zeit zu nutzen. Die Araber, so seine Überzeugung, werde man schon gewinnen.
Natürlich war das Echo auf Altneuland gespalten. Die einen stießen sich an der literarischen Gestaltung und verwarfen alle im Buch enthaltenen konkreten Vorschläge zur Gründung eines jüdischen Gemeinwesens als völlig unrealistisch. Andere hielten es einfach für unschicklich, dass der Anführer einer Bewegung mit einem Roman hervortrat. Viele erkannten aber auch, dass sich die zionistische Idee auf diese Weise wunderbar verbreiten – eben erzählen – ließ. Vor allem richtete sich Altneuland auch an Nichtjuden und sollte ihnen vor Augen führen, dass das zionistische Programm sinnvoll und durchführbar ist.
Im Jahr 1903, ein Jahr nachdem Altneuland erschienen war, beschlossen die Versammelten auf dem inzwischen sechsten Zionistenkongress, praktische Schritte zur Ansiedlung in Palästina zu unternehmen. Der Arzt und Soziologe Franz Oppenheimer stellte dazu einen detaillierten Plan für Genossenschaftssiedlung mit Gemeineigentum und basisdemokratischen Strukturen vor. 1911 wurde südlich von Nazareth die erste Siedlung nach diesem Modell aufgebaut. Später wird man sie als Kibbuz bezeichnen. Das aber hat Herzl schon nicht mehr erlebt.
Aus Herzls Vision von Altneuland spricht zu uns ein optimistisches und zugleich realistisches Menschenbild: Manche Leute werden sich nie ändern, aber die Menschen haben das Potenzial, sich zu bilden, sich zu engagieren und dabei wie einige seiner Romanfiguren über sich selbst hinauszuwachsen. »Wenn Ihr wollt, istes kein Märchen.« – Man muss die Dinge selbst in die Hand nehmen, dann wird auch das anscheinend Unmögliche möglich.
Theodor Herzl
Altneuland
Erstes Buch
Ein gebildeter und verzweifelter junger Mann
2
Die Familie Löffler wohnte im zweiten Stock eines großen Zinshauses in der Gonzagagasse. Im Erdgeschoss befand sich die Tuchniederlassung der Firma »Moriz Löffler und Komp.«.
Als Friedrich und Schiffmann in das Vorzimmer traten, bemerkten sie an der Menge der schon dahängenden Wintermäntel, dass die Gesellschaft heute zahlreicher sein musste als gewöhnlich.
»Ein ganzes Kleidergeschäft«, meinte Schiffmann.
Im Salon waren einige Leute, die Friedrich schon kannte. Fremd war ihm aber der kahlköpfige Herr, der neben Ernestine am Klavier stand und ihr ganz vertraulich zulächelte.
Das junge Mädchen streckte dem Ankömmling liebenswürdig die Hand entgegen:
»Herr Doktor Löwenberg, lassen Sie sich vorstellen. Das ist Herr Leopold Weinberger.«
»Mitchef der Firma Samuel Weinberger und Söhne in Brünn«, ergänzte Papa Löffler nicht ohne Feierlichkeit und Wohlwollen.
Die beiden Herren reichten einander erfreut die Hände, und Friedrich nahm bei dieser Gelegenheit wahr, dass Herr Weinberger, der Mitchef der Brünner Firma, beträchtlich schielte und eine sehr feuchte Handfläche hatte. Das missfiel Friedrich nicht, weil es den ersten blitzartigen Gedanken verscheuchte, von dem er bei seinem Eintritte befallen worden war. Ernestine mit einem solchen Menschen – das war einfach unmöglich. Wie sie jetzt dastand, schlank, anmutig, das holde Haupt lieblich geneigt, entzückte sie seine Augen. Er musste sich aber ein wenig zurückziehen, denn andere Gäste kamen und wurden begrüßt. Nur Herr Leopold Weinberger aus Brünn behauptete sich einigermaßen zudringlich an Ernestines Seite.
Friedrich erkundigte sich bei Schiffmann.
»Dieser Herr Weinberger ist wohl ein alter Bekannter des Hauses?«
»Nein«, sagte Schiffmann, »sie kennen ihn erst seit vierzehn Tagen, aber es ist eine feine Tuchfirma.«
»Was ist fein, Herr Schiffmann, das Tuch oder die Firma?«, fragte Friedrich belustigt und getröstet.
Denn ein Mensch, den man erst seit vierzehn Tagen kannte, war doch sicherlich kein Bräutigam.
»Beides«, erwiderte Schiffmann. »Samuel Weinberger und Söhne kriegen so viel Geld, wie sie wollen – für vier Prozent. Hochprima ... Überhaupt geht es heute hier nobel zu. Sehen Sie: Der Magere dort mit den Glotzaugen, das ist Schlesinger, der Prokurist von Baron Goldstein. Er ist ein zuwiderer Mensch, aber sehr beliebt.«
»Warum?«
»Was heißt: warum? Weil er der Prokurist von Baron Goldstein ist ... Kennen Sie den mit dem grauen Backenbart? Auch nicht? Ja, von wo kommen Sie denn? Das ist der Großspekulant Laschner, einer der bedeutendsten Börsianer. Der spielt Ihnen mit ein paar Tausend Effekten wie gar nichts. Jetzt ist er gerade sehr reich. Ob er nächstes Jahr noch etwas haben wird, weiß ich nicht. Heute hat seine Gemahlin die größten Brillanten Boutons ... Die anderen beneiden sie alle darum.«
Frau Laschner saß in einer Ecke des Salons mit mehreren ebenfalls stark herausgeputzten Damen, und sie sprachen leidenschaftlich von Hüten. Die übrigen Gruppen waren noch in der kühlen Stimmung vor dem Nachtmahl. Auch schienen einige von der bevorstehenden Überraschung unterrichtet zu sein, die Schiffmann im Kaffeehaus angedeutet hatte. Sie machten diskrete Mienen und flüsterten miteinander. Friedrich fühlte sich unbehaglich, ohne recht zu wissen, warum. In dieser Gesellschaft spielte er nächst Schiffmann die unbedeutendste Rolle. Sonst hatte er das nie bemerkt, weil Ernestine mit ihm zu bleiben pflegte, wenn er kam. Aber heute wandte sie keinen Blick und kein Wort an ihn. Herr Weinberger aus Brünn musste ein sehr anregender Plauderer sein.
Noch etwas empfand Friedrich als Demütigung des Schicksals. Er und Schiffmann waren die Einzigen, die nicht im Frack oder Smoking erschienen waren, sondern im Salonrock. Dadurch waren sie auch äußerlich als die Parias des Abends gekennzeichnet. Am liebsten wäre er gegangen, aber dazu fand er nicht den Mut.
Der große Salon war schon überfüllt. Man schien aber noch jemanden zu erwarten. Friedrich wandte sich mit einer Frage an seinen Elendsgenossen. Schiffmann wusste es auch wirklich, denn er hatte soeben eine Bemerkung der Hausfrau erlauscht.
»Man wartet nur noch auf Grün und Blau.«
»Wer ist das?«, fragte Friedrich.
»Was? Sie kennen Grün und Blau nicht? Die zwei geistreichsten Menschen von Wien? Es gibt doch keine Gesellschaft, keine Hochzeit, keinen Polterabend oder was immer ohne Grün und Blau. Manche sagen, Grün ist der Geistreichere, manche sagen, Blau. Grün ist mehr auf Wortspiele eingerichtet, Blau macht sich mehr über die Leute lustig. Blau hat darum auch schon mehr Backpfeifen bekommen, aber das geniert ihn nicht. Er hat das richtige Gesicht dafür. Seine Wangen werden nicht rot, wenn man sie ohrfeigt ... In den besseren jüdischen Kreisen sind die zwei Herren sehr beliebt. Nur kann einer den anderen nicht ausstehen – natürlich, sie sind ja Konkurrenten.«
Eine kleine Bewegung im Salon. Herr Grün war eingetreten, ein langer hagerer Mensch mit rötlichem Bart und auffallend weit vom Kopf abstehenden Ohren, die Herr Blau die »uneingesäumten Ohren« nannte, weil ihr oberer Rand nicht zur Muschel hin gefaltet war, sondern flach dalag.
Ernestines Mutter ging dem berühmten Witzbold mit einem liebenswürdigen Vorwurf entgegen:
»Warum kommen Sie erst jetzt, Herr Grün?«
»Ich hab’ nicht später kommen können«, antwortete er humoristisch.
Die es hörten, lächelten dankbar. Doch über die Züge des Humoristen flog ein Schatten: Blau war erschienen.
Herr Blau, ein mittelgroßer Mann von etwa dreißig Jahren, hatte ein glattrasiertes Gesicht, und auf der stark gebogenen Nase saß ihm ein Kneifer.
»Ich war im Wiedener Theater«, sagte er, »bei der Premiere. Nach dem ersten Akt bin ich gegangen.«
Die Mitteilung erregte Interesse. Damen und Herren scharten sich um Blau, der weiter berichtete:
»Der erste Akt ist zum allgemeinen Erstaunen nicht durchgefallen.«
Frau Laschner rief ihrem Gatten herrisch zu:
»Moriz, ich will morgen hingehen.«
Blau fuhr fort:
»Die Freunde der Librettisten haben sich ausgezeichnet unterhalten.«
»So gut ist die Operette?«, fragte Schlesinger, der Prokurist des Baron Goldstein.
»Nein – so schlecht!«, erklärte Blau. »Die Freunde der Verfasser unterhalten sich doch nur, wenn das Stück schlecht ist.«
Man ging zu Tisch. Der große Speisesaal war noch zu klein für die heutige Gesellschaft. Man saß dicht gedrängt. Ernestine neben Herrn Weinberger. Friedrich und Schiffmann hatten am untersten Ende der Tafel Platz nehmen müssen.
Anfänglich gab es mehr Tellergeklapper und Klirren von Esszeug als Gespräche. Herr Blau rief seinem Konkurrenten über den Tisch zu:
»Grün – essen Sie nicht so laut! Man hört seinen eigenen Fisch nicht.«
»Sie sollten keinen Fisch essen, sondern Neidhammelkeule.«
Die Anhänger des Herrn Grün lachten über diesen Witz. Die Anhänger des Herrn Blau fanden ihn matt.
Aber die Aufmerksamkeit der Tafelrunde wurde von den beiden Witzbolden abgelenkt, als ein älterer Herr, der neben Frau Löffler saß, mit etwas lauterer Stimme sagte:
»Bei uns in Mähren wird die Lage auch schlecht. In den kleineren Landstädten sind die Leute wirklich in Gefahr. Sind die Deutschen schlecht aufgelegt, schlagen sie den Juden die Fenster ein. Sind die Tschechen schief gewickelt, brechen sie bei den Juden ein. Die armen Leute fangen an auszuwandern. Aber sie wissen nicht, wohin sie sollen.«
»Moriz!«, schrie in diesem Augenblick Frau Laschner. »Ich will übermorgen ins Burgtheater.«
»Gib jetzt Ruh!«, antwortete der Börsenmann. »Doktor Weiß erzählt uns, wie es bei ihnen in Mähren aussieht. Auf Ehre nicht schön.«
Samuel Weinberger, der Vater des Herrn Leopold Weinberger, mischte sich ein:
»Herr Doktor, Sie als Rabbiner sehen etwas zu schwarz.«
»Weiß sieht immer schwarz!«, sagte einer der Spaßmacher, aber der Witz fiel ins Leere.
Samuel Weinberger fuhr fort:
»Ich fühl’ mich in meiner Fabrik ganz sicher. Wenn man bei mir Spektakel macht, ruf’ ich die Polizei oder geh’ zum Platzkommando. Wenn das Gesindel die Bajonette nur sieht, hat es schon Respekt.«
»Das ist aber doch ein trauriger Zustand«, meinte Rabbiner Weiß mit Sanftmut.
Der Advokat Doktor Walter, der ursprünglich Voglstock geheißen hatte, bemerkte:
»Ich weiß nicht mehr, wer gesagt hat: Mit Bajonetten kann man alles machen; nur sich darauf setzen kann man nicht.«
»Ich seh’ schon«, rief Laschner, »wir werden alle wieder den gelben Flicken tragen müssen.«
»Oder auswandern«, sagte der Rabbiner.
»Ich bitte Sie, wohin?«, fragte Walter. »Ist es vielleicht anderswo besser? Sogar im freien Frankreich haben die Antisemiten die Oberhand.«
Doktor Weiß aber, der arme Rabbiner einer mährischen Kleinstadt, der entschieden nicht wusste, in welchen Kreis er da geraten war, wagte eine schüchterne Einwendung:
»Es gibt seit einigen Jahren eine Bewegung, man nennt sie die zionistische. Die will die Judenfrage durch eine großartige Kolonisation lösen. Es sollen alle, die es nicht mehr aushalten können, in unsere alte Heimat, nach Palästina gehen.«
Er hatte ganz ruhig gesprochen und nicht wahrgenommen, wie die Gesichter um ihn her sich allmählich zum Lächeln verzogen, und er war daher ordentlich verdutzt, als das Gelächter beim Worte Palästina plötzlich losbrach. Es war ein Lachen in allen Tonarten. Die Damen kicherten, die Herren brüllten und wieherten. Nur Friedrich Löwenberg fand diesen Heiterkeitsausbruch brutal und ungeziemend gegen den alten Mann. Blau benutzte die erste Pause im allgemeinen Gelächter, um zu erklären:
»Wenn es in der neuen Operette einen einzigen solchen Witz gegeben hätte, wär’ uns wohl gewesen.«
Grün schrie:
»Ich werde Botschafter in Wien.«
Erneutes Gelächter. Einige riefen dazwischen:
»Ich auch, ich auch.«
Da sagte Blau ernst:
»Meine Herren, alle können es nicht werden. Ich glaube, die österreichische Regierung wird so viele jüdische Botschafter nicht annehmen. Sie müssen sich um andere Posten umsehen.«
Der alte Rabbiner war aber sehr verlegen und sah nicht mehr von seinem Teller auf, indessen die Humoristen Grün und Blau sich mit einer wahren Lust auf den spaßigen Stoff warfen. Sie teilten das neue Reich ein, schilderten die Zustände. Am Sabbat wird die Börse geschlossen sein. Der König wird den Männern, die sich um das Vaterland oder um die Börse herum Verdienste erworben haben, den Davidsorden oder den Orden vom »fleischigen Schwert« verleihen. Wer aber soll König sein?
»Jedenfalls Baron Goldstein«, sagte der Witzbold Blau.
Herr Schlesinger, der Prokurist dieses berühmten Bankiers, bemerkte unwillig:
»Ich bitte, die Person des Herrn Baron von Goldstein nicht in die Debatte zu ziehen, wenigstens nicht in meiner Gegenwart.«
Fast alle Anwesenden gaben ihm durch Kopfnicken ihre Zustimmung zu erkennen. Der witzige Herr Blau beging wirklich manchmal Taktlosigkeiten. Die Person des Herrn Baron Goldstein in die Debatte zu ziehen, das ging denn doch ein bisschen zu weit. Herr Blau aber fuhr fort:
»Justizminister wird Herr Doktor Walter. Er bekommt den Adelsstand mit dem Prädikate ›von Voglstock‹. Walter Edler von Voglstock.«
Man lachte. Der Advokat errötete über seinen Vatersnamen und rief dem Witzling zu:
»Sie haben schon lang keine fremde Hand in Ihrem Gesicht gespürt.«
Grün, der Wortwitzige, aber Vorsichtigere, flüsterte seiner Nachbarin eine Silbenkombination zu, in der das Wort Ohrfeiglstock vorkam.
Frau Laschner erkundigte sich:
»Wird es Theater auch geben in Palästina? Sonst geh’ ich nicht hin.«
»Gewiss, gnädige Frau«, sagte Grün. »Bei den Festvorstellungen im Hoftheater von Jerusalem wird die ganze Israelite versammelt sein.«
Der Rabbiner Weiß meinte nun schüchtern:
»Über wen machen Sie sich lustig, meine Herren? Über sich selbst?«
»Nein, ernst werden wir uns nehmen!«, sagte Blau.
»Ich bin stolz, dass ich ein Jud bin«, erklärte Laschner. »Denn wenn ich nicht wär’ stolz, wär’ ich doch auch ein Jud. Also bin ich lieber gleich stolz.«
In diesem Augenblick gingen die beiden Stubenmädchen hinaus, eine andere Schüssel zu holen. Die Hausfrau bemerkte:
»Wenn die Dienstboten dabei sind, sollte man lieber nicht über jüdische Sachen reden.«
Blau erwiderte sofort:
»Entschuldigen, gnädige Frau, ich hab’ nicht gewusst, dass Ihre Dienstboten nicht wissen, dass Sie Juden sind.«
Einige lachten.
»Nun ja«, sagte Schlesinger mit Autorität, »aber man muss es doch nicht an die große Glocke hängen.«
Champagner wurde hereingebracht. Schiffmann stieß seinen Nachbarn Löwenberg mit dem Ellbogen:
»Jetzt wird’s losgehen!«
»Was wird losgehen?«, fragte Friedrich.
»Haben Sie’s denn noch immer nicht heraus?«
Nein, Friedrich hatte es noch immer nicht erraten. Aber im nächsten Augenblick wurde es ihm zur Gewissheit. Herr Löffler klopfte mit dem Messer an sein Glas und erhob sich. Stille trat ein. Die Damen lehnten sich zurück. Der Humorist Blau schob noch schnell einen Bissen in den Mund und kaute, während Papa Löffler sprach:
»Meine hochverehrten Freunde! Ich bin in der angenehmen Lage, Ihnen eine freudige Mitteilung zu machen. Meine Tochter Ernestine hat sich mit Herrn Leopold Weinberger aus Brünn, Mitchef der Firma Samuel Weinberger und Söhne, verlobt. Das Brautpaar soll leben. Hoch!«
Hoch! Hoch! Hoch! Alle hatten sich erhoben. Die Gläser klangen. Dann ging man um den Tisch herum, zu den Eltern, zum Brautpaar, Glück wünschend. Auch Friedrich Löwenberg machte diesen Weg mit, obwohl er eine Wolke vor den Augen hatte. Eine Sekunde lang war er vor Ernestine gestanden und hatte mit zitternder Hand sein Glas dem ihrigen genähert. Sie sah flüchtig über ihn hinweg.
Dann war die Stimmung an der Tafel fröhlich geworden. Ein Trinkspruch folgte dem anderen. Schlesinger hielt eine würdevolle Rede. Grün und Blau zeigten sich auf der Höhe ihrer humoristischen Aufgabe, Grün verrenkte in seinem Toast noch mehr Silben als gewöhnlich, und Blau machte allerlei taktlose Anspielungen. Die Gesellschaft geriet in die beste Laune.
Friedrich hörte das alles nur undeutlich, wie aus der Ferne, und es war ihm zumute, als befände er sich in einem dichten Nebel, in dem man nichts sieht und schwer Atem holen kann.
Das Mahl ging zu Ende. Friedrich hatte den einzigen Gedanken, fortzukommen, weit weg von all diesen Leuten. Er kam sich überflüssig vor in diesem Zimmer, in dieser Stadt, in der Welt überhaupt. Aber als er sich in dem kleinen Gedränge nach der Tafel unauffällig verdrücken wollte, kam ihm Ernestine in den Weg. Lieblich war ihre Stimme, als sie ihn anhielt:
»Sie haben mir noch nichts gesagt, Herr Doktor!«
»Was soll ich Ihnen sagen, Fräulein Ernestine? ... Ich wünsch’ Ihnen Glück. Jaja – ich wünsche Ihnen viel Glück zu dieser Verlobung.«
Aber da war schon der Bräutigam wieder neben ihr, legte den Arm mit der Sicherheit des Besitzers um ihre Taille und zog sie fort.
Sie lächelte.
3
Als Friedrich Löwenberg in die Winternachtluft hinaustrat, legte er sich die Frage vor, was das Widerlichere gewesen sei: die Besitzergebärde des Herrn Weinberger aus Brünn oder das Lächeln des jungen Mädchens, das er bisher so bezaubernd gefunden hatte. Wie? Seit vierzehn Tagen erst kannte der »Mitchef« die Holde, und er durfte seine schwitzende Hand auf ihren Leib legen. Welch ein ekelhafter Handel. Es war der Zusammenbruch einer feinen Illusion. Der Mitchef hatte offenbar Geld, und Friedrich hatte keines. In diesem Kreise, wo man nur für Vergnügen und Vorteil Sinn hatte, war Geld alles, und doch war er auf diesen Kreis der jüdischen Bourgeoisie angewiesen. Mit diesen Leuten und leider auch von diesen Leuten musste er leben, denn sie stellten die Klientel einer zukünftigen Advokatenpraxis dar. Wenn es hoch kam, wurde man Rechtsbeistand eines Mannes wie Laschner – von dem fantastischen Glücksfalle, dass man einen Kunden wie Baron Goldstein bekam, gar nicht zu träumen. Die christliche Gesellschaft und eine christliche Klientel gehörten zum Unzugänglichsten in der Welt. Also was? Entweder sich dem Löffler’schen Kreise einfügen, dessen niederes Lebensideal teilen, die Interessen zweifelhafter Geldmenschen vertreten und zum Lohne für solche brave Aufführung nach soundso vielen Jahren auch eine Kanzlei besitzen, mit dem Anspruch auf die Hand und Mitgift eines Mädchens, das nach vierzehntägiger Bekanntschaft den Erstbesten heiratet. Oder, wenn einem das alles zu ekelhaft war, die Einsamkeit und Armut.
Er war in solchen Gedanken wieder vor dem Café Birkenreis angelangt. Was sollte er auch jetzt schon zu Hause in seinem engen Stübchen anfangen? Es war zehn Uhr. Schlafen gehen? Ja, wenn es kein Erwachen mehr gäbe ...
Vor der Tür des Kaffeehauses wäre er beinahe über einen kleinen Körper gestolpert. Auf der Stufe des Eingangs hockte ein Knabe, Friedrich erkannte ihn: Es war derselbe Junge, den er vor wenigen Stunden beschenkt hatte.
Barsch fuhr er ihn an:
»Was? Du bettelst hier schon wieder?«
Der Knabe erwiderte mit fröstelnder Stimme:
»Ich wart’ auf mein’ Taten.«
Dann stand er auf und hüpfte wieder und schlug die Arme übereinander, um sich zu erwärmen. Friedrich war so unglücklich, dass er für das frierende Kind kein Mitleid empfand.
Er trat in den qualmigen Raum ein und setzte sich auf seinen gewohnten Platz am Lesetisch. Um diese Stunde war das Kaffeehaus schwach besucht. Nur in den Winkeln einige verspätete Spieler, die sich voneinander nicht trennen konnten und immer wieder die letzten Runden ankündigten, an die sich die allerletzten und unwiderruflich letzten anschlössen.
Eine Weile saß Friedrich und starrte vor sich hin, dann kam ein schwatzhafter Bekannter an den Tisch heran. Friedrich flüchtete sich hinter eine Zeitung und tat, als ob er läse. Aber als er in das Blatt hineinsah, fiel sein Blick zufällig wieder auf die Anzeige, von der Schiffmann vor einigen Stunden gesprochen hatte:
»Gesucht wird ein gebildeter und verzweifelter junger Mann, der bereit ist, mit seinem Leben ein letztes Experiment zu machen. Anträge unter N. O. Body an die Expedition.«
Wie sonderbar. Jetzt passte die Anrufung auf ihn. Ein letztes Experiment! Das Leben war ihm ohnehin verleidet. Bevor er es wegwarf wie sein armer Freund Heinrich, konnte er immerhin noch etwas damit unternehmen. Er ließ sich vom Kellner einen Kartenbrief geben und schrieb an N. O. Body diese wenigen Worte:
»Ich bin Ihr Mann. Doktor Friedrich Löwenberg, IX. Hahngasse 67.«
Während er den Brief zuklebte, kam von hinten jemand an ihn heran:
»Zahnbürsteln, Hosenträger, Hemdknöpf’ gefällig?«
Friedrich scheuchte den zudringlichen Hausierer mit einem barschen Wort weg. Der zog sich seufzend zurück, mit einem ängstlichen Blick zum Kellner, der ihn vielleicht hinausweisen würde. Da bereute Friedrich, dass er den armen Menschen eingeschüchtert hatte, rief ihn zurück und warf ihm ein Zwanzighellerstück in das Hausiererkistchen. Der Mann hielt ihm seinen Trödel hin:
»Ich bin kein Bettler ... Sie müssen etwas kaufen, sonst kann ich das Geld nicht behalten.«
Um ihn loszuwerden, nahm Friedrich einen Hemdknopf aus dem Kästchen. Jetzt erst dankte der Mann und ging weg. Friedrich sah ihm gleichgültig nach, wie er zu dem Kellner trat und diesem das eben erhaltene Geldstück gab. Der Kellner holte aus einem Korb altbackene Brote hervor und lieferte sie dem Hausierer aus, der sie hastig in seine Rocktasche stopfte.
Friedrich erhob sich, um wegzugehen. Als er vor der Tür des Kaffeehauses stand, sah er den frierenden Jungen wieder, diesmal mit dem Hausierer, der ihm die harten Brötchen übergab. Das war also der Vater des Knaben.
»Was macht Ihr da?«, fragte Friedrich.
»Ich geb ihm die Kipfeln, gnädiger Herr«, sagte der Hausierer, »dass er sie soll zu Haus tragen zu mein Weib. Es ist heut mei’ erste Einnahme.«
»Ist das wahr?«, forschte Friedrich.
»So soll es nicht wahr sein, wie es wahr ist«, sagte der Mann stöhnend. »Überall werfen sie mich heraus, wenn ich handeln will. Wenn man ein Jud is’, soll man lieber gleich in die Donau gehen.«
Friedrich, der noch kurz vorher mit dem Leben abgeschlossen hatte, sah plötzlich eine Gelegenheit, sich zu betätigen, jemandem nützlich zu sein. Eine Ablenkung seiner Gedanken. Er steckte den Kartenbrief in einen Postkasten. Dann ging er mit den beiden weiter und ließ sich vom Hausierer erzählen.
»Wir sind von Galizien hergekommen. In Krakau hab’ ich gewohnt in ein’ Zimmer mit noch drei Familien. Wir haben gelebt von der Luft. Hab’ ich mir gedacht, schlechter kann es nit mehr werden, und bin mit mei’ Weib und meine Kinder hergekommen. Hier is’ es nit schlechter, aber auch nit besser.«
»Wie viele Kinder haben Sie?«
Der Hausierer begann im Gehen zu schluchzen:
»Fünfe hab’ ich gehabt; drei sind mir gestorben, seit wir hier sind. Jetzt hab’ ich nur den da und das kleine Mädel, was noch an der Brust is’ ... David, lauf nit so schnell.«
Der Knabe drehte sich um:
»Die Mutter war so hungrig, wie ich ihr die drei Kreuzer von dem Herrn da gebracht hab’.«
»So? Sie waren der gute Herr?«, sagte der Hausierer und haschte nach Friedrichs Hand, um sie zu küssen.
Friedrich zog die Hand rasch zurück:
»Was fällt Ihnen denn ein? ... Sag, mein Junge, was hat deine Mutter mit den paar Kreuzern angefangen?«
»Milch hat sie geholt für Mirjam«, sagte der kleine David.
»Mirjam ist unser anderes Kind«, bemerkte der Hausierer erklärend.
»Und die Mutter hungerte weiter?«, fragte Friedrich erschüttert.
»Ja, Herr«, erwiderte David.
Friedrich hatte noch einige Gulden bei sich. Ob er die besaß oder nicht, war ziemlich gleichgültig, da er ohnehin mit dem Leben fertig war. Diesen Leuten konnte er die bitterste Not erleichtern, wenn auch nur für kurze Zeit.
»Wo wohnt Ihr?«, fragte er den Hausierer.
»Auf der Brigittenauer Lände. Wir hab’n a Kabinett – aber es ist uns schon gekündigt.«
»Gut, ich will mich überzeugen, ob das alles wahr ist. Ich gehe mit Ihnen nach Hause.«
»Bitte!«, sagte der Hausierer. »Sie wer’n ka Vergnüg’n hab’n, gnädiger Herr. Wir lieg’n am Stroh ... Ich hab’ noch in andere Kaffeehäuser gehen wollen. Aber wenn Sie wünschen, geh’ ich zu Haus.«
Sie gingen über die Augartenbrücke der Brigittenauer Lände zu. David, der jetzt neben seinem Vater einherschlich, fragte mit leiser Stimme:
»Tate, darf ich ein Stückl Brot essen?«
»Iss nur«, entgegnete der Alte. »Ich werd’ auch ein Stückl essen. Für die Mutter bleibt noch.«
Und nun kauten Vater und Sohn hörbar an dem harten Gebäck, das sie aus ihren Taschen hervorgeholt hatten.
Vor einem hohen, neu gebauten Hause an der Lände blieben sie stehen. Das Haus atmete noch den feuchten frischen Baugeruch aus. Der Hausierer zog die Klingel. Alles blieb still. Nach einer Weile zog er wieder den Messingknopf und sagte:
»Der Hausmeister weiß schon, wer da is’. Da lasst er sich Zeit. Oft steh’ ich da a Stund! Er ist ein grober Mensch. Manches Mal trau’ ich mich gar nit her, wenn ich ihm keine fünf Kreuzer Sperrgeld geben kann.«
»Was tun Sie dann?«, fragte Friedrich.
»Dann geh’ ich herum bis in der Früh, bis das Haustor offen is’.«
Friedrich ergriff nun selbst den Knopf und riss ein paarmal heftig die Klingel. Jetzt wurde Geräusch hinter dem Tore vernehmbar. Schlurfende Schritte, Klirren von Schlüsseln, und durch die Ritzen drang ein Lichtschein. Das Tor ging auf. Der Hausmeister hielt ihnen die Laterne entgegen und schrie:
»Wer reißt denn so an der Glocke? Was? Die Judenbagasch?«
Der Hausierer entschuldigte sich furchtsam:
»Nit ich war es – der Herr da!«
Der Hausmeister schimpfte:
»So a Frechheit!«
»Augenblicklich schweigen Sie, Kerl!«, herrschte ihn Friedrich an und warf ihm eine Silbermünze vor die Füße.
Als der Hausmeister den Silberklang auf den Fliesen hörte, wurde er kleinlaut und unterwürfig:
»Euer Gnaden hab’ i net g’meint. D’Juden da!«
»Schweigen Sie!«, wiederholte Friedrich. »Und leuchten Sie mir über die Stiege.«
Der Hausmeister hatte sich gebückt und das Geld aufgehoben. Eine ganze Krone. Das musste ein vornehmer Herr sein.
»Es is’ im fünften Stock, gnädiger Herr«, sagte der Hausierer.
»Vielleicht borgt uns der Herr Hausbesorger e Stückl Kerzen.«
»Dem Littwak bürg’ i nix«, rief dieser. »Aber wenn Euer Gnaden a Kerzen wolln ...«
Er nahm auch gleich das Stümpfchen aus der Laterne und gab es Friedrich. Dann verschwand er brummend. Friedrich stieg mit Littwak und David die fünf Treppen hinan.
Es war gut, dass sie die Kerze mithatten, denn es umgab sie tiefe Nacht. Auch in dem einfenstrigen Stübchen Littwaks brannte kein Licht, obwohl die Frau, die auf einer Streu ihr Lager hatte, wach und aufrecht dasaß. Friedrich sah im Halbdunkel des Kerzenstümpfchens, dass der schmale Raum keinerlei Möbel enthielt. Kein Stuhl, kein Tisch, kein Schrank. Auf dem Fensterbrett befanden sich einige Fläschchen und zerbrochene Töpfe. Ein Anblick des tiefsten Elends. Die Frau hatte ein kleines, wimmerndes Kind an der schlaffen Brust. Sie starrte ihnen hohläugig und angstvoll entgegen.
»Wer ist das, Chajim?«, stöhnte sie erschreckt.
»E guter Herr«, beruhigte sie ihr Mann.
David ging zu ihr hin.
»Mutter, da is’ Brot«, und gab es ihr.
Sie brach es mit Mühe und schob sich langsam einen Bissen in den Mund. Sie war recht schwach und abgemagert, aber das verhärmte Gesicht wies doch noch Spuren einer vergangenen Schönheit auf.
»Da wohnen wir«, sagte Chajim Littwak mit bitterem Lachen. »Aber ich weiß nicht emal, ob wir übermorgen noch das haben werd‘n. Sie hab’n uns scho’ gekündigt.«
Die Frau seufzte laut auf. David hatte sich neben sie hin auf das Stroh gekauert und schmiegte sich an sie.
»Wie viel brauchen Sie, um hierbleiben zu können?«, fragte Friedrich.
»Drei Gulden!«, erklärte Littwak. »E Gulden zwanzig auf Zins und das Übrige bin ich der Hausfrau schuldig. Wo soll ich bis übermorgen drei Gulden hernehmen? Dann lieg’n wir mit die Kinder auf der Gass’n.«
»Drei Guld’n!«, jammerte die Frau leise und hoffnungslos.
Friedrich griff in die Tasche. Er hatte acht Gulden bei sich. Die gab er dem Hausierer.
»Gerechter Gott! Is’ es möglich?«, rief Chajim, und es liefen ihm Tränen über die Wangen. »Acht Gulden! Rebekka! David! Gott hat uns geholfen. Gelobt sei sein Name!«
Frau Rebekka war auch fassungslos. Sie hatte sich auf die Knie erhoben und schleppte sich zu dem Retter hin. Im rechten Arm hielt sie ihr schlummerndes Wickelkind, mit der Linken haschte sie nach Friedrichs Hand, um sie zu küssen.
Er entzog sich ihrem Danke rasch.
»Macht doch keine solchen Geschichten! Für mich sind die paar Gulden gar nichts – ob ich sie habe oder nicht ... David kann mir hinunterleuchten.«
Die Frau war auf ihr Lager zurückgesunken und schluchzte bitterlich vor Freude. Chajim Littwak begann ein hebräisches Gebet zu murmeln. Friedrich ging, von David begleitet, hinaus und die Treppe hinunter. Als sie im zweiten Stock waren, hielt David, der die Kerze trug, an und sagte:
»Gott wird aus mir e starken Mann machen. Dann werd’ ich Ihnen zahlen.«
Friedrich war von dem Ton und den Worten des Kleinen überrascht. Es war etwas eigentümlich Festes, Reifes in seiner Art.
»Wie alt bist du?«, fragte er ihn.
»Mir scheint, zehn Jahr’«, antwortete David.
»Was willst du werden?«
»Lernen will ich. Viel lernen!«
Friedrich seufzte unwillkürlich.
»Und glaubst du, dass das genügt?«
»Ja!«, sagte David. »Ich hab’ gehört, wenn man gelernt hat, is’ man stark und frei. Gott wird mir helfen, dass ich lernen kann. Dann werd ich mit meine Eltern und Mirjam nach Eretz Israel gehn.«
»Nach Palästina?«, fragte Friedrich erstaunt. »Was willst du dort?«
»Das is’ unser Land. Dort können wir glücklich werden!«
Der arme Judenjunge sah gar nicht lächerlich aus, als er sein Zukunftsprogramm energisch in zwei Worten angab. Friedrich musste an die läppischen Humoristen Grün und Blau denken, die über den Zionismus ihre schalen Witze rissen.
David fügte noch hinzu:
»Und wenn ich etwas hab’, werd’ ich Ihnen zahlen.«
»Ich hab’ ja das Geld nicht dir gegeben, sondern deinem Vater«, meinte Friedrich lächelnd.
»Was man mei’ Taten gibt, hat man mir gegeben. Ich werd’ es zahlen – Gutes und Schlechtes.«
David sagte es energisch und ballte seine kleine Faust gegen die Hausmeisterwohnung, vor der sie jetzt angelangt waren.
Friedrich legte seine Hand auf das Haupt des Jungen:
»Möge dir der Gott unserer Väter beistehen!«
Und er wunderte sich selbst über seine Worte, nachdem er sie gesprochen hatte. Seit den Tagen der Kindheit, da er mit seinem Vater zum Tempel gegangen war, hatte Friedrich vom »Gott unserer Väter« nichts mehr gewusst. Diese merkwürdige Begegnung aber weckte das Alte, Vergessene in ihm auf, und sekundenlang überflog ihn ein Heimweh nach dem starken Glauben der Jugendzeit, in der er mit dem Gott der Väter noch in Gebeten verkehrte.
Der Hausmeister schlurfte heran. Friedrich sagte ihm:
»Von jetzt ab werden Sie diese armen Leute in Ruhe lassen – sonst haben Sie es mit mir zu tun! Verstanden?«
Da diese Worte von einem neuerlichen Trinkgelde begleitet waren, begnügte sich der Grobe, ein »Küss d’ Hand, Euer Gnaden!« zu murmeln. Friedrich gab dem kleinen David die Hand und trat auf die einsame Lände hinaus.
4
In dem Brief, den Friedrich von dem N. O. Body der Zeitungsannonce erhalten hatte, war ein vornehmes Hotel auf der Ringstraße als Ort der Zusammenkunft angegeben. Um die bezeichnete Stunde fand er sich ein und fragte nach Mister Kingscourt. Man verwies ihn an einen Salon des ersten Stockes. Als er eintrat, kam ihm ein hoher breitschultriger Mann entgegen:
»Sind Sie Doktor Löwenberg?«
»Der bin ich.«
»Nehmen Sie einen Stuhl, Doktor!«
Sie setzten sich. Friedrich betrachtete den Fremden aufmerksam und wartete auf dessen Erklärungen. Mr. Kingscourt war ein Mann in den Fünfzigern, mit ergrauendem Vollbart und dichtem braunen Haupthaar, das von Silberfäden durchzogen war und an den Schläfen schon weiß schimmerte. Er rauchte in langsamen Zügen eine große Zigarre.
»Rauchen Sie, Doktor?«
»Jetzt nicht«, gab Friedrich zur Antwort.
Mr. Kingscourt hauchte mit Sorgfalt einen Rauchring in die Luft, folgte der Auflösung der wolkigen Linien mit Spannung, und erst nachdem sie ganz verschwebt waren, sagte er, ohne seinen Gast anzusehen:
»Warum sind Sie lebensüberdrüssig?«
»Darüber gebe ich keine Auskunft«, erwiderte Friedrich ruhig.
Mr. Kingscourt sah ihn jetzt voll an, nickte zustimmend, streifte die Asche seiner Zigarre ab und sprach:
»Hol’s der Deibel, Sie haben recht. Das geht mich ja auch nichts an ... Wenn wir handelseins werden, wird schon die Zeit kommen, wo Sie es mir erzählen. Einstweilen will ich Ihnen sagen, wer ich bin. Mein eigentlicher Name ist Königshoff. Ich bin ein deutscher Edelmann. Ich war in meiner Jugend Offizier, aber der Waffenrock wurde mir zu eng. Ich kann’s nicht leiden, dass ein fremder Wille über mir ist, und wär’s der beste. Das Gehorchen war gut für ein paar Jahre. Aber dann musste ich fort. Ich wär’ sonst explodiert und hätte Schaden angerichtet ... Ich ging nach Amerika, nannte mich Kingscourt, erwarb mir in zwanzig Jahren blutschwitzender Arbeit ein Vermögen – und als ich so weit war, nahm ich ein Weib ... Was sagen Sie, Doktor?«
»Nichts, Mr. Kingscourt!«
»Gut. Sie sind unverheiratet?«
»Jawohl, Mr. Kingscourt ... Aber ich dachte, Sie würden mir sagen, worin das letzte Experiment besteht, das Sie mir vorzuschlagen haben.«
»Ich bin schon dabei, Doktor ... Wenn wir beisammenbleiben sollten, werde ich Ihnen ausführlich erzählen, wie ich es anfing, mich hinaufzuarbeiten, bis ich meine Millionen hatte. Denn ich habe Millionen ... Was sagen Sie?«
»Nichts, Mr. Kingscourt.«
»Energie ist alles, Doktor! Darauf kommt’s an. Was man recht stark will, das erreicht man unbedingt todsicher. Ich sah erst drüben in Amerika ein, was wir Europäer für ein faules, willenloses Gesindel sind. Hol mich der Deibel! ... Kurz, ich hatte Erfolg. Aber als ich so weit war, da begann ich meine Einsamkeit zu fühlen. Der Zufall wollte es, dass ein Königshoff Dummheiten gemacht hatte, der bei der Garde stand, ein Sohn meines Bruders. Ich nahm den Burschen zu mir, gerade um die Zeit, da ich auf Freiersfüßen ging. Ja, ich wollte mir einen Hausstand gründen, einen Herd, eine Frau suchen, die ich mit Juwelen behängen konnte wie jeder andere Parvenü. Ich sehnte mich nach Kindern, damit ich doch wisse, warum ich stets so furchtbar geschuftet hatte. Ich meinte es verdammt schlau anzufangen, indem ich ein armes Mädchen zur Frau nahm. Sie war die Tochter eines meiner Angestellten. Hatte ihr und ihrem Vater viel Gutes erwiesen. Natürlich sagte sie Ja. Das hielt ich für Liebe, aber sie war nur dankbar oder vielleicht feige. Sie wagte nicht, mich abzuweisen. So richteten wir ein Haus ein, und mein Neffe wohnte bei uns. Sie werden sagen, dass es eine Dummheit war – ein alter Mann zwischen zwei jungen Leuten, die sich finden mussten. Ich habe mich auch in der ersten Zeit nach der Entdeckung einen Esel gescholten. Aber wenn nicht er, wäre es ein anderer gewesen. Kurz, die beiden haben mich betrogen – ich glaube, vom ersten Augenblick an. Als ich es herausfand, war mein erster Griff nach dem Revolver. Dann sagte ich mir, dass eigentlich nur ich der Schuldige war. Da ließ ich sie laufen. Gemeinheit ist menschlich, und jede Gelegenheit ist eine Kupplerin. Man muss den Menschen ausweichen, wenn man an ihnen nicht zugrunde gehen will. Sehen Sie, das war mein Zusammenbruch. Da schlich der Gedanke heran, mit einer Kugel der schäbigen Komödie des Lebens ein Ende zu machen. Aber es fiel mir ein, dass man zum Erschießen ja noch immer Zeit hat. Freilich, das Anhäufen von Geld war jetzt für mich sinnlos geworden. Zum Erwerben hatte ich keine Lust mehr, vom Traum der Familie hatte ich genug. Blieb noch die Einsamkeit als letztes Experiment. Aber eine große, unerhörte Einsamkeit musste es sein. Nichts mehr wissen von den Menschen, ihren elenden Kämpfen, Unsauberkeiten, Treulosigkeiten. Die wirkliche, echte, tiefe Einsamkeit ohne Wunsch und Ringen. Die volle wahre Rückkehr zur Natur! Diese Einsamkeit ist das Paradies, das die Menschen durch ihre Schuld verloren haben. Und diese Einsamkeit habe ich gefunden.«
»So? Sie haben sie gefunden?«, sagte Friedrich, der noch nicht erriet, worauf der Amerikaner hinauswollte.
»Ja, Doktor, ich habe meine Geschäfte aufgelöst und bin meinen Bekannten wieder einmal entronnen. Niemand weiß, wo ich hingekommen bin. Habe mir eine gute Jacht gebaut und bin auf ihr verschollen. Viele Monate bin ich auf den Meeren umhergetrieben. Das ist ein herrliches Leben, müssen Sie wissen. Möchten Sie das nicht kennenlernen? – Oder kennen Sie es schon?«
»Ich kenne es nicht«, entgegnete Friedrich, »aber ich möchte wohl!«