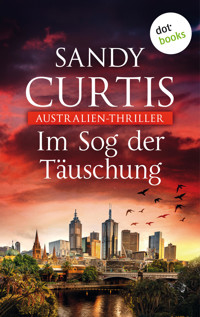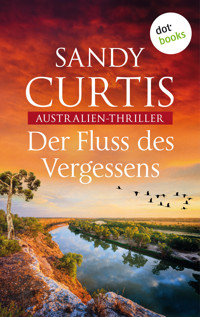6,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Eine atemlose Jagd durch Australien: Der packende Sammelband »Am Abgrund der Vergeltung & Im Sog der Täuschung« von Sandy Curtis als eBook bei dotbooks. Vor den grauenhaften Ereignissen ihrer Vergangenheit flieht die junge Libby nach Brisbane: Instinktiv will sie Schutz in jenem Haus suchen, in dem sie ihre glücklichsten Kindheitsmomente verbracht hat – doch dort öffnet ihr ein Unbekannter die Tür. Wer ist der charmante Professor Connor Martin – und welches Geheimnis verbirgt er vor Libby? Dunkle Schatten lauern auch in der Vergangenheit der jungen Wissenschaftlerin Breeanna. Nur dank des Ex-Soldaten Rogan McKay kann sie ihren gnadenlosen Verfolgern entkommen. Doch wer ist es, der im Verborgenen Jagd auf Breeanna macht – und welchen Preis muss sie für ihr Leben bezahlen? »Sandy Curtis ist die australische Königin der Romantikthriller! Hervorragend geschrieben, sehr schnell getaktet – und mit erotischen Szenen, die immer wieder überraschen!« Aussie Book Review Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Australien-Thriller-Bundle »Am Abgrund der Vergeltung & Im Sog der Täuschung« von Sandy Curtis wird alle Fans von Lisa Jackson und Sandra Brown begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 804
Ähnliche
Über dieses Buch:
Vor den grauenhaften Ereignissen ihrer Vergangenheit flieht die junge Libby nach Brisbane: Instinktiv will sie Schutz in jenem Haus suchen, in dem sie ihre glücklichsten Kindheitsmomente verbracht hat – doch dort öffnet ihr ein Unbekannter die Tür. Wer ist der charmante Professor Connor Martin – und welches Geheimnis verbirgt er vor Libby? Dunkle Schatten lauern auch in der Vergangenheit der jungen Wissenschaftlerin Breeanna. Nur dank des Ex-Soldaten Rogan McKay kann sie ihren gnadenlosen Verfolgern entkommen. Doch wer ist es, der im Verborgenen Jagd auf Breeanna macht – und welchen Preis muss sie für ihr Leben bezahlen?
Über die Autorin:
Sandy Curtis lebt an der Küste des australischen Bundesstaates Queensland. Die Mutter von drei erwachsenen Kindern hat in den verschiedensten Bereichen gearbeitet – doch seit sie als junges Mädchen ihre erste Geschichte geschrieben hat und es ihr sogar gelang, für die Recherche dazu von der örtlichen Polizei eingeladen zu werden, stand ihr Herzenswunsch fest, als Spannungsautorin erfolgreich zu werden.
Bei dotbooks erschienen Sandy Curtis‘ Thriller der locker zusammenhängenden Spannungsserie »Australian Heat« mit den unabhängig voneinander lesenswerten Bänden »Das Tal der Angst«, »Der Fluss des Vergessens«, »Im Meer der Furcht«, »Am Abgrund der Vergeltung« und »Im Sog der Täuschung« sowie der Einzelband »Der Sturm der Rache«.
Die ersten drei Bände von »Australian Heat« sind außerdem als Sammelband unter dem Titel »Im Feuer der Gefahr« erschienen.
Die Website der Autorin: www.sandycurtis.com
***
Sammelband-Originalausgabe Dezember 2023
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Die australische Originalausgabe von »Am Abgrund der Vergeltung« erschien erstmals 2004 unter dem Originaltitel »Until Death«; Copyright © 2005 Sandy Curtis; Copyright © 2006 Verlagsgruppe Lübbe GmbH Co. KG, Bergisch Gladbach; Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München.
Die australische Originalausgabe von »Im Sog der Täuschung« erschien erstmals 2005 unter dem Originaltitel »Dangerous Deception«; Copyright © 2005 by Sandy Curtis; Copyright © 2007 Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach; Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: dotbooks GmbH
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98690-807-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Am Abgrund der Vergeltung & Im Sog der Täuschung« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sandy Curtis
Am Abgrund der Vergeltung
Im Sog der Täuschung
Zwei Australien-Thriller in einem eBook
Aus dem Englischen von Cécile G. Lecaux
dotbooks.
Am Abgrund der Vergeltung
Aus dem Englischen von Cécile G. Lecaux
Gefangen in einem Albtraum, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint … Die weit aufgerissenen Augen ihrer Mutter, im Todeskampf erstarrt – dieses schreckliche Bild kann Libby Taylor einfach nicht vergessen, während sie vor den Männern flieht, die auch ihr nach dem Leben trachten. Instinktiv will sie Schutz in jenem Haus in Brisbane suchen, in dem sie ihre glücklichsten Kindheitsmomente verbracht hat, doch dort öffnet ihr ein Unbekannter die Tür … Der junge Professor Connor Martin traut seinen Augen kaum, als ihm die ebenso schöne wie verängstigte Fremde in die Arme taumelt. Selbstverständlich will er ihr helfen – aber bringt er sie damit möglicherweise in noch größere Gefahr? Denn Connor hat tief in seiner Seele ein Geheimnis begraben, das nun mit ungeahnter Macht in sein Leben zurückdrängt …
Prolog
Imena hatte Mühe, mit ihrer Mutter Schritt zu halten, und zerrte ihre kleine Schwester ungeduldig an der Hand hinter sich her. Ihre staubigen Füße verfingen sich immer wieder in den mit Flechten überzogenen Ranken, die den wenig benutzten Trampelpfad überwucherten.
Im dichten Unterholz raschelte es.
Imena blickte sich nervös um, und ihr Magen schien sich vor Furcht zu verkrampfen. Die dichten Baumkronen über ihnen bildeten zusammen mit dem Dickicht einen düsteren, stickigen Tunnel, und sie schmeckte heißen, salzigen Schweiß auf den Lippen.
Sie versuchte, die Erinnerung an den Leichnam ihres Vaters zu verdrängen. Die Machete hatte sein Gesicht gespalten, und die verdrehten Augen in der grausigen Fratze hatten sich weiß von seiner schwarzen Haut abgehoben, die Gehirnmasse, die einst den Verstand des einfachen Bauern gebildet hatte, war zum Festessen für die Ameisen geworden. Imena kämpfte tapfer gegen den Schmerz an, der sich wie ein eiserner Panzer um ihre Brust gelegt hatte. Mit sieben Jahren war sie die älteste von den Kindern. Sie musste ihrer Mutter helfen, ihre Schwester und ihren kleinen Bruder zu versorgen. Sie musste stark sein.
Das Baby fing an zu weinen. Die nackten Füße ihrer Mutter wurden langsamer; sie nestelte an ihrer Kleidung und legte den Säugling an die Brust. Imena wusste, dass sie nicht rasten konnten. Ihre Mutter hatte gesagt, die abtrünnigen Soldaten könnten überall sein. Sie mussten weiter, und sie mussten leise sein.
Leises Schmatzen löste das Weinen des Babys ab, und der Druck auf Imenas Magen ließ etwas nach. Ihre Mutter wurde wieder schneller und folgte einem Bogen des gewundenen Pfades. Ein leises Schluchzen ihrer kleinen Schwester klang unnatürlich laut in Imenas Ohren. Ein Ruck an ihrer Hand veranlasste sie, nach unten zu schauen. Das spitze Ende eines herabgefallenen Astes hatte den Fuß des Mädchens seitlich durchbohrt und war in der Wunde gesplittert. Die großen dunklen Augen schwammen in Tränen, aber die Kleine biss tapfer die Zähne zusammen.
Imena hockte sich hin und zog hastig die Splitter aus der Wunde, bis sie sich sicher war, dass keine Fremdkörper mehr in dem Fleisch steckten.
Noch bevor sie dazu kam, sich wieder aufzurichten, explodierte der Wald um sie herum. Die Druckwelle der Detonation versetzte ihr einen Schlag in die Magengrube, und der Knall hallte noch in ihren Ohren nach, lange nachdem sie rückwärts ins Dickicht geschleudert worden war.
»Ich traue unserem Führer nicht, Patrick.«
Rashods tiefe Stimme war nur ein Flüstern, nicht mehr als eine Reihe von gepressten Tönen, die sich in der Brise verloren, als sie eine sonnige Lichtung überquerten und gleich darauf wieder in den Wald eintauchten. Patrick nickte, aber seine Miene drückte aus, dass sie im Augenblick keine andere Wahl hatten, als dem Mann zu folgen, der geschickt worden war, um sie durch den Urwald zu einem anderen Grenzübergang zu führen. Ihre Fahrzeuge hatten sie zurücklassen müssen, nachdem ihr Kontaktmann sie gewarnt hatte, dass die Regierungstruppen ihr Ziel kannten und sie am ursprünglich vorgesehenen Grenzübergang in die gestellte Falle laufen würden.
Mit einem zutiefst unzufriedenen Stirnrunzeln verlängerte Rashod den Schritt und reihte sich wieder hinter ihrem Führer ein. Patrick warf einen Blick zurück auf den jungen Mann hinter sich. Wie Patrick und Rashod trug auch Marty ein Jagdgewehr bei sich, dazu einen kleinen Rucksack und auf dem Kopf einen Hut. Nur die Tarnhosen, das schwarze, ärmellose Shirt und die AK 47, die ihr Führer quer vor der Brust hielt, verrieten, dass es sich nicht um eine harmlose Jagdgesellschaft handelte, die auf weitere Trophäen für die Privatsammlung daheim aus war.
Eine halbe Stunde verstrich, in der keiner der Männer einen Ton sagte. Dann machte Rashod plötzlich Halt, hob schnuppernd die Nase und pfiff leise, um den Führer auf sich aufmerksam zu machen. Der Mann drehte sich um, die Augen ängstlich geweitet und der ganze Körper sichtlich angespannt. Rashod zog einen Revolver aus einer Art Halfter an seinem Gürtel. Er bedeutete den anderen zu bleiben, wo sie waren, und trat dann leise seitlich ins Unterholz. Sekunden später hatte der Wald ihn verschluckt.
Die anderen drei warteten. Patrick mit unerschütterlicher Ruhe, da die Erfahrung ihn gelehrt hatte, dass gedankenloses Handeln den Tod bedeuten konnte, der Führer misstrauisch und wachsam und Marty ungeduldig, mit einer Erschöpfung kämpfend, die über das Körperliche hinausging.
Patrick beobachtete den jungen Mann aufmerksam, wenn auch nur ein kaum merkliches Stirnrunzeln seine Sorge verriet. Irgendetwas beschäftigte den Jungen, aber er kam einfach nicht dahinter, was es war. Marty war nicht direkt mürrisch, aber ... Beinah hätte Patrick geseufzt. In den vergangenen zwei Jahren hatte er sich bemüht, eine Beziehung zu dem jüngeren Mann aufzubauen, aber in letzter Zeit war Marty noch wortkarger und abweisender gewesen als sonst. Er entwickelte sich zu einem Risikofaktor.
Marty verlor die Geduld. Er stieß sich von dem Baum ab, an dem er gelehnt hatte, und ging weiter den Pfad hinunter.
»Marty!«, zischte Patrick leise, aber mit einer Schärfe, die den jungen Mann veranlasste stehen zu bleiben. Marty presste die Lippen fest zusammen, dann öffnete er den Mund, als wolle er etwas sagen, aber Rashod trat etwas weiter vorn lautlos zurück auf den Weg, und der zornige Ausdruck auf seinem Gesicht verhinderte die drohende Auseinandersetzung.
Rashod packte mit einer kraftvollen Pranke die Kehle ihres Führers und drückte dem Mann den Revolver so fest an die Wange, dass er vor Schmerz aufschrie.
»Wolltest du mit uns zusammen sterben?«, zischte Rashod, wobei sich Speicheltropfen in seinem Bart verfingen, »oder wolltest du dich davonstehlen und uns allein in den Tod laufen lassen?«
Der Führer schüttelte den Kopf, soweit der Lauf des Revolvers es ihm erlaubte, und gab sich völlig ahnungslos. Patrick ging langsam zu ihnen hinüber, einen fragenden Ausdruck auf dem Gesicht.
»Jemand war vor uns hier. Landminen. Offensichtlich für uns bestimmt, aber glücklicherweise sind Einheimische vor uns hier durchgezogen.« Der Revolverlauf bohrte sich noch fester in das Fleisch ihres Führers. »Uns wurde gesagt, dieser Pfad würde nicht mehr von Einheimischen benutzt, seit euer Anführer es verboten hat.«
Der Mann nickte heftig. Angstschweiß rann ihm in Bächen über die ebenholzfarbenen Wangen. Rashod stieß ihn zu Boden, entwaffnete ihn und zog ihn dann gleich darauf wieder auf die Füße.
»Du wirst uns um die Minen herumführen, dann lasse ich dich gehen, sobald wir die Grenze erreicht haben. Schaffst du das nicht, sterben wir gemeinsam.«
»Können wir nicht umkehren?«, fragte Marty.
Rashod wirbelte herum. »Meinst du wirklich, man würde uns im Lager mit offenen Armen empfangen, nachdem sie versucht haben, uns in die Luft zu jagen?« Mit einem verächtlichen Schnauben stieß er den Führer vor sich her den Pfad hinunter. Mit den Gewehren im Anschlag folgten Patrick und Marty in einigen Schritten Entfernung.
Kurz darauf hatten sie den Schauplatz der Explosion erreicht. Zerfetztes Blattwerk, Baumstämme, gespickt mit Metall- und Gesteinssplittern, und dazu zwei Leichen. Beide Unterschenkel sowie der linke Arm der Frau fehlten, und das, was von ihrem Kleid übrig geblieben war, war mit Blut getränkt. Ihre linke Brust war entblößt und unbegreiflicherweise von der grausamen Verstümmelung völlig verschont geblieben, wies nicht die geringste Spur von Blut oder Schmutz auf. Ganz in ihrer Nähe lag ein Säugling, unversehrt, abgesehen vom rechten Arm, der in Höhe der rechten Schulter abgerissen worden war. Fliegen erfüllten die Luft mit einem monotonen Gesumme, und Ameisen krabbelten bereits über die toten Körper.
Patrick fuhr herum, als er Martys schockierten Aufschrei hörte. Der junge Mann war unter der olivfarbenen Haut kreidebleich geworden. Sein Adamsapfel hüpfte auf und ab, und er schluckte krampfhaft, verzweifelt gegen den Brechreiz ankämpfend. Patrick berührte leicht seinen Arm. »Sie sind tot, Marty. Wir müssen weiter.«
»Und das zügig«, knurrte Rashod und schob den Führer ins Unterholz. »Wenn wilde Schweine in der Nähe sind, werden sie rasend bei der Aussicht auf dieses Festessen. Ich habe schon erlebt, wie sie einen Leoparden von einer solchen Beute vertrieben haben. Wir schlagen uns ins Gebüsch und kehren in einem weiten Bogen zurück auf den Pfad.« Er warf einen Blick auf die Tote. »Wenn sie es bis hierher geschafft hat, müsste der Weg dahinter eigentlich sicher sein.«
Mit zögernden Schritten und zitternden Händen bahnte sich der Führer einen Weg durch das Dickicht. Rashod folgte dichtauf, aber Patrick gab Marty ein Zeichen, und sie warteten, bis die beiden anderen ein Stück weiter wieder den Pfad betreten hatten.
Aus dem Unterholz gegenüber drang ein Wimmern. Marty stürzte vor und blieb gleich darauf abrupt stehen. Zwei Mädchen lagen in den niedergedrückten Büschen. Das ältere der beiden Kinder hielt den leblosen, verstümmelten Körper des jüngeren Mädchens in den Armen. Dabei bewegte es seinen Kopf mit einem gequälten Laut aus seinem zerschmetterten Mund mechanisch auf und ab. Die Schrapnells hatten den Körper des Mädchens verschont, ihm aber mehrere Zähne ausgeschlagen, die Oberlippe fortgerissen und an der Wange eine klaffende Wunde hinterlassen, durch die der blanke Knochen hindurchschimmerte.
Das Mädchen verstummte, als es den Fremden bemerkte, und in der plötzlichen Stille war nur noch Martys keuchender Atem zu hören. Er legte das Gewehr auf den Boden und näherte sich den beiden Kindern ganz langsam, um sie nicht zu erschrecken.
»Nicht, Marty!« Patricks Aufschrei brach ab, als Rashods Arm gegen seine Brust schlug und ihn daran hinderte, Marty zu folgen.
Marty setzte zielstrebig einen Fuß vor den anderen. Das Hemd spannte sich an den Schultern, die Muskeln ganz verkrampft vor Nervosität. Schließlich kniete er neben dem Mädchen nieder und sah das nackte Grauen in den geweiteten Augen.
»Schon gut, Kleines«, sagte er beschwichtigend, ohne die Schritte hinter ihm zu beachten. »Ich will dir nichts tun. Ich möchte dir nur helfen.«
Das Mädchen schien sich ein wenig zu entspannen, aber gleich darauf weiteten sich seine Augen wieder, als ein tief gebräunter Arm an Marty vorbeilangte. Rashod packte das Mädchen an den Haaren, bog seinen Kopf zurück und schnitt ihm die Kehle durch.
Entsetzt und machtlos sah Marty zu, wie das Kind verblutete. Als die Kleine tot war, schlug er rasend vor Wut nach Rashod, der überrascht rückwärts taumelte, sich aber sofort wieder fing und Marty einen gezielten Faustschlag versetzte, der diesen glatt von den Füßen riss.
Als der junge Mann zu Boden sackte, blickte Rashod stirnrunzelnd auf Patrick, der sich ihnen näherte. »Du bist für ihn verantwortlich, Patrick. Wir brechen in dreißig Sekunden auf. Sieh zu, dass er bis dahin wieder fit ist.«
Patrick spritzte dem Bewusstlosen Wasser aus seiner Feldflasche ins Gesicht. Marty kam rasch wieder zu sich, anfangs noch benommen, aber schon Sekunden später trat ein Ausdruck mörderischer Wut auf sein Gesicht. Er rappelte sich taumelnd auf. Patrick legte ihm begütigend eine Hand auf den Arm. »Lass gut sein, Marty. Rashod würde keine Sekunde zögern, dir das Licht auszublasen.«
»Warum? Die Kleine ...« Seine Stimme brach, und er schüttelte unwillig Patricks Hand ab. »Wir hätten sie mitnehmen und jenseits der Grenze in ein Krankenhaus bringen können.«
»Nein. Sie hätte gewusst, dass ein Rebell uns geführt hat. Außerdem war es besser so«, fuhr Patrick achselzuckend fort. »Kein Mann hätte sie je geheiratet, und so entstellt, wie sie war, hätte sie sich nicht mal als Hure durchschlagen können.«
Er sah dem jungen Mann ins Gesicht.
In den dunklen Augen stand so lodernder Hass, dass Patrick einen flüchtigen Moment den bitteren Geschmack der Angst spürte. Er ließ die Hand sinken, die er in einer besänftigenden Geste halb erhoben hatte, und kehrte zurück zu Rashod und dem Führer.
Kapitel 1
Vierzehn Jahre später
Die Spritze reflektierte das Wohnzimmerlicht, als Wesley Scanlan sie zu den Ampullen in das Kästchen zurücklegte, das er von seinem Freund bekommen hatte.
»Und du bist dir sicher, dass es funktioniert?«
Der andere Mann lächelte. »Klar. Ich habe mich oft genug persönlich von der Wirkung überzeugen können. Von der Tablette, die du ihr in den Drink gibst, wird sie sich benommen und desorientiert fühlen. Du bringst sie nach oben ins Schlafzimmer und schließt die Tür ab. Falls sie sich erholt und es dir nicht gelingt, ihr vor meinem Eintreffen am nächsten Morgen eine zweite Tablette zu verabreichen, nimmst du das.« Er nickte in Richtung des Kästchens, das Wesley auf den Couchtisch gelegt hatte. »Es ist alles arrangiert. Samstagabend bist du ein verheirateter Mann, und wir haben ausgesorgt.«
»Das will ich verdammt noch mal hoffen«, brummte Wesley. Er ließ den Blick durch den großzügigen Raum mit dem eleganten Rosenholz-Mobiliar, dem dickflorigen, cremefarbenen Teppich und der spektakulären Aussicht auf den Hafen von Sydney schweifen. »Ich habe zu hart gearbeitet, um dort hinzukommen, wo ich heute bin. Das lasse ich mir von einem verfluchten, rührseligen Samariter nicht kaputtmachen.«
Der zweite Mann im Raum blickte an ihm vorbei und betrachtete die funkelnden Lichter einer Fähre auf dem dunklen Wasser, ehe das Schiff sich vor die grellbunte Kulisse des Luna Parks auf der anderen Hafenseite schob. Er legte Wesley eine Hand auf die Schulter. »Keine Bange, das werde ich zu verhindern wissen.«
Laute Stimmen drangen durch den Nebel, der ihre Sinne einhüllte wie Watte.
Libby wollte den Kopf schütteln, um wieder klar denken zu können, verzichtete jedoch darauf, als ihr jetzt sofort speiübel wurde. Stattdessen blieb sie ganz still liegen und bot ihre ganze Willenskraft auf, um sich zu konzentrieren und die Kontrolle über ihren Körper zurückzuerlangen.
Ganz langsam öffnete sie die Augen. Decke und Wände wankten, und sie wartete reglos ab, bis das Schaukeln aufhörte. Wie wabernde Dunstschleier drang das Erkennen in ihr benebeltes Hirn. Ihr Schlafzimmer. Außerhalb des Lichtkreises der Leselampe lag der Raum im Dunkeln. Als sie die Hand an die Stirn hob, registrierte sie, dass sie zitterte.
Eine der Stimmen wurde lauter. Sie bemühte sich zu verstehen, was gesagt wurde, aber offenbar hatte ihr Hirn verlernt, Laute zu interpretieren.
Die Stimmen verstummten abrupt. Wie in Zeitlupe drehte Libby sich auf die Seite, richtete sich ebenso langsam auf und schob erst das eine, dann das andere Bein von der Matratze, bis sie schließlich auf der Bettkante saß. Sie verlagerte das Gewicht auf die nackten Füße, die Beine hüftbreit gespreizt, weil sie hoffte, so leichter die Balance halten zu können. Den ersten Versuch aufzustehen musste sie abbrechen, als ihr sofort schwindlig wurde. Nach einer Weile probierte sie es jedoch wieder, und diesmal schaffte sie es.
Sie überlegte angestrengt, was mit ihr los sein mochte. Was war geschehen? Sie fühlte sich, als hätte sie einen Mordskater, dabei hatte sie nur zwei Drinks gehabt. Danach ...
Erinnerungsfetzen gingen ihr durch den Kopf, allerdings so wirr und zusammenhanglos, dass sie keinen Sinn machten. Ihrer Benommenheit nach zu urteilen, musste sie sich eine der aggressiven Viruserkrankungen eingefangen haben, die Sydney in diesem Winter heimgesucht hatten.
Unsicheren Schrittes steuerte sie die halb offen stehende Tür an und stolperte hinaus auf den Flur. Auf dem oberen Absatz der langen, breiten Treppe lehnte sie sich an die Wand und überlegte, ob es nicht zu gefährlich war, alleine hinunterzugehen. Dann fiel ihr Blick auf die Szene am Fußende der Treppe.
Zwei Männer beugten sich über eine auf dem Boden liegende Frau. Der Hinterkopf der Frau war blutverschmiert, das Gesicht auf die Seite gedreht, als schaue sie Hilfe suchend zur Haustür.
Ihre Mutter.
Der Schock traf Libby wie ein Schlag in die Magengrube. Sie bekam weiche Knie und stützte sich mit beiden Händen an der Wand ab, um nicht zu fallen. Einer der beiden Männer sagte etwas, und sie schnappte die Worte tot und blöd auf. Gleich darauf drehte sich ihr der Magen um, als ein Teil der Antwort des zweiten Mannes zu ihr nach oben drang. »Libby hat sie umgebracht.«
Sie schüttelte den Kopf und öffnete den Mund, brachte aber keinen Ton über die Lippen. Der erste der beiden Männer richtete sich auf. Sie sah ein Pistolenholster an seiner Hüfte, und etwas Glänzendes hing an seinem Gürtel. Eine Marke? Polizei? Ein Polizist. O Gott! Was hatte sie getan? Sie musste ihm sagen, dass sie nicht ... dass sie unmöglich ...
»Jetzt haben wir keine andere Wahl mehr«, sagte er. »Wir müssen Libby noch heute Nacht aus dem Weg räumen, sonst geht alles den Bach runter.«
»Heute Nacht? Dazu ist es noch zu früh. Wir haben doch vereinbart, sie erst Dienstag zu beseitigen«, entgegnete der Mann mit der vertrauten Stimme.
Libby starrte auf seinen Hinterkopf und versuchte, die Stimme zuzuordnen, aber ihr schockiertes Hirn versagte immer noch den Dienst. »Noch können wir es so einrichten, dass es wie ein Unfall aussieht. Sie muss sterben ...«
Die Erwiderung des anderen Mannes nahm Libby nicht mehr wahr, ganz in Anspruch genommen von dem Grauen, das sich ihrer bemächtigte. Sie wollten sie umbringen. Sie musste weg. Sie taumelte den Flur hinunter zurück zu ihrem Schlafzimmer. Die Fronten der Spiegelschränke warfen ihr Spiegelbild zurück, das in einem krassen Kontrast zu den mit Chintz bezogenen Polstermöbeln und den feinen Gardinen stand. Ihr kurzes braunes Haar war völlig zerzaust, Hose und Bluse zerknittert, und in den Augen, die zu ihr zurückstarrten, lag ein irrer Ausdruck.
Hektisch schaute sie sich um und versuchte, sich darüber klar zu werden, was sie als Nächstes tun sollte. Sie blickte an sich hinunter. Schuhe anziehen, befahl ihr Verstand. Kann nicht barfuß gehen. Sie zog eine der Schiebetüren auf, nahm ihre Sneakers heraus, schnappte sich nach einem Blick auf die Frisierkommode ihre Handtasche und kehrte so leise wie möglich zurück zur Tür. Sie warf einen Blick auf den Flur.
Niemand zu sehen. Sie eilte so schnell sie konnte den Gang hinunter, fort von der Treppe. Am Ende des Flurs verschwand sie im hell gefliesten Bad und zog die Tür hinter sich zu. Sie machte kein Licht; der Mondschein, der durch das Fenster hereinfiel, musste genügen. Sie zögerte kurz, ehe sie die Tür eines geräumigen Schranks öffnete. Beim Anblick des dunklen Lochs unterhalb der Regalfächer voller Handtücher wurde ihr erneut ganz flau vor Furcht.
Ihr Verstand sagte ihr, dass es nur der Wäscheschacht war, durch den die Haushälterin die Schmutzwäsche direkt in die darunter liegende Waschküche beförderte. Derselbe Schacht, durch den sie als Kind des Öfteren vor dem Zorn geflüchtet war, der wie ein übler Fluch aus dem Schlafzimmer ihrer Eltern über sie gekommen war. Aber ihr Bauch sagte ihr, dass es ein Tunnel war, ein Tunnel, in dem sie ein Grauen erwartete wie jenes am Fuß der Treppe.
Die Erinnerung an den leblosen Körper ihrer Mutter verlieh ihr die Kraft, die Schuhe in den Gürtel zu stecken und sich dann mit den Füßen voran in die Öffnung zu schieben. Sie war mit dreizehn Jahren das letzte Mal hinuntergeklettert und seitdem nicht mehr viel gewachsen, aber nun kam ihr der Schacht furchtbar eng und lang vor. Sie atmete kurz und stoßweise, und ihr Herz schlug zum Zerspringen.
Sie verlor den Halt und rutschte ab. Unten stieß sie mit den Füßen gegen die andere Tür am Ende des Schachtes, und sie fiel in den großen Rattankorb, in dem die Schmutzwäsche gesammelt wurde. Als sie den Lichtschein sah, der aus der angrenzenden Küche hereinfiel, atmete sie erleichtert auf, und ihr Puls verlangsamte sich ein wenig. Hastig schlüpfte sie in die Sneakers, schnürte sie mit ungeschickten Fingern zu und zog sich dann den langen Schulterriemen ihrer Handtasche über Kopf und Brust.
Sie lief aus dem Haus, um den Swimmingpool herum, und hastete durch die Reihen gepflegter Blumenrabatten, die ihre Mutter erst kürzlich hatte anlegen lassen. Auf einer Seite der parkartigen Gartenanlage ragten die Äste einiger alter Bäume über die hohe Steinmauer, und Libby hielt auf den mittleren dieser Bäume zu.
Sie sandte ein Stoßgebet nach dem anderen gen Himmel, während sie nach den Stufen tastete, die ihr Vater vor so vielen Jahren in den massiven Stamm hatte hauen lassen. Sie fand sie schließlich viel weiter oben als erwartet. Sie kletterte zum ersten dicken Ast hinauf, schwang sich rittlings hinauf und rutschte daran entlang, bis sie sich auf der anderen Seite der Mauer befand. Mit den Jahren hatte sich der Ast unter der Last seines eigenen Gewichtes geneigt, sodass der Abstand zum Boden nicht so hoch war, wie sie befürchtet hatte. Trotzdem knickte sie bei der Landung im Gras um, verlor das Gleichgewicht und stürzte schwer auf eine Schulter.
Sie rappelte sich jedoch gleich auf und rannte durch die Grünanlage, die das Anwesen vom Hafengelände trennte. Als sie ein dichtes Gestrüpp erreichte, das ihr Deckung gab, holte die Panik sie wieder ein. Die Übelkeit, die sie bis dahin hatte unterdrücken können, übermannte sie ebenso wie die Tränen, die ihr unkontrolliert die Wangen hinabliefen. Schließlich stolperte sie völlig erschöpft weiter, kramte ein Taschentuch aus ihrer Handtasche und wischte sich Schweiß und Tränen aus dem Gesicht.
Ihr Verstand schien abzuschalten, und ihr Körper funktionierte wie ferngesteuert, trug sie nur fort von dem Grauen, das ihr Hirn sich zu begreifen weigerte. Erst als ein Auto an ihr vorbeiraste, wurde ihr wieder bewusst, dass sie sich auf einer Straße befand, und sie unternahm einen halbherzigen Versuch, sich zu orientieren. Die Häuser lagen weit zurück, umgeben von unüberwindlichen Steinmauern. In regelmäßigen Abständen warfen Straßenlaternen weiße Lichtkreise auf gepflegte Rasenflächen und glatten Asphalt.
Hinter ihr verlangsamte ein Auto das Tempo und passte sich ihrer Geschwindigkeit an. Als Libby aufging, dass sie möglicherweise verfolgt wurde, wollte sie davonlaufen, aber dann fiel ihr das Schild auf dem Wagendach ins Auge.
Kapitel 2
Normalerweise nahm Joe keine Betrunkenen in seinem Taxi mit, weil die Reinigung des Wagens zu teuer war, wenn jemand sich übergeben musste, aber die junge Frau am Straßenrand tat ihm doch irgendwie Leid. Er kurbelte die Scheibe hinunter und rief sie an.
»Wollen Sie mitfahren? Es ist nicht ungefährlich, nachts allein herumzulaufen. Auch in diesem Viertel.«
Die Fremde wandte sich ihm zu. Ihre Augen waren geweitet vor Furcht, und ihre Kleider sahen aus, als wäre sie auf der Flucht vor einem Kerl, der mehr von ihr wollte, als sie zu geben bereit war. Gott, wenn jemand das bei seiner Tochter versuchte ...
»Steigen Sie ein!«, befahl er. »Es macht nichts, wenn Sie nicht zahlen können. Ich bringe Sie heim.«
Bei diesen Worten zuckte sie zusammen und schüttelte energisch den Kopf.
»Dann an einen sicheren Ort. Los, kommen Sie!«
Er bemerkte, dass sich ihre Züge allmählich entspannten, dann runzelte sie die Stirn, als überlege sie, ob es so etwas wie einen sicheren Ort überhaupt gäbe. Als Joe schon glaubte, sie würde sein Angebot ablehnen, öffnete sie schließlich die Hecktür und stieg schnell ein.
»Wohin?« Er warf ihr im Rückspiegel einen fragenden Blick zu.
»Zum Flughafen«, antwortete sie nach kurzem Zögern leise.
»Zum Flughafen?« Darauf wäre er nicht gekommen, aber sie kramte in ihrer Tasche, förderte eine Geldbörse zutage und schaute hinein.
»Ich kann bezahlen«, sagte sie und fügte dann hinzu: »Bitte«, wie ein Kind, das sich plötzlich daran erinnerte, was sich gehörte.
Joe versuchte auf der Fahrt mehrmals, ein Gespräch mit ihr anzufangen, aber die junge Frau saß einfach nur schweigend da. Manchmal schloss sie die Augen und nickte kurz ein, fuhr aber jedes Mal sofort wieder hoch, warf einen gehetzten Blick um sich und lehnte sich dann sichtlich erleichtert wieder in die Polster zurück.
Er ließ sie am Terminal für Inlandsflüge aussteigen und schaute nur einmal zurück, aber der Anblick ihrer kindlich schlanken, verlorenen Gestalt ließ ihn bis zum Ende seiner Schicht am frühen Morgen nicht mehr los. Als er nach Hause kam, lief Joe schnurstracks ins Zimmer seiner Tochter und betrachtete das schlafende Mädchen noch lange.
Lärm. Zu viel Lärm, der von den harten Böden und der hohen Decke zurückgeworfen wurde. Vorbeihastende Menschen, die sich unterhielten, Libby neugierig musterten und tuschelten. Diese suchte die Damentoilette auf und starrte ihr Spiegelbild an. Ihre Augen versanken förmlich hinter den Wangenknochen, und ihre sonst schon blasse Haut wirkte jetzt beinah durchscheinend. Sie registrierte diese Details ganz bewusst. Mit einer schnellen Bewegung ergriff sie die Bürste, die sie immer bei sich hatte, und begann, ihr Haar in Ordnung zu bringen.
Das Aufblitzen von Gold und Diamanten an ihrer linken Hand erregte ihre Aufmerksamkeit. Ringe. Ein Verlobungs- und ein Ehering. Verwirrt betrachtete sie die Schmuckstücke eine Weile und fragte sich, wie sie dorthin gekommen sein mochten. Dann nahm sie sie ab und steckte sie in die Handtasche.
Am Schalter zückte Libby ihre Kreditkarte und verlangte ein Ticket für den nächsten Flug nach Brisbane. Sie ergatterte mit viel Glück einen Platz an Bord der letzten Maschine, die an diesem Abend von Sydney startete, und noch bevor die Lichter der Stadt unter ihr gänzlich von der Nacht verschluckt wurden, war sie tief und fest eingeschlafen.
»Miss, Sie müssen jetzt aufwachen. Wir sind in Brisbane gelandet.«
Der sanfte Druck auf ihrem Arm und die freundliche, aber nachdrückliche Aufforderung schienen ihr etwas mitteilen zu wollen, was sie jedoch nicht aufnehmen konnte.
»Bris ... Brisbane?«, brachte sie mühsam hervor.
»Ja. Wir sind gelandet. Sie müssen das Flugzeug jetzt verlassen.«
Verwirrt schaute sie sich um und versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Sie befand sich tatsächlich in einem Flugzeug, aber warum nur?
Die Stewardess reichte ihr einen Becher Wasser. »Vielleicht hilft Ihnen das, wach zu werden«, sagte sie freundlich. Das Wasser war wunderbar kalt und erfrischend und machte Libby erst bewusst, wie trocken ihr Mund gewesen war. Sie murmelte ein Dankeschön, erhob sich von ihrem Sitz und verließ wie eine Schlafwandlerin die Maschine. Wie in Trance folgte sie den Hinweistafeln zum Ausgang, bis sie schließlich draußen vor dem Terminalgebäude stand. Die Luft war schwül, und Libby spürte einen ersten Anflug pochender Kopfschmerzen.
Ein gelbes Taxi fuhr vor, und ihr fiel wieder ein, dass sie sich an einen sicheren Ort begeben sollte. War sie deshalb nach Brisbane geflogen? Zu ihrem Großvater? Sie erinnerte sich an eine große Hand, die die ihre hielt. Eine freundliche, dunkle Stimme sagte, sie solle springen, er werde sie auffangen, dann wurde sie von starken Armen gehalten, bevor sie wohlbehalten abgesetzt wurde. Vertrauen. Sie hatte ihm blind vertraut, und er hatte seine Enkelin nie enttäuscht.
Aber sie hatten sich so viele Jahre nicht mehr gesehen. Ihre Mutter ... Schmerz wallte in ihr auf. Ihre Mutter war tot. Und dieser Mann hatte gesagt, sie hätte sie getötet. Das konnte nicht stimmen. Libby mochte ja aufbrausend sein, aber sie hatte hart daran gearbeitet, ihre Temperamentsausbrüche unter Kontrolle zu bringen. Und sie liebte ihre Mutter. Zwar waren sie nie einer Meinung, aber ...
Ein Mann rempelte sie an. Sie fuhr erschrocken zusammen, schaute sich um und bemerkte plötzlich, dass sie ganz vorn in der Taxischlange stand. Erschöpfte Reisende mit mehr oder weniger schwerem Gepäck musterten sie ungeduldig. Hastig stieg sie in den vordersten Wagen. Als das Taxi losfuhr, versuchte sie fieberhaft, sich an die Adresse zu erinnern. Der Name des Bezirks, New Farm, war leicht, aber erst als sie dort waren, fiel ihr der Straßenname wieder ein. Die Hausnummer allerdings wollte ihr Gedächtnis nicht preisgeben.
Bei Tageslicht hätte sie das Haus sicher wiedererkannt, aber bei Nacht und nur schwacher Straßenbeleuchtung kam ihr alles fremd vor. Vielleicht, wenn sie zu Fuß ginge ...
Libby bat den Fahrer anzuhalten, zahlte und schaute dem Taxi hinterher, ehe sie die Häuser rechts und links genauer betrachtete. Nur in einigen wenigen der alten Backsteinhäuser brannte noch Licht. Ausladende Bäume entlang des Gehweges warfen undurchdringliche Schatten auf den Boden, und Libby spürte, wie Furcht in ihr aufstieg. Kalter Schweiß rann ihr den Rücken hinunter, und die Bluse klebte ihr an der Haut.
Das leise Quietschen eines Gartentores veranlasste sie, einen Blick über die Schulter zu werfen. Eine dunkle Gestalt löste sich von einer Hecke, die einen niedrigen Zaun überwucherte, und kam auf Libby zu. Sie ging ein wenig schneller und schaute erneut zurück, als sie in den Lichtschein einer Straßenlaterne eintauchte. Ein Mann näherte sich ihres entschlossenen Schritts. Er trug eine Baseballmütze, die sein Gesicht verbarg, ein schwarzes T-Shirt und schlabberige Jeans. Libby unterdrückte den Impuls davonzulaufen. Es wäre ohnehin sinnlos gewesen; sie war viel kleiner als er und außerdem eine miserable Läuferin.
Zu ihrer Erleichterung ging er jedoch an ihr vorbei. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass sie die Luft angehalten hatte, und sie atmete aus. Bei jedem Haus, an dem sie vorbeikam, nahm ihre Enttäuschung zu. Zweifel an ihrer Erinnerung regten sich. In sechzehn Jahren konnte sich so vieles verändert haben. Hinzu kam, dass sie die Straße nur selten bei Nacht gesehen hatte. Sie war sich ja nicht einmal sicher, ob sie überhaupt in der richtigen Straße war.
Ganz vertieft in ihre Gedanken, bemerkte sie nicht, dass der Mann vor ihr das Tempo verlangsamte. Erst als er nur noch wenige Meter von ihr entfernt war, registrierte sie, dass er angehalten hatte und in der rechten Tasche seiner Jeans kramte. Libby ging noch ein paar Schritte weiter und blieb dann ebenfalls stehen.
Wäre sie nicht so furchtbar müde gewesen, hätte sie sicher rascher reagiert. Andererseits bewegte er sich so schnell, dass sie gerade noch dazu kam, kehrtzumachen, ehe er sie mit einer Hand am Arm packte und mit der anderen nach ihrer Handtasche griff. Libby schlug nach ihm, aber ihre Hiebe wurden von kräftigen Armen und Schultern abgewehrt.
Eine Faust krachte seitlich an ihren Schädel und schleuderte sie zu Boden.
Mit dem Kopf schlug sie hart auf der Bordsteinkante auf.
Kapitel 3
Conor spürte, dass nicht das erste fahle Licht des anbrechenden Tages, das durch die Vorhänge filterte, ihn geweckt hatte.
Da war es wieder. Das dumpfe Pochen des alten Messingklopfers an der Haustür. Er tippte eine Reihe von Zahlen in eine kleine Tastatur auf dem Nachttisch ein, stieg aus dem Bett, schlüpfte in seinen dünnen Frotteebademantel und knotete den Gürtel zu, während er barfuss über die glatt polierten Holzdielen zur Tür ging. Auf dem Monitor der Überwachungskamera sah er eine junge Frau, die an einer der Säulen des überdachten Eingangs lehnte. Sie hielt sich gebeugt, den Kopf gesenkt und leicht schräg, sodass er sich unwillkürlich fragte, ob sie unter Drogen stand. Und ob sie allein war. Er schaltete auf eine zweite Kamera um, die Haustür und Fassade zeigte. Außer der Fremden schien niemand da zu sein. Widerstrebend sperrte er die Haustür auf und öffnete.
Langsam hob die Frau den Kopf. Geronnenes Blut klebte an ihren kurzen Haaren und an einer Gesichtshälfte. Ihre Augen waren blutunterlaufen und ihre Haut unnatürlich bleich. Sie machte einen taumelnden Schritt auf ihn zu, und auf ihre eben noch verwirrten Züge trat ein flehender Ausdruck.
»Wissen Sie ...«, begann sie mit zitternder Stimme. »Wissen Sie ... wer ich bin?«
Die Frage überraschte ihn. »Nein.«
Enttäuscht runzelte sie die Stirn, und geronnenes Blut rieselte auf ihre Augenbrauen.
»Sie kennen ... mich nicht?«
Was sollte das? Conors erster Impuls war gewesen, der Verletzten zu helfen, aber ihre Fragen weckten seinen Argwohn. »Sollte ich das denn?«
Die Frage schien die Fremde aus dem Konzept zu bringen. Sie schwankte leicht, als sie die Schultern straffte und sich umschaute. »Ich weiß nicht«, murmelte sie. »Bitte entschuldigen Sie die Störung.« Sie wandte sich zum Gehen.
Conor verfluchte das Misstrauen, das er bei allem Mitleid mit der zerbrechlichen jungen Frau kaum unterdrücken konnte. Doch er verspürte auch den fast unwiderstehlichen Drang, ihr zu helfen: »Warten Sie!« Die Worte entfuhren ihm wider Willen. »Sie brauchen einen Arzt. Kommen Sie rein!«
Sie sah ihn so angestrengt an, als hätte sie Mühe, ihn zu verstehen, und er fragte sich, ob sie vielleicht schwerer verletzt war, als es auf den ersten Blick den Anschein hatte. »Soll ich jemanden für Sie anrufen?«, fragte er.
»Ich ... ich denke nicht. Ich weiß nicht.«
»Sie müssen medizinisch versorgt werden.« Conor sprach bewusst langsam und deutlich. »Kommen Sie herein! Ich rufe einen Arzt.«
Sie nickte und verzog gleich darauf vor Schmerzen das Gesicht. Dann schlurfte sie an ihm vorbei ins Haus. Sie sah aus, als würde sie jeden Moment zusammenbrechen. »Kommen Sie mit!«, sagte er und berührte sacht ihren Arm. »Im Gästezimmer können Sie sich hinlegen.«
Er sah zu, wie sie gehorsam wie ein artiges Kind in das alte Holzbett stieg. Als sie den Kopf auf das Kissen sinken ließ, schloss sie mit einem Seufzer die Augen. Conor zögerte an der Tür. War sie tatsächlich Opfer eines Unfalls, oder trog der Schein? Er kehrte in sein Schlafzimmer zurück, griff zum Telefon und wählte eine Nummer.
Das Gefühl der Erleichterung hielt nicht lange an. Die hämmernden Kopfschmerzen wurden nicht weniger, und im Liegen nahm die Übelkeit sogar noch zu. Die junge Frau verspürte nicht die geringste Lust, wieder aufzustehen, musste aber ins Bad. Es kostete sie fast übermenschliche Anstrengung, die Tür zu erreichen, und auf dem Flur musste sie sich an der Wand abstützen.
Aus dem Zimmer gegenüber drang eine Stimme. Im ersten Moment war die Verletzte verwirrt: Der Mann sprach kein Englisch, aber sie verstand trotzdem, was er sagte. Spanisch. Kein Dialekt, auch keine Spur des mexikanischen Akzents, den sie gewohnt war, sondern reinstes Kastilisch. Einen Augenblick lauschte sie nur wie gebannt der Sprachmelodie, aber gleich darauf, als es ihr gelang, den Sinn der Worte zu erfassen, versteifte sie sich unwillkürlich.
»Nein, nein«, sagte er. »Sie hat gefragt, ob ich sie kenne, nicht umgekehrt. Sie ist ganz verwirrt. Könnte sie durch die Kopfverletzung vielleicht an Amnesie leiden?«
Hierauf folgte eine kurze Pause, ehe Connor wieder weitersprach. »Nein, ich möchte nicht, dass du herkommst, das wäre zu riskant.« Wieder hielt er kurz inne. »Ein Krankenwagen würde noch mehr Aufsehen erregen.« Er seufzte tief. »Okay. Ich warte auf dich. Ach ja, du solltest vielleicht einen Bluttest machen! Könnte sein, dass sie Drogen genommen hat.«
Als der Mann gerade auflegte, drehte sich ihr vollends der Magen um. Die junge Frau schlug eine Hand vor den Mund und torkelte den Flur hinunter zum Bad. Mit zitternder Hand öffnete sie die Tür und erreichte die Toilette gerade noch rechtzeitig. Sie erbrach jedoch nur eine kleine Menge bitterer Galle, und gleich danach verschwamm alles vor ihren Augen, und sie sank kraftlos zusammen. Kräftige Arme hoben sie jedoch auf und trugen sie zurück zum Bett. Kurz darauf wusch ihr jemand mit einem feuchten Lappen sanft das Gesicht. Sie wollte die Augen öffnen, brachte jedoch nicht mehr die Kraft auf und schlief ein.
Als würde ich mich durch Erbsensuppe kämpfen, dachte Libby, als sie wieder zu sich kam. Grenzenlose Lethargie hatte sie befallen. Ganz am Rande ihres Bewusstseins nahm sie Stimmen wahr, und erst der Umstand, dass sie Spanisch sprachen, erinnerte sie daran, wo sie war. Sie zwang sich jetzt zur Konzentration. Mit geschlossenen Augen blieb sie reglos liegen, als die Stimmen deutlicher wurden und dann plötzlich verstummten. Jemand betrat das Zimmer.
»Ich kann verstehen, warum du dir Sorgen gemacht hast«, sagte einer der Fremden nun auf Englisch, ganz dicht vor ihrem Gesicht. Libby schlug die Augen auf. Das Aussehen des Fremden passte zu seiner Stimme – freundlich und würdevoll. Silbernes Haar, olivfarbener Teint, hohe Wangenknochen. »Ich bin Arzt«, sagte der Mann begütigend. »Ich möchte mir nur ein Bild davon machen, wie schwer Sie verletzt sind, verstehen Sie?«
»Ja.«
Er untersuchte sie mit gezielten, sanften Griffen. Sie zuckte zusammen, als er die Platzwunde seitlich an ihrem Kopf berührte, und warf einen Blick zu dem anderen Mann neben dem Bett. Er war viel jünger als der Arzt, die Haut nicht ganz so dunkel, und sein Haar glänzte wie frischer Teer in der Sonne. Sie hatte noch nie so ausdrucksvolle, dunkle Augen gesehen. Es war der Mann, der sie hereingelassen hatte.
»Sehen Sie auf meinen Finger«, befahl der Arzt, und Libby richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Untersuchung. Der Nebel um ihren Verstand hatte sich etwas gelichtet, und sie versuchte verzweifelt, die Erinnerungsfetzen als Teile eines großen Puzzles wieder zusammenzufügen. Die vergangene Nacht kam ihr jetzt vor wie ein Albtraum, aber sie fürchtete, dass sie nur allzu real ihrer jetzigen Vorstellung entsprochen hatte. Auf grauenvolle Art und Weise. Ihre Mutter musste tot sein; der Anblick ihres zerschmetterten Schädels hatte sich Libby unauslöschlich ins Gedächtnis eingebrannt. Aber sie konnte ihre Mutter unmöglich getötet haben! An eine so grauenhafte Tat würde sie sich bestimmt erinnern, oder? Andererseits, wie konnte das alles passiert sein; ihre Mutter war doch für eine Woche bei einer Freundin zu Besuch gewesen? Panik durchströmte sie, und der Arzt unterbrach seine Untersuchung, als ihr der Atem stockte und ihr Puls sich beschleunigte. Sie kämpfte den Impuls nieder, aus dem Bett zu springen und blindlings davonzulaufen. Wo sollte sie auch hin? Sie hatte niemanden, dem sie vertrauen konnte.
Und dann diese beiden Männer und das Telefonat, das sie belauscht hatte – offenbar wollten sie es um jeden Preis vermeiden, Aufmerksamkeit zu erregen. Warum? Ihnen zu vertrauen könnte sich noch als verhängnisvoller Fehler erweisen. Vielleicht steckten sie sogar mit dem Mann unter einer Decke, den sie hatte sagen hören, sie müsse aus dem Weg geräumt werden. Man konnte nie wissen.
Amnesie. Ihr Retter in der Not hatte dieses Wort vorhin am Telefon erwähnt. Sie würde Gedächtnisverlust vortäuschen, bis sie in Erfahrung gebracht hatte, was genau mit ihrer Mutter geschehen war. Sofern ihr das überhaupt je gelang.
Einige Minuten später fragte der Arzt sie nach ihrem Namen. »Wie heißen Sie?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete sie leise.
»Können Sie sich noch daran erinnern, was Ihnen passiert ist?«
»Nein.« Die Lüge kam ihr ganz leicht über die Lippen.
Der Doktor stellte ihr noch weitere Fragen, auf die sie jedes Mal antwortete, dass sie sich nicht erinnern könne. Schließlich lächelte er freundlich. »Sie brauchen erst einmal viel Schlaf.« Er steckte das Stethoskop zurück in seine Arzttasche.
»Was ist mit der Blutuntersuchung?«, wollte der andere Mann wissen, und Libby fragte sich, was sein Stirnrunzeln zu bedeuten haben mochte.
»Wären Sie damit einverstanden, dass ich Ihnen Blut abnehme, um einige Tests durchzuführen, meine Liebe?«
Libby nickte. »Wenn es dazu beiträgt herauszufinden, was mir passiert ist.« Sie war zu allem bereit, das half, Licht ins Dunkel zu bringen.
»Ich denke, Sie sollten doch zur Polizei gehen. Vielleicht hat Sie ja jemand als vermisst gemeldet.«
Polizei? Die Marke ... der Mann, der gesagt hatte, sie müsse sterben. Wenn sie die Polizei verständigten, würde er sie finden. »Nein!«
Der Arzt schien überrascht davon, wie heftig Libby dies ablehnte. Sie warf einen Blick auf den Hausherrn, sah den nachdenklichen Ausdruck in seinen Augen und fragte sich, was ihm wohl durch den Kopf gehen mochte.
»Conor hat gesagt, Sie hätten keine Handtasche bei sich gehabt«, fuhr der Doktor fort, während er Spritze und Kanüle aus der Tasche nahm. »Vielleicht findet sich in Ihren Hosentaschen etwas, was helfen könnte, Ihre Identität zu klären?«
»Ich habe nachgesehen«, bemerkte Conor, was ihm einen verblüfften Blick von Libby und dem Doktor einbrachte. Er zuckte die Achseln. »Ich habe nur nach einem Hinweis gesucht auf jemanden, den ich benachrichtigen kann.« Er musterte ihre rechte Hand. »Vielleicht gibt es ja auf der Innenseite des Rings eine Gravur?«
Libby blickte auf den silbernen Reif mit dem kaum noch zu erkennenden Ornament, das einen Vogel im Flug darstellte. Ihr Vater hatte ihr den Ring an ihrem dreizehnten Geburtstag geschenkt, nur einen Monat, bevor ... Sie wartete, bis der Doktor mit der Blutabnahme fertig war, ehe sie den Ring vom Finger zog und Conor reichte.
»Für Libby, in Liebe Dad«, las er laut. Er musterte sie mit prüfendem Blick. »Weckt das bei Ihnen irgendeine Erinnerung?«
»Libby.« Sie sprach den Namen aus, als würde sie ihn sorgfältig abwägen. »Das wird dann wohl mein Vorname sein.« Sie betrachtete den hellen Streifen an ihrem Finger. »Offensichtlich trage ich den Ring schon länger.«
»Richtig«, entgegnete Conor, als er ihr den Ring zurückgab. »Sieht ganz so aus.«
Nichts in seinem Tonfall ließ auf Argwohn schließen, aber Libby fühlte instinktiv, dass er ihr misstraute. Ein Gefühl, das auf Gegenseitigkeit beruhte.
»Sie sprechen mit amerikanischem Akzent, der allerdings nicht sehr ausgeprägt ist.« Er runzelte nachdenklich die Stirn. »Vielleicht leben Sie ja schon einige Jahre hier in Australien?«
»Keine Ahnung«, erwiderte Libby, der es zunehmend schwerer fiel zu lügen, auch wenn es aus reinem Selbstschutz geschah. Sie schloss die Augen. »Ich habe Kopfschmerzen. Könnte ich vielleicht etwas schlafen, ehe wir uns weiter unterhalten?«
»Ich gebe Ihnen etwas gegen die Schmerzen«, sagte der Arzt freundlich, aber Conors Anspannung war für Libby greifbar.
»Also, Pascual, was meinst du?«, fragte Conor den Doktor an der Haustür.
»Die Kopfwunde lässt darauf schließen, dass die junge Frau einen ziemlich heftigen Schlag abbekommen hat, aber ich denke eigentlich nicht, dass die Verletzung schwer genug ist, eine totale Amnesie auszulösen. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass es sich um einen posttraumatischen Gedächtnisverlust handelt. Vielleicht ein Ehekrach, und sie wurde von ihrem Mann oder Freund verprügelt. Möglich auch, dass sie überfallen wurde. Ebenfalls nicht auszuschließen ist, dass sie psychisch labil ist oder unter Drogeneinfluss steht. Sie hat Einstiche am Arm, allerdings nicht von der Art, wie man sie bei Süchtigen findet.« Pascual musterte Conor beunruhigt. »Sie braucht ärztliche Hilfe, Conor. Du kannst sie nicht bei dir aufnehmen wie ein herrenloses Kätzchen«, fügte er hinzu, als eine große, grau-weiß getigerte Katze sich vom Sofa im Wohnzimmer erhob und in den Flur stakste.
Conors Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, das allerdings seine Augen nicht ganz erreichte. »Ich glaube kaum, dass man das vergleichen kann.«
»Nein? Du schließt keine Freundschaften, für den Fall, dass du Hals über Kopf verschwinden musst. Damit dich niemand vermisst, wenn du ganz plötzlich weg bist. Das heißt aber auch, dass es niemand gibt, den du vermissen würdest. Du hast dein Herz nur einem halb verhungerten Kätzchen geöffnet, weil es keine Bedrohung darstellt. Du brauchst dich ihm nicht anzuvertrauen; und wenn du gehst, wird es sich ein neues Zuhause suchen. Die Kleine hast du vorhin mit demselben Gesichtsausdruck gemustert, mein Freund. Du bist einsam und hast zu lange ohne die Berührung einer Frau gelebt.« Pascual schüttelte den Kopf. »Aber sie ist kein kleines Kätzchen, und vielleicht macht sich jemand schreckliche Sorgen um sie. Eigentlich sollte ich sie gleich ins Krankenhaus oder zur Polizei bringen.«
»Man würde dir nur einen Haufen Fragen stellen, die du doch nicht beantworten kannst, Pascual. Sie kann ein, zwei Tage hier bleiben. Wenn sie bis dahin ihr Gedächtnis nicht wiedererlangt hat, kann sie sich selbst an die Polizei wenden.« Er legte dem Arzt eine Hand auf die Schulter. »Danke, dass du gekommen bist! Vergiss nicht, auf der Heimfahrt darauf zu achten, ob dir jemand folgt!«
»Du lebst jetzt seit sieben Jahren unbehelligt hier. Langsam könntest du dich doch etwas entspannen, meinst du nicht auch?«
Ein trauriger Ausdruck trat auf Conors Gesicht. »Das habe ich schon einmal geglaubt, und du weißt ja, was passiert ist.«
Pascual seufzte. »Für dich, den Sohn meiner Lieblingskusine, werde ich beide Augen offen halten.«
Diesmal konnte sich Conor das Lächeln nicht verkneifen, aber es verflog rasch wieder, als er die Tür öffnete und zusah, wie der Arzt zu seinem Wagen, einem Holden Statesman, ging und davonfuhr. Er schloss die Tür wieder ab und blickte auf die Katze herab. »Komm, Thomas, lass uns nach dem Kätzchen sehen, das uns da zugelaufen ist.«
Wesley Scanlan bog auf den Parkplatz vor seinem Wohnblock ein, als das Zwielicht, das man in Sydney als Morgengrauen bezeichnete, sich eben lichtete. Mit zitternder Hand sperrte er seine Wohnungstür auf und stürzte hinein. Das Telefon läutete, und ihm war klar, dass er eigentlich sofort rangehen musste, aber der Zwang, sich die Hände zu waschen, war stärker.
Das Gesicht, das aus dem Badezimmerspiegel zurückstarrte, wirkte gehetzt, die sonst attraktiven Züge waren von Schmutz und Schweiß gezeichnet, die Augen blutunterlaufen und das wirre blonde Haar voller Spinnweben. Mit der Nagelbürste schrubbte er sich den Tod von den Händen. Als das Telefon erneut anfing zu läuten, warf er die Bürste beiseite und eilte nach nebenan.
Er räusperte sich, bevor er abnahm. »Hallo?«
»Ich habe alle Spuren beseitigt, einschließlich Vanessas Wagen. Hast du dein ... Paket entsorgt?«
»Ja.« Er schauderte. »Aber was sollen wir wegen Libby unternehmen?«
»Ich habe bereits bei allen Taxiunternehmen nachgefragt. Eine Frau, auf die ihre Beschreibung passt, wurde in der Nähe aufgelesen und hat sich zum Flughafen bringen lassen. Ich habe dort einen Kontaktmann, der überprüfen wird, ob sie irgendwo hingeflogen ist.«
»Aber ...«
»Sie hat ihren Pass dagelassen, muss sich also noch in Australien aufhalten. Wir werden sie schon finden.«
Wesley fuhr sich mit der Hand über das Gesicht und zog diese angewidert wieder zurück, als er bemerkte, wie schmutzig er noch war. »Und was passiert, wenn sie zur Polizei geht?«
»Wir wissen nicht, wie viel sie – sofern überhaupt – gesehen hat, aber sie wird sich so oder so nicht an viel erinnern können. Verdammt unangenehm, dass Vanessa früher als geplant zurückgekommen ist. Und das, nachdem die blöde Kuh endlich aus dem Weg geräumt war.«
»Bist du dir auch ganz sicher, dass niemand Vanessa vermissen wird?«
»Falls in dieser Richtung Probleme auftreten sollten, kümmern wir uns darum, wenn es so weit ist. Wenigstens hatte sie in Sydney keine engen Freunde.«
»Was ist mit der Frau, die sie besucht hat? Warum ist sie früher als geplant zurückgekommen?«
Wesley zuckte zusammen, als ein genervtes Zischen an sein Ohr drang. »Ich kann nicht jede Kleinigkeit überprüfen. Ich muss diskret sein, sonst fliegen wir auf.«
»Tut mir Leid, Mal, das weiß ich. Es macht mich nur nervös, weil Vanessas Tod nicht geplant war.«
»Du bist in Panik geraten, Wesley. Du hättest Vanessa einfach ins Arbeitszimmer bitten und mich ihr vorstellen sollen.«
»Aber du warst gerade dabei, Libbys Computerdateien zu manipulieren. Was, wenn ihr das aufgefallen wäre ...«
»Das hätte keine Rolle gespielt. Wir hätten sie sowieso beseitigen müssen, sobald sie Libby gesehen hätte. Und jetzt schalte dein verdammtes Handy ein und lass auf der Festnetznummer den Anrufbeantworter laufen! Eigentlich bist du gerade in den Flitterwochen, schon vergessen? Ich melde mich, sobald ich weiß, wo sie steckt.«
Der Wachmann blickte auf, als der Holden Statesman in die Tiefgarage des Anzac Square Building in Brisbane einfuhr. Seit drei Monaten beobachtete und meldete er nun schon das Kommen und Gehen von Dr. Pascual Recio sowie jede seiner möglicherweise bedeutungsvollen Aussagen.
Er hatte vor zehn Jahren eine Stelle bei der seriösen, angesehenen Wachgesellschaft angenommen und dank seines tadellosen Leumunds und seiner Fähigkeiten rasch das Vertrauen und das Respekt seiner Arbeitgeber erlangt. Seine eigentliche Berufserfahrung reichte jedoch noch viel weiter zurück, und seine tatsächliche Arbeit spielte sich auf einer völlig anderen Ebene ab. Und für einen ganz anderen Boss.
Er ging zu dem Statesman hinüber und öffnete die Fahrertür. »So früh am Morgen schon ein Hausbesuch, Dr. Recio?«
»Ach, Dennis«, entgegnete der Arzt lächelnd. »Manche Patienten haben einfach kein Verständnis dafür, dass ein alter Mann seinen Schlaf braucht.«
»Ich hoffe, Sie mussten nicht zu weit rausfahren, Doktor.«
»Nein, nein. Es war nicht weit. Danke, Dennis.« Pascual nahm die Arzttasche vom Beifahrersitz und stieg aus.
Der Wachmann wartete, bis der Doktor in dem Gang verschwunden war, der zum Fahrstuhl führte. Vor zwei Monaten hatte er dem Arzt den Zweitschlüssel des Statesman gestohlen. Nun schloss er das Fahrzeug auf, griff unter das Armaturenbrett und überzeugte sich davon, dass der Peilsender, den er dort angebracht hatte, noch an seinem Platz war. Anschließend durchsuchte Dennis das Handschuhfach sehr gründlich und tastete den Beifahrersitz ab. Nichts. Er fand nichts außer ein paar Fachzeitschriften und einer Kleenex-Box. Vermutlich war diese Routine sinnlos, aber eines Tages könnte die regelmäßige Durchsuchung des Wagens einen Hinweis liefern, der seinem Auftraggeber dienlich wäre.
Möglicherweise brachte ja die Wanze, die er in der Wohnung des Arztes angebracht hatte, mehr Erfolg. Manchmal machte ihn sein Job als Wachmann ganz kribbelig, aber dann dachte Dennis wieder an die Kollegen, deren Aufgabe darin bestand, die vielen Bänder abzuhören und abzutippen, und ihm wurde klar, dass er noch dankbar sein konnte, nicht den ganzen Tag in einem muffigen Büro eingesperrt zu sein.
Als er gerade die Fahrertür schloss, bemerkte Dennis eine Bewegung in Höhe des Gangs. Sofort ging er in die Hocke und gab vor, den Reifen des Wagens zu inspizieren, als der Arzt ihn ansprach. »Stimmt etwas nicht, Dennis?«
Der Wachmann richtete sich auf. »Nein, alles in Ordnung. Ich habe einen Nagel in Ihrem Reifen entdeckt, aber es scheint alles gut gegangen zu sein.«
»Gut. Ich habe die Milch vergessen, die ich auf dem Heimweg besorgt habe«, sagte der Doktor, öffnete die hintere Tür und nahm eine Plastiktüte von der Rückbank. Er lächelte. »Bei der Hitze wäre sie schnell sauer geworden.«
Dennis erwiderte das Lächeln. Als er aber dem Arzt nachblickte, fragte er sich, wie viel der alte Mann tatsächlich bemerkt haben mochte.
Schweiß lief Conor in Bächen über Brust und Rücken, als er den Spaten tief in die Erde stach und diese anschließend umdrehte. In den sieben Jahren, die er nun bereits in Brisbane lebte, hatte er noch keinen so heißen Dezember erlebt. Die Luft war zum Schneiden dick vor Feuchtigkeit, und seine selbst gezogenen Tomatenpflanzen ließen in der sengenden Hitze die Köpfe hängen. Im Nebenbeet wuchs Zuckermais. Sein Gemüsegarten diente dem Stressabbau, erinnerte ihn aber auch immer wieder an das Leben, das ihm nun verwehrt war und nach dem er sich mit jedem Jahr schmerzlicher zurücksehnte.
Er machte Schluss mit Umgraben und brachte den Spaten zurück in den Schuppen an der Seite des kleinen Gartens. An mehreren Maiskolben hingen seidig braune, trockene Fäden herab. Er brach die Kolben ab und nahm sie mit in die Küche. Libby hatte tief und fest geschlafen, als er ins Gästezimmer zurückgekehrt war, nachdem Pascual gegangen war, sodass er ihr keine weiteren Fragen hatte stellen können. Später hatte er sich dann gesagt, dass Gartenarbeit ihm besser täte, als sich von wachsendem Misstrauen verrückt machen zu lassen, während er darauf wartete, dass die junge Frau aufwachte.
Pascual hatte in einem Punkt Recht gehabt: Er war tatsächlich einsam. Und anstatt mit den Jahren gelassener zu werden, wurde seine innere Unruhe immer größer, als blase der Wind aus den Bergen und Tälern seiner Heimat durch seine Adern. Es kam ihm vor, als würde er ständig auf etwas warten. Sehnte er sich nach der Berührung einer Frau? Vielleicht, aber es war mehr als das. Und das junge Ding mit den aufgerissenen Augen in seinem Gästezimmer konnte für noch mehr Ärger sorgen, als sogar Pascual befürchtete.
Er legte die Maiskolben auf den Küchentisch und ging den Flur hinunter zum Gästezimmer. An der Tür blieb er stehen und erstarrte, nachdem er einen Blick hineingeworfen hatte. Das Zimmer war leer.
Kapitel 4
Voller Argwohn schaute sich Conor in dem Zimmer um. Nichts. Er hastete den Flur entlang, stieß die Badezimmertür auf und zuckte peinlich berührt zurück, als Libby ängstlich vor ihm zurückwich. Sie hatte die Bluse ausgezogen, und ihre kleinen, festen Brüste bebten unter der feinen Spitze. In der Kuhle unterhalb des schlanken Halses pochte eine Vene. Ihr Puls raste. An ihrer Schulter hob sich ein Bluterguss tieflila von der ansonsten sehr blassen Haut ab.
Sie riss die Bluse vom Handtuchhalter und hielt sie sich schützend vor die Brust. Auch die Kopf- und Gesichtsverletzungen hatten sich verfärbt, und das Hämatom reichte bis zum Wangenknochen. Conor ging durch den Kopf, dass sie aussah wie ein kleines Mädchen, das dabei erwischt worden war, wie es unerlaubt mit der Schminke seiner Mutter herumexperimentierte. Belustigt sah er, wie Libby herausfordernd das Kinn vorstreckte.
»Ich wollte mich nur frisch machen«, erklärte sie. »Es ist so heiß und stickig.«
Conor nickte verlegen. »Handtücher sind im Schrank.« Er zeigte an die gegenüberliegende Wand. »Sie möchten bestimmt gerne duschen. Ich hänge Ihnen ein T-Shirt von mir von außen an die Türklinke. Das können Sie tragen, bis ich Ihre Sachen gewaschen habe.«
Auf dem Weg zurück in sein Schlafzimmer gestattete er sich ein Lächeln. Nein, von diesem Kätzchen hatte er ganz sicher nichts zu befürchten. Er hatte Libbys Sachen gründlich durchsucht, während diese schlief, und nicht mehr gefunden als ein paar Taschentücher und einige Münzen in ihrer Hosentasche. Er war überzeugt davon, dass die junge Frau etwas vor ihm verbarg und die Amnesie vermutlich nur vortäuschte, aber was immer es war, es hatte ganz sicher nichts mit ihm zu tun. Vielleicht versteckte sie sich vor einem brutalen Verwandten oder Liebhaber. Und überhaupt, jetzt wo er wieder vernünftig denken konnte, wäre es nicht Rashods Art, jemanden zu schicken, der ihn ausspionierte. Nein, sagte er sich, und lodernder Zorn stieg in seiner Brust auf. Wenn Rashod wüsste, wo er sich aufhielt, würde er persönlich kommen. Allein. Und bewaffnet.
Libby stand mehrere Minuten unter dem Wasserstrahl und ließ das lauwarme Nass über ihr Gesicht laufen, während sie versuchte, Ordnung in ihre wild durcheinander wirbelnden Gedanken zu bringen. Nach und nach konnte sie wieder halbwegs klar denken, aber die Ereignisse der vergangenen Nacht kamen ihr zunehmend vor wie ein böser Traum. Ein unwirklicher Traum mit zu vielen Lücken.
War ihre Mutter wirklich tot? Und hatte sie, Libby, sie tatsächlich getötet? Sie hatten sich oft gestritten, und jedes Mal hatte Vanessa ihr wieder vorgehalten, dass wenn Libby nicht lernte, sich zu beherrschen, sie eines Tages ebenso enden würde wie ihr Vater. Libby ihrerseits war außer sich gewesen, weil ihre Mutter sich schlicht weigerte zu akzeptieren, dass ihre Tochter jetzt eine erwachsene Frau war, die ein Recht auf eine eigene Meinung hatte. Bei ihrer letzten Auseinandersetzung hatte Libby ein Kissen nach Vanessa geworfen und war davongestürmt. Hiernach hatten sie zehn Monate kein Wort mehr miteinander gesprochen, aber es war Libby gewesen, die schließlich den ersten Schritt getan und versucht hatte, den Graben zwischen ihnen zu überbrücken. Aber das lag bereits Jahre zurück. Seitdem waren sie höflich und rücksichtsvoll miteinander umgegangen. Nicht liebevoll, so weit hatte sich Vanessa nie herablassen können – Vergebung passte nicht zu ihrer Natur –, aber Libby hatte sich um eine zumindest freundschaftliche Beziehung bemüht.
War es doch wieder zum Streit gekommen? Hatte sie etwas nach Vanessa geworfen, etwas, das schwer genug gewesen war, diese zu töten? Gott, wenn sie sich doch nur erinnern könnte! Und dann die beiden über die Tote gebeugten Männer. Libby hatte ihre Gesichter nicht gesehen, und ihre Erinnerung an sie war immer noch verschwommen, aber der eine war ihr doch sehr vertraut vorgekommen. Hatten die Männer tatsächlich ihre Mutter umbringen wollen? Oder hatte Libby sie in ihrer Panik missverstanden? Und überhaupt, war die Tote wirklich Vanessa? Ihre Mutter war doch zu Besuch bei einer alten Freundin, wo sie noch mindestens eine Woche bleiben wollte!
Und wo steckte ihr Großvater? War das hier sein Haus? Möglicherweise, vieles kam ihr bekannt vor, aber vieles war auch anders als in ihrer Erinnerung, was nicht weiter verwunderlich war, immerhin war sie bei ihrem letzten Besuch noch ein Kind gewesen.
Plötzlich fühlte sie sich überfordert von den vielen offenen Fragen. Schluchzend ließ sie sich an die Wand sinken und weinte bis zur völligen Erschöpfung. Ihre Knie gaben nach, und Libby glitt an der gefliesten Wand hinab, bis sie in der Duschwanne saß.
Erst ein Klopfen an der Tür machte ihr bewusst, dass sie schon eine Ewigkeit im Bad war.
»Alles in Ordnung?« Conors Stimme drang nur sehr leise durch die massive Holztür.
»Ja«, rief sie zurück, und als er daraufhin nichts mehr sagte, ging sie davon aus, dass er wieder gegangen war. Sie stand auf, nahm das Shampoo von der Ablage und wusch sich das Haar. Anschließend seifte sie sich gründlich ein, als könnte sie damit das Gefühl drohenden Unheils fortwaschen, das sie nicht losließ. Sie musste in aller Ruhe nachdenken, ganz vernünftig. Bestimmt gab es für das alles eine plausible Erklärung, sie musste sie nur finden. Aber das Grauen blieb, lauerte wie ein dunkler, unheilvoller Schatten in Bereichen ihres Gedächtnisses, zu denen ihr Verstand ihr noch den Zugriff verweigerte.
Conor war nebenan in seinem Schlafzimmer gewesen, als er Libby hatte weinen hören. Das Schluchzen hatte sein Mitleid erregt und Erinnerungen geweckt, die er ein halbes Leben lang mehr oder weniger erfolgreich verdrängt hatte. Was immer sonst sie vortäuschen mochte, ihr Kummer war echt, und das Bedürfnis, der jungen Frau zu helfen, wurde noch stärker.
Er duschte rasch in dem kleinen Bad, das er im großen Schlafzimmer hatte einbauen lassen, sich seiner körperlichen Reaktion auf den Anblick ihrer nur mangelhaft verhüllten Brüste nur zu bewusst. Vielleicht besaß Pascual ja mehr Feingefühl und Menschenkenntnis, als er ihm zugetraut hatte.
Als er fertig war, presste er in der Küche Orangen aus und backte Croissants im Ofen auf. Der frisch gebrühte Kaffee verströmte einen verlockenden Duft. Als Libby hereinkam, blickte Connor auf. An ihrem grazilen Körper wurde das Shirt zum Kleid. Das kurze, feuchte Haar hatte sie streng zurückgekämmt, was ihr alles in allem ein knabenhaftes Aussehen verlieh.
»Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich Ihre Haarbürste benutzt habe.«