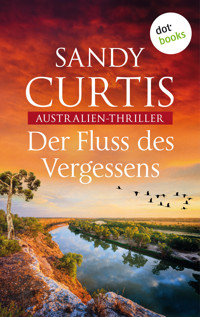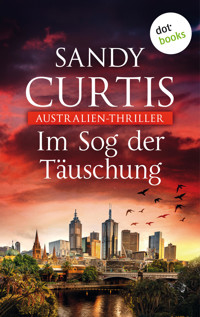
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Australian-Heat
- Sprache: Deutsch
Eine wissenschaftliche Sensation mit tödlichen Folgen: Der Australien-Thriller »Im Sog der Täuschung« von Sandy Curtis jetzt als eBook bei dotbooks. Manche Erfindungen haben einen Preis, der nur mit Blut bezahlt werden kann … Als sein Bruder spurlos verschwindet, ist der Ex-Navy-Soldat Rogan McKay voller dunkler Vorahnungen – hat der Privatermittler einen Fall angenommen, der ihn das Leben kosten kann? Die Suche nach Antworten führt Rogan auf die Spur der schönen Breeanna, nach der auch sein Bruder suchte. Im letzten Moment kann er die Wissenschaftlerin vor ihren eiskalten Verfolgern retten. Auf der halsbrecherischen Flucht durch Australien wird immer deutlicher, dass mehr als eine Partei Jagd auf Breeanna macht … und diese über Leichen gehen, um sie in ihre Gewalt zu bekommen! Aber hütet Breeanna womöglich selbst ein dunkles Geheimnis vor Rogan? »Ein atemloser, blitzschneller Thriller, der mit immer neuen Wendungen überrascht. Wenn Sie Hochspannung und erotisches Knistern lieben, kommen Sie hier auf Ihre Kosten!« CrimeDownUnder Jetzt als eBook kaufen und genießen: der temporeiche Australien-Thriller »Im Sog der Täuschung« von Sandy Curtis wird Leserinnen und Leser von Karen Rose und Lisa Jackson begeistern! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Manche Erfindungen haben einen Preis, der nur mit Blut bezahlt werden kann… Als sein Bruder spurlos verschwindet, ist der Ex-Navy-Soldat Rogan McKay voller dunkler Vorahnungen – hat der Privatermittler einen Fall angenommen, der ihn das Leben kosten kann? Die Suche nach Antworten führt Rogan auf die Spur der schönen Breeanna, nach der auch sein Bruder suchte. Im letzten Moment kann er die Wissenschaftlerin vor ihren eiskalten Verfolgern retten. Auf der halsbrecherischen Flucht durch Australien wird immer deutlicher, dass mehr als eine Partei Jagd auf Breeanna macht … und diese über Leichen gehen, um sie in ihre Gewalt zu bekommen! Aber hütet Breeanna womöglich selbst ein dunkles Geheimnis vor Rogan?
»Ein atemloser, blitzschneller Thriller, der mit immer neuen Wendungen überrascht. Wenn Sie Hochspannung und erotisches Knistern lieben, kommen Sie hier auf Ihre Kosten!« CrimeDownUnder
Über die Autorin:
Sandy Curtis lebt an der Küste des australischen Bundesstaates Queensland. Die Mutter von drei erwachsenen Kindern hat in den verschiedensten Bereichen gearbeitet – doch seit sie als junges Mädchen ihre erste Geschichte geschrieben hat und es ihr sogar gelang, für die Recherche dazu von der örtlichen Polizei eingeladen zu werden, stand ihr Herzenswunsch fest, als Spannungsautorin erfolgreich zu werden.
Mehr Informationen über die Autorin und ihre Thriller finden sich auf ihrer Website: www.sandycurtis.com
Bei dotbooks erschienen Sandy Curtis‘ Thriller der locker zusammenhängenden Spannungsserie »Australian Heat« mit den unabhängig voneinander lesbaren Bänden »Das Tal der Angst«, »Der Fluss des Vergessens«, »Im Meer der Furcht« und »Am Abgrund der Vergeltung« sowie der Einzelband »Der Sturm der Rache«.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2021
Die australische Originalausgabe erschien erstmals 2005 unter dem Originaltitel »Dangerous Deception«.
Copyright © der australischen Originalausgabe 2005 by Sandy Curtis
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2007 by Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Gordon Belll, Olga Kashubin, schankz
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-358-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Sog der Täuschung« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sandy Curtis
Im Sog der Täuschung
Thriller
Aus dem Englischen von Cécile G. Lecaux
dotbooks.
Prolog
Als Professor John Raymond seinen Wagen in den fließenden Verkehr einfädelte, blendete ihn grelles Scheinwerferlicht. Ein Lieferwagen wurde zur Vollbremsung gezwungen und entging mit quietschenden Reifen nur knapp einem Zusammenprall mit dem Heck der kleinen Limousine.
Normalerweise hätte er sich selbst dafür gescholten, dass er so unkonzentriert fuhr, vor allem bei diesem Nieselregen und der entsprechend schlechten Sicht. Aber dies war kein gewöhnlicher Abend. Was der krönende Abschluss jahrelanger harter Arbeit hätte sein sollen, hatte sich stattdessen zu einer riesigen Katastrophe entwickelt, einer Katastrophe, wie er sie sich nie hätte vorstellen können. Und er allein trug die Schuld.
Jetzt betete er, dass sich das, was er ins Rollen gebracht hatte, doch noch irgendwie stoppen ließ. Das war seine einzige Chance, seinen guten Ruf zu bewahren. Er klopfte auf seine Brusttasche, in der sich der winzige USB-Stick befand. Die Welt der Wissenschaft würde Augen machen, und niemand würde seine Erfindung als Unsinn abtun können, nachdem er den unwiderlegbaren Beweis sichergestellt hatte.
Mit diesem Gedanken versuchte er, die nagende Furcht in Schach zu halten. Doch selbst der neutrale, analytische Teil in ihm sah förmlich vor sich, wie die Säure sich in seine Magenwand fraß und der Blutdruck in seinen Venen mit jedem Herzschlag zunahm. Das Risiko, mit dem er seit Jahren lebte, war ihm wohl bekannt, sein Arzt hätte sich die mahnenden Worte also sparen können. Er konnte einfach nicht abschalten. Er hatte bereits das gesetzliche Rentenalter überschritten. Nein, ihm blieb nicht mehr genug Zeit, um es langsam angehen zu lassen.
Als er in die South Road einbog, eine der Hauptverkehrsstraßen im Melbourner Stadtteil North Hampton, hatte der Regen nachgelassen. Hier war der Verkehr dichter, das allgemeine Tempo aber gleichzeitig höher, sodass er Gas gab, um sich der Geschwindigkeit der anderen anzupassen.
Das erste Symptom war so verhalten, dass er es gar nicht registrierte. Ein leichtes Zittern und ein kaum wahrnehmbares Schwächegefühl in der linken Hand. Kurz darauf bemerkte er jedoch bereits, dass er das Steuer beinahe nicht mehr halten konnte. Auch die Kraft in seiner rechten Hand ließ jetzt rapide nach. Er versuchte, die Funktion seiner Hände durch reine Willenskraft wiederherzustellen, aber sein Körper gehorchte ihm nicht mehr.
Da dämmerte es ihm.
»Neiiiinnn ...«, entfuhr es seinen erschlaffenden Lippen.
Beide Hände glitten vom Lenkrad, und er sackte nach vorn. Ein furchtbarer Schreck fuhr ihm durch die tauben Glieder, als ihm bewusst wurde, dass er vergessen hatte, sich anzuschnallen.
In hilfloser Panik sah er, wie sein Wagen von der Fahrbahn abkam und geradewegs auf einen entgegenkommenden Lastwagen zusteuerte.
Der Knall beim Aufprall erinnerte an eine Detonation. Für Sekunden spürte er einen intensiven, brennenden Schmerz, dann nichts mehr.
Als der Professor aus dem Wrack geschleudert wurde, glitt der USB-Stick aus seiner Jacketttasche und landete im Rinnstein.
Kapitel 1
Es wurde von der Nachtluft getragen.
Ein Geräusch so leise, dass sie beinahe geglaubt hätte, sie bilde es sich nur ein. Andererseits war es in der idyllischen Straße in dem grünen Vorort von Melbourne so fehl am Platz, dass Breeanna Montgomerys Nackenmuskeln sich unwillkürlich anspannten.
Erst jetzt fiel ihr auf, dass das von einem Bewegungsmelder gesteuerte Licht vor dem Haus nicht wie gewöhnlich angegangen war. In der frischen Frühlingsluft war weder das Summen von Fluginsekten zu hören, noch raschelte das Laub der Sträucher in der abendlichen Brise. Plötzlich empfand sie die Stille als beklemmend. Ihr Magen verkrampfte sich. Vielleicht hatte sie ihr Instinkt doch nicht getrogen. Sie hatte dem Professor nicht glauben wollen, konnte einen solch ungeheuerlichen Verdacht in ihrem Leben nicht brauchen. Und doch kam sie nicht gegen die Furcht an, die ihr die Kehle zuschnürte, bis ihr das Atmen schwerfiel. Es waren zu viele merkwürdige Dinge geschehen. Dinge, die sie versucht hatte zu ignorieren, um sich nicht jenem Teil ihrer selbst stellen zu müssen, den sie bislang erfolgreich vor der Außenwelt verborgen hatte.
Breeanna schüttelte den Kopf, als könne sie so die Angst vertreiben, holte tief Luft, kurbelte die Fensterscheibe hoch und öffnete die Wagentür. Ihre Schritte hallten leise zwischen der wuchernden Hecke und dem Haus, als sie den Weg hinaufhastete und eilig die betonierte Freifläche vor der Haustür überquerte.
Wolken schoben sich vor die Mondsichel, und sie musste in der Dunkelheit den Hausschlüssel an ihrem leise klirrenden Schlüsselbund ertasten. Als sie den richtigen Schlüssel endlich gefunden hatte, steckte sie ihn ins Schloss. Das vertraute Geräusch zerrte nun an ihren bereits angespannten Nerven. Sie betrat das Wohnzimmer und streckte die Hand nach dem Lichtschalter aus. In der Sekunde, in der das Licht aufflammte, ließ ein Rascheln sie herumfahren.
Eine schwarz gekleidete Gestalt stürzte durch die offene Haustür, packte sie am Hals und schleuderte sie mit dem Rücken gegen die Wand.
Als sie kaltes Metall an der Wange fühlte, konnte sie das Geräusch, das sie vorhin im Wagen gehört hatte, plötzlich einordnen: das Entsichern einer Waffe. Einer Pumpgun mit abgesägtem Lauf, um genau zu sein.
Ruhig Blut zu bewahren hatte Breeanna in der Vergangenheit schon mehrfach aus haarigen Situationen herausgeholfen, aber das irre Glitzern der Augen in den Löchern der Sturmhaube lähmte sie förmlich.
Der Mann stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Und es schien, als wäre er bereits auf Entzug: Sein Körper zuckte unkontrolliert, darunter auch der Arm mit der Waffe. Seine schwarze Jeansjacke roch durchdringend nach Schweiß, Zigarettenrauch und zu vielen Joints.
»Wo ist es?« Die Worte klangen abgehackt, die Stimme gepresst und zugleich unnatürlich schrill.
Der Typ ist auf Speed, ging es ihr durch den Kopf. Und das war gefährlich. Unberechenbar. Breeanna versuchte, ruhig zu bleiben, aber ihre Stimme zitterte dennoch, als sie fragte: »Wo ist was?«
»Das Buch. Du weißt schon. Er hat es dir gesagt.«
»Wer hat mir was gesagt?«
Der Lauf drückte sich tiefer in ihr Fleisch.
»Der Professor. Und jetzt rück es raus, oder ich drücke ab.« Ein hässliches Kichern kam über seine schmalen Lippen.
Breeanna schlug das Herz bis zum Hals. Worauf der Mann auch aus war, sie hatte es nicht. Unglücklicherweise musste sie davon ausgehen, dass er ihr das in seinem Zustand nicht abkaufen würde. Und er würde wohl auch nicht zögern, seine Drohung wahr zu machen.
»Ich gebe es Ihnen«, log sie. »Es ist in meiner Handtasche.« Sie hob die Tasche mit der linken Hand leicht an, während ihre Rechte sich fester um den Schlüsselbund schloss. »Aber mir ist so schwindelig, so ...« Sie verstummte, schloss die Augen bis auf einen schmalen Spalt und sackte leicht nach vorn, sodass ihr Gewicht gegen die Hand an ihrer Kehle drückte.
»Scheiße!« Der Mann ließ sie los und griff nach der Handtasche, wobei er das Gewehr von Breeannas Wange nahm. Darauf hatte sie gehofft. Sie riss das Knie hoch, rammte es ihm in den Unterleib und schlug ihm gleichzeitig den Schlüsselbund ins Gesicht.
Er schrie vor Schmerz auf, krümmte sich und presste eine Hand in den Schritt. Die Hand mit dem Gewehr ließ er kraftlos sinken.
Breeanna spurtete los.
Die kurze Entfernung bis zu ihrem Wagen kam ihr endlos vor, und es schien ewig zu dauern, bis die Fernbedienung die Türen entriegelte. Mit vor Panik wild klopfendem Herzen kletterte sie auf den Fahrersitz und verriegelte die Tür hinter sich.
Ein Wutschrei zerriss die nächtliche Stille. Ihr Angreifer folgte ihr humpelnd und zielte mit dem Gewehr auf das Seitenfenster ihres Wagens.
Breeanna drehte den Schlüssel im Zündschloss. Der Motor sprang sofort schnurrend an.
Ein Schuss peitschte durch die Luft.
Sie rechnete damit, dass Glas splitterte und Schrotkugeln sich schmerzhaft in ihre Seite bohrten, aber stattdessen explodierte das Gesicht des Mannes förmlich, und er taumelte rückwärts.
Wie gelähmt von dem Schock saß Breeanna da und starrte auf den Toten.
Ein Mann, der mit beiden Händen eine Pistole hielt, kam hinter der Hecke hervor und ging an ihrem Wagen vorbei. Als er den Leichnam erreicht hatte, steckte er die Pistole in das Holster unter seiner Anzugjacke und durchsuchte mit geübten Handgriffen die Kleidung des Mannes. Dann richtete er sich wieder auf und kam auf ihren Wagen zu. Er versuchte, die Fahrertür zu öffnen, und als er feststellte, dass diese verriegelt war, klopfte er an die Scheibe.
Das Geräusch riss Breeanna aus ihrer Starre. Sie kurbelte die Scheibe herunter. Der Motor lief noch, ein gewöhnliches Geräusch an einem alles andere als gewöhnlichen Abend.
»Die Gefahr ist vorbei, Miss.« Scheinbar beruhigende Worte und ein neutraler Tonfall, und doch misstraute sie dem Mann instinktiv. Sie machte keine Anstalten, die Tür zu öffnen. Der Mann beugte sich zu ihr herab. Mit dem Licht im Rücken, das durch die Haustür nach draußen fiel, lag sein Gesicht im Schatten, aber im schwachen Schein der Armaturen erkannte sie tief liegende Augen über einer geraden Nase und vollen Lippen, die gegenwärtig jedoch zusammengepresst waren, so als versuche er, seine Ungeduld zu verbergen. Breeanna ging völlig zusammenhanglos durch den Kopf, dass er als junger Mann sehr attraktiv gewesen sein musste.
Er hielt ihr die offene Hand hin. »Sie können mir das Buch jetzt geben.«
Das Buch?
Schon der Mann, der jetzt mausetot vor ihrer Haustür lag, hatte »das Buch« haben wollen. War bereit gewesen, dafür zu töten. Um welches Buch ging es hier bloß? Sie zwang sich nachzudenken. Ein Buch, das der Professor ihr gegeben haben soll? Sie besaß kein solches Buch und hatte auch sonst keinen Schimmer, wovon die Rede war. Aber ein Mann war bereits tot, und der Professor lag verletzt im Krankenhaus, so eingeschüchtert, dass es an ein Wunder grenzte, dass er noch keinen zweiten Infarkt erlitten hatte.
»Ich sorge dafür, dass das Buch in die richtigen Hände kommt.« Die Ungeduld in der Stimme des Mannes war nicht zu überhören.
Breeanna spürte die Wellen der Gier und unterdrückten Erregung, die er aussandte. Wie ein Hund im Blutrausch. Und da registrierte sie, dass seine Hand sich wieder der Waffe unter dem Jackett näherte.
»Gut.« Sie war selbst überrascht darüber, wie ruhig sie klang. Sie tat so, als wolle sie nach der Handtasche greifen, die sie auf den Beifahrersitz geworfen hatte, legte stattdessen am Automatikgetriebe den Rückwärtsgang ein und gab abrupt Gas.
Mit quietschenden Reifen schoss der Wagen rückwärts die kurze Auffahrt hinunter. Während der Mann zur Seite taumelte, schleuderte Breeannas Wagen auf die Straße. Sie trat auf die Bremse, legte den Vorwärtsgang ein und fuhr so rasant an, dass die rauchenden Reifen schwarze Spuren auf dem Asphalt hinterließen.
»Mach die Schweinerei weg. Und beeil dich«, knurrte Vaughn Waring und versetzte dem Leichnam vor Breeannas Haustür einen Tritt. Den Idioten zu erschießen, der die Montgomery überfallen hatte, war nicht zu vermeiden gewesen, aber hinterher auf sie zuzugehen und zu versuchen, ihr Vertrauen zu gewinnen, war ein Risiko gewesen. Ein Risiko, das sich nicht einmal gelohnt hatte. Er hatte sie nicht nur in die Flucht gejagt, sie wusste nun auch, wie er aussah, und zum gegenwärtigen Zeitpunkt verschaffte ihr das einen Vorteil, den sie eigentlich nicht haben sollte.
»Ich hole den Wagen.« Ein zweiter Mann war hinter der Hecke hervorgekommen und hatte sich zu Vaughn gesellt, der sich jedoch kommentarlos abwandte und auf das Haus zuging. Seinem Frust machte Vaughn durch einen Zischlaut Luft, den er durch zusammengebissene Zähne ausstieß. Wenigstens etwas, worauf er sich verlassen konnte: Mark Talbert war ebenso nützlich wie verschwiegen. Hilfreiche Eigenschaften bei einem Angestellten, von dem erwartet wurde, Befehle auszuführen, ohne Fragen zu stellen.
Vaughn holte ein Taschentuch hervor, knipste das Licht im Haus aus und zog die Tür hinter sich zu.
Nur die Rücklichter verrieten den dunklen Wagen, der langsam die Auffahrt hinaufglitt. Der Kofferraum sprang auf. Mark Talbert stieg aus, breitete eine Decke im Kofferraum aus und hob den Toten hinein.
Vaughn wickelte einen Schlauch von einem Wasserhahn an der Hausecke und spritzte den Beton ab. Das frische Blut ließ sich leicht entfernen und versickerte mit dem Wasser in der Erde unter der Hecke. Im Übrigen war kaum damit zu rechnen, dass jemand den Toten vermissen würde. Jedenfalls gab es niemanden, der das Verschwinden des Mannes der Polizei melden würde. Er wickelte den Schlauch wieder auf und nahm auf dem Beifahrersitz Platz.
Als der Wagen fast lautlos auf die Straße rollte, ließ Vaughn aufmerksam den Blick über die Nachbarhäuser schweifen. In einer so friedlichen Straße mit hohen Zäunen, dichten Hecken und altem Baumbestand hielt man den Knall von vorhin bestimmt für eine Fehlzündung, trotzdem konnte es nicht schaden, vorsichtig zu sein. Immerhin gab es auch neugierige Nachbarn. Aber zu seiner Erleichterung sah er nirgendwo beiseitegezogene Vorhänge, und es hatte auch niemand das Haus verlassen, um der Ursache für den Lärm auf den Grund zu gehen.
Vaughn zückte mit einem grimmigen Lächeln sein Handy. Wenn Breeanna Montgomery glaubte, sie wäre ihm entkommen, hatte sie sich geirrt.
Fünf Minuten später parkte Breeanna vor einem Schnellrestaurant, das rund um die Uhr geöffnet hatte. Ihre Hände am Steuer zitterten unkontrolliert, und sie versuchte verzweifelt, sich zu beruhigen und ihre wild durcheinanderwirbelnden Gedanken zu ordnen.
Was immer Professor Raymond ihr anvertraut haben sollte, war offensichtlich einen Mord wert. Sie war wütend auf sich selbst, dass sie ihn nicht ernst genommen hatte. Seine Furcht war real gewesen, aber bis heute Abend hatte sie versucht sich einzureden, dass es die Furcht eines Mannes war, der dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen war und nun ein Leben als Querschnittgelähmter vor sich hatte. Seine Bezugnahme auf ihre Familie hatte sie sehr beunruhigt, aber bisher hatte sie noch keine Veranlassung gesehen, die anderen anzusprechen. Bis jetzt, da feststand, dass die Ängste des Professors durchaus begründet waren.
Sie konnte zur Polizei gehen, aber wenn Paige in die Sache verwickelt war ... Breeanna seufzte. Auch wenn sie einander nicht so nahestanden, wie sie es sich gewünscht hätte, war Paige immer noch ihre Halbschwester, und Breeanna liebte sie von ganzem Herzen. Der Beschützerinstinkt ihrer Schwester gegenüber war einfach zu ausgeprägt. Wenn sie nur wüsste, wo sie ihren Vater erreichen konnte. Ganz sicher hatte er eine plausible Erklärung für die Beschuldigungen des Professors. Der Professor hatte auch ernste Beschuldigungen gegen ihren Onkel James Montgomery erhoben, aber da Breeanna wusste, dass die beiden Männer einander spinnefeind waren, hatte sie das nicht weiter überrascht.
Sie ließ noch einmal die Ereignisse der vergangenen fünf Tage Revue passieren und verfluchte sich dafür, dass sie das Unbehagen ignoriert hatte, das sie seit dem Unfall des Professors verspürt hatte. Wenn sie den Mut gehabt hätte, sich ihrem Bauchgefühl zu stellen, hätte sie die Vorfälle des heutigen Abends möglicherweise verhindern können.
Ein junges Pärchen verließ das Restaurant, und der Duft der Gerichte, die sie in einer Papiertüte davontrugen, erinnerte Breeanna daran, dass sie seit dem Frühstück nichts mehr gegessen hatte. Die letzten Tage hatte sie die Mittagspause ausfallen lassen, um neben ihrer eigenen Arbeit möglichst auch jene des Professors zu erledigen. Essen stand zurzeit nicht auf ihrer Prioritätenliste. Ihr war klar, dass der Mann, der ihren Angreifer erschossen hatte, sie suchte, und sie zweifelte keine Sekunde daran, dass er jederzeit wieder morden würde, um in seinen Besitz zu bringen, wovon er annahm, dass der Professor es ihr anvertraut habe. Das bedeutete, dass sie nicht bei Freunden unterkommen konnte, da sie diese nur in Gefahr brächte. Sie hatte erwogen und wieder verworfen, dass dieser Mann Polizist sein könnte – alles an ihm hatte darauf hingedeutet, dass er kein Gesetzeshüter war.
Wo also sollte sie sich verstecken, bis sie ihren Vater erreicht hatte? Ihr fiel ein Roman ein, den sie vor ein paar Jahren gelesen hatte. Er handelte von einer Frau auf der Flucht, die von einer ehemaligen Prostituierten wertvolle Tipps bekam, wie sie untertauchen und ihren Verfolgern entkommen könne. Geld. Sie musste sich eine möglichst große Summe Bargeld besorgen. Ein paar Häuser weiter sah sie die Leuchtreklame eines Geldautomaten.
Sie eilte hinüber und hob so viel Geld ab, wie es ihr Tageslimit erlaubte. Sie starrte auf die brandneuen Scheine in ihrer Hand. Eintausend Dollar. Fürs Erste würde es reichen müssen. Sie kehrte zurück zu dem Restaurant. Obwohl ihr immer noch flau im Magen war, musste sie etwas essen.
Drinnen war es warm und duftete verlockend nach Pommes frites und Steaks vom Grill. Breeanna bestellte einen Burger, zahlte und setzte sich dann an einen Ecktisch. Während die Minuten verstrichen, versuchte sie, sich einen Plan zurechtzulegen, wurde aber immer wieder von der Erinnerung an das explodierende Gesicht ihres Angreifers abgelenkt.
Eine blau-rote Spiegelung in der Scheibe erregte ihre Aufmerksamkeit. Ein Streifenwagen hielt draußen vor dem Lokal. Sie starrte eine Weile blind hinüber, ehe sie realisierte, dass der Beamte auf dem Beifahrersitz ins Mikrofon sprach und dabei ihr Nummernschild fixierte. Normalerweise hätte sie sich als paranoid gescholten, wenn eine gewöhnliche Polizeikontrolle sie nervös gemacht hätte, aber in dieser Nacht glaubte sie nicht an einen Zufall. Ihre Nackenhaare sträubten sich, und ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken.
Der Streifenwagen fuhr langsam weiter, und sie sah, wie er an der nächsten Kreuzung abbog und aus ihrem Blickfeld verschwand. Aber das beruhigte sie keineswegs. Sie vertraute jetzt ganz auf ihren Instinkt, und der sagte ihr, dass die Polizisten nicht wirklich abgezogen waren. Sie lagen auf der Lauer. Außer Sichtweite. Und sie hatte das ungute Gefühl, zu wissen, auf wen sie warteten.
Die Bedienung blickte ihr verwundert hinterher, als sie sich die weiße Papiertüte schnappte und mit ihrer Bestellung zur Tür hinausrannte. Sekunden später saß sie in ihrem Wagen. Ohne die Scheinwerfer einzuschalten, fuhr sie in die entgegengesetzte Richtung, die der Streifenwagen genommen hatte, und den Weg zurück, den sie gekommen war. Zwei Kreuzungen weiter bog sie rechts ab und fuhr in Richtung Norden, so schnell es ging, ohne die erlaubte Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten.
»Sie muss den verdammten Streifenwagen gesehen haben.« Vaughns Ärger war spürbar, als Mark zum Wagen zurückkam und berichtete, was die Bedienung des Schnellrestaurants beobachtet hatte.
»Warum ist sie nicht zur Polizei gegangen?«, überlegte Mark laut und steckte das Foto von Breeanna, das er der Angestellten gezeigt hatte, zurück in die Innentasche seines Sakkos. »Wäre das nicht deine erste Reaktion nach einem Überfall?«
»Vielleicht geht es ihr wie uns. Vielleicht will sie es für sich haben, will vermeiden, dass unnötig Staub aufgewirbelt wird. Wenn es so wertvoll ist, wie uns gesagt wurde, wäre das Anreiz genug.«
»Vielleicht weiß sie nur nicht, wem sie trauen kann.«
Vaughn zündete sich eine Zigarette an und musterte den jüngeren Mann abwartend. Worauf wollte er hinaus?
»Du hast vor ihren Augen einen Menschen erschossen«, fuhr Mark fort. »Warum sollte sie annehmen, dass sie dir vertrauen kann? Vielleicht sollte ich sie das nächste Mal ansprechen.«
Mark Talbert war in jeder Beziehung eine durchschnittliche Erscheinung, mit einem freundlichen Gesicht, dem die meisten Menschen instinktiv vertrauten. Was er sagte, machte Sinn, trotzdem widerstrebte es Vaughn, ihn tiefer in die Sache hineinzuziehen als unbedingt nötig. Als Vaughn die Einzelheiten des Falles erfahren hatte, hatte es ausgesehen, als handle es sich um die einmalige Gelegenheit, auf die er schon immer gewartet hatte. Die Chance auf den Jackpot. Obwohl er für seine Dienste gut bezahlt wurde, wollte er mehr. Und wenn er mit seiner Vermutung richtig lag, ging es möglicherweise sogar um etwas noch Wertvolleres. Mit 59 Jahren spürte Vaughn langsam die Beschränkungen des Alters und wusste, dass seine Tage an der »Front« gezählt waren. Und auch die großzügige Abfindung, die ihn erwartete, würde nicht genügen, um sich das zu kaufen, wonach er trachtete. Er blies den Rauch aus dem Fenster und griff nach dem Laptop zu seinen Füßen. Die Polizei klapperte bereits die Freunde der Montgomery ab, aber vielleicht hatte er etwas übersehen. Der Bildschirm erwachte flackernd zum Leben, und er überflog eilig die relevanten Dateien.
Nichts. Nichts, was er nicht bereits in Erwägung gezogen hätte. Sie war weder zu ihrer Schwester gefahren noch zu ihrem Onkel, also war sie entweder noch unterwegs oder hielt sich irgendwo anders versteckt. Gern hätte er seinem Ärger Luft gemacht, aber er beherrschte sich. Seinem Frust nachzugeben würde ihn auch nicht weiterbringen. Er durfte keinen Fehler riskieren, dafür stand zu viel auf dem Spiel.
Das rote Lämpchen der Tankanzeige leuchtete auf. Obwohl sie auf Reserve noch an die 60 Kilometer weit fahren konnte, zog sie es vor, aufzutanken – für den Fall, dass der Mann, der ihren Angreifer erschossen hatte, sie doch einholte.
Aufgrund der höheren Polizeidichte auf den Bundesstraßen, hatte sich Breeanna an Nebenstraßen gehalten und dabei ständig im Rückspiegel den Verkehr im Auge behalten. Sie hatte beschlossen, ein paar Stunden in nördliche Richtung zu fahren und sich dann auf einem Campingplatz einen Wohnwagen zu mieten, bis sie entschieden hatte, wie sie weiter vorgehen wollte. Sie hatte den Burger während der Fahrt gegessen und sehnte sich nach einer Tasse Kaffee. Der Schock des Erlebten hatte etwas nachgelassen, und ein Schuss Koffein würde helfen, sie wach zu halten. Sie würde die nächste Tankstelle mit angeschlossenem Café ansteuern.
In den vergangenen fünf Minuten hatte sie mehrmals das Gefühl gehabt, verfolgt zu werden, aber der einzige Wagen, der konstant hinter ihr herfuhr, schien sich mehr auf ständige Spurwechsel zu konzentrieren als auf Breeannas weißen Laser.
Weitere zehn Minuten später entdeckte sie endlich eine Tankstelle mit Café. Eine Gruppe Teenager verließ gerade lachend und durcheinanderrufend das Lokal. Breeanna hielt an einer Zapfsäule, stieg aus und behielt beim Tanken den Verkehr im Auge. Als sie fertig war, hatte sich hinter ihr bereits eine kleine Schlange gebildet, sodass sie den Wagen in eine Parklücke an der Einfriedung fuhr.
Sie zahlte die Tankfüllung, ging durch zum Café und bestellte sich einen Kaffee. Ein junges Pärchen trat an den Tresen, und Breeanna wich zurück, sodass sie mit dem Rücken nah an einem Regal mit Brot und Lebensmitteln stand. Als eine Hupe ertönte, blickte sie hinaus und sah, wie die Teenager obszöne Gesten in Richtung eines Wagens machten, der zügig auf der Straße vorbeizog.
Eine Bewegung in der Nähe ihres Lasers erregte ihre Aufmerksamkeit. Ein kräftig gebauter, durchschnittlich großer Mann ging von der Fahrertür aus hinten um den Wagen herum. In Breeanna schrillten sämtliche Alarmglocken, als er in Höhe der Beifahrertür erneut stehen blieb. Zwei Sekunden später ging er an der Reihe geparkter Fahrzeuge vorbei und auf den Tankstellenshop zu. Als er den letzten Wagen in der Reihe erreichte, ging er zur Beifahrertür, legte einen Arm auf das Wagendach und beugte sich hinunter, um sich mit dem Beifahrer zu unterhalten. Unter seinem Jackett hob sich ein Schatten dunkel von seinem weißen Hemd ab. Ein Schatten, den man ohne viel Fantasie als Pistolenholster deuten konnte.
Breeannas Nummer wurde aufgerufen. Mit zitternden Händen nahm sie ihren Kaffee entgegen, zog sich hinter das Regal zurück, nippte an der heißen Flüssigkeit und blickte wieder hinaus.
Der Mann kam jetzt auf die Tankstelle zu, sein Schritt ebenso entschlossen wie der Ausdruck auf seinem Gesicht.
Breeanna wich mit klopfendem Herzen zurück. Es war nicht der Mann, der ihren Angreifer erschossen hatte, aber sein Verhalten war verdächtig. Zu verdächtig, um es zu ignorieren. Warum sollte er sich von allen Fahrzeugen draußen ausgerechnet ihres genauer ansehen? Nein, das war kein Zufall, und je näher er kam, desto nervöser wurde sie.
Die Versuchung, zu ihrem Wagen zu laufen und loszufahren, war groß, aber der gesunde Menschenverstand sagte ihr, dass sie diesmal nicht so leicht entkommen würde. Wer immer sie aufgespürt hatte, musste ein Profi sein. Die Tür der Tankstelle nebenan glitt auf, und Breeanna sah, wie der Mann dem Kassierer ein Foto zeigte.
Breeanna kehrte zurück an den Tresen des kleinen Cafés; Ihre Gedanken überschlugen sich. Sie drängelte sich vor einen anderen Kunden und fragte nach der Damentoilette. Der Angestellte zeigte auf einen Flur am anderen Ende des Raumes. Die Kaffeetasse noch in der Hand, hastete sie an den zitronengelb gestrichenen Wänden entlang zu einer verschlossenen Tür, die ein Schild als Damentoilette auswies. Erst jetzt sah sie, dass der Flur einen Rechtsknick beschrieb und bei zwei Türen mit der Aufschrift »Nur für Personal« endete. Sie öffnete die erste der beiden Türen: eine Vorratskammer. Sie versuchte es mit der zweiten: ein Waschbecken mit einem Spiegel darüber sowie eine offen stehende Tür, die in eine Toilettenkabine führte.
Verdammt! Sie saß in der Falle. Dann entdeckte sie auf der anderen Seite des kleinen Raumes eine weitere Tür. Sie riss sie auf und fand sich auf der Rückseite des Gebäudes wieder.
Gegen die Panik ankämpfend, sah sie sich um. Zu ihrer Rechten befand sich ein geschlossenes Rolltor, auf das die Aufschrift »Werkstatt« gepinselt war. Davor parkten ein großer Kühlwagen sowie ein kleiner Lastwagen, dessen Ladefläche von einer Plane verdeckt wurde. Als sie noch dastand und fieberhaft überlegte, welche Alternativen sich ihr boten, kam ein stämmiger Mann in verknitterten Hosen und Flanellhemd um die Ecke, der hungrig eine Portion Pommes frites verschlang. Breeanna stellte ihren Kaffee auf dem Boden ab und gab vor, ihre Schuhe zu schnüren. Dabei beobachtete sie verstohlen, wie der Mann ins Führerhaus des kleineren Lasters kletterte und die Tür hinter sich zuschlug.
Sie zögerte nur kurz. Noch bevor der Motor mit lautem Getöse ansprang, lief sie zur Ladefläche und löste auf einer Seite die Plane. Froh, dass sie sich am Morgen nicht für einen Rock, sondern für eine Hose entschieden hatte, stieg sie auf die Anhängerkupplung und hievte sich von dort auf die Ladefläche. Der Truck setzte ruckartig zurück. Sie verlor das Gleichgewicht und stieß sich den Arm an einer großen Holzkiste. Sie unterdrückte einen Schmerzensschrei und hielt sich an der Kiste fest, als der Lastwagen auch schon losfuhr. Erst nach einer kleinen Ewigkeit – zumindest kam es ihr so vor, tatsächlich konnte höchstens eine halbe Stunde verstrichen sein – wagte sie einen Blick durch den Spalt in der Plane.
Als sie erkannte, welcher Route der Fahrer folgte, wusste sie, dass das Schicksal ihr die Entscheidung, wie es von hier aus weitergehen sollte, abgenommen hatte.
Mark gesellte sich zu Vaughn, der neben Breeanna Montgomerys Wagen wartete. Als ihr Partner sie darüber informiert hatte, dass Breeanna soeben getankt habe und jetzt in dem Café eingekehrt sei, hatten sie sofort reagiert, in der Hoffnung, sie zu schnappen.
Vaughn hatte Mark an der Tankstelle und im Café nach Breeanna suchen lassen, während er selbst im Wagen gewartet hatte.
»Und?«, fragte er jetzt ungeduldig.
»Der Angestellte sagt, sie hätte sich nach der Damentoilette erkundigt. Er hat sie reingehen, aber nicht wieder rauskommen sehen. Ich habe nachgeschaut. Auf der Toilette war niemand, und dort gab es auch keine Fluchtmöglichkeit. Allerdings gelangt man von der Personaltoilette nach draußen auf die Rückseite des Gebäudes.«
»Dann ist sie uns also wieder entwischt.«
Mark nickte. »Sieht ganz so aus. Sie befindet sich definitiv nicht mehr im Gebäude, und ich habe auch die nähere Umgebung abgesucht.« Aufmerksam beobachtete er die Reaktion seines Partners. Er wusste, dass Vaughn wie immer mit Leib und Seele bei der Arbeit war, aber diesmal kam noch etwas Persönliches hinzu. Vaughn verfolgte ein ganz privates Interesse, und das war ihm sehr, sehr wichtig.
»Sorg dafür, dass jeder Cop im ganzen Land ihr Foto bekommt, aber schärfe ihnen auch ein, dass die Medien auf gar keinen Fall Wind von der Sache bekommen dürfen. Sie sollen mich persönlich informieren, sobald ihr Aufenthaltsort bekannt ist. Kein Zugriff; sie sollen sie nur im Auge behalten. Diskret.«
Mark tippte eine Nummer in sein Handy ein. Es ärgerte ihn, dass Vaughn nicht einmal ihm verraten hatte, worum es eigentlich ging. Irgendein Buch, das die Montgomery angeblich bei sich hatte – so viel hatte er immerhin erwähnt –, jedoch kein Wort darüber, was daran so furchtbar wichtig war. Aber Mark war ein geduldiger Mensch, einer der Gründe, weshalb man ihn für diesen Job ausgewählt hatte.
Er hoffte nur, dass seine weiteren speziellen Fähigkeiten nicht benötigt werden würden.
Kapitel 2
»Wie konntest du einen solchen Vollidioten auf die Montgomery ansetzen?«, schimpfte Frank Delano, die buschigen schwarzen Brauen unheilvoll über der breiten Nase zusammengezogen.
Darren »Doggie« Kennett zuckte zusammen, als Frank mit der Faust auf seinen Schreibtisch schlug, das einzige Möbelstück in seinem Arbeitszimmer, das stabil genug aussah, um dem Wutanfall des massigen Mannes standzuhalten. Doggie verdankte seinen Spitznamen Frank, den das lange Gesicht, die hängenden Ohren und Tränensäcke seines Untergebenen an eine der Lieblings-Zeichentrickfiguren seiner Kindheit erinnerten. Manchmal fragte er sich allerdings, ob Doggies Intellekt nicht auch jenem des Tieres entsprach, nach dem er benannt war.
»Bisher hat er seine Sache immer gut gemacht.« Doggie zog in einem halben Achselzucken die linke Schulter hoch, sodass es aussah, als agiere diese losgelöst vom Rest des Körpers. »Er hat mir versichert, er wäre clean. Schon seit Monaten. Als er kam, machte er einen ganz normalen Eindruck. Erst als wir eine Weile warten mussten, merkte ich, dass er auf einem Trip war. Ich hab gesagt, er soll sich verpissen, aber er wollte unbedingt bleiben, weil er scharf auf die Kohle war.«
»Du hättest ihm einen Fünfziger zustecken und ihn wegjagen sollen wie einen räudigen Köter.«
»Dazu war es zu spät. Der Wagen fuhr vor, und er folgte ihr ins Haus. Ich wollte ihm nach, aber dann habe ich die beiden anderen Typen bemerkt. Richtig unheimlich waren die. Wie aus dem Nichts aufgetaucht. Sie müssen durchschaut haben, was los war, sie sind nämlich nicht ins Haus, sondern haben sich draußen versteckt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also habe ich mich nicht von der Stelle gerührt.«
Frank hievte seinen massigen Körper aus dem Ledersessel, der sich langsam wieder mit Luft vollsog. »Stattdessen hast du zugesehen, wie sie deinen Kumpel erschießen, und die Montgomery einfach wegfahren lassen.«
Die Worte an sich klangen recht harmlos, aber der Tonfall war eiskalt. Doggie trat kalter Schweiß auf die Stirn. Er fuhr sich mit der Hand über das Gesicht und fragte sich, ob die Klimaanlage eingeschaltet war. »Ich habe keinen Schimmer, wer die Kerle waren, Frank, ehrlich. Mich haben sie aber nicht entdeckt. Sie sind los, sobald sie die Leiche im Kofferraum verstaut hatten.«
Frank versuchte, logisch zu denken. Die Leiche mitzunehmen und den Tatort zu säubern passte zu niemandem, den er kannte, und nach allem, was Doggie ihm über den Zwischenfall berichtet hatte, musste es sich bei den beiden Männern um Profis handeln. Fragte sich nur welcher Art. Das führte ihn zum einzig logischen Schluss.
Jemand hatte gesungen.
Jemand hatte ihn aus dem Spiel drängen wollen.
Dafür würde dieser Jemand bezahlen.
Der Sessel ächzte, als er sich wieder hinsetzte und nach dem Telefonhörer griff.
Paige Montgomery blickte auf, als Allan Walters die Empfangshalle des Montgomery Medical Research Institutes in St. Kilda betrat. Er ging so zügig, dass die Schöße seines offen stehenden Laborkittels hinter ihm her wehten, und als er sich über den Empfangstresen beugte, fiel ihm das glatte braune Haar bis auf die Brillengläser.
»Hat Breeanna sich gemeldet?«, fragte er.
Paige runzelte die Stirn. »Ist sie denn nicht an ihrem Platz?«
»Sie ist heute Morgen nicht gekommen, und da auch der Professor fehlt, musste ich die Routinechecks für ihre sämtlichen Experimente durchführen – neben meiner eigenen Arbeit, versteht sich. Sie meldet sich weder zu Hause noch auf dem Handy. Ich habe es mehrmals versucht.« Sein Haar schwang hin und her, als er verärgert den Kopf schüttelte. »Dabei ist sie sonst so zuverlässig.« Er sah auf die Uhr und schob die Brille höher. »Es ist schon fast zwölf. Ich muss wieder an die Arbeit.« Mit einer ungeduldigen ruckartigen Kopfbewegung wandte er sich ab und entfernte sich durch den Verbindungsgang zwischen Verwaltungs- und Labortrakt.
Paige blickte ihm nach. Er erinnerte ein wenig an einen aufgeschreckten Ibis, aber Allan hatte recht, für gewöhnlich war Breeanna absolut zuverlässig. Da sie sich nicht telefonisch krankgemeldet hatte, musste etwas passiert sein. Der Unfall des Professors vor einer Woche hatte sie betroffen gemacht, und nachdem sie ihn dann zwei Tage später im Krankenhaus besucht hatte, hatte sie abwesend gewirkt ... und tief beunruhigt. Paige kaute nervös auf der Unterlippe. Sie würde bei Breeanna vorbeifahren und nachsehen, ob mit ihr alles in Ordnung war.
Ein kleiner Warteraum, eingerichtet mit braun gemusterten bequemen Sesseln, die farblich perfekt auf die cremefarbenen Wände und klassischen Gemälde abgestimmt waren, trennte den Empfangstresen von zwei geschlossenen Türen auf der anderen Seite des einladenden Raums. Paige hatte ihren Vater darauf hingewiesen, dass moderneres Mobiliar den Bereich repräsentativer machen würde, aber George Montgomery hatte nur milde gelächelt und gemeint, die Sessel seien noch tadellos und würden erst ausgetauscht werden, wenn sie ihren Zweck nicht mehr erfüllten. Paige wusste, dass der gesamte Gewinn, den sie mit der kommerziellen Arbeit des Labors erzielten, in die Krebsforschung gesteckt wurde, die ihrem Vater so sehr am Herzen lag.
Sie schnappte sich ihre Handtasche, steuerte die linke der beiden Türen an und klopfte. Auf das knappe »Herein« ihres Onkels hin betrat sie dessen Büro.
Die Einrichtung von James Montgomerys Büro stand in krassem Kontrast zur konservativen, beinahe altmodisch bestückten Empfangshalle. Chrom und Glas dominierten und schufen ein Ambiente, das perfekt zum Nutzer des Zimmers passte. Bei Paiges Eintreten blickte James auf, und die grauen Strähnen in seinem lichter werdenden braunen Haar schimmerten im Schein der Deckenbeleuchtung. Sein anthrazitfarbener Anzug war maßgeschneidert und brachte sowohl seine imposante Statur als auch die schlanke Figur zur Geltung. Paige registrierte jedoch überrascht, dass der Stoff leicht verknittert war, als hätte James seiner Erscheinung nicht die gleiche Sorgfalt gewidmet wie sonst. Er war am Morgen leicht verspätet erschienen, und Paige hatte ihm beim Durchqueren der Halle nur einen flüchtigen Blick zugeworfen.
Sie berichtete ihm, was sie von Allan Walters erfahren hatte. »Ich fahre jetzt mal schnell rüber, um nach Breeanna zu sehen. Ich mach mir Sorgen«, schloss sie.
James erhob sich. »Ich begleite dich. Falls sie krank ist, kann ich vielleicht etwas für sie tun.« Er kam um seinen Schreibtisch herum und legte Paige beruhigend eine Hand auf die Schulter. »Wir nehmen meinen Wagen.«
Auf der Fahrt nach East Malvern, dem Viertel, in dem Breeanna lebte, versuchte Paige, die Sorge um ihre Schwester zu verdrängen und sich auf das zu konzentrieren, was ihr Onkel sagte. Sie hatte James sehr gern.
Obwohl sie wusste, dass ihr Vater sie liebte, hatte der sie immer ein wenig eingeschüchtert. Vielleicht lag es daran, dass sie ihn als Kind so selten zu Gesicht bekommen hatte. So wie die Dinge standen, hatten die gelegentlichen Ferien, die sie bei ihm in Melbourne verbracht hatte, den Eindruck emotionaler Distanz nur verstärkt. Der ganze Lebensinhalt ihres Vaters bestand darin, ein Heilmittel für den Krebs zu finden, der Morag, Breeannas Mutter, das Leben gekostet hatte. Und wenn sie ganz ehrlich war, war sie selbst immer eifersüchtig gewesen auf seine Liebe zu seiner toten ersten Frau. Als Teenager hatte sie ihn beinahe gehasst dafür, dass ihre Mutter seinetwegen so sehr gelitten hatte. Er hatte nur wieder geheiratet, weil er eine Ersatzmutter für Breeanna brauchte, und das war seiner zweiten Frau, die sich immer ungeliebt gefühlt hatte, ebenso wenig entgangen wie seiner zweiten Tochter, die von Anfang an hinter seiner Arbeit hatte zurückstehen müssen.
Sein jüngerer Bruder James hingegen war charmant, freundlich und nahm sich Zeit, mit Paige zu reden, wodurch er ihr das Gefühl vermittelte, für jemanden wichtig zu sein. Die 26-Jährige, die in Perth aufgewachsen war und ihren Vater immer nur bei kurzen Besuchen erlebt hatte, hatte in James die schmerzlich vermisste Vaterfigur gefunden. Und so hatte sie nicht gezögert, als er ihr vor zwei Jahren den Job im Institut angeboten hatte.
Sie betrachtete die eleganten Villen East Malverns, die an ihnen vorbeizogen. James bog mehrmals ab, und die Häuser veränderten sich, sahen bescheidener, weniger imposant aus. In einer Straße, in der die meisten Gärten einen eher vernachlässigten Eindruck machten, verlangsamte er das Tempo.
Kurz darauf hielten sie vor einem kleinen, gedrungenen Backsteinhaus, das nach dem Ersten Weltkrieg Breeannas Urgroßeltern gehört hatte. Das Haus war über ihre Familie mütterlicherseits weitervererbt worden, und vor einigen Jahren hatte Breeanna schließlich beschlossen, bei ihrem Vater auszuziehen und stattdessen hier zu wohnen.
Breeannas Wagen stand nicht in der Auffahrt. Paige hatte ihre Halbschwester früher immer ein wenig sonderbar gefunden, aber nachdem sie über die Arbeit in der Firma ständig in Kontakt gestanden hatten, hatte sie eine warmherzige, großzügige Seite an Breeanna kennengelernt, die sie inzwischen längst schätzte. Ihre Sorge nahm zu.
»Sie sollte den Garten etwas besser pflegen«, grummelte James, als sie die Zufahrt hinaufgingen.
Paige blickte auf die blühenden Sträucher und fand die Farbenpracht rundum sehr ansprechend. »Mag sein, dass der Garten etwas ungepflegt ist, aber die Blüten überall sind doch hübsch. Außerdem duftet es wunderbar.«
James lächelte nur dünn, und jetzt bemerkte sie auch, wie müde er aussah. Graue Strähnen durchwirkten seit Kurzem sein Haar, und die Furchen in seiner hohen Stirn waren tiefer geworden. Da er das Institut allein leiten musste, solange sein Bruder sich in Übersee aufhielt, und in Anbetracht der zusätzlichen Last, seit der Professor verunglückt war, musste Breeannas unerklärliches Verschwinden eine zusätzliche unwillkommene Sorge darstellen.
Ein helles Läuten hallte durch das Haus, als James den Klingelknopf drückte. Sie warteten. Er klingelte erneut. Wieder rührte sich nichts.
»Hast du noch den Zweitschlüssel, den Breeanna dir gegeben hat?«
Paige kramte in ihrer Handtasche und förderte tatsächlich einen einzelnen Schlüssel an einem schmalen Band zutage. Sie sperrten auf und traten ein, wobei Paige laut Breeannas Namen rief. Als sie eben das Wohnzimmer betreten hatte, blieb Paige abrupt stehen.
»Oh!«, entfuhr es ihr. Als sie das Stirnrunzeln ihres Onkels bemerkte, sagte sie eilig: »Breeanna ist normalerweise sehr ordentlich. Das ... passt gar nicht zu ihr.« Sie deutete auf die halbvolle Teetasse, die übergeschwappt sein musste und in einer kleinen Pfütze stand, sowie auf einen unordentlichen Stapel alter Zeitschriften. Das spärlich gehaltene Mobiliar ließ den Raum größer erscheinen, als er war: ein grünes Sofa mit niedriger Rückenlehne, eine Stereoanlage und ein hohes Bücherregal in der gegenüberliegenden Zimmerecke.
»Komm weiter«, meinte James. »Vielleicht liegt sie im Bett.«
Der Zustand des Schlafzimmers beunruhigte Paige ebenfalls. Das große Doppelbett war nicht gemacht, und auf einem weißen Rattanstuhl und auf dem Fußboden lagen Kleidungsstücke und ein Paar Schuhe verstreut. Nun war sie wirklich ernsthaft besorgt. Sie griff nach einem umgekippten Bilderrahmen auf der Kommode und betrachtete das Foto. Schwarzes, von der Sonne wie poliertes Haar umrahmte ein Gesicht, das man aufgrund der entschlossenen Kinnpartie und der vollen, lächelnden Lippen weder als schön noch als unscheinbar bezeichnen konnte. Am faszinierendsten aber waren die Augen. Warm und dunkel – schien es, als könnten sie tief in die Seele anderer Menschen blicken, eine Wirkung, die sogar das Foto vermittelte.
»Breeanna ist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten, nicht wahr?«
James war unbemerkt hinter sie getreten, und Paige zuckte beim Klang seiner Stimme erschrocken zusammen. Hastig stellte sie das Foto wieder hin. »Ja. Allerdings ist Breeanna hübscher, als es ihre Mutter war.« Sie zuckte die Achseln. »Soweit ich das anhand der Fotos, die ich gesehen habe, beurteilen kann.«
»Morag war eine außergewöhnliche Frau«, entgegnete James, wie um ihr bewusst zu widersprechen. »Charismatisch, faszinierend ...« Er wandte sich ab, aber sie hörte noch das geflüsterte Wort »wunderschön«, und die offenkundige Bewunderung ihres Onkels trug noch dazu bei, den geheimnisvollen Eindruck zu verstärken, den sie von der ersten Frau ihres Vaters hatte.
James warf ihr über die Schulter hinweg einen Blick zu. »Ich schaue mal in den anderen Zimmern nach. Vielleicht findest du ja in der Zwischenzeit hier einen Hinweis darauf, wo Breeanna stecken könnte.«
Paige richtete den Blick wieder auf die Kommode. Breeanna benutzte nur wenig Schminke, was die spärlichen Utensilien dort bestätigten. Paige öffnete die oberste Schublade. Eine Schmuckschatulle, persönliche Gegenstände, ein Ersatzschlüsselbund, Weihnachts- und Geburtstagskarten, die ihr besonders viel bedeuten mussten. Aber nichts, was auf ihren Verbleib hindeutete. Sie sah in den anderen Schubfächern nach. Unterwäsche, Strickoberteile, Shorts. Sie schob die letzte Schublade wieder zu und hörte ein dumpfes Poltern. Stirnrunzelnd zog sie die Lade wieder auf und tastete zwischen Nylons, Slips und Sportunterwäsche umher, bis sie einen harten Gegenstand fühlte. Sie holte ein schwarzes Plastikkästchen hervor, nicht größer als eine kleine Pralinenschachtel. Sie wollte schon den Deckel aufklappen, zögerte dann aber doch. Sie sollte das nicht tun. Damit würde sie Breeannas Privatsphäre verletzen. Sie legte das Kästchen gerade zurück, als James hereinkam.
»Was ist das?«
»Keine Ahnung. Es lag in der Schublade. Ich wollte es gerade zurücklegen.«
Ehe Paige jedoch dazu kam, hatte James ihr das Kästchen aus der Hand genommen und öffnete es.
Der Blick auf den Inhalt verschlug Paige den Atem. Im ersten Moment war sie sprachlos, dann schüttelte sie ungläubig den Kopf.
»Oh, nein«, hauchte sie mit vom Schock rauer Stimme und schlug gleich darauf eine Hand vor den Mund, als wollte sie die Worte zurückhalten. »Nicht Breeanna.«
Kapitel 3
Neun Tage später
Der Schmerz war schier unerträglich.
Er fraß sich in Rogan McKays Körper und war so quälend, dass dieser sich rastlos in den schweißnassen Laken herumwälzte. Rogan versuchte aufzustehen, um Hilfe zu holen, aber es gelang ihm nicht.
Dann hörte der Schmerz plötzlich auf, und zurück blieb ein Gefühl von Wundsein, wo eben noch unbeschreibliche Qualen gewütet hatten. Für eine Weile blieb er verschont, und seine Atmung normalisierte sich wieder.
Aber der Schmerz kehrte zurück.
Rogan biss die Zähne zusammen, um nicht zu schreien, nicht laut um Gnade zu flehen. Entkräftet tastete er nach der Nachttischlampe und machte Licht.
2.53 Uhr.
Er war so müde, so verdammt müde gewesen, als er sich um Mitternacht ins Bett hatte fallen lassen, dass er, als ihn der Schmerz aus dem Tiefschlaf gerissen hatte, im ersten Moment glaubte, es handle sich um einen bösen Traum. Aber die Intensität der Qualen hatte ihm bald klargemacht, dass es sich nicht um einen Albtraum handelte, der sich nach dem Aufwachen abschütteln ließ.
Ein heiserer Schrei blieb ihm förmlich im Hals stecken, als der Schmerz ihn auf das Kissen zurückwarf. Diesmal war es schlimmer als alles, was er je erlebt hatte ... Seine Muskeln verhärteten sich, und die Sehnen und Adern in seinem Hals spannten sich wie Drahtseile. Schweiß rann ihm von der Stirn in die Augen. Sein Verstand blendete alles aus, jeden Gedanken, so sehr nahmen ihn die unmenschlichen Qualen gefangen.
Dann, von einer Sekunde auf die andere, war es wieder vorbei.
Ermattet ließ er sich auf die Matratze zurücksinken. Während die durcheinanderwirbelnden Nebelschwaden in seinem Hirn sich lichteten, sog er gierig und keuchend die wohltuende Luft ein. Vorsichtig bewegte er Arme und Beine. Schließlich setzte er sich bedächtig auf, stand dann schwach und wackelig neben dem Bett und versuchte zu begreifen, was das alles zu bedeuten hatte.
Nach und nach wurde er sich einer großen Leere in seiner Seele bewusst. Einer Verzweiflung, eines Gefühls des Verlustes, das so tief reichte, dass seine Eingeweide sich zusammenzogen.
Jetzt wurde ihm alles klar. Jetzt wusste er, was los war. Aber noch weigerte sich sein Hirn, die Wahrheit zu akzeptieren.
Wie ein Greis schlurfte er aus dem Schlafzimmer hinüber ins angrenzende Arbeitszimmer. Er schaltete das Licht ein, ließ sich auf den Schreibtischsessel fallen und zwang sich, den Telefonhörer zu ergreifen. Er tippte eine Nummer ein. Dann wartete er.
Als sich niemand meldete, wählte er eine zweite Nummer. Ein Anrufbeantworter forderte ihn auf, eine Nachricht zu hinterlassen. Er sprach ein paar Worte und legte dann wieder auf.
Ein Spiegel an der gegenüberliegenden Wand warf den verzweifelten Blick seiner Augen zurück. Augen, so strahlend blau, dass sie im warmen Licht glitzerten wie Eisberge. Augen, die ihn, wie er fürchtete, nie wieder ansehen würden.
»Hast du letzte Nacht schlecht geschlafen, Junge?«, fragte Alice McKay, als Rogan sich auf einen Küchenstuhl fallen ließ und sich einen Orangensaft einschenkte.
Er strich sich eine lange Strähne sonnengebleichter Haare aus der Stirn, ehe er antwortete. »Ich brauche nach längerer Zeit auf See immer eine Weile, um mich daran zu gewöhnen, wieder an Land zu sein, Mum.«
Alice lächelte. »Du bist seit zwei Tagen zurück. Du hast wohl eher etwas zu heftig mit Meryl und deinen Brüdern gefeiert?«
Rogan sah den Schmerz in den Augen seiner Mutter aufflackern. Vor sechs Monaten war sein jüngster Bruder Ewan ermordet worden, und obgleich Rogan dazu beigetragen hatte, dass der Mörder gefasst werden konnte, wusste er, dass dies seinen Eltern nur ein geringer Trost war. Auch wenn sie es nicht offen gezeigt hatte, war Ewan immer Mutters Liebling gewesen. Sie hatte sich bemüht, ihren Schmerz durch harte Arbeit in der Familienmolkerei zu ersticken, aber Rogan war nicht entgangen, dass sie in den letzten Monaten um Jahre gealtert war. Ihr Haar, früher dunkelblond wie das seine, war in kürzester Zeit beinahe völlig ergraut, und die Pfunde, die sie im Alter zugelegt hatte, waren dahingeschmolzen, sodass ihr Gesicht eingefallen und faltig aussah. Auch sein Vater machte nicht mehr solch einen unermüdlichen und starken Eindruck auf ihn.
Das abrupte Altern seiner Eltern hatte ihn schockiert, und ihm wurde klar, dass er ihnen nicht von der lähmenden Furcht erzählen durfte, die ihn auffraß. Sie hatten schon einen Sohn verloren; er wollte ihnen nicht sagen, dass sie möglicherweise noch einen zweiten verloren hatten. Rogans erfolgloser Versuch, seinen Bruder telefonisch zu erreichen, schien seinen schrecklichen Verdacht zu bestätigen.
»Ich dachte, ich fahre mal nach Melbourne und besuche Liam«, sagte Rogan scheinbar beiläufig. Seiner Stimme war nicht anzuhören, dass er es kaum erwarten konnte, in seinen Wagen zu springen und loszufahren. Er ließ den Blick durch die geräumige Wohnküche mit den Holzschränken, den cremefarbenen Wänden und dem massiven Essplatz schweifen. Der Raum strahlte Beständigkeit und Geborgenheit aus, aber Ewans plötzlicher Tod hatte ihnen vor Augen geführt, dass Sicherheit nicht mehr war als eine Illusion.
»Das wird ihn sicher freuen.« Alice stellte einen Teller mit Würstchen, Eiern und Tomaten vor ihn hin. »Ihr beide habt euch seit Ewans Beerdigung nicht mehr gesehen«, fügte sie ein wenig traurig hinzu.