
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Im großen Berliner Zimmer beginnt die Freundschaft von Andrej und Simon. Dort ritzen sie ihre Initialen ins Holz der Fensterbank und von dort aus begeben sie sich auf den langen Streifzug durch die Straßen ihres Viertels. Während Berlin-Mitte durch den Elan der herbeiströmenden Alteigentümer, Unternehmerinnen, DJs und DJanes, Kunst- und Abenteuerlustigen zu neuem Leben erwacht, gleiten die Kinder auf den Wegen ihrer Jugend an den Rand des Geschehens. Durch verwinkelte Hinterhöfe und den chaotischen Leerstand, in die Sackgasse der Kleinen Hamburger Straße, wo sie den Anfang und das Ende der Besetzung der Nr. 5 beobachten, bis auf die Dächer, auf denen sie fern der Welt ganze Nachmittage verbringen. Als die alten Häuser hinter neuen Fassaden und die Flachdächer unter den Dachterrassen der neuen Bewohner mehr und mehr zu verschwinden beginnen, geraten sie auf immer bedrohlichere Abwege. In seinem Romandebüt verwebt Lorenz Just das Aufwachsen seiner Figuren mit der rasanten Veränderung, die aus dem Berlin-Mitte der Wende das Berlin-Mitte der Nullerjahre werden ließ. Fernab gefestigter Geschichtsbilder vom wilden Berlin und den Träumen der Selbstverwirklicher erzählt er von jener fragilen Freiheit, die in den Neunzigern eine ganze Generation geprägt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Im großen Berliner Zimmer beginnt die Freundschaft von Andrej und Simon. Dort ritzen sie ihre Initialen ins Holz der Fensterbank und von dort aus begeben sie sich auf den langen Streifzug durch die Straßen ihres Viertels. Während Berlin-Mitte durch den Elan der herbeiströmenden Alteigentümer, Unternehmerinnen, DJs und DJanes, Kunst- und Abenteuerlustigen zu neuem Leben erwacht, gleiten die Kinder auf den Wegen ihrer Jugend an den Rand des Geschehens. Durch verwinkelte Hinterhöfe und den chaotischen Leerstand, in die Sackgasse der Kleinen Hamburger Straße, wo sie den Anfang und das Ende der Besetzung der Nr.5 beobachten, bis auf die Dächer, auf denen sie fern der Welt ganze Nachmittage verbringen. Als die alten Häuser hinter neuen Fassaden und die Flachdächer unter den Dachterrassen der neuen Bewohner mehr und mehr zu verschwinden beginnen, geraten sie auf immer bedrohlichere Abwege.
In seinem Romandebüt verwebt Lorenz Just das Aufwachsen seiner Figuren mit der rasanten Veränderung, die aus dem Berlin-Mitte der Wende das Berlin-Mitte der Nullerjahre werden ließ. Fernab gefestigter Geschichtsbilder vom wilden Berlin und den Träumen der Selbstverwirklicher erzählt er von jener fragilen Freiheit, die in den Neunzigern eine ganze Generation geprägt hat.
© Robert Sievert
Lorenz Just, geboren 1983, lebt und arbeitet in Berlin. Er studierte in Halle an der Saale und in Leipzig am Deutschen Literaturinstitut. 2015 erschien sein Sachbuch ›Mohammed. Das unbekannte Leben des Propheten‹ (Gabriel Verlag), 2017 bei DuMont sein Erzählband ›Der böse Mensch‹.
Lorenz Just
AM RAND DER DÄCHER
Roman
Von Lorenz Just ist bei DuMont außerdem erschienen: Der böse Mensch
eBook 2020 © 2020 DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Nurten Zeren, www.zerendesign.com Satz: Angelika Kudella, Köln eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, LeckISBN eBook 978-3-8321-7040-0
www.dumont-buchverlag.de
Seine rotbraunen Haare hingen kerzengerade, sie waren viel länger, als ich gedacht hätte. Ich glaube auch, dass die Sonne schien und jedes einzelne seiner Haare glänzen ließ. Kopfüber hing er an der obersten Stange und sah mich an. Ich stand im Sand, sicherlich barfuß, und rätselte angesichts seines rot angelaufenen Gesichts. Ich leckte mir über die Oberlippe, ich hielt den Atem an. Wie der Knall einer winzigen Explosion hallte mir sein Name durchs Hirn.
»Die Boa!«, rief Simon und wedelte mit seinem Unterarm, der bis auf die Fingerspitzen eingegipst war: »Ich habe Ratte gespielt, vor dem Terrarium, die dumme Schlange hats nicht verstanden, zwei Tage lang war sie ohnmächtig. Um es wiedergutzumachen, habe ich noch einmal Ratte gespielt und diesmal hinter dem Glas.«
Die Geschichte gefiel mir, sehr sogar; sie zu glauben, war eine andere Sache, da konnte er mit seinem Gipsarm wedeln, soviel er wollte.
»Die Schlange will ich sehen.«
Er schwang vor und zurück, wirbelte herum, landete artistengleich vor mir im Sand. Wilder Applaus wehte von den Silberpappeln herüber, auch die Kinder, die sich mühsam die Stäbe des Klettergerüsts hocharbeiteten, hielten einen Moment lang inne und schauten voller Bewunderung zu Simon. Der strich sich die Haare aus der Stirn und grinste sein Zahnlückengrinsen, und irgendwo, wenn ich mich recht entsinne, fingerte sich ein einsamer Klarinettist vorm offenen Fenster eine festliche Tonleiter hinauf.
»Okay«, sagte er, und los ging es, ohne Umwege und Abschweifungen zielgerichtet die Oranienburger entlang, vorbei an all den gewichtigen Gebäuden, die uns nichts angingen.
Die Haustür schlug ins Schloss, Simon rannte, ich rannte, ein Wettlaufen am Geländer entlang, etliche Stockwerke hoch. An der Wohnungstür holte ich ihn ein, der schon den Schlüssel umdrehte, aufsperrte, hineinstürzte, und stolperte ihm nach. Mitten hinein in die plötzliche Ruhe eines hohen, schiffsartigen Flures, baumlange Dielenbretter knarzten unter den Schritten, Zugluft ließ eine Tür schlagen, irgendwo pochte mein Herz, und ich keuchte wie ein kurz vorm Ertrinken Geretteter. Im riesigen Garderobenspiegel entdeckte ich Simon, der in der Küche vor dem Kühlschrank stand und sich die kalte Luft mit seinem T-Shirt zufächerte. Ich trat die Schuhe von den Füßen, etwas verrenkt zog ich mir auch die Socken aus. Ungewohnt groß war ich im Spiegel, und auch die Bewegungen, die ich machte, hatten etwas fremdartig Selbstverständliches, was mir gefiel. Um mir einmal tief in die Augen zu schauen, wie ich meinte, streckte ich meinen Kopf dem immer größer werdenden Spiegelbild entgegen, aber da waren nur meine blauen Kinderaugen. Ich blickte an mir herab, auf meine blassen Füße, deren Sohlen an den Dielen klebten und feuchte Abdrücke hinterließen, als ich sie vom Boden löste.
»Auf welcher Schule bist du jetzt?«, sagte Simon, als ich zu ihm in die Küche trat. Er stand an der Spüle und war damit beschäftigt, Eier über einer Plastikschüssel aufzuschlagen.
»4. Grundschule, am Koppenplatz, und du?«
Zu konzentriert, um antworten zu können, hatte er begonnen, Kakaopulver in die Schüssel zu schaufeln, sehr viel Kakaopulver, leise zählte er die gehäuften Suppenlöffel, hatte bei zwölf plötzlich genug und warf den Löffel ins Spülbecken. Er kippte noch Milch dazu, verrührte das Ganze dann hektisch mit einem Quirl.
»Überlebenssaft, eklig, aber wichtig«, sagte er, goss den braunen Schleim in hohem Bogen in zwei Tassen und schob mir eine hin. Schwungvoll stieß er seine Tasse gegen meine, dass es laut und dumpf klackte, und trank in einem einzigen, langen Zug aus.
Rohe Eier, giftig, echote es durch meinen Kopf, aber was zählte das schon: Schluck für Schluck, ohne abzusetzen. Ich wischte mir noch den Eiersaft aus den Mundwinkeln, da war Simon schon aufgesprungen.
»Hier, die haben wir jetzt auch.«
Zwischen seinen Händen hielt er eine Schildkröte, hob sie mir wie zum Beweis zentimeternah vors Gesicht, die unförmigen Beine ruderten suchend, und setzte sie wieder ab, vor einen Teller, auf dem zwei Salatköpfe gammelten. Ich wollte mich schon zu ihr hocken, aber Simon zog mich »kommkomm« rufend weiter, durch den Flur ins Wohnzimmer, wo er eine hohe Flügeltür öffnete.
»Das Schlafzimmer meiner Eltern«, sagte er und schob mich vorwärts.
»Was denn?«, sagte ich.
»Na dort«, antwortete er und ließ mich allein.
Am Fußende eines breiten Bettes in einem Glaskasten ein Quadratmeter Steinwüste. Ich trat heran, kniete mich davor, auf Augenhöhe, denn sie war sofort da, die Boa constrictor, wie Simon mir erklärt hatte, sie hatte mich sofort bemerkt, ihren Kopf gehoben, züngelte in meine Richtung. Es gab sie tatsächlich, den Schlangenkopf, den Schlangenkörper, die gesamte Welt, aus der sie stammte, ganze Kontinente lagen auf dieser schwarzen, doppelspitzigen Zunge. Mit einer geduldig lauernden Aufmerksamkeit sah sie mich an, richtete eine Konzentration auf mich, wie ich es noch nicht erlebt hatte. Und ich hockte vor ihr, auf wackligen Beinen. Vollkommen ruhig lag sie da, ihr gewundener, schimmernder Körper, ruhiger als die Steine, die Wasseroberfläche ihrer Tränke, das tote Holz; sie selbst hätte tot sein können, nur die Zungenspitze, die aus dem lippenlosen Maulschlitz vor und zurück schnellte, zeigte, dass sie lebte. Und über allem thronte ihr Blick, der aus den stecknadelkopfgroßen Augen fast leblos, wie etwas Außerirdisches hervorstach. An die Nacht musste ich denken, an die Schwärze des Himmels, die Stille des Weltalls. Ein Blick, dem ich mich anvertrauen wollte, mich in ihn hineinstürzen, zumindest einen Moment lang darin versinken, doch beinahe hätte ich das Gleichgewicht verloren. Auf den Fußballen wippend drückte ich meine Hände gegen das Glas, um wieder sicher zu stehen. Ich ertappte mich dabei, Worte in der Zeitung zu entziffern, mit der der Boden des Terrariums ausgelegt war: Hasenstall, Reisekoffer … Die Schlange hielt ihren Blick auf mich gerichtet, während ich mir vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben in dieser Deutlichkeit aufsagte, was ich da vor mir sah. Und unablässig fuhr ihre Zungenspitze durch die Luft, dieses in zwei geschnittene Sinnesorgan schmeckte mich durch das Glas hindurch und verschwand wieder im Maul der Boa. Der starre Blick und die lebhafte Zunge. Wie eigenständige Lebewesen begannen Gedanken durch meinen Kopf zu schießen, sodass ich umsonst versuchte, mich vom Blick der Schlange noch einmal einfangen zu lassen. Sie fragten, was Simon tat, sagten mir, dass die Knie schmerzten, es genug sei, ich endlich wieder aufstehen solle. Die Schlange hauchte ihre Zunge aus und ein wie Atemluft; sie schien zu lächeln, etwas zu wispern, sie schien wirklich zu wissen, dass es mich gab. Ich riss mich los.
Und mir war, als würde ich durch einen Traum taumeln: zurück ins Wohnzimmer, wo die Strahlen der untergehenden Sonne geradeso über die Dächer der Stadt hinweg durch die staubigen Fenster schrammend mir in die Augen stachen, dass ich für einige Sekunden blind war. Ich stützte mich auf dem Fernseher ab, bis die Schwärze im Kopf nachließ. Da war meine Hand, knochenweiß lag sie auf dem schwarzen Kasten. Mit dem Zeigefinger strich ich über das graue Glas des Bildschirms, zog einen horizontalen Streifen, der eine Steinwüste vom Himmel trennte, hörte das Rasseln von Klapperschlangen und das Kreischen in trockenen Halmen versteckter Grillen, sah einen Sandsturm aufziehen. Den Staub rieb ich zwischen Daumen und Fingerkuppe zu einem Klümpchen und schnipste es weg wie etwas, das gerade noch eine Welt bedeutet hatte. Im Flur rief ich Simons Namen so laut, als stünde er hundert Meter entfernt im Gegenwind.
Ich hörte eine Antwort oder glaubte, sie zu hören.
Und dann betrat ich Simons Zimmer, dieses dunkle, riesenhafte Zimmer, ein Berliner Zimmer, wie ich irgendwann lernen würde, setzte Fuß in diese Kathedrale meiner Kindheit und kletterte sofort über die Strickleiter auf einen großen Kasten hinauf, der in Simons Zimmer hineingebaut war. Die Freifläche auf diesem Podest war nicht mit einem Geländer, sondern einem engmaschigen Netz gesichert, in das überall Löcher geschnitten waren, durch die eine Reihe anderer, ineinander verschachtelter Podeste zu erreichen war, auf denen sich hingeworfene Schlafecken verteilten, über die Comichefte, Kuscheltiere, Klamotten verstreut waren. Ich erkannte eine Sprossenwand, einen Turnbock, einen mit Blättern, Büchern, Stiften, Werkzeugen, Spielzeugen über und über bedeckten Schreibtisch. Von zahllosen Höhlen, in die nur über verborgene Nischen zu gelangen war, war auszugehen – wahrscheinlich werkelte Simon irgendwo in einem dieser Verstecke. Ich kniete mich an den Spielherd, der am Rand des Podests aufgestellt war, hob den Deckel von einem winzigen Topf, der leer war. Ich fand eine halb volle Kanne Tee, roch daran, Pfefferminztee, und trank sie aus.
»Simon«, rief ich noch einmal ins Zimmer hinab.
»Gleich«, wurde mir geantwortet.
Also legte ich mich für den Augenblick auf eine der Steppdecken mit Zwergenmuster und betrachtete die dünnen Risse im Anstrich der Zimmerdecke und die zerfetzten Spinnweben, die überall in den Ecken des Zimmers hingen, und fühlte mich sehr wohl dabei, an diesem entrückten Ort, denn niemand außer Simon wusste, dass ich hier war, weder mein Bruder noch meine Eltern, niemandem hatte ich Bescheid gegeben, niemanden um Erlaubnis gebeten, wie zwei unabhängige Menschen waren wir einfach losgelaufen. Und es war, als ahnte ich jetzt schon die ganze Zukunft, die sich hier entfalten würde. All die Nachmittage schienen durch den Raum zu schweben, die wir hier oben auf dem Podest damit verbringen würden, am Spielherd winzige Portionen Suppennudeln oder eine Handvoll Kartoffeln und zum Nachtisch Apfelkompott zu kochen. Als läge ich jetzt schon zwischen den Stapeln an Geschirr, die sich über Wochen ansammeln würden, bis wir sie in die Spüle schaffen und dort seinen Eltern überlassen würden. Als wüsste ich schon von dieser ersten durchwachten Nacht, in der Simon und ich uns eine Kanne Kaffee aus der Küche schmuggeln und eine ganze Sammlung John Sinclair-Kassetten durchhören und kurz darauf vernichten würden, um die leeren Kassettenkörper an den rausgeleierten Bändern wie Leichenteile, die an den Außengrenzen einer Stadt zur Abschreckung auf Holzpfähle gestoßen wurden, ins Netz und an die Sprossenwand zu knoten; wie zwei irre gewordene Urzeitmenschen würden wir kichern am Ende dieser allerersten durchgemachten Nacht. Es war, als könnte ich jetzt schon über die kleine kreisförmige Narbe auf meinem Unterarm streichen, die als einziges Andenken eines Rituals übrig bleiben würde, das Simon und ich eines Abends mit Feuer, Blut und Asche erfinden, aber nicht ein einziges Mal wiederholen würden. Als könnte ich in den feinen Linien der Spinnweben und Risse all das schon ablesen.
»Simon«, rief ich leise und lauschte in sein zerklüftetes Zimmer.
»Ja«, antwortete er, hingehaucht, als hätte ich einen Geist beschworen. Er stand am Fensterbrett, im körnigen Licht des Hinterhofs, halb verdeckt vom taubengrauen Vorhang, der über seine Schulter hing. Ich krabbelte auf allen vieren durchs Netz, über einen Schrank zur Sprossenwand und kletterte hinunter.
»Was machst du denn?«
Feierlich hielt er mir ein Taschenmesser entgegen, und für einen Augenblick dachte ich, er wolle seine eingegipste Linke durchbohren, aber er klappte es zu.
»Guck mal«, sagte er und trat zurück.
Mit vielen harten Schnitten hatte er ein großes S ins Fensterbrett geritzt. Er beugte sich vor und pustete mit kurzen Luftstößen helle Späne von Farbe und Holz aus den Rillen. Sein S war aus spitz aufeinanderstoßenden Linien zusammengesetzt, was dem Buchstaben etwas Verärgertes, beinahe Wütendes verlieh. Simon kratzte noch einmal mit dem Fingernagel sein Werk entlang, zog dann mit einem Ruck den Vorhang zu und trat auf den Schalter einer Stehlampe.
»Es gibt Arbeit«, sagte er und griff aus einem Pappkarton eine Handvoll bunt lackierter Stäbe, die er vor uns auf den Boden schmiss.
»Wir müssen das testen«, erklärte er.
Es handelte sich, so verstand ich seine Ausführungen, um ein nagelneues Spielzeug, das seine Mutter für irgendeine Stiftung zu bewerten hatte. Ziel war es, wie sie es Simon aus der Spielanleitung vorgelesen hatte und er mir mit falschem Ernst zusammenfasste, die Stäbe zu fantasievollen Gebilden zusammenzustecken, um auf diese Weise spielerisch Vorstellungskraft und Abstraktionsvermögen zu schulen. Simon schüttete die ganze Kiste wie einen Eimer Müll aus, und wir stocherten mit den Fußspitzen unschlüssig darin herum, bis er sein Urteil fällte: nichts zu machen. Und er hatte ja recht. In all den Jahren, in denen wir immer mal wieder für seine Mutter testen würden, war nie etwas Brauchbares dabei. Es war sinnloses Zeug, was da erfunden wurde, von scheinbar hoch entwickelten Kleinkindern, gescheiterten Physikern oder Mechanikern und wirren Genies, die ihrer eigenen Spielwut erlegen waren, beraten von Didakten, die sich kaum in ihre kleinen Finger hineindenken konnten, geschweige denn in uns, und sich hinter ihren angelernten pädagogischen Ansätzen verschanzten wie in einem von der Außenwelt abgetrennten, keimfrei gekachelten und Tag und Nacht grell erleuchteten Laboratorium. Es half nichts: Unsere Kritik war gnadenlos und nützte seiner Mutter wenig. Die vernichtenden Berichte aus der Wirklichkeit dieses Spielzimmers würden ihren Auftraggebern nicht zuzumuten sein. Konstruktiv denken war gefordert, aber darüber konnten wir nur lachen.
Nach getaner Arbeit fragte Simon: »Willst du auch?«
Klar wollte ich, hatte mit sicherer Hand mein rostiges Barlow sofort gezückt – woher ich das hatte, ist mir ein Rätsel, ich weiß nur, wie unheimlich stolz ich darauf war, hatte ich doch gehört, dass es so ein Messer war, von dem Huckleberry Finn träumte. Drei gekonnte Schnitte, und die Skizze zu einem großen A war in den Lack des Fensterbretts geritzt.
Ich atmete durch und machte mich ans Schnitzen; Simon hockte sich nun doch noch zu den Stäben, die zwischen seinen Händen leise zu klackern begannen, und eine Art Pause stellte sich ein, ein konzentrierter Stillstand, nur die Finger bewegten sich, nur die Geräusche unserer Arbeit waren zu hören. Fast hätte ich das Zimmer, die Zeit, mich selbst und auch Simon vergessen. Tiefer und tiefer kratzte ich mich ins Holz, pustete den Staub aus den Furchen; die rostige Klinge meines Barleys war scharf wie sonst nichts; Stunden vergingen, Tage oder Monate, was machte das schon?
Da knallte Simon Was-auch-immer-er-gebaut-hatte auf den Boden. Ich hörte, wie er die Stäbe mit dem Fuß zur Seite schob, wie er hinter mich trat, spürte die Wärme seines Kopfes an meiner Wange, als er mir über die Schulter blickte.
»Weißt du«, und er fing an zu erzählen, vom Grundstück seines Opas schwärmte er, von verwachsenen Kiefern, einem Waldsee, hohem Gras, von einem tiefunterkellerten Bungalow, einem Steingarten voll seltener Wüstenpflanzen.
»All das werde ich erben«, sagte Simon und erzählte, dass sein Opa schon seit Jahren kurz vorm Tod stehe. Jedes Mal wenn seine Familie den weiten Weg in den Harz auf sich nahm, würde er in das riesige Greisenohr flüstern, dass er allein das Haus haben dürfe und niemand sonst.
»Keiner versteht, wie Opa dort ganz allein überlebt. Wenn wir kommen, steht er aus seinem Sessel nicht auf. Aber mir hat er’s verraten, und ich soll es genauso machen wie er, das musste ich versprechen, dafür krieg ich das Haus und alles, was dazugehört.«
»Was willst du denn im Harz, du hast hier doch alles«, sagte ich noch, da quietschte die Wohnungstür, Dielen knarzten, schwere Tüten wurden fallen gelassen, ein Ächzen, ein leises Genuschel, auf einmal trat Simons Mutter ins Zimmer.
»Hallo«, sagte sie.
»Hallo«, sagten wir.
Ich schob mein Messer unauffällig in die Hosentasche und trat vom Fensterbrett zurück. Simons Mutter blickte müde in unsere Richtung. Ihre schwarz-grauen Haare hingen ihr tief in die Stirn, dieselbe Frisur wie Simons, ein kraftloser Topfschnitt. Sie sagte auch etwas, aber ich hörte nicht hin; da war sie wieder, die Schildkröte, in ihren Händen, wieder ruderten die orientierungslosen Beine durch die Luft. Ich erkannte den winzigen Kopf in der dunklen Panzeröffnung, sie hatte schwarze Perlenaugen und einen kantigen Mund, sie sperrte ihn auf, verharrte, schloss ihn wieder. Als würde sie gähnen. Sie tat es unaufhörlich. Auf und wieder zu. Wieder und wieder. Simons Mutter kam ins Reden, aber ich konnte nicht wegsehen. Das gepanzerte Tier in den Händen der großen, schweren Frau, wie einen beliebigen Gegenstand hielt sie es vor ihrer Brust. Die Schildkröte versuchte, etwas zu sagen, sie sprach stumm auf uns ein, vielleicht schrie sie auch, verzweifelt, jedoch in der Geschwindigkeit der Schildkröten, weil sie einfach nicht verstehen konnte, warum sie ausgerechnet hier ausgerechnet jetzt gelandet war. Simons Mutter formulierte Silbe für Silbe Dinge wie zweihundertzwanzig Millionen Jahre, Sauropsida, Kriechtiere, einmalige Anpassungsfähigkeit, massenhaftes Aussterben – diese Familie war gefüllt mit enzyklopädischem Wissen, das heute jeder mit Wikipedia vom Tisch fegen würde, aber damals war so ein Wissen noch selten und nicht für jeden zu haben. Ich ging auf sie zu und bat mit offenen Händen um die Schildkröte, und ohne in ihrem monotonen Tonfall auch nur ein wenig ins Stocken zu geraten, sah sie nur kurz zu mir herab, als wäre ich ein neugieriger Hund fremder Leute, und löste gleichzeitig ihre fleischigen Finger vom Panzer. Ich zog ihr die Schildkröte aus den Händen, sie war kühl und hart, aber lebendig, eine merkwürdige Mischung, und stellte mich an eines der Betten. Zwischen zwei Kissen setzte ich sie ab, wo sie sofort in sich selbst verschwand, in ihren Panzerkörper, der kaum so groß war wie meine Hand, ich konnte ihn vollständig umfassen, ihr kleines perfektes Haus. Mit einer Fingerspitze voll Krümeldreck, den ich mir aus der Hosentasche pulte, versuchte ich, sie wieder herauszulocken, aber sie reagierte nicht.
Simon und seine Mutter gerieten tiefer und tiefer in ihr langatmiges Gespräch über Reptilienarten, chemische Formeln, über Wasser und Land und die spezifischen Unterschiede. Ich versuchte gar nicht, mich einzumischen, obwohl ich gern gewusst hätte, wie sie überhaupt zu einer Schildkröte gekommen waren oder wie sie heißen sollte und was sie mit ihr vorhatten. Ich strich der Schildkröte über den Panzer und wartete ab, ob sie ihren Kopf je wieder hervorstrecken würde.
Da schlängelte sich auch Simons Vater zur Tür herein und kratzte sich angesichts der immer noch andauernden Fachsimpelei seinen grauen Vollbart, der ein fliehendes Kinn verdecken sollte, wie Simon mir später verraten würde. Nach einer Weile grüßte er unbestimmt in die Runde und zog sich lautlos einen Stuhl heran; mit vorgerecktem Kopf und bereit, jederzeit mit Wissen auszuhelfen, begann er zuzuhören. Gerade rechtzeitig wandte ich mich wieder der Schildkröte zu, denn millimeterweit schien sich tatsächlich ihr Kopf hervorzuwagen. Sie zuckte aber sofort zurück, als sie mein freundlich zudringliches Lächeln bemerkte.
Ich würde aufs Klo gehen und mich danach auf den Heimweg machen. Was solls, dachte ich und schlich mich hinaus.
Als ich noch vorm Garderobenspiegel stand und mich fragte, ob ich mich verabschieden müsste oder wortlos verschwinden könnte, kamen Simon und seine Mutter in den Flur. Sie sahen mich an, als hätten sie längst vergessen, dass ich da gewesen war. Seine Mutter sagte etwas von Dabei-sein-Wollen, aber ich wusste nicht, was sie meinte. Ob ich dabei sein wolle, wiederholte Simon. Ich nickte nur und folgte ihnen.
Auf der Schwelle zum Schlafzimmer seiner Eltern drehte Simon sich noch einmal um und fing an, hektisch auf mich einzuflüstern: Ich hätte still, sehr still zu sein, reglos bis in die Fingerspitzen, müsse lautlos atmen und auch den Blick ruhig halten, selbst die Gedanken hätten zu schweigen, in Stein gehauen von Kopf bis Fuß solle ich sein, damit Cäsar nicht abgelenkt sei, sobald der Jagdinstinkt die Kontrolle übernahm.
Leise pirschten wir uns zum Glaskasten, in dem die Schlange gleichmütig ausgestreckt über ihrem Deko-Ast hing. Simons Mutter öffnete einen Beutel, den sie unter dem Arm getragen hatte, zog einen Pappkarton hervor, schob behutsam die Scheibe des Terrariums zur Seite, öffnete den Pappkarton und schüttete etwas Schweres zur Schlange hinein. Krallen kratzten über den glatten Kartonboden, ohne Halt zu finden, da kam es zum Vorschein, eine dicke weiße Ratte, die sich sofort in eine Ecke kauerte und zusammenkrümmte, als könnte sie auf diese Weise wie die Schildkröte in sich selbst verschwinden oder sich zumindest wie ein Igel zu einer wehrhaften Kugel einrollen. Ich weiß nicht, ob sie die Schlange überhaupt wahrgenommen hatte, sie sehen konnte, wahrscheinlich ahnte die Ratte ja nicht einmal, dass auf dieser Erde ein so absonderliches Wesen wie eine Boa constrictor existierte. Orientierungslos schnüffelte sie in ängstlichen Verrenkungen herum, um irgendwie zu erraten, was das für eine Gefahr war, die sie so überdeutlich zu wittern schien. Der gesamte Körper der Schlange war augenblicklich in Bewegung geraten. Langsam, wie in Zeitlupe, aber mit einer eisernen Entschlossenheit, sodass ich verstand, warum sie Cäsar hieß, ringelte sich die Boa binnen atemraubender Sekunden zur Sprungfeder ein, während sie die nervös herumschnüffelnde Ratte unablässig anvisierte. Ein einziges blitzartiges Zucken, und ihr exotischer Körper schlang sich um die Todgeweihte, von deren Nasenspitze, die wie ein Hilferuf aus dem Knäuel hervorragte, dunkelrotes Blut zu tropfen begann.
Die weiße Ratte, in die Steinwüste entlassen, erwürgt und verschlungen; ich mochte keine Ratten, die braunen, die von Mülltonne zu Mülltonne huschten, genauso wenig wie die weißen, deren blutrote Augen so leblos gierig starrten, und trotzdem hatte ich Mitleid.
Ich jagte die Treppen hinunter, die Hand immer am Geländer, über den zerkratzten, abgegriffenen Lack, sprang über die letzten acht oder neun Stufen, dass mir vom Aufprall die Fußsohlen brannten, auf den mit gelblichen Ziegeln gepflasterten Hinterhof hinaus, über die verwaiste Teppichstange auf die Mauer, wo ich aufstand, um noch einmal zurückzublicken, und es war, als wäre ich aus einem Traum erwacht, der sofort und auf Nimmerwiedersehen ins Vergessen driftete. In Simons Fenster, hoch oben in der schattigen Ecke zum linken Hinterhaus, brannte kein Licht, nur graues Schwarz und die Ahnung eines Vorhangs. Vielleicht lag sein Zimmer doch auf der anderen Seite, wo die Fenster weit offen standen, als hätte sich jemand endlich dazu durchgerungen, einmal kräftig durchzulüften. Doch kein Vorhang wehte, und keine Aufbruchsmusik tönte in den Hinterhof, kein Mensch lehnte an der Fensterbank, auch kein Blumentopf, nicht einmal ein Aschenbecher waren aufs Fensterbrett gestellt. Die Fenster waren eines Tages einfach nicht mehr geschlossen worden. Oder sein Zimmer lag dort unten, wo im drahtumwickelten Blumenkasten eine Birke wuchs.
Los jetzt, dachte ich und ließ mich auf der anderen Seite der Mauer hinunter. Auf einem Trampelpfad ging es zwischen Brennnesseln und unkrautüberwuchertem Schrott hindurch, dann rannte ich über die Auguststraße und machte durch eine Aneinanderkettung von Innenhöfen hoch zur Linienstraße, auf der ich unentschlossen Richtung Osten spazierte. Und kurz bevor ich zu Hause angekommen war, packte es mich doch noch. Rechter Hand bog ich in einen Hinterhof, kletterte über die Mülltonnen auf eine Mauer, balancierte ein Stück und stieg durch ein Fenster in den ersten Stock einer Trümmerbude, zertrat den Rest einer Glühbirne, dass das Glas unter der Sohle knirschte, kroch durch ein Loch in der Wand, durch das ich auf die Umkleidebaracken des Sportplatzes kam. Ich ließ mich an der Regenrinne hinunterhängen und sprang. Alles Training war vorbei oder ausgefallen, oder alle Mannschaften waren heillos krank oder von einem Auswärtsspiel nicht mehr heimgekehrt; niemand war da, die kahle Freifläche gehörte mir allein. Ich schrie nicht, ich schlug kein Rad, vielleicht wäre das das Richtige gewesen, lief einfach rüber auf die andere Seite des Fußballfelds, zu dem Schrottberg, der sich dort angesammelt hatte, an dem ich manchmal nachmittags spielte. Jetzt setzte ich mich auf ein Brett, das jemand über die Betonblöcke einer kaputten Bank gelegt hatte.
Ich warf einen Stein in die Luft und fing ihn wieder auf. Mein Magen knurrte. Ich sah hinüber zu unserem Haus auf der gegenüberliegenden Seite des Sportplatzes. Hinterm Küchenfenster brannte Licht, die anderen Fenster hatte die Dämmerung schon geschluckt. Es blieb keine Zeit mehr für ein kurzes Spiel gegen die Wand, dabei gab es, wenn der Platz einmal so frei war wie jetzt, nichts Besseres, als am Ende des leeren Feldes Anlauf zu nehmen und den Ball gegen die himmelhohe Rückwand der Volkshochschule zu treten. Stundenlang konnte ich dort stehen und gegen die freie Wand schießen, wieder und wieder, diese endlose Wand, schluckte die Schläge und spuckte den Ball wie einen abgekauten Kern zurück. Mit dünnen Beinen und ohne Technik würde ich zutreten, zwergenhaft, aber mit ganzer Kraft, meinen Ball gegen die Wand, ziellos, da das Ziel so riesig war; einen schwachen Bogen würde er fliegen, sanft und leise aufschlagen und zurückrollen. Doch der Aufprall würde lauter werden, über die Jahre, irgendwann würde ich den Ball gegen die Wand dreschen, dass die Schläge über die ganze Weite des Platzes hallen würden, so träumte ich, wenn ich mit der Wand Fußball spielte.
Eine dunkle Fahne hing bewegungslos an einem Ast im Flieder. Ich stand auf. Es war eine Jacke, eine schwarze Lederjacke, die jeden Augenblick in der Dunkelheit zu verschwinden drohte.
Niemand war zu sehen oder zu hören.
Ich zog sie herunter, warf sie mir wie einen Umhang über die Schultern und rannte weg, am Rand des Sportplatzes entlang, mit weit ausholenden Schritten, die Arme ausgebreitet, und kreischte laut und schrill wie ein Raubvogel. Ich schleuderte die Jacke auf die Mauer zum Hinterhof, kletterte über den angrenzenden Zaun hinterher, hüllte mich wieder in die schwarze Lederkutte und balancierte gegenüber den Fenstern unserer Wohnung die Mauer entlang. Im Wohnzimmer war es dunkel, auch im Badezimmer brannte kein Licht, nur der Müllsack, der vorübergehend ins Fenster geklebt war, schimmerte vom Abendhimmel der Stadt beschienen wie eine Pfütze am Straßenrand. Gestern erst hatte wieder einer der Bolzprofis von Blau-Weiß Berolina über den fünf Meter hohen Zaun, unsere Mauer und unseren Hof hinweg eins unserer Fenster erwischt, meilenweit am Tor vorbei. Wie eine Splitterbombe war die Scheibe explodiert, und wir konnten Gott oder dem allmächtigen Zufall danken, dass in diesem Augenblick niemand von uns friedlich auf dem Klo gesessen hatte. Der Unglücksschütze war sofort in den Hof geklettert und hatte seine ratlosen Entschuldigungen heraufgerufen. Angesichts des treudoofen Gesichts des Fußballjungen war meinem Vater der Ärger in der Brust wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Einen Glaser sollten sie schicken, sie wüssten ja, wohin, hatte er geantwortet und begonnen, die Scherben aufzufegen. Vielleicht wollte er sich seinen Ärger auch nur für den Sonntag aufsparen. Wenn sich die Trainer schon früh am Morgen am Spielfeldrand aufplusterten, sich den letzten Funken Wut aus den Körpern schrien, um die träge Masse ihrer Elf in Bewegung zu versetzen, und mit ihrem Geschrei dem ganzen Viertel die Vormittagsruhe verdarben, konnte es passieren, dass er auf dieses Leben am Rand des Fußballfelds fluchte, die Fenster aufriss und losbrüllte: Ruhe, gebt endlich Ruhe! Und ich weiß nicht, ob er sich an den Herrgott richtete, an den er nicht glaubte, oder an die Fußballtrainer, an die er noch viel weniger glaubte.
In der Küche brannte Licht. Da war mein Bruder, der sich mit erhobenem Arm in einem dünnen Strahl Milch einschenkte, und meine Mutter, die ihm zusah. Sie sagte etwas, worauf er nickte, die Milchpackung absetzte und vorsichtig aus dem stehenden Glas einen Schluck schlürfte. Sie hatten eine Kerze angezündet, deren Licht im stärkeren Licht der Küchenlampe unterging. Ich überlegte, mit den Armen zu wedeln oder wieder zu kreischen. Ich schloss die Augen, holte Luft, öffnete sie, da blickte mir mein Bruder entgegen, zufällig, er stierte müde hinaus, ohne mich zu bemerken.
Bis vor Kurzem waren wir jeden Abend Hand in Hand eingeschlafen, waren nachts zusammen ins Bad geschlichen, um zu pinkeln, erst der eine, dann der andere, und zusammen zurück. Dann jedoch, ohne Streit und ohne Absprache, hatten wir die Matratzen auseinandergezogen und mit Kreide, die schnell wieder verwischte, eine Linie markiert und unser Zimmer aufgeteilt. Seitdem lag ich abends lange wach, wälzte mich von der einen zur anderen Seite und versuchte, die Augen geschlossen zu halten, die wie von selbst immer wieder aufklappten, um noch ein letztes Mal durch unser dunkles Zimmer in Richtung meines Bruders zu schauen; noch einmal wollte ich Gute Nacht sagen, um noch einmal seine Antwort zu hören, aber ich zwang mich, stumm zu bleiben und reglos am Rand der Matratze auf dem Bauch zu liegen, damit er ja nichts bemerkte. Er schlief ohne Schwierigkeiten ein oder täuschte dasselbe vor wie ich. Jetzt schmierte er sich Butter aufs Brot, legte Käse drüber und strich Tomatenketchup oben drauf. Meine Mutter sah ihn an, dann blickte auch sie zum Fenster, wahrscheinlich betrachtete sie sein Spiegelbild. Ich sprang auf eine der Mülltonnen und sprang hinunter in den Hof, ob sie mich hörten, konnte ich nicht mehr sehen.
Geräuschlos öffnete ich die Wohnungstür, stellte meine Schuhe, die ich schon im Treppenhaus ausgezogen hatte, ans Ende der langen Reihe von Schuhen und schlich an der nur einen Spalt weit offenen Tür zum Zimmer meines älteren Bruders vorbei ins Wohnzimmer. Mein Vater lag auf seinem Lesesofa, schlief im orangeroten Licht der Straßenlaterne, die Zeitung über seinen Bauch gebreitet. Schritt für Schritt und auf Zehenspitzen, die Hand über dem Griff meiner blauen Axt, näherte ich mich. Ich stand über ihm, er atmete ruhig, ahnte nichts. Vorsichtig, mit Gespensterhänden, griff ich nach seiner Brille, Zentimeter für Zentimeter.
Seine Mundwinkel zuckten, zogen sich in die Breite, ein Lächeln, er sperrte die Augen auf, seine Hand packte mich am Bauch, ich schrie, riss mich los, rannte.
Ich wusch meine Hände über der Badewanne, schöpfte kaltes Wasser und trank, schlug mir den Rest ins Gesicht.
In meinem Zimmer, die Zimmerhälfte zur Tür hin, zog ich die Axt aus dem Gürtel, mein Messer aus der Hosentasche, schob beides unter mein Kopfkissen, blickte mich um und seufzte wie einer, der nach langer Irrfahrt endlich zu Hause angekommen ist. Dann gings über den Flur in die Küche, wo ich grußlos auf die Küchenbank rutschte, als hätte ich seit Stunden selbstvergessen auf dem Wohnzimmerteppich gesessen und gespielt.
Erst als ich zwei Glas Milch getrunken und zweimal Käsebemme gegessen hatte, fragte meine Mutter, was das für eine Jacke sei, die ich da anhätte.
»Gefunden«, murmelte ich.
Da blickte auch mein Bruder auf, der bis dahin über ein Blatt gebeugt mit Buntstiften gekritzelt hatte.
»Wo?«
»Drüben«, antwortete ich und zeigte mit dem Kopf in Richtung Fenster.
»Ach so. Und? Gehört sie jemandem? Hast du mal in die Taschen geguckt?«
Aus der Innentasche zog ich ein schwarzes Lederportemonnaie, aus den Seitentaschen einen Schlüsselbund und schob beides meiner Mutter zu. Sorgsam blätterte sie sich durch das Portemonnaie, bis sie innehielt.
»So etwas haben normale Menschen nicht«, sagte sie und legte zwei unterschiedliche Ausweise, deren Fotos ein und dasselbe Gesicht zeigten, nebeneinander auf den Tisch. »Dann flitz jetzt gleich noch in die Gartenstraße und wirf dem Herrn einen Zettel in den Briefkasten, wo er seine Jacke abholen kann. Und wenn’s keinen ordentlichen Finderlohn gibt, werd ich ihm aber ein Wörtchen erzählen.«
An diesem Abend wäre ich leicht und ohne Widerstand in den Schlaf geglitten. Ich lag am äußersten Rand meiner Matratze, meine Hand auf der Jacke, deren Taschen voll waren mit Geld, Schlüsseln, geheimnisvollen Notizheften; der Geruch des Leders stieg mir in die Nase. Doch meine Mutter rief mich zurück, aus den ersten Träumen und aus dem Bett heraus, damit ich die Jacke übergebe. Nur schemenhaft erinnere ich mich an den Mann, der bei uns an der Tür stand. Als ich über die Schwelle in den Flur tappte, machte er wortlos einen Schritt auf mich zu. Licht brannte keins, nur durch die Milchglasfenster der Küchentür schien ein schwacher Rest, der Konturen zeichnete, aber kein Gesicht. Die eigentliche Übergabe, das Loslassen und Hingeben, den Blick des Mannes, als er sein Eigentum entgegennahm, all das habe ich vergessen, ich war schon halb betäubt vom Schlaf. Wahrscheinlich ist, dass ich die Jacke auf beiden Händen getragen und mit geneigtem Kopf überreicht habe wie eine Reliquie. Deutlich sehe ich erst wieder, wie er einen Fünfziger etwas zögerlich aus seinem Portemonnaie zog und mir entgegenhielt, aufrecht zwischen Daumen und Zeigerfinger geklemmt wie eine kostbare Rose. Meine Mutter konnte ihr Wörtchen für sich behalten, und ich taumelte zurück in Richtung Bett.
Mein Geld, war der erste Gedanke, der mir vom Kopf aus durch den ganzen Körper fuhr, als ich am Morgen mit dem zerknitterten Schein in der Faust erwachte. Heute mussten wir keine Erdbeeren klauen oder die Böden nach Kleingeld absuchen, das mein Vater jedes Mal verstreute, wenn er sich die Hosen auszog, kein Tag der Bettelei nach zwanzig Pfennig, um sich einen Kaugummi ziehen zu können – heute knüllte ich den mir vom Himmel geschenkten Reichtum in die Hosentasche und ließ mir genüsslich die Möglichkeiten durch den Kopf gehen, die diese lächerliche Welt zu bieten hatte. Meine Schritte hatten mehr Gewicht, mein Bauch war dicker, mein Rücken gerader, meine Brust geschwollener, mein Kinn gereckter, und meine Haare glänzten golden, als ich Fuß auf das Pflaster meiner Straßen, meines Viertels setzte. Ich wedelte mit dem Scheinchen, und die Freunde folgten mir zum Koppenplatz, wo ich sie mit sicherer Geste in die großräumige Eisdiele an der Ecke lud – zwei Jahre später schon ein Chinarestaurant mit allem, was dazugehörte: Holzfurniere mit Drachenmustern, künstliche Wasserfälle hinter Glas in bombastischen Rahmen, roter Teppichboden, Süß-Sauer-Suppe und eine militant-höflich lächelnde Kellnerin, danach eine Sushi-Bar, japanisch minimalistisch, die wiederrum von einem ambitionierten Vegan-Restaurant abgelöst werden würde, und alles im ewig selben, ollen Plattenbau.
Am großen Familientisch in der hintersten Ecke nahmen wir Platz, und jeder orderte, wonach ihm war. Bevor ich mich selbst meinem Becher widmete, sah ich mir ihre Gesichter an, Christoph und Stefan nickten mir mit großen Augen zu, dann senkten sie die Köpfe und aßen, als hätte ihnen jemand einen Schatz serviert. Simon löffelte wie ein Forscher, endlos langsam, den Geschmack des Eises immer wieder prüfend; da zeigte sich, dass er zwar kein Einzelkind, doch wie ein Einzelkind war – seine Schwester war schon zu alt, um noch ein richtiges Geschwisterkind zu sein, deshalb kannte er die Angst nicht, dass jemand die besten Stücke vom Teller stiehlt. Mein Bruder aß wie ich, schätze ich, schnell und ohne lange Geschmackserforschung. Ihn von mir zu unterscheiden, in dieser Zeit, war fast unmöglich. Wenn wir etwas gemeinsam taten, zum Koppenplatz spazierten, am Fenster des Schreibwarenladens Ackerstraße Ecke Torstraße, oder hieß die da noch Wilhelm-Pieck?, die Auslage betrachteten oder auf den Wänden in unserem Zimmer mit Wassermalfarben herumpinselten, unterhielten wir uns zwar ununterbrochen miteinander, trotzdem war es, als würden wir Selbstgespräche führen. Meistens warteten wir, wenn wir zu zweit waren, ohnehin auf einen Dritten. Und wenn Simon oder irgendwer dann seinen Namen sagte, wenn jemand ihn rief: Anton, verwandelte sich mein Bruder für einen winzigen Augenblick in eine mir völlig fremde Person.
Als ich großzügig die neue Runde einläuten wollte, hatten alle, kaum zu glauben, genug. Ich zahlte, knauserte nicht am Trinkgeld, und der ehrliche Finderlohn war gegessen.
Christoph und Stefan verabschiedeten sich Auguststraße Ecke Große-Hamburger – kaum zwei Wochen später würden sie mit ihren Eltern gen Mahlsdorf umziehen, also vom Erdboden verschluckt sein, so würde es uns zumindest vorkommen –, Simon hatte nichts weiter geplant, und mein Bruder und ich sollten wie immer nicht zu spät zu Hause sein. Was das bedeutete, durften wir selbst abschätzen; eine Uhr hatte sowieso keiner, weshalb eine Uhrzeit genauso vage gewesen wäre wie früh oder spät oder eben zu spät. Außerdem weigerten wir uns, Zeigeruhren lesen zu können, die überall an Kirchtürmen klebten oder an Kreuzungen aufgebaut waren wie Verkehrspolizisten.
»Wohin?«
»Keine Ahnung.«
»Erst mal Mombi?«
»Klar.«
Wir erzählten einander Witze, kurze Geschichten oder dachten uns Blödsinn aus, plapperten wie Vögel zwitschern, spuckten so weit wie möglich oder auf die schönen Gesichter der Werbeplakate. Simon pfiff auf zwei Fingern, und wir versuchten vergeblich, es nachzumachen.
Und wieder einmal erzählte Simon vom Harz und dem Krieg, an dem er teilnahm, wenn er mit seinen Eltern an die Front reiste. Schon vor einiger Zeit hatte er sich sozusagen als Gelegenheitsmitglied der Bande von Jugendlichen angeschlossen, die in dem an das Grundstück seines Opas angrenzenden Gebiet das Sagen hatte. Immer wieder hatte eine verfeindete Bande unerlaubt die Grenzen ihres Territoriums überschritten. Es war zu Verwüstungen von geheimen Unterschlüpfen gekommen, zu aufgeschlitzten Fahrradreifen, von der Leine geklauten Lieblingshosen oder zu kurzen Verfolgungsjagden, die in einem Hinterhalt mit Wortgefechten oder knapp verfehlten Fausthieben endeten.
»Wir mussten für Ordnung sorgen«, erklärte Simon, und so war es zu einer Großoffensive auf die unterirdische Zentrale der gegnerischen Bande gekommen.
»Es gab Verletzte«, erklärte er, ernst, aber unerschrocken. »Wir hatten ihren Bunker umzingelt. Ein Hammerteil. Mitten im Wald. Mit Gras drüber. Zwei hatten ihn zufällig beim Pilzesammeln entdeckt. Die Jungs da sind zehnmal härter als alles. Unser Plan war klar: ausräuchern, lebendig begraben. Also Strohfeuer vorm Eingang legen und ihr Dach zurück in die Erde schieben. Aber wir hatten einen schlechten Tag erwischt, wir waren mindestens zehn, von denen kamen dann nur drei oder vier aus dem Loch gekrochen. Und die waren nicht mal sauer, der eine heulte, der andere jammerte, dass jetzt alles kaputt war. Was sollten wir machen, die hatten Krieg gewollt.«
Als befände er sich noch immer auf feindlichem Gebiet, zog Simon den Kopf ein und rannte geduckt am Eingang zur Sophienkirche vorbei. Auf der Höhe vom Jüdischen Friedhof holten wir ihn wieder ein: In einer Baulücke lag er an einem Schutthaufen in Deckung.
»Simon«, schrie ich.
Er riss die Augen auf und rutschte noch tiefer in den Staub. Ich stieg auf die Spitze des Schuttbergs, hob ein Stück Putz auf und schleuderte es gegen die fensterlose Hauswand, dass es zerstob, und tat dasselbe noch einmal mit einem abgebrochenen Flaschenhals. Als ich Simon ein drittes Mal mit einem zerschepperten Gurkenglas laut und deutlich enttarnt hatte, stand er auf, klopfte sich den Dreck von den Ärmeln und faselte irgendetwas von kriegstraumatisiert.
»Wir sollten uns auch so ’nen Bunker graben, mitten im Mombi«, rief ich ihm zu. Er sah sich nach meinem Bruder um, der am Ende der Baulücke in einem von Holunderbüschen versteckten Holzschuppen verschwunden war, und lief ihm hinterher. Ich strich noch schnell mit der Fußspitze durch den Sand – manchmal fand man etwas, das zu gebrauchen war –, dachte kurz daran, dass ich eigentlich zum Monbijou gewollt hatte, schon rannte ich hinterher.

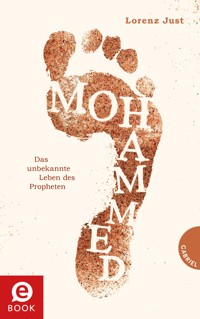













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













