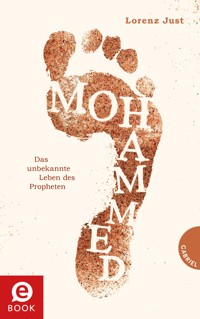
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gabriel Verlag/Thienemann
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Kaum ein Mensch ist so umstritten wie Mohammed. Doch was wissen wir wirklich über ihn? Für Muslime ist er ein Vorbild: der Gesandte Gottes - Begründer des Islams. Er verkündete die Worte Allahs, um die Menschen vom Glauben zu überzeugen. Es war eine Botschaft, die Frieden bringen sollte, und doch sah er sich bald schon als Anführer einer neuen Gemeinschaft, die er in den Krieg gegen die Nicht-Muslime führte. Um diese Widersprüche zu ergründen, nimmt Lorenz Just den Leser mit ins 7. Jahrhundert auf die arabische Halbinsel. Er erzählt, in welchem Umfeld der Halbwaise Mohammed aufwuchs, was ihm wichtig war, wie er handelte und was ihm offenbart wurde. Und sein spannendes Porträt des Propheten macht auch deutlich: Wer heute Gewalt rechtfertigen möchte, kann sich nicht auf das Leben Mohammeds und die Worte Allahs berufen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buchinfo
Kaum ein Mensch ist so umstritten wie Mohammed. Doch was wissen wir wirklich über ihn?
Für Muslime ist er ein Vorbild: der Gesandte Gottes – Begründer des Islams. Er verkündete die Worte Allahs, um die Menschen vom Glauben zu überzeugen. Es war eine Botschaft, die Frieden bringen sollte, und doch sah er sich bald schon als Anführer einer neuen Gemeinschaft, die er in den Krieg gegen die Nicht-Muslime führte.
Um diese Widersprüche zu ergründen, nimmt Lorenz Just den Leser mit ins 7. Jahrhundert auf die arabische Halbinsel. Er erzählt, in welchem Umfeld der Halbwaise Mohammed aufwuchs, was ihm wichtig war, wie er handelte und was ihm offenbart wurde. Und sein spannendes Porträt des Propheten macht auch deutlich: Wer heute Gewalt rechtfertigen möchte, kann sich nicht auf das Leben Mohammeds und die Worte Allahs berufen.
Autorenvita
© Hanna Stiegeler
Lorenz Just, Jahrgang 1983, studierte Islamwissenschaften an der Universität Halle-Wittenberg und seit 2011 am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Während seines Studiums verbrachte er längere Zeit in Kairo sowie im Libanon am Orient-Institut in Beirut, bereiste den Jemen und Syrien. Zu Forschungszwecken war er zuletzt auch im Iran.
Im Frühjahr 2014 nahm er als Finalist beim MDR-Literaturpreis teil.
Editorische Notiz:
Falls keine Übersetzung angegeben ist, hat der Autor den zitierten Text selbst aus dem Arabischen übertragen.
Vor einigen Jahren bestieg ich mit drei Freunden den Dschabal Musa, den Mosesberg oder den Berg Sinai. Um nicht im Strom der Pilger wandern zu müssen, hatten wir uns am Abend auf den Weg gemacht und eine Nacht auf dem Gipfel eingeplant. Der sinkenden Sonne hinterher, ging es die viertausend Stufen und siebenhundert Höhenmeter hinauf. Es wurde eine eiskalte und sternenklare Nacht. Während meine besser vorbereiteten Freunde in ihre Schlafsäcke krochen, musste ich mich in die stinkenden Wolldecken hüllen, die für Touristen bereitlagen. Acht Stunden waren es noch bis zum Sonnenaufgang, der die Wärme zurückbringen würde.
Murmelnde Stimmen und das Geräusch von Schritten weckten uns. Noch in tiefer Dunkelheit versammelte sich zu unseren Füßen eine Menschenmenge. Ich hörte Russisch, Italienisch, Portugiesisch, Englisch. Im schwachen Schein ihrer Taschenlampen waren sie den Berg heraufgestiegen und erwarteten nun frierend und erschöpft das viel gelobte Spektakel. Wir lagen in vorderster Reihe, direkt am Abgrund, mit Blick gen Osten.
Als die ersten Sonnenstrahlen hinter den kahlen Gebirgszügen aufblitzten, verstummten wir alle, die Pilger und christlichen Reisegruppen, die Touristen und auch die ägyptischen Händler. So nahe am Äquator, war es, als schieße der Sonnenball über den Horizont. Augenblicklich war die Kälte und Dunkelheit der Nacht hinweggefegt. Durch die klare Luft jagte der Blick weit über alle Grenzen hinaus, über das Rote Meer hinweg bis an die Gipfel des Hedschas. Tags zuvor erst hatten wir im Katharinenkloster am Fuße des Berges einen Ableger des legendären Buschs besichtigt, aus dem Jahwe zu Mose gesprochen haben soll. Jetzt schaute ich auf jene ferne Gegend, in der Gott seinen jüngsten Propheten erwählte. Die Schauplätze zweier, nein, dreier Weltreligionen verschmolzen in diesem Blick, und ich fühlte mich in jene vergangenen Zeiten versetzt, in denen das Warten auf den kommenden Propheten das Bild der Zukunft bestimmte.
Mohammed Ibn Abdallah, so hieß das Kind, das um das Jahr 570 am Rand der Arabischen Wüste das grelle Licht der Welt erblickte. Sein Name bedeutete zwar »der Gepriesene«, doch hatte es bereits als Ungeborenes einen großen Verlust erlitten. Der Tod des Vaters hatte Mohammed zur Halbwaisen gemacht und ihn zu einer Existenz im Schatten der arabischen Stammesführer bestimmt. In seinem vierzigsten Lebensjahr aber gab sich ihm ein anderer, ungleich größerer Vater zu erkennen: Allah, der Schöpfer der Welt. Mohammed wurde sein Gesandter. Bis zu seinem Tod kämpfte er zuerst mit dem Wort, später auch mit dem Schwert für die Verbreitung der Botschaft, die ihm offenbart wurde. Sein Vermächtnis ist der Islam, der heute den Platz der zweitgrößten Weltreligion einnimmt. So hatte bereits 570 Jahre nach Christi Geburt die Lebensgeschichte eines neuen Propheten begonnen.
Doch nicht einen einzigen Tag in seinem Leben war Mohammed die riesige Verehrung entgegengebracht worden, die er heute genießt. 1,6 Milliarden Gläubige bekennen sich zum Islam, der inzwischen auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. In den Köpfen und Herzen der Muslime lebt Mohammed als Vorbild für ein gottergebenes Leben und den wahren Glauben bis heute fort. In den Sammlungen seiner Taten und Aussprüche finden sie Antworten auf die Fragen des Alltags. Aber auch der Koran, das heilige Buch der Muslime, bleibt eng mit der Lebensgeschichte des Propheten verbunden. Viele Textstellen lassen sich erst entschlüsseln, wenn sie im Zusammenhang mit der überlieferten Situation ihrer Offenbarung gelesen und interpretiert werden.1 So bedingt das Wissen vom Leben Mohammeds auch das Verständnis der ewig gültigen, göttlichen Rede. Während seiner letzten dreiundzwanzig Lebensjahre hatte Mohammed den Arabern den Weg zur Nähe Gottes gezeigt; als erinnerter Prophet tut er es für die Muslime noch heute. Er ist die zentrale Gestalt des Islam. Wer also erfahren möchte, wie ein Muslim die Welt sieht und versteht, der wird fragen, wer jener Gesandte Allahs war oder ist.
Eine Biografie Mohammeds wird immer zwei Geschichten erzählen, die unauflöslich ineinander verwoben sind: einerseits die Geschichte von der Geburt des Gesandten Gottes und dessen Leben und Wirken unter den Arabern des Hedschas – den Gründungsmythos des Islam. So heißt es in den islamischen Geschichtswerken, dass der Gesandte Gottes im Jahr 570 geboren wurde. Andererseits aber wird der Werdegang eines Arabers erzählt, der erst spät in seinem Leben seinen Anspruch, Prophet zu sein, durchsetzen konnte. In diesem Buch wollen wir die letztere der beiden Geschichten in den Vordergrund rücken.
Das Kind Mohammed Ibn Abdallah wollen wir auf seinen ersten Reisen durch die Wüste begleiten und fragen, was die Wunder, die ihm begegneten, zu bedeuten hatten. Und was ist bekannt über Mohammeds späteres Leben als arabischer Kaufmann, der im Dienste seiner wohlhabenden Frau die Karawanen anführte? Wie war es, als ihn ein Engel aufsuchte und zu ihm sprach, und wie haben seine Zeitgenossen darauf reagiert, als er ihnen die göttliche Botschaft aufsagte? Worin bestand diese Botschaft? Wer glaubte ihm? Was waren die Wunder, durch welche er seine Mitmenschen zu überzeugen versuchte? Und warum hat Mohammed zu guter Letzt seine Heimatstadt verlassen?
Diesen Fragen sind der erste und zweite Teil des Buches gewidmet. Mögliche Antworten werden immer wieder auf die Lebensgeschichten auch anderer Propheten verweisen, denen Ähnliches widerfahren ist. Oft finden sich in der überlieferten Biografie Mohammeds Motive der jüdisch-christlichen Prophetenliteratur wieder. Manchmal enthält auch die Offenbarung selbst Hinweise, die Mohammed an seine Vorgänger erinnern. Vor allem Mose, der von Gott die zehn Gebote erhielt, scheint ihm ein Bruder im Geiste gewesen zu sein.
Im dritten Teil, Mohammed der Anführer, befindet er sich im Kreis seiner Gemeinschaft in Medina und arbeitet aktiv an der Herausbildung des Islams als Religion mit. Seine Anhänger werden ihn als Gesandten Gottes anreden, ihn um Rat fragen und bitten, in Streitfällen zu schlichten. Die neusten Offenbarungen werden sie unmittelbar aus seinem Mund vernehmen. Vor allem aber wird sich seine Gemeinschaft zum wichtigsten Machtfaktor in der Arabischen Wüste entwickeln. Im rasanten Lauf der Ereignisse werden Schlachten, Belagerungen, Vertreibungen, Eroberungen und das Aushandeln von Bündnissen und Verträgen aufeinanderfolgen. Am Ende seines Lebens wird Mohammed die Gewissheit haben, die arabischen Stämme unter dem Banner des Islams vereint zu haben.
Wer einen Blick auf das Leben des islamischen Propheten werfen will, wird aber auch in eine Welt vorstoßen, die dem europäischen Erfahrungshorizont unbekannt ist. Die klassischen islamischen Quellen, die über das Leben und Wirken des Gesandten Gottes berichten, waren adressiert an Zeitgenossen, die bereits vieles über die Schauplätze ihrer Geschichte und die grundlegenden Bräuche und Gesetze jener Zeit wussten. Uns, die wir heute leben und im christlichen Kulturkreis, fehlt dieses Vorwissen. Allerdings bietet die europäische Forschungsliteratur, die versucht, die Entstehung des Islams im Hinblick auf Kultur und Geschichte zu erklären, ein ausführliches Hintergrundwissen. Sie wird uns Orientierung verschaffen, wenn die Reise nicht allein in das Gebiet des heutigen Saudi-Arabiens führt, sondern über vierzehn Jahrhunderte zurück in der Zeit, in die karge, damals weltvergessene Gegend, auf die ich meinte, einen Blick zu werfen, als ich vom Dschabal Musa aus der aufgehenden Sonne entgegen nach Osten sah.
DIE WÜSTE
Eines Tages im Jahre 570 erreichten die Familien des Beduinen-Stammes der Sad Ibn Bakr die Stadt Mekka. Sie hatten den weiten Weg auf sich genommen, um dem mekkanischen Stamm der Quraisch ihre Ammendienste anzubieten. Unter ihnen reiste auch eine junge Mutter namens Halima. Auf einer weißen Eselin war sie gemeinsam mit ihrem Mann und dem Sohn im Säuglingsalter nach Mekka gekommen. Auch sie suchte nach einem Neugeborenen, das sie mit in die Wüste nehmen könnte, wo sie es stillen und aufziehen würde wie ihr eigenes Kind.
Halima war aber fast so mager wie ihre Eselin, die es nur mühsam geschafft hatte, mit der Karawane der Ammen Schritt zu halten. Ihre Brust gab nicht genügend Milch, um den Hunger des Kindes zu stillen; sie war fast so leer wie das Euter der Kamelstute, die sie ebenfalls mit sich führten. Sie konnte kaum ihr eigenes Kind ernähren, wie wollte sie sich dann um ein zweites kümmern? Halima hatte den abschätzigen Blicken ihrer Reisegenossinnen getrotzt und darauf gesetzt, dass die Reise ihr Glück bringen werde. Aber weder war Regen gefallen, noch waren sie auf üppigere Weidegründe gestoßen. Das Pech schien an ihren Fersen zu haften und die Ankunft in Mekka war eine sorgenvolle.
Es war ein Jahr der Dürre gewesen, und wohin auch immer sie und ihr Mann die Ziegen und Schafe getrieben hatten, sie waren am Abend nicht weniger hungrig als am Morgen von den Weidegründen zurückgekehrt. Wenn die Tiere aber nicht mehr als einen Halm zu fressen fanden, dann konnten sie auch nicht mehr als einen Tropfen Milch zu trinken geben. So hatten Tier und Mensch gleichermaßen unter der Dürre zu leiden – und die Eltern zusätzlich unter dem Weinen des hungrigen Kindes, das ihnen des Nachts den Schlaf raubte und sie zwang, ihr Zelt abseits der anderen aufzuschlagen.2
Die Lebensweise der Beduinen erlaubte es nicht, ausgiebige Vorräte anzulegen, die hätten helfen können, die regenarme Zeit auch ohne Hunger zu überstehen. Die Wüste versprach kein einfaches Leben. In ihrer eintönigen Weite boten nur wenige Felsformationen Abwechslung und Orientierung. Der Witterung verdankten diese Felsen ihre ausdrucksvolle, oft sprechende Gestalt: Sturm, die Eiseskälte der Nacht und die Gluthitze des Tages hatten den Stein zu riesigen Pilzen, Köpfen oder kauernden Tieren geschliffen. In einem Meer von Sand waren die Beduinen zu Hause. Die raue und unwirtliche Landschaft zwang sie, immer wieder die Zelte abzubrechen und sich aufzumachen zu den raren Weidegründen und Wasserplätzen.
In einem von andauernder Bewegung und Ortswechseln geprägten Leben war es nicht möglich, Besitztümer oder Vorräte anzuhäufen, die nicht selbst auf ihren vier Beinen laufen konnten. Der Reichtum der Beduinen waren ihre Ziegen-, Schaf- und Kamelherden, die sie auf der immerwährenden Suche nach Nahrung durch die Wüste trieben. Die Tiere konnten beinahe alles liefern, was zum Überleben gebraucht wurde: Wolle, die zu Stoff für Kleidung und Zelte verarbeitet wurde, Knochen, um daraus Werkzeug zu schnitzen, und vor allem die tägliche Milch. Um all dies reibungslos zu bewerkstelligen, herrschte im Haushalt einer Beduinenfamilie klare Arbeitsteilung. Die Verarbeitung von Nahrungsmitteln und die Zubereitung der Speisen gehörten ebenso zu den Aufgaben der Frauen wie das Verspinnen der Wolle, die mit der Hand aus dem Fell der Tiere gezupft wurde, und das Weben von Stoffen. Die Frauen waren es, die die Zelte auf- und abbauten und den gesamten Hausrat auf den Lasttieren verstauten, wenn die Reise wieder einmal weiterging. Die Männer dagegen hatten die Herden zu hüten und zu versorgen. Bei Gefahr waren sie es, die für den Schutz ihrer Familien und ihres Besitzes einstanden.
In Zeiten der Not aber richtete sich der Blick der Beduinen auf die sesshaften Bewohner der großen Oasen. Ihre Palmenhaine schenkten reiche Ernte und füllten die Vorratskammern. Um das eigene Überleben zu sichern, scheuten sich die kriegstüchtigen Männer nicht davor, Siedlungen zu überfallen und ihre Gesundheit im Kampf zu riskieren. Neben der Dattelernte, Waffen und Gold galt es, auch solche Beute zu machen, die selber laufen konnte: Für Gefangene konnten hohe Lösegelder von den Familien verlangt werden. Falls es keine vermögenden Verwandten gab, die das Lösegeld zahlen konnten, wurden die Entführten als Sklaven verkauft.
Ein Stamm konnte sich auch dazu entschließen, die Lagerstätten anderer Beduinen zu überfallen oder einer reich beladenen Handelskarawane aufzulauern. Eine solche Razwa war ein übliches, sogar angesehenes Mittel der schnellen Bereicherung. In der Arabischen Wüste gab es kein allgemeingültiges Gesetz, das automatisch jeden betraf, der seinen Fuß in sie setzte. Zuallererst war der Araber seiner Familie und Sippe verpflichtet, dann seinem Stamm. Der Einzelne lebte und handelte immer als Angehöriger dieses oft weitverzweigten Verbandes. Ihre unbedingte Gemeinschaft bot den Nomaden einen Weg, der kargen, gesetzlosen Wüste ein geschütztes und geordnetes Leben abzutrotzen. Nicht die Zugehörigkeit zu einem Land, einer Stadt oder zu einer gemeinsamen Religion, sondern allein die Zugehörigkeit zu einem Stamm stiftete Identität und Heimat.
Deshalb galt es als erlaubt, einen fremden Stamm, sei er nun sesshaft oder nicht, zu überfallen. Solche kriegerischen Unternehmungen festigten den Zusammenhalt unter den Männern. Wer die meiste Beute zurückbrachte – Herden, Gefangene oder auch Gold –, der wurde zusätzlich mit Ruhm und Ehre belohnt. Es war nicht das Ziel, sich gegenseitig auszulöschen und mit der Anzahl der Getöteten zu prahlen – zumal das Gesetz der Blutrache unerbittlich war. Jeder Tote bedeutete eine Blutschuld, für die die Gemeinschaft des Totschlägers früher oder später büßen musste, mit einer hohen Auslösesumme oder ihrerseits mit einem Toten. Eine andauernde Blutsfehde, die viele Opfer forderte, konnte einen Stamm nachhaltig schwächen. Jede Art von Mord war folgenschwer. Es war also ratsam, einem Gegner Hab und Gut zu rauben, ihm sein Leben aber zu lassen.3
Die Bewohner der Wüste unterhielten natürlich auch friedliche Beziehungen zueinander. Sie verabredeten gemeinsame Beutezüge oder trafen Waffenstillstandsabkommen. Und vor allem die Händler der Städte waren auf Schutzabkommen für ihre Karawanen, die die Gebiete der Stämme durchqueren mussten, auf Gedeih und Verderb angewiesen.
Kein Bündnis oder Abkommen aber war stärker und zuverlässiger als verwandtschaftliche Beziehungen, die nicht allein durch stammesübergreifende Eheschließungen geknüpft werden konnten. Der Wunsch, solche Verbindungen einzugehen, hatte auch die Ammen der Sad Ibn Bakr ins Tal Mekkas gebracht.
Indem die Beduinenfrauen Säuglinge von edler Abstammung als Pflegekinder aufnahmen, auf dass diese die ersten Lebensjahre in der Wüste verbringen und zu starken und gesunden Kindern heranwachsen würden, konnten sie eine besondere Art der Verwandtschaft zu einflussreichen Familien der mekkanischen Quraisch herstellen: Die sogenannte Milchmutter galt fast ebenso viel wie die echte Mutter. Auch die Milchbruderschaft bedeutete ein starkes verwandtschaftliches Band. Und diese Verwandtschaft war keine rein symbolische: Bei den Arabern galt die Brust als ein Kanal der Vererbung, durch den die Eigenschaften der Amme auf den Säugling übergingen. So war es auch nicht erlaubt, dass ein Ziehkind eines der leiblichen Kinder seiner Amme heiratete.
Als die Frauen der Wüste in Mekka eintrafen, wurden sie freundlich empfangen. Man bat sie herein, ließ sie auf prächtigen Teppichen Platz nehmen, bewirtete sie großzügig und präsentierte unauffällig den Reichtum des Hauses. Die mekkanischen Frauen zeigten sich in seltenen Gewändern, die nur auf den dortigen Märkten zu erstehen waren, servierten Tee in verzierten Bechern und sprachen gern über die weiten Reisen der Männer, deren Karawanen sie bis ins ferne Syrien oder tief in den Süden, in den Jemen brachten. Den Augen der Beduinenfrauen entging keines dieser Details.
Zwar waren es die Quraisch, die von ihren weiten Handelsreisen als Kaufleute große Reichtümer ins sichere Mekka brachten und ihre von außen so kargen Festungen füllten. Die Beduinen aber waren es, die über einen anderen Reichtum verfügten, der wohl kaum mit Gold aufzuwiegen war. Es war der Reichtum der Wüste, der nicht so leicht zu fassen ist wie ein Klumpen Gold oder ein feiner Umhang und der allein durch das Leben in der Wüste zu erwerben ist.
Was aber war der Reichtum der Wüste und ihrer Bewohner, den sich die Mekkaner für ihren Nachwuchs erhofften? Warum sollte eine Mutter ihr Kind einer Amme überlassen, die es weit fort, hinaus zu den Lagerplätzen ihres Stammes, tragen würde? Zuallererst schenkte die Wüste Gesundheit. Die Städte waren von Menschen und Tieren überfüllt, die Häuser und Straßen eng. Es gab keine großen Flüsse, die Unrat und Mist hätten hinausspülen können. Die Wüste aber war übervoll von frischer, unverbrauchter Luft. Sie war reinlicher, als es die Städte der Oasen und deren Wasserquellen je hätten sein können. Mit jedem neuen Abbruch der Zelte wurde die tägliche Notdurft zurückgelassen. Die Menschen waren auch nicht derart zusammengedrängt, wie sie es in den Siedlungen der Sesshaften waren, wo sich Krankheiten und Epidemien schnell ausbreiten konnten. Gefährliche Fieberkrankheiten waren vor allem in den Gebieten der großen Oasen an der Tagesordnung. Die unter der sengenden Sonne stehenden Gewässer boten Lebensraum für Stechmücken und all die Krankheiten, die von diesen übertragen werden.
Die Wüste und die Lebensweise, die sie ihren Bewohnern auferlegte, schützten den Körper. Sie forderten aber auch den Geist auf besondere Art und Weise. In ihrer für das menschliche Auge so unfassbaren Weite war die Wüste immer schon ein Ort gewesen, der den Weisen und Asketen nicht fremd war. Viele der noch heute bekannten Propheten und Gottsuchenden haben dort Erkenntnis, höhere Einsicht oder gar Erleuchtung gefunden. Wer einsam durch die Wüste wandelt, dem werden die Götter und Geistwesen dieser Welt sich zeigen – sie ist ein Ort, der allein durch seine Beschaffenheit den menschlichen Geist reinigen, aber auch verwirren und ängstigen kann. Der menschliche Geist manifestiert sich in der Sprache. So scheint der, der die Sprache beherrscht, auch der Wüste gewachsen zu sein. Es verwundert nicht, dass den Beduinen die Sprache eines der höchsten Güter war.
Die Sprache gab aber nicht nur dem Geist eine Form, sie war es auch, die den Ruf eines einzelnen Helden und seines Stammes bis weit in alle Himmelsrichtungen verbreiten konnte. Zu bestimmten Zeiten im Jahr versammelten sich die Bewohner der Wüste um ihre Heiligtümer, wie auch die Kaaba in Mekka, das heilige Haus Abrahams, eines war. Während dieser Zeiten der Pilgerschaft war jedes kriegerische Handeln in weitem Umkreis der Heiligtümer verboten, und so eigneten sich diese für allerlei stammesübergreifende Zusammenkünfte. Die großen Märkte wurden in diesen Zeiten abgehalten. Die Dichter der arabischen Stämme nutzten den temporären Frieden, um sich zu versammeln und miteinander in Wettstreit zu treten. Durch den Vortrag ihrer Verse vor einem Publikum, das die gesamte Arabische Wüste repräsentierte, konnte ein Dichter Ruhm für sich und seinen Stamm erlangen.
Die Beduinen, die weder Paläste noch Tempel errichteten, die also nichts von Dauer hinterlassen würden, wussten, dass der Ruf ihres Stammes eng verknüpft war mit der Größe ihrer Dichter. Nur durch das lyrische Wort, das von Mund zu Mund und von Generation zu Generation getragen wurde, würde der Ruhm ihres Stammes vielleicht die Zeiten überdauern. Das reinste und edelste Arabisch fand sich daher nicht in den Ballungszentren der Sesshaften, die ihre Kraft darauf verwendeten, Handel zu treiben, Besitztümer anzuhäufen und Festungen, Paläste oder auch Grabmäler zu errichten. Die wahre Hochsprache würden die Kinder der mekkanischen Quraisch allein in der Wüste erlernen können.
»So sind wir: Wenn die Wolken am Abend den fetten Bäuchen der Schafe gleichen und der kalte Wind den Himmel rötet
und eisigen Nebel herantreibt, dessen Reif die Zelte wie weiße Baumwollflocken bedeckt,
die Hengste, um sich zu erwärmen, vor den Muttertieren tänzeln, während der Hirte seine kalten Finger reibt,
und die fetten Kamelstuten, trächtig im zehntenMonat, zurück zu den Lagerstätten gebracht werden, bis die Sommerweide wieder blüht,
dann lassen die Frauen des Stammes über Nachtdie Kessel kochen, und jeder erschöpfte, hart bedrängte Gast findet bei uns Unterkunft«.4
Nach einigen Tagen ihres Aufenthalts in der Stadt war die Karawane der Ammen bereit, wieder aufzubrechen. Fast alle der Frauen waren sich mit einer der mekkanischen Familien einig geworden und hatten einen Säugling in ihre Obhut genommen. Allein Halima hatte niemand ein Kind anvertrauen wollen, sie war zu arm, zu elend. Sie grämte sich, die anstrengende Reise vergeblich unternommen zu haben. Der Spott und Hohn ihrer Gefährtinnen war ihr gewiss. Da erinnerte sie sich eines Jungen, der Halbwaise war und ihr gleich zu Beginn von seinem Großvater und der verwitweten Mutter angeboten worden war. Sie hatte ihn, wie auch die übrigen Ammen, abgelehnt. »Ein Waise! Was können seine Mutter und sein Großvater schon für uns tun!«, waren ihre Worte gewesen. Nun war sie bereit, ihre Meinung zu ändern, und sprach zu ihrem Mann: »Bei Gott, ohne einen Säugling kehre ich nicht zurück! Lass mich deshalb jenes Waisenkind holen und es mitnehmen.«
»Vielleicht wird Gott uns dafür segnen«, sagte ihr Mann und gab sein Einverständnis.5
Sie holte das Kind bei der dankbaren Mutter ab und kehrte mit ihm zur Lagerstätte der Karawane zurück, wo sie sich im Schatten des Zeltes niederließ. Das Kind lag auf ihrem Schoß, noch war es wohlgenährt und gesund. Es blickte friedlich ins Ungefähre, die kleinen Arme ruderten ziellos durch die Luft. Halima seufzte, als sie ihre weiche Brust entblößte, um es das erste Mal zu stillen. Die Lippen des Kindes schlossen sich gierig um die Brustwarze. Wieder seufzte Halima. Plötzlich aber spürte sie, wie unter dem kräftigen Saugen des Kindes ihre Brüste anzuschwellen begannen. Ungläubig und voller Verwunderung starrte sie auf den Knaben. Ihre Brüste wurden so voll und prall, als wäre es nicht das Kind, das von der Brust trank, sondern andersherum, die Brust, die vom Kind trank.
Kurz darauf stürzte ihr Mann zu ihr, um freudestrahlend zu berichten, dass die Euter der alten Kamelstute sich auf wundersame Weise gefüllt hätten. Zum Beweis brachte er eine Schale warmer Milch, die Halima, noch während das Kind an ihrer Brust lag, trank.
Nun brach eine Zeit an, in der Halima und ihre Familie den Hunger vergaßen. So groß war der Segen, den das Kind gebracht hatte, dass Halima zeit ihres Lebens nicht müde wurde, davon zu berichten: »Bei Gott, es gab kein unfruchtbareres Land als das Gebiet unseres Stammes, doch seitdem dieser gepriesene Knabe bei uns war, kehrten meine Ziegen und Schafe am Abend fett und voll mit Milch von der Weide zurück!«6
Vielleicht hatte sich Halima auch von den geheimnisvollen und vielversprechenden Gerüchten, die das Kind und seine Herkunft betrafen, dazu bewegen lassen, sich seiner anzunehmen. Vielleicht hatte ihr die Mutter des Kindes, Amina, von der Stimme erzählt, die sie vernommen hatte, als sie noch zutiefst betrübt war vom Verlust ihres Mannes, dessen Sohn sie unter dem Herzen trug. »Du hast empfangen den Herrn dieses Volkes, und wenn er geboren wird, so sprich: ›Ich gebe ihn in die Obhut des Einzigen vor dem Übel eines jeden Neiders!‹ Und nenne ihn Mohammed, der Gepriesene!«, hatte die Stimme zu Amina gesprochen.7





























