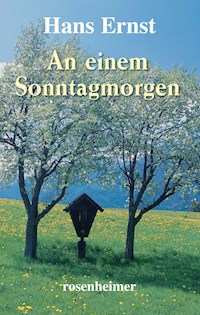
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Martha und Anton haben sich auf den ersten Blick ineinander verliebt. Die arme Häuslerstochter und der reiche Bauernsohn scheinen unzertrennlich. Doch dann, an einem Sonntagmorgen, bringt sich Anton in eine solch schwierige Lage, dass er keinen anderen Ausweg sieht, als seine Heimat zu verlassen. Die beiden Liebenden ahnen nicht, dass jemand eine schlimme Intrige gesponnen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
LESEPROBE ZU
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2004
© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim
www.rosenheimer.com
Satz: ew print & medien service GmbH, Würzburg
Titelfoto: Albert Gruber
eISBN 978-3-475-54724-9 (epub)
Worum geht es im Buch?
Hans Ernst
An einem Sonntagmorgen
Martha und Anton haben sich auf den ersten Blick ineinander verliebt. Die arme Häuslerstochter und der reiche Bauernsohn scheinen unzertrennlich. Doch dann, an einem Sonntagmorgen, bringt sich Anton in eine solch schwierige Lage, dass er keinen anderen Ausweg sieht, als seine Heimat zu verlassen. Die beiden Liebenden ahnen nicht, dass jemand eine schlimme Intrige gesponnen hat.
— 1 —
Früher hatten die Holzknechte, Senner und Sennerinnen jeden Herbst, wenn das Vieh von den Almen abgetrieben war, einen Almtanz abgehalten. Holzknechtsball hatten sie das auch genannt. Aber der Krieg hatte diesem Brauch ein Ende gemacht. Nun dachte man daran, die alte Sitte zu neuem Leben zu erwecken. Und so sah man denn eines Tages an Scheunentoren und Zäunen große Plakate in weißblauem Rautenmuster hängen, auf denen zu lesen stand:
Am Samstag, den 10. Oktober 1946, findet im Saal »Zum Schwarzen Adler« der Almtanz statt.
Beginn: abends 8 Uhr. Eintritt 1,50 RM.
Zu zahlreichem Besuch lädt ein:
Der Gebirgstrachtenerhaltungsverein »D’ Edelweißler«, Riedenegg.
Vor einem dieser Plakate stand am Sonntag nach der Kirche die junge Martha Reiner und las staunend, was da Verlockendes angeboten wurde. Neunzehn Jahre war sie alt und sie war noch nie auf einem Tanzfest gewesen. Sie war groß und schlank gewachsen, mit einer Fülle dunkelblonden Haares und großen braunen Augen in dem vom Sommer her noch braun gebrannten Gesicht.
Eine alte Bäuerin stand plötzlich neben ihr, zog ihre Nickelbrille aus der Tasche und las ebenfalls das Plakat. Dann nickte sie und schaute Martha an.
»Jetzt fangt ’s Leben wieder an«, meinte sie. »Euch hat man sowieso um die Jugend betrogen. Von wem bist denn du?«
»Daheim bin ich beim Reiner am Graben, aber arbeiten tu ich beim Söller droben.«
»Aha! Bist im Sommer auf der Alm gewesen?«
»Ja, den zweiten Sommer schon.«
»Gehst hin zum Tanz?«, forschte die Alte weiter.
»Ich weiß es noch nicht. War noch nie auf einem Tanzfest.«
»Freilich gehst, Dirndl. Kann leicht sein, dass du dein Glück dabei findest.«
»Glück?«, fragte die Martha und lächelte. »Was ist das?«
»Glück ist wie ein Blümerl, das der liebe Gott aus der Hand fallen lässt. Und da muss man sich halt bücken darum, bevor’s ein anderer aufhebt.«
An diese merkwürdigen Worte musste Martha denken, als sie den steilen Weg zum Söllerhof hinaufging. Eine Stunde Fußweg war es dort hinauf, eine Zeitlang an einem munter sprudelnden Bach entlang, dann durch einen kleinen Lärchenhain und wieder durch Wiesen, auf denen die Herbstzeitlosen blühten, und vorbei an dunklen Ackerstreifen.
Der Oktobertag war von goldener Schönheit. Der Bergwald stand noch im Farbenrausch seiner welkenden Blätter und darüber erhoben sich die Gipfel. In der herbstlichen Klarheit sahen sie aus, als wären sie aus Glas, in dem sich tausendfach die Sonne spiegelte.
Bei dem Marterl, wo die Schwester ihres Bauern vor fünfzehn Jahren vom Blitz erschlagen worden war, blieb die Martha stehen und nahm den schweren Bänderhut ab. Sie war ein bisschen ins Schwitzen gekommen, öffnete ihr Jäckchen am Hals und genoss dankbar die Kühle des Windes auf Stirn und Wangen. Dann las sie, wie so oft schon, den Spruch auf dem Marterl:
»Vom Blitzstrahl getroffen sank sie nieder, die Kathi, und erhob sich nicht wieder. Sie starb im siebzehnten Lebensjahr, gerade, als sie brauchbar war.«
»Zur Arbeit brauchbar«, sagte der Söller immer, wenn er auf diese Zweideutigkeit angesprochen wurde.
Ist das Landl schön!, dachte die Martha, als sie so dastand und die Augen umherschweifen ließ. Wie Küken um die Henne scharten sich da drunten die Höfe und Häuser von Riedenegg um den schlanken Kirchturm. Gleich daneben das stattliche Gasthaus »Zum Schwarzen Adler«. Dann das Kaufhaus Pichler, daneben der gelb angestrichene Bau der Raiffeisenbank. An den Höhen ringsum sah man Bauernhöfe liegen, von der Sonne umschimmert. Ganz droben, am Wald schon, der mächtige Hof des Balthasar Löschauer, genannt »beim Schlegl am Holz«, ein wahrer Herrensitz, mit viel Land, zwei Almgründen und eigener Jagd.
So reich müsste man sein, dachte Martha, die in arger Armut aufgewachsen war, da hinten im Graben, wo Hasen und Füchse sich gute Nacht sagten. Der Vater war im Krieg gefallen, die Mutter fristete das Leben mit einer kleinen Rente und einer winzigen Landwirtschaft. Sie selber arbeitete seit zwei Jahren beim Söller, eine schwere Arbeit, denn die Äcker da oben waren steinig, der Hof noch ohne elektrisches Licht, das Wasser musste man noch von einem Pumpbrunnen ins Haus tragen. Aber die Martha empfand die Mühsal gar nicht so, sie schaffte mit fröhlichem Herzen und es konnte sie nichts aus der Ruhe bringen. Wenn ihre Bauersleute stritten, dann lächelte sie nur und dachte sich: So will ich einmal nicht verheiratet sein.
Sie stritten oft, diese beiden ungleichen Menschen. Der Mann schrie immer nur ganz kurz, jäh herausbrechend aus seiner sonstigen Ruhe. Sie nörgelte und geiferte stundenlang. Trotzdem lag jedes Jahr ein Kind in der Wiege.
Darüber hatte Martha viel nachzudenken. Das Wunder der Menschwerdung, dachte sie, kann doch nur durch Liebe zustande kommen. Sie wusste noch nichts von Liebe, aber sie sehnte sich manchmal danach.
Jetzt ging sie weiter, bald lag dann der Hof vor ihr. Niedere, lang gezogene Gebäude, das Wohnhaus mit kleinen Fenstern und ganz aus Holz, fast schon schwarz gebrannt von der Sonne vieler Sommer. Auf dem Balkon standen noch die Blumenkästen mit verwelkten Geranien und braunen Blättern. Nur der Rosmarin dazwischen grünte noch.
Auf dem ungepflasterten Platz vor der Tür spielten ein paar Kinder, aus der Stube hörte sie ein anderes schreien. In der Küche hantierte die Bäuerin und blickte kaum auf, als die Martha eintrat. Sie fragte nur:
»Ist der Bauer nicht mitgekommen?«
Martha legte ihr Gebetbuch auf das Fensterbrett. »Den hab ich zum Wirt hingehen sehn.«
»Ja, natürlich! Wieder saufen bis zum Abend! Es ist doch jedes Mal das Gleiche, wenn der am Sonntag ins Dorf ’nunterkommt!«
Vergönn ihm doch die paar Halbe Bier, hätte Martha am liebsten gesagt. Er hat ja sonst nicht viel vom Leben, hätte sie hinzufügen müssen. Aber das verbiss sie sich lieber. Das ging sie nichts an. Ihre Gedanken bewegten sich auch in ganz anderer Richtung. Fast ohne es zu wollen sagte sie: »Am nächsten Samstag geh ich auf den Almtanz.«
Wie von einer Biene gestochen fuhr die Söllerin herum. Ihr Gesicht mit den kantig hervorstehenden Backenknochen war ärgerlich. »Du bleibst bei den Kindern daheim! Ich hab mit dem Bauern ausgemacht, dass ich mitgeh. Einmal im Jahr kann er mich doch mitnehmen.«
Woher Martha plötzlich den Mut hernahm zu widersprechen und das gleich auf solch nachdrückliche Art, das wusste sie nicht. Sie reckte nur den schlanken Hals höher und machte die Augen schmal. »Da hab ich doch nichts dagegen. Aber ich geh auch.«
»Und wer soll dann bei den Kindern bleiben?«
»Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall geh ich.«
»Ja, wie redest denn du mit mir?« Die Söllerin kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. »Wenn ich sag, du bleibst daheim, dann bleibst daheim!«
Die Martha schüttelte den Kopf und strich über das Haar eines der Kinder, das sich an ihren Rock gehängt hatte. »Bäuerin, das kannst du deinen Kindern einmal sagen, wenn sie groß sind. Aber mir nicht. Ich bin nicht dein Kind.«
»Aber arbeiten tust bei mir und da hast du zu gehorchen!«
Auf Marthas Stirn hatte sich eine steile Falte gebildet. »Was die Arbeit anlangt, ja. Aber alles andere ist meine Sach ganz allein. Ich bin kein Kind mehr, und verlang ich denn etwas Unrechtes? Bis jetzt hab ich von meinem Leben noch nicht viel gehabt. Ich bin jung, ich will auch einmal lustig sein dürfen und tanzen, grad so dahinfliegen will ich auf dem Tanzboden!« Das hatte sie aus sich herausgeschrien. Leiser fügte sie hinzu: »Vorausgesetzt, dass mich einer zum Tanzen holt.«
Die Söllerin starrte sie an, als sähe sie einen Geist. Eine hektische Röte hatte sich über ihr Gesicht ergossen. Dann ließ sie den Kopf sinken und bekam einen schiefen Mund; die oberen Zähne traten groß hervor.
Da tat sie der Martha wieder Leid und das Mädchen lenkte ein. »Also gut dann, wenn du für die Kinder niemanden auftreibst, dann bleib ich halt daheim und denk mir, ich werd nicht viel versäumen. Es wird ja noch öfter ein Almtanz sein.«
Somit wäre eigentlich alles gut gewesen. Aber dann kam der Bauer heim, nicht am Abend, wie seine Bäuerin gedacht hatte, sondern kurz nach zwei Uhr.
»Hast schon gegessen?«, fragte die Söllerin.
Er schüttelte den Kopf, setzte sich auf das Bänkchen neben dem Küchenherd und schnürte die Schuhe auf. Er war ein kleiner, breitschultriger Mann, mit einem zerzausten Schnauzbart auf der Oberlippe und ziemlich lichtem Haar, dessen Strähnen er quer über den Kopf gekämmt hatte. Er sah seiner Bäuerin zu, wie sie die Bratpfanne mit dem Schweinebraten vom Mittag aus der Röhre zog. In der Soße, die schon eine dünne Haut angesetzt hatte, lagen ein paar Knödel. Sie stellte die Pfanne vor ihn auf den Tisch, ohne Teller, und während er einen Knödel zerschnitt, setzte sie sich ihm gegenüber und sagte:
»Die Martha möchte am Samstag auf den Almball gehn.«
»Ja, und?«
»Ich hab gesagt, das geht nicht, weil sie bei den Kindern daheimbleiben muss.«
Der Söller zuckte die Schultern. »Zwingen kannst sie dazu nicht. Sie ist neunzehn und bis jetzt hat sie noch gar nichts vom Leben gehabt.«
»Und was hab ich schon gehabt in den zehn Jahren, seit wir verheiratet sind? Jedes Jahr einen Schrazen!«
»Nicht jedes Jahr. Zwischen dem Bertl und der Rosl liegen drei Jahr’. Wir haben sieben Kinder, nicht zehn. Und überhaupt, frag dich doch, ob du es anders hast haben wollen. Tu bloß nicht immer mir die Schuld geben!«
»Ja, ja, ich weiß schon! Wenn es nach dir ging, tätst am liebsten für dich allein in einer Kammer schlafen.«
»Warum nicht?«
»Das tät dir so passen! Dass du zur Martha in die Kammer schleichen könntest! Meinst, ich seh nicht, wie du immer hinter ihr herlurst? Wie ein Fuchs, wenn er um den Hühnerstall schleicht!«
Der Söller warf das Messer auf die Tischplatte. »Ja spinnst denn du? Ich lang mit dir schon!«
Er hatte ein reines Gewissen und hätte gar nicht so zu schreien brauchen. Aber es wurmte ihn, dass sie mit ihrer dauernden Eifersucht jetzt auch noch die Martha verdächtigte, der er doch mit keinem Gedanken zu nahe gekommen war. Er schätzte sie über alle Maßen, weil sie tüchtig war, ehrlich in allem und weil sie seine Kinder gern hatte, als ob es ihre eigenen wären. Mussten sie denn nicht froh sein einen jungen Menschen gefunden zu haben, der noch auf so einem abgelegenen Berghof arbeiten mochte, auf dem es keinerlei Komfort gab? Und wie hatte sie in diesen zwei Sommern die Alm bewirtschaftet! Nein, die Theres war ungerecht!
Der Appetit war ihm vergangen. Mürrisch schob er die Bratpfanne zurück und stand auf. Dann verließ er das Haus und sprach droben in der Hütte der Angermaierin vor, ob sie am Samstag nicht auf die Kinder aufpassen wolle. Das Weiblein sagte zu, und als er dann am Abend mit dieser Botschaft zurückkam, sagte die Söllerin:
»Das hätt’s gar nicht gebraucht. Ich wär schon daheim geblieben.«
Am Samstag gingen sie zu dritt ins Dorf hinunter. Die Söllerin war versöhnlichen Sinns geworden und hatte ihrer Magd eine ihrer beiden Halsketten geliehen, ein wertvolles Stück mit sieben Silbergliedern und einem goldenen Verschluss. Als sie auf halbem Weg waren, sagte der Söller zur Martha, die aufgeregt und voller Erwartungen immer ein Stück Wegs vorausrannte:
»Dein Herz hättest eigentlich auf dem Hof zurücklassen sollen, Martha.«
»Warum denn, Bauer?«
»Ich mein bloß, wenn du es grad verliern tätst heut.«
Wie sie lachen konnte, die Martha! »Ich wüsst nicht, wie das zugehn sollt.«
»Warten wir’s ab, Martha.«
»Das geht oft schneller, wie man meint«, glaubte die Söllerin noch sagen zu müssen.
In der Dunkelheit schrie irgendwo ein Nachtvogel. Der Wind kam stöhnend aus der Schwärze des Waldes heraus. Die Söllerin stolperte über einen Steinbrocken auf dem rauen Fahrweg und konnte sich gerade noch am Arm ihres Mannes festhalten. Sie ließ ihn nicht mehr los, bis sie vor dem hell erleuchteten Gasthof standen.
Der Saal fasste zweihundertfünfzig Personen und die drei vom Söllerhof fanden gerade noch mühsam einen Platz neben der Schänke, wo Otto, der Schankkellner, seines Amtes waltete und es vorzüglich verstand die Krüge so zu füllen, dass eine gute Handbreit Schaum darauf stand. Da es Steinkrüge waren, konnte man das nie so genau bemessen. Immerhin wusste der Otto, dass man bei richtigem Einschenken pro Hektoliter sieben bis acht Maß für sich abzweigen konnte.
Sechzehn Mann spielten auf ihren Blechinstrumenten und brachten gleich von Anfang an Stimmung in den Saal. Zu lange hatte man Tanz und Lustbarkeit entbehren müssen. Die Menschen waren ausgehungert und stürzten sich geradezu ins Vergnügen. Der Söller tanzte mit seiner Bäuerin einen Walzer und sagte ihr dabei, dass er auch mit der Martha tanzen werde, das sei er ihr schuldig und sie müsse es verstehen. Und da sie heute friedfertig gestimmt war, verstand sie es auch. Wenigstens sagte sie es.
Martha sah den beiden zu und ließ dann den Blick durch den Saal schweifen. Da drüben saß der Förster Rehbusch mit seiner Frau und dem amerikanischen Major, der hier einmal Ortskommandant gewesen und jetzt zur Kreiskommandantur versetzt worden war. Dieser Major Frederik Mores kam gern nach Riedenegg, ging auch in Begleitung von Rehbusch hier auf die Jagd und war im Sommer ein paar Mal mit dem Förster auf ihrer Almhütte eingekehrt. Jetzt sah er sie an, erkannte sie und hob grüßend die Hand. Martha nickte und ließ dann ihre Blicke weiterwandern zu dem Tisch, wo die Schloderer-Buben saßen. In Begleitung des Schloderer Stefan, der eine dunkel getönte Brille trug und von sich behauptete, er sei weitum bekannt wie ein »roter Hund«, befand sich ein bildschönes schwarzhaariges Mädchen. Martha sah, wie der Stefan jetzt unter den Tisch langte, eine Aktentasche hervorholte und ihr eine Flasche Wein entnahm, die er in den Maßkrug entleerte.
Die Söller kamen zurück. Die Bäuerin schwitzte und atmete schwer.
»Ich bin ’s Tanzen nicht mehr gewöhnt«, sagte sie und wischte sich mit dem Taschentuch übers Gesicht. »Ich hab ja auch von nicht mehr getanzt seit der Anni ihrer Hochzeit und das ist fünfzehn Jahr’ her.«
Dann tanzte der Söller mit der Martha. Ach, dachte er, was für ein Unterschied! Die Martha lag wie eine Feder in seinem Arm, seine Theres dagegen wie eine Bleikugel. Direkt Leben kam in seine krummen Beine, er griff mit den Unterzähnen nach seinem Bart hinauf und sagte:
»Dich spürt man kaum. Wie eine Feder bist! Wo hast denn du ’s Tanzen so gut gelernt?«
»Mit einem Besenstiel«, lachte sie. »Und mit einem alten Plattenspieler.«
»Mmdada«, machte die Basstuba und die Klarinetten jubelten hell darüber. Immer heißer wurde es im Saal. Ein paar Hitzköpfe schrien aufeinander ein und Otto schaute unter den Schanktisch nach dem Ochsenfiesel. Aber er brauchte ihn nicht. Das Bier war zu dünn um in der zweiten Sunde schon Räusche erzeugen zu können.
Einmal begonnen, kam Martha kaum mehr zum Niedersetzen. Man riss sich um sie und mehr als einmal wurden jetzt Worte in ihr Ohr geflüstert, die sie noch nie gehört hatte. Dass sie schön sei, wurde ihr gesagt, dass sie gut tanzen könne, ob man nicht erfahren könne, von wem sie sei und wo ihr Kammerfenster wäre.
Martha nahm das alles nicht ernst, gab sich ganz dem Rhythmus des Tanzes hin und war froh, als sie einmal ausschnaufend bei den Söller sitzen konnte.
»Weißwürste gibt’s auch«, sagte der Söller und sah mit langem Hals den Kellnerinnen nach, die mit den Tellern durch den Saal rannten.
»Mir wär ein Nierenbraten lieber«, knurrte die Söllerin. »Haben wir überhaupt Marken dabei?«
In diesem Augenblick gab es der Martha einen Riss. Unter der Saaltür stand, groß gewachsen und schlank, ein Bursch in einem hellen Steireranzug und mit einem mächtigen Gamsbart auf dem grünen Samthut.
Die Hände hinter dem Rücken verschränkt stand er dort und ließ seine Augen durch den Saal wandern. Sein Blick traf die Martha. In seinen Augen leuchtete es kurz auf. Dann wurde er vom Tisch der Schloderer her angerufen und er begab sich dorthin. Der Krug mit Wein wurde ihm angeboten. Er nahm nur einen kleinen Schluck. Dann stellte er den Krug zurück und sprach mit dem schwarzhaarigen Mädchen. Die Martha konnte nicht wegschauen und zum ersten Mal empfand sie ein Gefühl, das sie bisher noch nicht gekannt hatte. Es tat ein bisschen weh, so wie ein kleiner Stich im Herzen ...
Jetzt legte der Schloderer Stefan den Arm um die Schultern des neu Angekommenen. Es war etwas Eigenartiges um diesen Stefan. Sein breites Gesicht mit dem sandfarbenen Haar über der hohen Stirn hatte so gar nichts Männliches. Man hätte es eher weibisch nennen können, wenn nicht der harte, fast brutale Zug um Mundwinkel und Kinn gewesen wäre. Mit biederer Herzlichkeit redetet er auf den anderen ein, hielt ihm wieder den Weinkrug hin, doch der lehnte ab.
»Martha, deine Würst’ werden kalt«, mahnte die Söllerin.
Wie aus einem Traum gerissen griff Martha nach Messer und Gabel. Die Musik begann wieder zu spielen. Eine Polka, die wie Feuer in die Beine fuhr.
Plötzlich hörte Martha eine Stimme dicht vor sich. Sie schaute auf und erschrak. Der fremde Bursch stand vor ihr. »Ach so, du isst grad. Ja, dann lass dich nicht stören. Guten Appetit wünsch ich und hernach tät ich um eine Polka bitten.«
Martha merkte, wie ihre Hände zitterten und wie ihr das Blut in die Wangen stieg. Dann war die Stimme wieder da, diesmal an die Söller gerichtet: »Habt ihr Besuch gekriegt?«
»Nein, das ist unsere Magd«, sagte die Söllerin gleich und Martha hatte das Gefühl, als hätte die Bäuerin ihr eine Ohrfeige versetzt. Jetzt wird er nicht mehr mit mir tanzen wollen, dachte sie, denn — sie war ja »bloß« eine Magd, so was ganz Hinterstelliges, der letzte Dreck auf einem Bauernhof. Oh, sie wusste doch aus Erfahrung, was ein dienender Mensch wert war. Wie im Zorn schob sie den letzten Brocken Brot in den Mund und wischte sich dann mit dem Taschentuch Hände und Lippen ab.
Der Bursche stand immer noch vor ihr, lächelte sie an und fragte: »Hat’s geschmeckt?« Dabei bot er ihr zugleich seine Hand, die sie ergriff.
Dann wurde sie von seinen Armen umfangen. Sie wagte kaum zu ihm aufzuschauen. Das heißt, aufschauen hätte sie gar nicht brauchen, denn sie waren ziemlich gleich groß und sie hätte bequem in seine Augen sehen können, die blau waren und wunderschön harmonierten mit seinen schwarzen Wimpern und Brauen. Seine Stimme klang warm, zärtlich. »Bist du mit den Söller auf den Ball gekommen?«, fragte er.
Jetzt schaute sie ihn zum ersten Mal voll an. Die Bangigkeit war auf einmal wie weggeflogen. »Ja, sie haben mich mitgenommen.«
»Aber heimbringen werd ich dich.«
Eine schwere, fremde Süße schien ihre Gedanken vernebeln zu wollen. »Das sagst du so einfach«, meinte sie mit zaghaftem Lächeln.
»Weil es einfach ist.« Er zog sie nah an sich, so dass ihre Füße kaum mehr den Boden berührten.
»Bei dir ist scheinbar alles einfach und selbstverständlich?«, fragte sie.
»Leider doch nicht alles. Dirndl, Dirndl! Du gefällst mir!«
»Du mir auch«, hätte sie beinahe geantwortet. Doch das verschluckte sie und sagte stattdessen: »Ich weiß ja gar nicht einmal, wer du bist.«
»Das kann ich dir gern sagen. Der Toni Löschauer bin ich, vom Schlegl am Holz.«
»O weh!«, entschlüpfte es ihr und sie wollte den festen Griff um ihre Taille lockern.
Aber das ging gar nicht so leicht. Er lehnte jetzt seine Stirn an die ihre, klatschte dann wie besessen, als die Polka zu Ende war und drauf ein Walzer gespielt wurde. »Warum sagst du o weh? Schlechte Erfahrungen?«
Das war ganz nahe an ihrem Ohr gefragt. Es war eigentümlich, wie sein naher Atem sie erschauern ließ.
»Ich hab überhaupt noch keine Erfahrungen«, sagte sie. »Und ich will auch mit dir keine machen, weil die doch bloß schlecht ausgehen müssen.«
»Wie kommst denn darauf?«
Sie schaute ihm wieder in die Augen. Er wich ihr nicht aus. »Sonst bist ein netter Bursch«, lächelte sie, »aber du kannst es ja gar nicht ehrlich meinen.«
»Und warum nicht?«
»Geh, du, der Löschauer-Bub, und ich! Hast es ja selber gehört, was die Söllerin g’sagt hat. Bloß eine Magd.«
»Als wenn das mich stören tät!«, lachte er. »Eine gute Magd ist mehr wert als eine schlechte Bäuerin.«
»Jetzt red bloß keinen Unsinn, Löschauer.«
»Toni heiß ich. Und so unsinnig ist das durchaus nicht, wenn ich sag, dass du mir g’fallst.«
»Und morgen weißt das vielleicht schon gar nicht mehr.«
»Da kennst mich aber schlecht.«
»Ich kenn dich überhaupt nicht.«
»Das kann man nachholen. Im Übrigen – ich weiß ja auch noch nicht, wie du heißt und wo du daheim bist.«
Es hatte keinen Sinn sich gegen ihn zu stemmen. Es war, als stünde sie mitten in einer Verzauberung. Willenlos ließ sie geschehen, dass er jetzt seine Wange an die ihre legte, und ein wunderliches, fast heftiges Verlangen wollte sie überkommen, mit ihrem Mund über den seinen hinzuzärteln.
»Martha heiß ich«, flüsterte sie. »Und daheim bin ich im Graben. Beim Reiner heißt unser Häusl.«
Als sie es gesagt hatte, erwartete sie, dass seine Wange sich von der ihren löse. Statt dessen drückte er sie nur noch fester an sich und da fiel ihr auf einmal wieder ein, was die alte Bäuerin vor dem Plakat zu ihr gesagt hatte: »Glück ist wie ein Blümerl, das der liebe Gott aus der Hand fallen lässt. Und da muss man sich halt bücken darum, bevor’s ein anderer aufhebt.«
Da war der Walzer zu Ende und Toni brachte sie zurück an den Tisch der Söller. Er unterhielt sich mit dem Bauern und sah dann mit gesenkten Brauen hinter der Martha her, die auf einmal von allen Burschen zum Tanz begehrt wurde. Ihre Wangen glühten wie Pfingstrosen, auf ihrer Stirn standen Schweißtropfen. Als sie an den Tisch zurückkam, legte der Löschauer Toni seine Hand auf ihren Arm und sagte:
»Du kommst ins Schwitzen, Dirndl. Das ist nicht gut, wenn du hernach in die Kälte hinaus musst. Den nächsten Tanz schlagst aus, der übernächste gehört dann wieder mir. – Was du für eine schöne Halskette hast!« Er berührte sie, ließ die Silberglieder durch seine Finger gleiten und betrachtete den Verschluss.
In diesem Augenblick sagte die Söllerin: »Die hat sie von mir zu leihen genommen.«
Marthas Gesicht lief rot an. Am liebsten hätte sie jetzt losgeheult und es tröstete sie kaum, dass der Söller meinte: »Das hättest jetzt auch nicht sagen brauchen.«
»Warum?«, piepste sie auf, schon wieder zu Streit bereit. »D’ Wahrheit wird man doch noch sagen dürfen!«
Da sagte der Löschauer Toni in aller Ruhe: »Streit nicht, Söller. Es kann halt kein Mensch aus seiner sauren Haut heraus.«
Das war denn doch zu viel. Saure Haut! Das hatte ihr noch niemand gesagt! Aber mit dem jungen Löschauer konnten sie sich doch auf keinen Streit einlassen. Man konnte höchstens heimgehen jetzt.
»Zahl jetzt, Alter. Wir gehn heim«, forderte sie und zitterte vor Zorn, weil der Löschauer mit stoischer Ruhe sagte:
»Die Martha bleibt noch da. Die bring ich heim.«
»Sonst nichts mehr! Sie ist mit uns runtergegangen und geht auch mit uns heim!«
»Ach, so ist das!«, sagte der Toni und schaute die Martha an. »Darfst du gar keinen Schritt allein tun?«
Der Martha war der Auftritt peinlich. Sie wusste, was sie morgen von der Bäuerin zu erwarten hatte. Aber wenn sie nun wegging, war all ihre Seligkeit vorbei. Sie schaute den Toni an und sagte traurig: »Neunzehn bin ich geworden.«
»Und da musst du dich von deiner Bäuerin noch bevormunden lassen? Sag einmal, Söller, in was für einer Zeit lebt denn ihr noch? Heutzutag muss man doch froh sein, wenn man überhaupt noch gute Leute kriegt. – Komm, Martha! Wir tanzen!«
Als sie nach zehn Minuten zurückkamen, waren die Söller heimgegangen.
»Jetzt wird’s erst lustig«, lachte der Toni. »Die Söllerin mit ihrem Sauerampfergesicht könnt einem jeden Spaß verderben!« Er legte den Arm um ihre Schulter. »Wie du es bei der bloß aushalten kannst!«
»Ja mei«, sagte sie. »Man muss sie halt nehmen, wie sie ist. Du warst aber auch ganz schön frech mit ihr.«
»Weil ich mich geärgert hab. Deinetwegen, nicht meinetwegen.«
»Bist du immer so frech?«
»Bin ich vielleicht frech mit dir?«
Ein neues Glücksgefühl durchströmte sie, sie schmiegte sich gern in seinen Arm und fühlte sich geborgen. »Wer ist das Mädl da drüben, die saubere Schwarze, die dauernd zu uns rüberschaut?«, forschte sie.
»Das ist die Barbara, meine Schwester.«
»Ach so. Und ich hab schon gemeint ...«
»Was hast gemeint?«
»Es könnt auch eine von den vielen sein, die dir gefallen.«
Zum ersten Mal betrachtete er sie genauer. Ihr Mund stand leicht offen, ihre Wangen glühten, ihre Augen leuchteten in einem wunderbaren Glanz.
»Du bist schön«, flüsterte er und sein Mund kam dem ihren ganz nah.
»Doch nicht hier, wo alle zuschaun können.«
»Ja, du hast Recht. Komm, tanzen wir wieder.«
Sofort erhob sie sich, obwohl sie jetzt lieber mit ihm ganz weit weg gewesen wäre. Ganz gleich, wo. Nur keine Menschen dürften da sein. Aber es waren so viele Menschen da. Annähernd dreihundert, weil außer den Söller noch niemand daran gedacht hatte, den Saal zu verlassen.
— 2 —
Grau lag der Novembertag über dem Land. Ende Oktober hatte es schon eine Menge Schnee hergeworfen. Aber er war noch nicht leicht und weich wie im Hochwinter, er war schwer und matschig. Es fehlte der Frost. Alles war in tiefe Schwermut gehüllt. Als ob der Himmel weinen wollte, so sah es aus an diesem Allerheiligentag.
Schwermut fing auch an die Martha zu belasten. Sie war mit ihrer Mutter am Familiengrab gestanden, so wie es sich gehörte an diesem Tag. Und da hatte sie den Mann wieder gesehen, der sie durch eine Nacht geführt hatte, der sie geküsst und ihr so viel Liebes gesagt hatte.
Er stand etwa fünfzehn Schritte von ihr entfernt, auch an einem Grab. Mit seinem Vater, seiner Mutter und mit seiner schönen Schwester. Die Löschauer hatten natürlich ein viel größeres und kostbareres Grabmal, Martha aber war mit ihrer Mutter nur vor dem kleinen schmiedeeisernen Kreuz gestanden, auf dessen weißem Schild der Name des gefallenen Soldaten Thomas Reiner prangte.
Nicht einmal herübergeschaut hatte er zu ihr. Wahrscheinlich hatte er sie längst vergessen, weil es sich nicht lohnte, an ein Mädchen zu denken, das ihm nicht mehr schenken hatte wollen als ihren Mund. Ganz sicher war dieser Großbauernsohn etwas anderes gewöhnt und sah sich nun enttäuscht, weil sich seine Erwartungen nicht erfüllt hatten. Vielleicht war sie selber schuld, weil sie nicht den Mut gehabt hatte sich nach dem Blümerl Glück zu bücken.
Der Friedhof leerte sich. Die Reinermutter hob den Kopf mit dem dunklen Tuch.
»Kommst mit heim, Martha, auf eine Tasse Kaffee?«
Martha nickte und ging vor der Mutter her zu dem Häusl am Graben. Es lag geduckt unterm Schnee, der nur um das Haus herum weggeschaufelt war. In der Stube aber war es gemütlich warm. Der rot gescheckte Kater sprang gleich vom Kanapee und schnurrte zutraulich um Martha herum, bis sie ihn auf den Arm nahm und streichelte.
Die Mutter saß auf der Ofenbank, hatte die Kaffeemühle zwischen den Knien und drehte die Kurbel. »Wie geht’s dir denn, Kindl?«
Martha setzte den Kater ab und schlüpfte aus ihrem Mantel. »Gut, Mutter. Wie soll’s mir sonst gehn?«
»Ich weiß nicht, du bist mir heut so verstimmt vorgekommen, als ob du einen Kummer hättest.«
»Aber, Mutter, das bildest du dir bloß ein!«
Martha wollte nun den Tisch decken, aber die Mutter drückte sie auf das Kanapee zurück. Die resolute Frau war so glücklich darüber, die Tochter wieder einmal bei sich zu haben, wenn auch bloß für ein paar Stunden. Aber es stimmte: Mit Martha war eine Veränderung vor sich gegangen. Die Mutter ließ sich nicht täuschen. Im Gesicht der Tochter war ein Zug, den es früher nicht gegeben hatte. Gerade als ob sie ein Leid oder einen Kummer verbergen wolle.
Und plötzlich fiel es der Reinerin ein: »Wenn’s dir nicht mehr gefällt da oben beim Söller, dann komm heim. Beim Adlerwirt bräuchten sie ein Küchenmädl. Dann könntest jeden Abend zum Schlafen heimkommen.«
Martha hob den Kopf. Ihre Stirn war in Falten gelegt, so als ob sie angestrengt nachdächte. Dann sagte sie: »Ich hab dem Söller zugesagt, dass ich auch das nächste Jahr bleibe. Sie ist zwar eine Zwiderwurzn und mag sich oft selber nicht. Aber es ist zum Aushalten, weil ich mir nicht mehr alles gefallen lass, und im Frühjahr, da zieh ich wieder auf die Alm. Das Leben da oben ist herrlich, Mutter.«
»Wem sagst du das? Auf der Alm, da hab ich doch deinen Vater kennen gelernt.«
Herrlich zog der Duft des Kaffes durch die kleine Stube. Es war so gemütlich hier. Auf der Herdplatte brutzelten ein paar Bratäpfel, der Kanarienvogel hüpfte in seinem Bauer geschäftig hin und her und ließ manchmal einen Triller los, als wollte er der Martha zeigen, dass er es noch nicht verlernt hatte.
Aber die hörte es kaum, sie war mit ihren Gedanken ganz woanders.
Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!
Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com





























