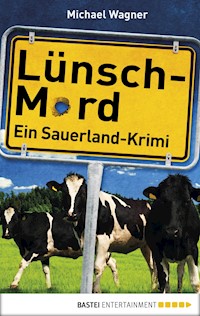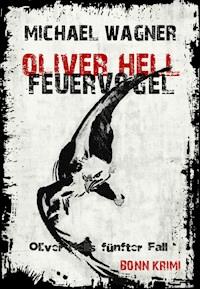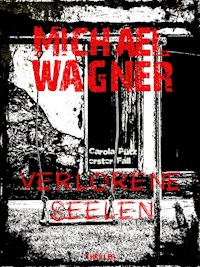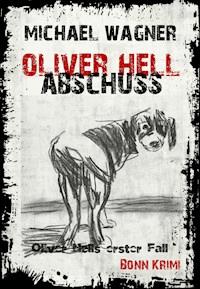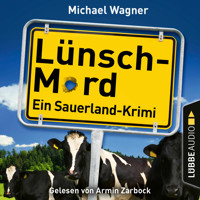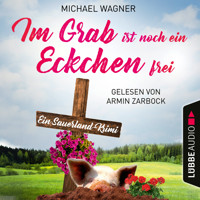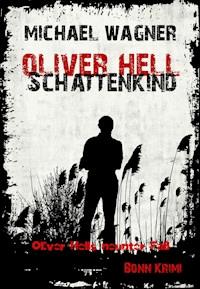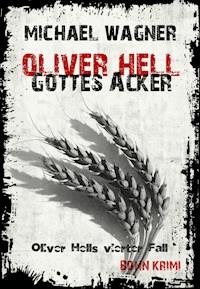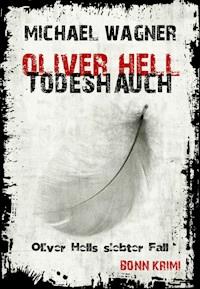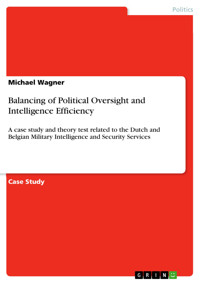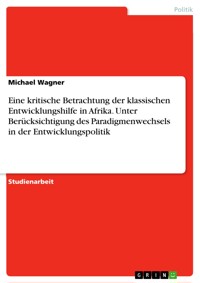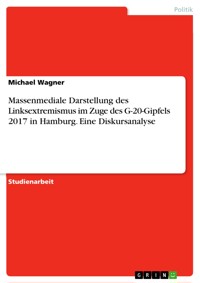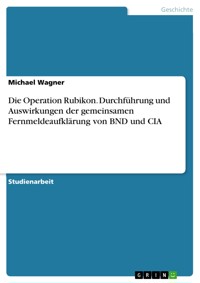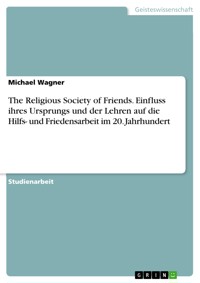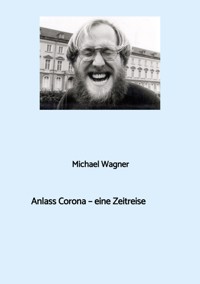
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Bei dem Buch handelt es sich um eine Autobiographie. Es wird die Geschichte von Michael Wilde und seiner Familie erzählt, deren Wurzeln in einem Dorf im Oberbergischen Kreis liegen. Es handelt von Höhepunkten und Tiefpunkten des Lebens, von guten und glücklichen Zeiten, aber es lässt auch peinliche und traurige Momente nicht aus. So ist in den Zeiten der Corona-Pandemie ein Buch über seinen Werdegang, sein Studium, seinen nicht immer stringenten Lebensweg, seine Familie, viele Freunde und Arbeitskollegen entstanden. Es ist ein Buch über Lebensabschnitte mit historischen Exkursen, über Musik, Filme, Literatur, Angesagtes und mit vielen Reiseberichten. Und das alles mit hohem Identifikationspotential und Wiedererkennungswert, das die Leser auf ihrer Reise durch die letzten Jahrzehnte begleitet. Die Biographie ist dabei stets in den historischen Kontext und das jeweilig aktuelle Weltgeschehen eingebettet. Den Anstoß, das Buch zu schreiben, gab der Beginn der Corona-Pandemie. Der Autor hat die wichtigsten Ereignisse der Pandemie noch einmal kurz zusammengefasst und dabei strikt auf wissenschaftliche Korrektheit geachtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 731
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anlass Corona – eine Zeitreise
Michael Wagner
© 2024 Michael Wagner
Umschlag, Illustration: Petra Grossmann-Wilde
Lektorat: Petra Grossmann-Wilde, Birgit Buchen
Druck und Distribution im Auftrag:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
ISBN
Softcover
978-3-384-19562-3
Hardcover
978-3-384-19563-0
e-Book
978-3-384-19564-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor Michael Wagner verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags und des Autors unzulässig.
Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag, zu erreichen unter:
tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice",
Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Prolog
Chronik der Covid-19-Pandemie
Morsbach
Die Großeltern
Die nächste Generation - Meine Eltern
Kinder und die ersten gemeinsamen Jahre in den Fünfzigern
Meine Geburt – der Übergang in die 60er Jahre
Die Siebziger – meine Schulzeit
Die Achtziger Jahre Zivildienst, Studium und meine Traumfrau
Die Neunziger – Zweites Staatsexamen und neue Arbeitsperspektiven
Das neue Jahrtausend, die Nullerjahre - unsere beruflichen Karrieren
2010 bis 2023 unsere privaten und beruflichen Highlights
Nachbemerkungen und Danksagung
Anlass Corona - eine Zeitreise
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Prolog
Nachbemerkungen und Danksagung
Anlass Corona - eine Zeitreise
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
Prolog
Was hat mich zum Titel ‚Anlass Corona – Eine Zeitreise‘ veranlasst?
Es war eine besondere Zeit, in der wir fast drei Jahre lang gelebt haben. Ich werde im nächsten Kapitel in einer Chronik noch einmal die wichtigsten Ereignisse der Pandemie zusammenfassen. Drei Jahre wurden alle Entscheidungen direkt oder indirekt durch Covid 19 geprägt. Wer hätte gedacht, dass wir so etwas in Deutschland oder auf der Welt einmal erleben müssten? Es war in vielen Phasen unseres Lebens nichts mehr, wie es einmal war. Covid 19 hat viele Leben verändert. Es sind viele Menschen gestorben, und im Unterbewusstsein bleibt oft der Gedanke, dass es auch noch lange nicht komplett vorbei ist. Im Oktober 2023 habe ich mich bereits zum sechsten Mal gegen Corona und zeitgleich gegen Grippe im anderen Arm impfen lassen. Wir haben auch immer noch genug FFP2-Masken und Corona-Schnelltests zuhause.
Ich war froh, in dieser Krise in einem Land wie Deutschland zu leben mit allen positiven Aspekten, die dazu geführt haben, dass wir die Pandemie besser im Griff hatten als viele andere Länder auf der Welt, in denen teilweise Ignoranz und Dummheit, aber auch Machtversessenheit das Handeln bestimmt haben. Vernunft kann man leider nicht anordnen. Das sagt meine Frau seit vielen, vielen Jahren sehr oft. Die Pandemie war der Ausgangspunkt und der letzte Baustein für die Entscheidung, dieses Buch zu schreiben. Ich hatte schon vorher damit geliebäugelt, ein Buch über mein Leben zu schreiben, besonders nachdem ich die passive Phase meiner Altersteilzeit (ATZ) 2019 erreicht hatte. Der Start des Projekts sollte dann allerdings noch bis zum ersten Lockdown 2020 dauern.
Ich saß damals sehr viel zu Hause und versuchte, im Zeichen von Covid 19 meinen Tag zu gestalten. Es war das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit, dass sich mein Leben total verändert hatte. Im Herbst 2019 hatte ich mit 60 Jahren aufgehört zu arbeiten. Wir feierten zu beiden Anlässen – Abschied aus dem Erwerbsleben und 60. Geburtstag - in Bonn ein rauschendes Fest in der Regina Bonni. Ich bin froh, dass das noch möglich war. Meiner Frau gebührt ein riesiges Dankeschön für ihren Beitrag an diesem ganz besonderen Fest.
Ich hatte mich sehr lange und genau damit beschäftigt, was ich nach meinem Arbeitsleben tun wollte. Ein sehr großer Lebensabschnitt war zu Ende gegangen, und es bedurfte neuer Ideen für die Zukunft. Und im gleichen Stil wie ich immer gearbeitet hatte, plante ich nun generalstabsmäßig meinen Ruhestand mit Struktur und klarem Gerüst. Alles fing gut an. Ich ging zur Uni und hörte historische Vorlesungen, saß im gleichen Hörsaal wie vor 40 Jahren, ging ins Institute français und als Lesepate in eine Grundschule sowie zum Qigong. Nach einer kurzen depressiven Phase ging es mir in meinem neuen Leben gut. Und dann kam Corona, und auf einmal waren alle meine Pläne nicht mehr durchführbar. Ich machte viel zu Hause, ging mit Maske einkaufen, fuhr meine Frau zur Arbeit und holte sie wieder ab, beaufsichtigte Umbauten im Haus, die möglich waren, las sehr viel, hörte Musik bei Spotify und war guter Kunde bei Netflix und Amazon. Aber irgendwie fehlte mir etwas. Sollte ich mir einen Job besorgen? 450,- € durfte ich schließlich in der ATZ nebenher verdienen. Aber was und wo? Wir hielten uns sehr strikt an die Corona-Vorgaben, und daher war das alles nicht so einfach durchzuführen. Meine Frau hat in der Uniklinik einen systemrelevanten Job in einer Leitungsfunktion und gehört auch aufgrund von Vorerkrankungen zur Risikogruppe.
Unser ganzer Tagesablauf war in vielem coronabedingt vorgegeben, und das würde sich dann auch jahrelang erst mal nicht ändern. Schließlich hatte ich mich durchgerungen und war zu dem Entschluss gekommen, ein Buch zu schreiben. Es sollte ein Buch über mein Leben und das meiner Familie werden, ein Zurückschauen auf den bisherigen Lebensweg, so eine Art Zwischenbilanz vor dem Neubeginn, der nun folgen sollte.
Vor allem aber wollte ich meine Geschichte in den jeweiligen historischen Kontext der einzelnen Jahrzehnte und wichtiger historischer Ereignisse einbetten. Als Historiker kann ich allerdings nur einzelne Themen allgemein und knapp betrachten. Vielleicht setze ich manchmal zu viel voraus, vielleicht nimmt der ein oder andere ein entsprechendes Stichwort auf und möchte mehr darüber erfahren. Das ist heute ja kein Problem mehr und schnell geschehen. Neben den historischen Exkursen möchte ich noch weitere Aspekte betrachten oder einfach benennen. Ich werde mich auch in den verschiedenen Lebensabschnitten mit den Themen Musik, Filme, Serien, Literatur, Reiseberichte und Angesagtem beschäftigen. Es soll an das jeweilige Lebensgefühl erinnern, und so können wir gemeinsam in Erinnerungen schwelgen.
Zunächst begann ich, das gesamte Material des Nachlasses meiner Eltern mit meinem Bruder Robert zu durchforsten und habe dann alles chronologisch geordnet. Danach habe ich alle relevanten Bilder, Filme, Unterlagen und Sammelstücke aus unserem Hausstand in Kisten und Folien nach Jahrzehnten geordnet. Bevor es dann endlich losging, habe ich für meine Recherche unzählige Interviews mit der Familie, Freunden und Zeitzeugen aus Morsbach geführt, alles gesammelt und provisorisch in meinem „Recherche-Buch“ niedergeschrieben. Ich habe auch versucht, nach vielen Jahren mit einigen Menschen, die mir „verloren“ gegangen waren, Kontakt aufzunehmen, was leider nicht immer von Erfolg gekrönt und in manchen Fällen sehr schade war. Ferner hatte ich mir noch vorgenommen, alles zu anonymisieren. In einer Exceltabelle (Name alt und neu sowie Bemerkungen) habe ich 500 neue Namen für Personen, Firmen, Institutionen oder Locations vergeben, manchmal lustig und kreativ und manchmal einfach so. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Einige durften auch bei der Neufindung ihres Namens mitreden. Ich kann nur sagen, „wer suchet, der findet“.
Schauen wir nun gemeinsam, was bei meinem Versuch herausgekommen ist und ob mein Leben und das Buch so spannend sind, dass es auch andere interessiert. Sollte das nicht so sein, habe ich es auf jeden Fall für mich, meine Familie und meine Freunde geschrieben.
Viel Spaß bei der Reise durch die letzten Jahrzehnte.
Chronik der Covid-19-Pandemie
Am Anfang der Pandemie sagte Angela Merkel: „Es ist ernst.“ Kurz danach kam der erste Lockdown. Deutschland erlebte fünf Ansteckungswellen und so manche skurrile Debatte – über Impfdrängler, Quadratmeterzahlen und die Frage, warum sich das Virus in Gartencentern anders verbreitet als in Baumärkten, Hamsterkäufe von Mehl, Hefe und Toilettenpapier in Deutschland, während in Frankreich die Kondome und der Rotwein ausgingen. Weil zu Beginn der Pandemie deutsche Masken nach China gingen, erforderte es bei Einführung der Maskenpflicht in Deutschland große Anstrengungen, überhaupt an eine Maske zu kommen. Außerhalb der Krankenhäuser musste selbst genäht werden. Blöd nur, dass in kürzester Zeit Nähmaschinen nur noch überteuert oder gar nicht mehr zur Verfügung standen und Gummizugbänder quasi vom Markt verschwunden waren. Ich habe noch einmal die Nachrichtenmeldungen der vergangenen drei Jahre recherchiert und den Verlauf der Pandemie in der folgenden kurzen Chronik zusammengefasst.
Alles begann Ende Dezember 2019/Anfang Januar 2020, als eine neue Viruserkrankung, die in China um sich griff, die Weltgesundheitsorganisation aufhorchen ließ. Wie gefährlich die Krankheit war, war noch unklar. Die chinesischen Behörden bestritten eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Am 11. Januar 2020 meldete China mehr als 200 Corona-Infektionen und den ersten Corona-Todesfall. Das Virus war inzwischen auch in den Nachbarländern angekommen. Letztlich ungeklärt blieb die Frage, woher das Virus eigentlich kam. Einige Wissenschaftler hatten die Spuren des neuartigen Erregers zu einem Fischmarkt in der ostchinesischen Millionenstadt Wuhan zurückverfolgt. Sie gingen davon aus, dass dort verkaufte Tiere mit dem Virus infiziert waren und sich daran erstmals Menschen ansteckten. Der Markt wurde Anfang des Jahres 2020 geschlossen und desinfiziert.
Am 16. Januar 2020 gab die Charité bekannt, dass Professor Christian Drosten - ein ausgesprochener Coronavirus-Experte, der auch schon das SARS-CoV-1- und das MERS-Virus entdeckt hatte – einen ersten diagnostischen PCR-Test entwickelt hatte, der das SARS-CoV-2-Virus nachweisen kann. Das Testprotokoll wurde veröffentlicht und allen Laboren weltweit zur Verfügung gestellt. Dies war ein erster wichtiger Schritt, um Verdachtsfälle zweifelsfrei aufzuklären und zu untersuchen, ob eine Menschzu-Mensch-Übertragung des neuen Virus möglich ist. Damit war gleichzeitig ein wichtiger initialer Schritt zur Bekämpfung des neuen Virus getan.
Am 21. Januar wurde dann klar, dass das Virus doch von Mensch-zu-Mensch übertragen wird. China riegelte die Stadt Wuhan ab, strich alle Zug- und Flugverbindungen und alle Feierlichkeiten zum Neujahrsfest, während die WHO noch immer keine internationale Notlage erkannte. Am 25. Januar war das Virus nach den USA auch in Europa angekommen. Frankreich meldete erste Fälle. Am 27. Januar wurde bei einem Mann aus Starnberg, der sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt hatte, der erste Covid-19-Fall in Deutschland gemeldet. Am 28. Januar warnte der Virologe Christian Drosten vor einer drohenden Pandemie. Er sagte: „Die Symptome bei dieser Erkrankung beginnen mit Fieber und allgemeinem Krankheitsgefühl. Viele Leute nehmen solche Symptome nicht ernst und gehen trotzdem arbeiten. Das ist ein ganz normales Verhalten. Und das Gefährliche ist, wenn in dieser Situation die Krankheit bereits übertragen wird. Ich bin über diesen neuen Befund, dass wir offenbar so milde Symptome zu Beginn dieser Erkrankung haben, überrascht und besorgt. Denn so lässt die Verbreitung sich nur schwer kontrollieren.“
Alle großen Airlines setzten Flüge nach China aus. Am 30. Januar sprach dann auch die WHO von einer „Notlage von internationaler Tragweite“. Viele Staaten verhängten Einreiseverbote für Menschen aus China. Deutschland holte Bürger aus Wuhan zurück und stellte sie für 14 Tage in einer Kaserne unter Quarantäne. Während die Bundesärztekammer davor warnte, dass deutsche Krankenhäuser nicht ausreichend auf eine drohende Pandemie vorbereitet seien, bekundete der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dass Deutschland sehr gut auf diese Situation vorbereitet sei. Inzwischen waren Zehntausende mit dem Virus infiziert und alleine in China 500 Menschen an der Infektion gestorben. Es gab bereits mehr Tote als bei der ersten SARS-Pandemie 2002/2003. Die WHO sprach immer noch nicht von einer „Pandemie“.
Weltweit begannen Wissenschaftler mit Unterstützung großer Pharmaunternehmen und staatlicher Förderung zum Teil in Millionenhöhe an der Entwicklung eines Impfstoffs zu forschen. Zum ersten Mal wurden große Hoffnungen auf die Entwicklung eines wirksamen Impfstoffs auf mRNA-Basis gesetzt.
Es häuften sich Infektionen auf Kreuzfahrtschiffen. Am 12. Februar, als es in China bereits mehr als 1000 Tote gab, nannte die WHO die Krankheit „Covid-19“ (Benennung nach Corona, Virus, Disease und Erstentdeckung im Jahr 2019 in China). Die Deutsche Post schickte keine Pakete mehr nach China. Am 15. Februar meldete Frankreich den ersten Todesfall in Europa. Am 22. Februar gab es in Italien, wo sich die Lage bald ernsthaft zuspitzen würde, den ersten Todesfall. Italien war das am stärksten in Europa betroffene Land. Die norditalienischen Städte wurden abgeriegelt und der Karneval in Venedig komplett abgesagt.
Auch am 24. Februar glaubte die WHO noch, dass der Höhepunkt der Erkrankungswelle überschritten sei und das Virus gestoppt werden könne. Jens Spahn sagte, die Grenzen in Europa blieben offen. Es gab in Deutschland weitere Fälle, u.a. in Gangelt bei Heinsberg in NRW. Es sollte sich später herausstellen, dass die Ansteckungen auf einer Kappensitzung während des in Deutschland nicht abgesagten Karnevals stattgefunden hatten. Jens Spahn meinte, dass man das öffentliche Leben in Deutschland und Europa nicht so einfach lahmlegen könne, auch wenn die Epidemie nicht an uns vorbeigehen würde.
Am 26. Februar startete der Podcast „Das Corona-Virus Update“, in dem der Virologe Professor Christian Drosten regelmäßig auf sehr hohem Niveau die aktuelle wissenschaftliche Datenlage zum SARS-CoV-2 Virus mit den Wissenschaftsjournalistinnen Korinna Hennig und Beke Schulmann vom NDR besprach. Ich habe mit meiner Frau Petra fast immer fasziniert reingehört und mir von ihr erklären lassen, wenn ich etwas nicht so ganz verstanden hatte.
Anfang März gab es dann schon über 500 Infizierte in Deutschland, und es wurde vor den Folgen für die deutsche Wirtschaft gewarnt und erstmals Staatshilfen gefordert. Am 8. März starb der erste Deutsche an Covid-19. Am 9. März brachen der DAX und die internationalen Börsen ein. In Deutschland wurden Großveranstaltungen abgesagt, und im Sport fanden „Geisterspiele“ statt. Von Wirtschaftsminister Altmaier wurden Hilfen für die deutsche Wirtschaft angekündigt. Am 11. März sprach auch die WHO dann erstmals von einer „Pandemie“. Am 13. März begannen in Deutschland die Lock-down-Maßnahmen: Schulen und Kitas mussten schließen. Es ergingen Besuchsverbote in Altenheimen und Krankenhäusern.
International gab es Einreiseverbote, und die Fußball-Bundesliga stellte ihren Betrieb ein. Am 16. März wurden schließlich die Grenzen zwischen Deutschland und den Nachbarländern quasi geschlossen. Auch Geschäfte und öffentliche Einrichtungen mussten schließen. Alle Urlauber mussten die Nordseeinseln verlassen. Offen blieben Super- und Drogeriemärkte, Apotheken, Banken und Poststellen sowie Tankstellen. Es startete ein Rückholprogramm für im Ausland befindliche Deutsche. Am 18. März hielt die Bundeskanzlerin zum ersten Mal außerhalb der Neujahrsansprachen eine Rede an die Nation, in der der initial genannte Satz fiel: „Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.“
Die Schuldenbremse wurde aufgehoben und milliardenschwere Hilfsprogramme aufgesetzt. Es folgten strenge Kontaktverbote. Restaurants und Cafés durften nur noch „außer Haus“ verkaufen. Die Olympischen Spiele in Japan wurden um ein Jahr verschoben, was in Friedenszeiten noch nie vorgekommen ist. Ende März wurde New York zum Hochrisikogebiet. Premierminister Boris Johnson infizierte sich. Seine Erkrankung nahm einen schweren Verlauf, der intensivmedizinische Behandlung nötig machte. In den Krankenhäusern wurden planbare Operationen abgesagt, um Betten für Corona-Patienten frei zu halten. Ab dem 27. April galt in NRW eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr, im Einzelhandel und in Arztpraxen. Selbstgenähte Masken waren erlaubt, medizinische und FFP2-Masken Mangelware. Am 4. Mai ging der erste Lock-down zu Ende. Aber überall herrschten strenge Hygieneregeln.
Viele Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie führten zu einer Einschränkung der Grundrechte, was in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein einmaliger Vorgang ist. Angela Merkel sprach sogar von einer „Zumutung für die Demokratie“. Die Herausforderung für alle in der Politik Verantwortlichen bestand in der schwierigen Abwägung zwischen dem Schutz von Gesundheit und Leben der Bevölkerung einerseits und den Grundrechten andererseits. Die Debatte über diese Gratwanderung war mit unbequemen Fragen verbunden und führte uns die Bedeutung der Grundrechte vor Augen, die wir in Vor-Corona-Zeiten stets so selbstverständlich in Anspruch genommen hatten. Unser Leben hatte sich komplett verändert. Selbstverständliche Dinge und Vergnügen waren nicht mehr möglich: fast kein Schul- und Kitabesuch, keine Restaurant- und Kneipenbesuche mehr, kein Kino, kein Theater, kein Museum, kein Fitnessstudio, kein Friseur, kein Urlaub, keine Besuche in Krankenhäusern oder Altenheimen, was für die Betroffenen unendlich schmerzlich war, und vieles mehr. Das soziale Leben wurde fast komplett runtergefahren. Spazierengehen wurde ein Highlight in der Freizeitbeschäftigung. Häusliche Gewalt nahm unter diesen Einschränkungen zu. Lehrer, Schüler und Eltern lernten, was „home schooling“ ist und wie es funktioniert – mehr oder weniger gut.
In der Corona-Krise stieg das Ausmaß unbezahlter und gesellschaftlich als selbstverständlich angesehener Tätigkeiten des Sorgens und Sich-Kümmerns - etwa der Pflege Angehöriger, der Kinderbetreuung sowie Haushaltstätigkeiten - exponentiell an, und all dies musste überwiegend von Frauen geleistet werden.
Große Teile der Arbeitnehmer hatten quasi „Arbeitsverbot“, waren in Kurzarbeit oder im Homeoffice. Und die Mitarbeiter der Krankenhäuser, Arztpraxen, Labore und Gesundheitsämter drohten immer wieder völlig zu dekompensieren. Die anstrengenden AHA-L-Regeln gingen den meisten in Fleisch und Blut über – natürlich mit Ausnahme der Covid-Leugner, Maskenverweigerer und sogenannten „Querdenker“. Händeschütteln und viele körpernahe Begrüßungsrituale wurden zu einem „No go“. Viele verloren in dieser Zeit, bevor es Impfstoffe gab, Angehörige, Freunde und/oder Kollegen oder erlebten, welche schweren gesundheitlichen Einschränkungen viele Patienten nach einer schweren Infektion zu ertragen hatten.
Die Auswirkungen der Pandemie auf die Psyche waren enorm. Die massiven Einschränkungen im Alltag, die Trauer um gestorbene Corona-Opfer, Vereinsamung und Einkommensverluste förderten bei vielen Menschen das Entstehen von Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen sowie psychosomatischen Beschwerden. Unter der Krise litten vor allem Kinder und Jugendliche, aber auch die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und die Patienten in den Krankenhäusern.
Am 16. Juni wurde die Corona-Warn-App der Bundesregierung eingeführt. In vielen Städten fanden große Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen statt. Ende September stiegen die Infektionszahlen nach dem milden Sommer wieder stark an. Die zweite Infektionswelle kündete sich an. Am 2. November wurde ein „Lock-down light“ eingeläutet. Wegen drastisch steigender Infektionszahlen wurde am 16. Dezember ein zweiter Lock-down beschlossen, der bis in den März 2021 dauern sollte. Am 21. Dezember wurde in der Europäischen Kommission der mRNA-Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer und wenige Tage später der mRNA-Impfstoff Spikevax von Moderna zugelassen und große Impfkampagnen vorbereitet. Sorgen machten mutationsbedingte Varianten des Coronavirus. Ab dem 19. Januar waren keine selbstgenähten Masken mehr erlaubt. Nach Beginn der Impfkampagne sorgten sogenannte „Impfdrängler“ für Empörung. Ende Februar wurden die ersten Selbsttests auf eine Corona-Infektion verfügbar. Anfang Juni ging die dritte Coronawelle zu Ende, und die Infektionszahlen blieben bis August niedrig. Die Priorisierung bei den Impfungen wurde aufgehoben. Im August begann mit der Delta-Variante die vierte Infektionswelle. Ende Oktober schwafelten einige namhafte Politiker schon von einem „Freedom day“. Am 24. November trat das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft. Es sah zur Bekämpfung der Pandemie unter anderem die sogenannte 3-G-Regelung am Arbeitsplatz, in Bussen und Zügen vor. Zutritt erhielten demnach nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete.
Nach der Bundestagswahl wurde Deutschland dann von einer Ampelregierung aus SPD, FDP und Grünen regiert. Und Jens Spahn wurde durch Karl Lauterbach, der bisher der ungekrönte Talkshow-König in Sachen Pandemie war, als Bundesgesundheitsminister abgelöst. Ende 2021 löste dann die Omikron-Variante des Virus eine fünfte Infektionswelle aus. Es kam wieder zu Einschränkungen. So durften sich maximal 10 Personen privat treffen, was Mitte Februar 2022 wieder aufgehoben wurde. Ende Februar kam das Medikament Paxlovid auf den Markt, das wenn es frühzeitig eingenommen wird, schwere Covid-19-Fälle verhindern soll. Erst am 26. März 2022 wurde mit einem Wert von 1756,6 die bundesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz während der Pandemie erreicht. Anfang April fielen viele Corona-Maßnahmen weg. Im September wurden von der Europäischen Kommission neue Impfstoffe zugelassen, die an die Omikron-Varianten angepasst wurden. Im November 2022 hoben die ersten Bundesländer die Isolationspflicht bei Infektion auf. Durch die vielen Impfungen und Infektionen war die Immunität in der Bevölkerung gegen das Virus inzwischen so gut, dass das Robert-Koch-Institut im Februar 2023 die allgemeine Gefährdung durch das Coronavirus von „hoch“ auf „moderat“ herabstufte. Am 1. März 2023 entfielen fast alle verbliebenen Corona-Auflagen, so dass nunmehr zum ersten Mal seit fast drei Jahren keine Corona-Schutzverordnung mehr galt. In der erschreckenden Bilanz beläuft sich die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid 19 deutschlandweit auf mehr als 171.000.
Welches Bild wird uns von einer solchen globalen Erschütterung wie der Corona-Pandemie im Gedächtnis bleiben? Die Militärfahrzeuge, die Särge mit Leichen in Bergamo transportierten, Lagerhallen mit Särgen, leere Supermarktregale, Kämpfe um Toilettenpapier, die Polizeiabsperrbänder an Spielplätzen und Parkbänken, Menschen mit Mundschutzmasken, die Luca-App, die faxenden Gesundheitsämter, die rasende Geschwindigkeit, mit der Homeoffice plötzlich möglich war, die Pressekonferenzen mit Lothar Wieler?
Die Frage muss jeder für sich beantworten. Für einige sind es vielleicht diese Worte, die der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn am 22. April 2020 während einer Regierungsbefragung sagte: „Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müssen.“ Wir hatten alle unfassbar viele neue Worte gelernt. Nicht nur unser Leben hatte sich massiv verändert, sondern auch unsere Sprache: Wuhan, Covid-19, Corona, Pandemie, RKI, exponentielles Wachstum, Maskenpflicht, FFP 2-Maske, Beherbergungsverbot, Allgemeinverfügung, Basisreproduktionszahl, Verdopplungszahl, Inzidenz, Behelfs-Mund-Nasen-Schutz, SARS-CoV-2, Risikogruppe, Quarantäne, Querdenker, Sterberate, Systemrelevanz, und das schlimmste Wort Triage. Corona bestimmte unseren Alltag.
Ein wichtiger positiver Aspekt geht meist völlig unter: Weltweit wird häufig die „Spitzenwissenschaft“ in den USA gesehen, wohingegen Deutschland in der Wissenschaft häufig als „abgehängt“ betrachtet wird. Und obwohl es in Deutschland nur Bruchteile der finanziellen Förderung der Wissenschaft im Vergleich zu den USA gibt, war es mit Professor Christian Drosten ein Virologe aus Berlin, der schon im Januar 2020 den ersten diagnostischen Test auf SARS-CoV-2 entwickelt hatte und der ganzen Welt zur Verfügung stellte. Ferner gelang es der Mainzer Firma Biontech gemeinsam mit Fa. Pfizer, die im großen Maßstab auf Impfstoffproduktion spezialisiert ist, mit Comirnaty den ersten hochwirksamen mRNA-Impfstoff gegen SARS-CoV-2 auf den Markt zu bringen. Das ist keine so schlechte Bilanz.
Morsbach
Alles begann in der Gemeinde Morsbach im Oberbergischen Kreis. Das Autokennzeichen ist hier „GM“ für Gummersbach. Ich war am Anfang meines Lebens viele Jahre der Meinung, „GM“ könne nur für „Gemeinde Morsbach“ stehen und hatte mit Gummersbach nix am Hut. Das kam erst viel später mit dem VFL.
Am 18. September 1959 erblickte ich in Morsbach das Licht der Welt als drittes Kind der Eheleute Wilde. Unser Haus stand „Auf’m Büchel“. Es wurde in den 30er Jahren von meinem Großvater gebaut. Im Nachlass der Familie finden sich noch die notarielle Urkunde für das Darlehen vom 30. April 1931 für 2000 Goldmark und 5000 Reichsmark, der Grundbucheintrag vom 5. Juni 1937 Band 37 Blatt 1337 und ein Auszug aus der Gebäudesteuerrolle vom 28. Januar 1938.
Es war ein wahnsinniger Akt, den Hausbau in dieser Zeit umzusetzen, und es hat allen Beteiligten eine Menge abverlangt. Eine genauere Einschätzung der Bauzeit konnte ich bei einem kürzlichen Besuch in unserem Haus vornehmen. Katja, die unser Haus 2004 gekauft hatte, hat im Hausordner ein Dokument zur Schätzung des Hauses gefunden, aus dem hervorgeht, dass das Haus in den Jahren 1934 - 1937 gebaut worden ist. Das Haus der Mauelshagens schräg gegenüber ist noch älter. Das wurde schon 1927 fertiggestellt. Auf nicht genau datierten Fotos aus den 30er Jahren sieht man im näheren Umfeld nur vier fertige Häuser, eines davon das unsere. Erst viel später kamen die neuen Wohnsiedlungen „Hahnerstraße“ und „Goldener Acker“ in den 50er und 60er Jahren hinzu.
Wir können nur erahnen, was es für den Großvater bedeutet haben muss, in Stentenbach zu wohnen, als Walzwerkarbeiter im acht km entfernten Wissen zu arbeiten und in Morsbach, das 12 km von Wissen und vier km von Stentenbach entfernt war, ein Haus zu bauen. Es gab keinen Bus und kein Fahrrad, höchstens Pferdewagen. Die einzige feste Verbindung war die Bahn von Wissen nach Morsbach, ansonsten muss er wohl sehr viel zu Fuß unterwegs gewesen sein. Um Material zu transportieren, gab es Pferdefuhrwerke und hier und da mal einen Lastkraftwagen, wenn überhaupt.
Damals ging man sowieso viel wandern und spazieren. Es gab einfach noch nicht viele andere Fortbewegungsarten, die man sich leisten konnte. Wenn man Freunde besuchen wollte, musste man laufen - im Sommer wie im Winter. Da waren die sechs Kilometer nach Katzenbach oder die acht Kilometer nach Stentenbach eine ganz normale Entfernung wie auch die Schulwege. Mein Vater lief von Katzenbach nach Holpe fast eine Stunde bis zur Schule. Holpe gehört zur Gemeinde Morsbach.
Die Gemeinde Morsbach liegt in der südöstlichen Ecke des Oberbergischen Kreises und gehört zum Regierungsbezirk Köln in NRW. Man ist sich bis heute nicht sicher, wann genau Morsbach gegründet worden ist.
Um 895 herum wurde Morsbach erstmals erwähnt. Der Name findet sich auf einem alten Ortsregister des Bonner Cassius-Stifts. Schon damals sehen wir die zukünftige Verbundenheit des Verfassers zu Bonn. Auch heute wird immer noch heiß diskutiert, ob Morsbach am östlichen Rand noch zum Rheinland gehört und sich der Verfasser als Rheinländer bezeichnen darf. Das Jahr 895 wurde jedenfalls als Basis für die 1100-Jahr Feier 1995 herangezogen. Es finden sich nirgendwo Hinweise, wie der Name Morsbach entstanden ist.
Von besonderer Bedeutung und schon immer das Wahrzeichen von Morsbach ist die Katholische Kirche St. Gertrud. Der staufisch-romanische Bautyp wurde im 12. und 13. Jahrhundert in mehreren Bauabschnitten erbaut. Es ist historisch leider nicht bekannt, wer der Bauherr gewesen ist.
Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich der Ort immer weiter. Kirchenrechtlich führte die Reformation letztendlich zur katholischen Enklave. Der Katholizismus prägte die Geschichte von Morsbach über Jahrhunderte, aber nicht nur den Ort, sondern auch die Menschen, und er machte auch nicht halt vor dem Verfasser dieses Buches. Sowohl der Katholizismus als auch die historische Entwicklung werden später noch mal Thema sein, wenn es konkreter um meine Familie geht.
Die Großeltern
Meinen Großvater habe ich ja schon kurz eingeführt. Wilhelm Weber wurde am 16.09.1894, also noch im Kaiserreich in Alzen geboren. Alzen gehört zur Gemeinde Morsbach. Meine Großmutter Gertrud Quast wurde am 22.08.1896 in Stentenbach ganz in der Nähe von Alzen geboren. Wie sie sich kennengelernt haben, ist unklar, aber sie haben sich gefunden, und am 09.05.1919 wurde in Morsbach in St. Gertrud Hochzeit gefeiert. Es war für das junge Brautpaar sicher nicht einfach so kurz nach dem 1. Weltkrieg. Der Versailler Vertrag und seine Folgen, die innere Zerrissenheit der Deutschen in der Weimarer Republik, Inflation, Arbeitslosigkeit, die Weltwirtschaftskrise bis hin zum Aufkommen des Nationalsozialismus, das alles spiegelte sich natürlich auch bis hinunter in die kleinen Gemeinden.
Familie Weber bekam vier Kinder: Wilhelm (1919), Hermann (1922), Robert (1926) und als letztes meine Mutter Gertrud am 22.07.1929 und damit schon wieder eine Gertrud.
Der 2. Weltkrieg hat auch in Morsbach einen tiefen Einschnitt hinterlassen. Wir wissen nicht, wie Großvater und Großmutter durch den Krieg gekommen sind. Alle drei Söhne zogen in den Krieg, und zwei Söhne haben sie verloren. Bevor ich mich mit den einzelnen Söhnen beschäftige, möchte ich einen kurzen Exkurs machen. Neben dem normalen Nachlass, den ich bis dato schon komplett gesichtet und verarbeitet hatte, fand mein Bruder später noch in einer alten Persil-Dose Unmengen von Briefen und Postkarten aus dem Krieg und der folgenden Kriegsgefangenschaft, also aus dem Zeitraum von 1942 bis 1948, die erst mal unbeachtet geblieben waren. Bevor ich Anfang 2023 nach einer Schreibpause bzw. -blockade endlich weiterschreiben wollte, habe ich zum Einstieg diese Briefe im Detail analysiert. Ein Teil war noch in Sütterlin geschrieben. Das meiste konnte ich aber lesen, teilweise mit Lupe. „Sütterlin“, entworfen von Ludwig Sütterlin, war von 1924 bis 1942 die deutsche Standardschrift. Die Sütterlinschrift war zwar von den Nationalsozialisten 1941 verboten worden, wurde aber noch von vielen übergangsweise parallel verwendet. Die lateinische Grundschrift wurde nun zum Standard. Man sieht es auch bei den Briefen meines Vaters. In seinen Briefen und Postkarten von 1942 bis 1948 nahm der Anteil Sütterlin kontinuierlich ab.
Insgesamt habe ich 191 Briefe oder Postkarten gelesen (von Wilhelm, Robert, Hermann, Thomas, seinem Bruder Kunibert und anderen) und in einer Excel-Tabelle zusammengefasst und eine Vielzahl mit Kommentaren versehen. Dabei war mir meine Frau eine große Hilfe. Eine Detailanalyse würde hier zu weit führen, könnte aber eventuell in einem neuen Buch münden. Hier werde ich nur einige übergeordnete Ergebnisse erläutern.
Kommen wir nun zurück zu den Brüdern meiner Mutter. Von Wilhelm selbst sind nur vier Postkarten erhalten, sie bestehen alle nur aus kurzen Grüßen aus Russland sowie einer kleinen Todesanzeige. Weiterhin ist die Abschrift des Briefes der Wehrmacht vom 08.03.1942 erhalten, in dem Frau Weber mitgeteilt wurde, dass ihr ältester Sohn Wilhelm „in soldatischer Pflichterfüllung, getreu seinem Fahneneid“ an der Ostfront gefallen war.
Von Robert gibt es auch nur fünf Postkarten und eine undatierte Weihnachtspostkarte mit Foto. Er starb am 25.04.1945 kurz vor Ende des Krieges in Den Haag „für Volk und Vaterland“ beim Verlegen von Schützenminen. Informiert wurde sein Vater darüber erst in einem sehr ausführlichen Brief von Leutnant Christian Müller am 28.06.1945.
Es fällt auf, dass der Krieg vorbei war. Es war ein eher mitfühlender Brief, der nicht mehr nur noch nationalsozialistisches „Helden-Geschwafel“ enthielt.
Meine Großmutter hat immer wieder versucht herauszufinden, wo sein Grab gewesen ist („Letztes Schreiben an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge vom 08.02.1961“). Im Antwortschreiben vom 03.03.1961 erhielt sie die Information, dass „alle in den Niederlanden Gefallenen auf den Soldatenfriedhof Yaselsteyn in der Provinz Limburg umgebettet wurden. Die Grablage ihres Sohnes geht aus den Unterlagen nicht hervor. Wir bemühen uns die Beschriftung der Erkennungsmarke zu ermitteln“. Damit hat sie sich dann wohl abgefunden. Von den drei Brüdern kam nur Hermann, der Zweitgeborene, aus dem Krieg zurück. Gertrud, die jüngste der vier Geschwister, hatte zwei ihrer geliebten Brüder verloren.
Von Hermann gibt es aus den Jahren 1942 bis 1944 insgesamt 23 Postkarten aus dem Krieg, unter anderem aus dem von der Wehrmacht besetzten Paris, aus Rennes, und er war wohl auch mal in Marseille. Er hat allerdings nur in Sütterlin geschrieben, sodass es für mich bei der Analyse sehr schwierig war.
Nach seiner Rückkehr wird er nur kurz zu Hause gewesen sein. Er hatte seine zukünftige Frau Lisa schon kennengelernt, die in Niederwarnsbach wohnte. Nach ihrer Hochzeit wohnten sie weiter dort und bekamen 1949 ihre erste Tochter Roswitha.
Die Quellenlage über Morsbach zur Zeit des Nationalsozialismus ist eher dürftig. Es sind wohl auch viele Unterlagen am Ende des Krieges vernichtet worden. Das war für den ein oder anderen auch vielleicht besser so. Wie stark der Nationalsozialismus in Morsbach wirklich war, lässt sich nicht genau nachvollziehen. Die katholische Zentrumspartei war in der Weimarer Republik mit Abstand stärkste Kraft in Morsbach. Sogar in der Reichstagswahl vom 05.03.1933 hatte das Zentrum noch dreimal so viele Stimmen wie die NSDAP. Eine letzte Wahl fand im November statt, danach wurde 14 Jahre lang nicht mehr gewählt. Die erste freie Wahl war erst wieder die Gemeinderatswahl im November 1946. Am 08.04.1045 (Weißer Sonntag) hatten amerikanische Truppen Morsbach und die umliegende Gegend erobert. Genau einen Monat später, am 08.05.1945 hatte das Deutsche Reich bedingungslos kapituliert, der 2. Weltkrieg war zu Ende – die Stunde Null in Deutschland. Es begann die belgische Besatzungszeit bis Anfang 1949 (die Belgier als Kontingent der britischen Armee), auch die französische Besatzungszone war in der Nähe. Bei der Nähe der Besatzungszonen war es nicht so einfach, von Morsbach nach Wissen zu kommen. Der Krieg hatte auch in Morsbach gewütet und sehr viel Leid über die Bevölkerung gebracht. Nun begann die Zeit des Wiederaufbaus. Begriffe aus dieser Zeit wie „Kohldampf“ und „Schmacht“ dokumentieren eines der Hauptprobleme dieser Zeit. Morsbach wurde auch als „Armenhaus des oberbergischen Kreises“ tituliert. Es sollte ein langer Weg zum allgemeinen Wohlstand werden. Die Abgeschiedenheit nach dem 2. Weltkrieg, die fehlenden Verkehrsverbindungen und das nicht immer Halten an die Besatzervorgaben in vielerlei Hinsicht führte zum Auftauchen des Begriffs „der Republik Morsbach“. Die Morsbacher waren immer schon ein „eigenes Völkchen“ gewesen, und das sollte sich auch später noch in meinem eigenen Leben zeigen. Dass sich der Begriff der „Republik“ bis heute gehalten hat, hat auch sehr viel mit dem Morsbacher Karneval in der katholischen Enklave zu tun. Manche bezeichneten Morsbach auch als „die Wiege des Oberbergischen Karnevals“.
Die nächste Generation - Meine Eltern
Gertrud und Thomas sind beides Kinder der Golden Zwanziger.
Mein Vater wurde am 23.08.1924 in Katzenbach geboren. Seinen Vater Johann verlor er schon mit 13 Jahren, er war nur 39 Jahre alt geworden. Erhalten ist noch eine Rechnung vom 03.März 1938 über ein Grabdenkmal mit Einfassung der Firma Valentin Heinz aus Wissen für 50,--Reichsmark. Thomas hatte einen jüngeren Bruder, Kunibert, der 1928 geboren war. Seine Mutter Anna, meine zweite Großmutter, war also schon sehr früh mit ihren beiden Söhnen auf sich allein gestellt. Thomas ging in Holpe in die katholische Grundschule (natürlich gab es überall noch eine katholische und eine evangelische Schule). Danach machte er eine Lehre als „Seidenstoffweber“. Das „Entlassungszeugnis der Gewerblichen Berufsschulen der Stadt Gummersbach vom 15.03.1942“ befindet sich im Nachlass. Er hatte nur „gut“ und „befriedigend“. Im Nachlass findet sich auch eine weitere Bescheinigung („Bescheinigung Abschlussprüfung“). Die Abschlussprüfung bei der Bergischen Industrie und Handelskammer bestand er mit „gut“.
Wir befinden uns im Jahre 1942, drei Jahre nach Kriegsbeginn. Im Alter von 18 Jahren war klar, was nun passieren würde. Bereits am 30.01.1942 war die „Aufforderung zur Musterungsgestellung“ gekommen, und Thomas musste sich am 04.02.1942 in Waldbröl im Hotel Althoff vorstellen. Laut einem weiteren Dokument „Aufforderung zur marineärztlichen Nachuntersuchung – Eilige Wehrmachtssache mit Feldpost“ musste er sich in Koblenz vorstellen. Danach ist sicher alles ziemlich schnell gegangen. Es ging für ihn zunächst nach Aurich. Hier war er das ganze Jahr 1942 stationiert. Von Thomas gibt es insgesamt 100 Briefe und Postkarten aus den Jahren 1942 bis 1945 und dann noch mal 15 aus der Kriegsgefangenschaft. Thomas war bei der Marine Funker, und von Aurich ging es dann an die Westfront.
Stationiert war er in St Nazaire. St. Nazaire galt als zweitwichtigster Kriegshafen im westlich besetzten Frankreich nach Brest. Im „Westfeldzug“ oder auch „Blitzkrieg“ im Mai und Juni 1940 hatte die deutsche Wehrmacht die Niederlande, Belgien, Luxemburg und auch Teile Frankreichs besetzt. Mit dem Waffenstillstand von Compiègne endeten die Kampfhandlungen.
Seine hundert Briefe geben einen sehr guten Einblick in sein Leben und seinen Alltag im Krieg, wie und wo sie gelebt, was sie gemacht haben und welche alltäglichen Probleme sie hatten, wann war er in Urlaub und wie gläubig er war. Es herrschte reger Schriftverkehr zwischen ihm und seiner Mutter, seinem Bruder und vielen anderen Freunden und Freundinnen. Es gab viele Päckchen für ihn, und er half aus mit Dingen, die es in Katzenbach nicht gab. Ich finde es erstaunlich, wie viel hier kommuniziert wurde und wie gut die Feldpost doch zumindest an der Westfront funktionierte. Im Durchschnitt dauerte ein Brief vier bis sieben Tage. Er konnte als Funker innerhalb der Nachtwache sicher häufiger schreiben als andere. Das war seltener möglich, wenn sie auf dem Schiff waren oder sonst vor Ort im Einsatz. Ende 1944 bis in das Jahr 1945 waren sie monatelang im Bunker eingeschlossen, da gab es dann nur Funknachrichten, aber immer noch besser als gar nichts für Anna, seine Mutter und Kunibert, seinen Bruder.
Eine Geschichte hat er erzählt (zum ersten Mal habe ich mit ihm, meiner Mutter und meiner heutigen Frau 1988 in Domburg fast die ganze Nacht über die Ereignisse gesprochen, das erste Mal und danach nie wieder!). Er erzählte, sie seien abgeschossen worden, und er hätte dann ein paar Tage im Atlantik „verbracht“, bevor man ihn fand.
Diese Episode sollte später noch mal wichtig werden. Vieles von dem, was er damals erzählt hat, konnte ich jetzt nachvollziehen.
In aussichtsloser Lage und nach Monaten im eingeschlossenen Bunker hatten sie dann wohl die weiße Fahne gehisst, und es ging vom 10.05.45 bis 20.03.48 in französische Kriegsgefangenschaft. Er wusste auch später noch ganz genau, wo es passiert war. Bei einer Reise mit der Familie (mein Vater und meine Mutter mit Robert und Annika) 1977 stellte er sich an den Originalplatz, an dem es passiert war. Sicher kein gutes Gefühl.
Es gibt ein Foto aus dem Jahre 1947 aus der Kriegsgefangenschaft. Ein tolles Porträt mit Anzug und Krawatte, erstaunlich, wie ein solch tolles Foto dort entstehen konnte. Erhalten ist weiterhin die “Entlassungsurkunde aus der Kriegsgefangenschaft vom 20.03.1948“. Hier ist auch der Marinedienstgrad definiert: OGEFR. Drei Jahre in französischer Kriegsgefangenschaft (glücklicherweise nicht in russischer Gefangenschaft!) waren eine lange und schwierige Zeit und bedeuteten Hunger und Zwangsarbeit sowie Leben auf engstem Raum. Man kann sich vorstellen, was die Gefangenen erleiden mussten, aber was hatte man erwartet, nach allem, was die deutsche Wehrmacht den Franzosen angetan hatte. Er hatte erzählt, dass er zweimal versucht hatte zu fliehen. Zweimal wurde er wieder gefangen genommen, und ihm wurde als Strafe der Kopf kahlgeschoren. Es hätte schlimmer kommen können. Beim zweiten Mal hatte er sich gewundert, dass der Zug auf einmal die Richtung änderte und nicht nach Westen, sondern zurück nach Frankreich fuhr, irgendwie dumm gelaufen. Letztendlich aber hat er den Krieg und die Gefangenschaft überlebt, das war die Hauptsache, und irgendwann war er endlich wieder zu Hause in Katzenbach. Er sollte 1956 DM 450,-- Entschädigung bekommen laut „Bescheid über die Feststellung der Entschädigung nach dem Kriegsgefangenen-Entschädigungsgesetz“. Als er endlich nach vier Jahren wieder nach Hause kam, war sein Bruder Kunibert mittlerweile 20 Jahre alt und seine Mutter 49 Jahre.
Gertrud hat den Krieg in Morsbach irgendwie überstanden. Über ihre Schulzeit gibt es keine Belege. Sie wird die Katholische Volksschule in Morsbach besucht haben. Was wir wissen ist, dass sie ein paar Wochen in Zoppot im heutigen Polen war. Warum sie ausgewählt wurde oder Details der Reise lassen sich heute leider nicht mehr nachvollziehen. Komplett erhalten ist das Poesiealbum von Gertrud mit dem ersten Eintrag vom 10. März 1940. Hier haben viele Menschen geschrieben, die ich auch noch kennengelernt habe, später auch meine Geschwister. Vieles kann ich auch hier leider nicht mehr lesen, da es auch in Sütterlin geschrieben war.
Auch über eine mögliche Ausbildung von Gertrud liegen keine Dokumente vor. In zwei „Bescheinigungen der Landesversicherungsanstalt bzw. Invalidenversicherung von 1947“ finden wir folgende Daten:
• 01.04.1942 - 30.06.1943 Frau Franz Müller Drogerie Morsbach Sieg
• 01.08.1943 - 31.12.1943 Werner Theis Morsbach Sieg
• 01.01.1944 - 01.08.1944 Erna Theis Morsbach Sieg
• 23.08.1944 - 31.12.1944 Morsbach Heinrich Schaumann
• 01.01.1945 - nicht entzifferbar Morsbach Heinrich Schaumann
Als Beschäftigungsart steht Hausgehilfin, wobei sie wohl das Nähen bei Schaumann gelernt bzw. sich dann selbst weiter beigebracht hatte. Ich hatte immer gedacht, sie hätte Näherin gelernt. Ich kann mich erinnern, dass sie in meiner Kindheit oft an der Nähmaschine gesessen hat, die Schnittmuster herumlagen und stets viele Leute zum Anprobieren kamen. Sie hatte ein besonderes Faible, aus alten Sachen neue zu machen. Zur Familie Schaumann hatten meine Großeltern wohl eine besondere Beziehung. Gefunden habe ich den Gratulationsbrief zur Silberhochzeit von Opa und Oma vom 10.05.1944. Glückwunschkarten gab es auch von den Familien Julius Mauelshagen und Familie Pielsticker.
Etwas genauer habe ich mir die Versicherungsdaten von Gertrud angeschaut. Was auffällt - und das wurde wohl übersehen - ist, dass auf der offiziellen Übersicht der Versicherungsanstalt von 1983 die Daten falsch sind. Hier sind Fehlzeiten vom 19.04.1944 bis 30.05.1965 dokumentiert. Anscheinend wurde das nie gerade gezogen, und daher fehlten meiner Mutter auf jeden Fall acht Monate von 1944 und alle Monate von 1945 für die Rente. Die Originalunterlagen sind nicht richtig gedeutet bzw. interpretiert worden.
Dies war ein kleiner Einblick in das, was Gertrud gegen Ende des Krieges gemacht hatte. Bei uns im Haus wohnte später neben meiner Mutter und Thomas auch noch meine spätere Patentante Gertrud, genannt Gerti (geb. 29.09.1941). Sie war die Tochter von Wilhelm, Gertruds ältestem Bruder, der sie allerdings aufgrund seines frühen Todes in Russland nie gesehen hatte. Sie lebte vorher bei ihrer Mutter im Saarland, die neu geheiratet hatte. Die genauen Umstände sind nicht bekannt, aber aus irgendwelchen Gründen wollte sie lieber bei der Großmutter in Morsbach leben. Und so kam sie Ende der fünfziger Jahre nach Morsbach. Das war nach dem Saarentscheid von 1955 auch kein Problem mehr.
Auch mit meiner Mutter konnte man nicht viel über die NS-Zeit und den Krieg sprechen. Ich kann mich nur an eine Geschichte erinnern. Ich gehe davon aus, dass ich nach den Juden gefragt hatte. Ja, es gab auch in Morsbach Juden, ja, es gab sogar eine Familie, die man kannte und die man oft beim Waldbeerenpflücken getroffen hatte, ja, irgendwann waren die alle nicht mehr da, die Eltern und Kinder. Keiner wusste, was mit ihnen passiert war. Im Nachlass von Thomas sind zwei Artikel aus dem Oberbergischen Volksfreund vom 08. November 1999 über das tragische Schicksal der Familie Levi aus Niederwarnsbach. Hier bekommt man einige Eindrücke aus der Zeit. Geendet hat es für die Familie (Vater/Mutter/Tochter/Sohn) wie für über sechs Millionen weiterer Juden in Europa mit dem Tod. Was für ein grausames, nicht begreifbares Schicksal als Ergebnis der Shoa bzw. des Holocaust. Ich habe mich später im Leben oft geärgert, dass ich nicht öfter und intensiver bei meinen Eltern oder meiner Oma nachgefragt habe, was sie in der Zeit getan haben und was alles so passiert ist. Irgendwann war es dann zu spät, und so sind leider viele Informationen aus dieser Zeit für immer verloren - außer den Unterlagen, die ich aus dem Nachlass sichten konnte. Aber wie mir ist es vielen Nachkriegskindern gegangen, sehr lange waren Themen wie NS-Zeit oder auch Krieg Tabuthemen, und mittlerweile sind viele Zeitzeugen, die man fragen könnte, einfach nicht mehr da. Wie hatten sich Thomas und Gertrud damals kennengelernt? Gertrud hatte das Ende des Krieges in Morsbach verbracht. Thomas kam 1948 aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Er arbeitete zunächst im Walzwerk in Wissen. Wie sich später herausstellen sollte, mochten beide das Singen und waren daher Mitglied in den jeweiligen Kirchenchören, Gertrud in Morsbach und Thomas in Holpe. Morsbach sollte ja noch bekannt werden für seine Chöre. In den Siebzigern und später gab es „11 Chöre und 6 Meisterchöre. Und nicht nur Chöre, die Gemeinde Morsbach hatte in dieser Zeit auch die meisten Musikkapellen in NRW“. Man wohnte also damals schon in einer sehr musikalischen Gemeinde. Auch das Singen im Kreise der Familie hatte einen hohen Stellenwert. Zu wichtigen katholischen Kirchenfesten wurde zu Hause aus dem Gebetbuch gesungen, aber auch sonst aus der Mundorgel, dem kleinen roten Wegbegleiter unserer aller Jugend in der Schule, zu Hause, im Kommunionsunterricht oder Konfirmationsunterricht. Ich hatte keine mehr, zum Schreiben habe ich mir eine neue bestellt und als sie per Post kam, habe ich erst einmal ein paar Lieder geschmettert.
Aber nun zurück ins Jahr 1948. Ich denke, es war gegen Ende des Jahres, als der Morsbacher Kirchenchor dem Kirchenchor in Holpe einen Besuch abstattete. Man erzählt, dass sich die Gäste aus Morsbach auf der Empore breitgemacht hatten und der Holper Chor mit dem Erdgeschoß Vorlieb nehmen musste. Die Morsbacher Chordamen konnten die Holper Chorjungen sehr gut von oben begutachten, und dabei muss Gertrud dann wohl ihren Märchenprinzen Thomas zum ersten Mal erblickt haben. Das Schicksal hatte zugeschlagen. Es gab auch noch einen Gegenbesuch, sodass die beiden die Möglichkeit hatten, sich näher zu kommen, und fortan durfte Thomas dann auch schon mal im Hause Weber verweilen. Eines der schönsten Fotos aus der Zeit der Annäherung ist eines, auf dem die beiden auf dem Kühler eines Autos sitzen. Nach drei Jahren, am 05.07.1951, traten die beiden dann in den Stand der Ehe. Erst im August 2020 habe ich zum ersten Mal alte Fotos von der Hochzeit gesehen, ganz tolle Fotos. Ein tolles Paar waren die beiden. Gefeiert wurde im „Prinzen Heinrich“.
Meine Geburt – der Übergang in die 60er Jahre
Am 18.09.1959 war es dann soweit. Ich erblickte das Licht der Welt. Es gibt viele Fotos von mir als Kleinkind, z.B. im Kinderwagen - Mann, war das eine super Kiste (später sollte hieraus meine erste Seifenkiste entstehen!) - im Haus, hinter dem Haus, im Garten, beim Spazierengehen und Wandern im Wald, am Aussichtsturm oder in Flockenberg, wo ich beinahe mal im Pool ertrunken wäre. Man stelle sich das vor: als Sohn des Schwimmmeisters. Weitere Fotos an der Hand von meiner Oma oder meinen Eltern oder Geschwistern, beim Blumen pflücken, zu Hause vor der Weihnachtskrippe und dem Weihnachtsbaum, in der Kirche, vor dem Altar bei der Fronleichnam-Prozession bei uns am Grundstück, bei der Kommunion meiner Geschwister, beim Küren der Maikönigin, beim Spielen alleine oder mit anderen Nachbarskindern, im Freibad - damals noch Badeanstalt genannt - beim Neubau/Anbau mit Handwerkern und auf vielen weiteren Fotos mehr.
Die Fotos dokumentieren eine Zeit, die ich selbst bewusst noch nicht wahrgenommen hatte. Ich denke gerade darüber nach, welches die ersten Erinnerungen an mein Leben sind. Ich war auf jeden Fall nicht im Kindergarten so wie meine Geschwister. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht wollten meine Mutter und meine Oma den Nachzügler lieber bei sich zu Hause haben.
An den Hausanbau kann ich mich erinnern. Irgendwann war die Holzschiebetüre zum neuen Wohnzimmer fertig. Mit Bauschein Nr. 887/64 war der Bau am 08.05.1064 von der Gemeinde Morsbach genehmigt worden. Bis zur Fertigstellung hatte es aber gedauert, und es gab Ärger in der Familie. Es ist nicht geklärt, ob Hermann von der Hausumschreibung gewusst hatte oder nicht. Es kam die Frage