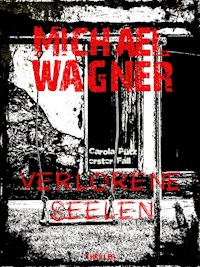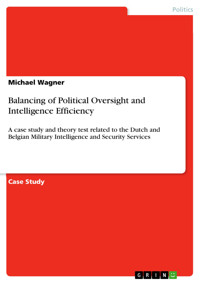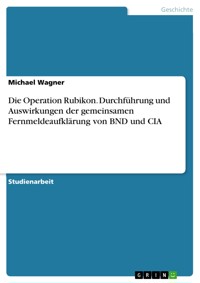Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Oliver Hell
- Sprache: Deutsch
Der Mann presste seine Handflächen gegen die Schläfen und gab einen unterdrückten Schrei von sich. Schrie in sich hinein, bis die Lunge und sein Zwerchfell schmerzten. Biss die Zähne aufeinander, bis sie ein ungesundes Knirschen erzeugten. Doch je stärker er presste, desto schlimmer wurde der Schmerz. Oder hatte das nichts miteinander zu tun? Er riss die Hände abrupt weg von seinem Kopf, ohne Effekt. Der Schmerz fuhr ihm vom Kopf aus in seinen Nacken, von dort aus über den Rücken bis in die Füße, bis in die Zehen. Jetzt hielt er es nicht mehr aus und begann zu schreien, als würde er bei lebendigem Leib in heißem Teer versenkt. Karnevalszeit in Bonn 2015. In einem Park unweit der Bonner Universitätskliniken findet man einen Toten. Am Tatort ein jugendlicher Zeuge, der kein Wort spricht. Kaum beginnt das Team um Hauptkommissar Oliver Hell mit den Ermittlungen, wird in derselben Siedlung eine weitere Leiche entdeckt. Mitten in den tollen Tagen müssen die Bonner Ermittler einen Mörder finden, der maskiert und gut getarnt unter den Bonner Jecken einen Rachefeldzug unter Medizinern der Bonner Universität weiterführt. Bei der Aufklärung fragen sich die Bonner Ermittler schnell, ob der rätselhafte Junge, dem Psychologen eine autistische Störung attestieren, der Schlüssel zur Lösung der Mordfälle ist … Kontakt: facebook.com/michaelwagner.autor walaechminger.blogspot.de/
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Wagner
Oliver Hell
Schattenkind
Bonn - Krimi: Oliver Hells neunter Fall
Thriller
Ungekürzte Ausgabe
1.Auflage
Im Dezember 2016
Copyright © 2016 Michael Wagner
Textur by Ruth West.
Frame by Freepik.
Michael Wagner
http://walaechminger.blogspot.de/
@michaelwagner.autor
All rights reserved.
“Autismus ist eine lebenslange, nicht heilbare tiefgreifende Entwicklungsstörung und entsteht wohl schon in der frühen Phase der Schwangerschaft.“
(Quelle: Autismus online)
Mittwoch, 13.07.1988
Donnerstag, 22.05.2014
Mittwoch, 04.02.2015
Donnerstag, 12.02.2015
Freitag, 13.02.2015
Samstag, 14.02.2015
Sonntag, 15.02.2015
Montag, 16.02.2015
Dienstag, 17.02.2015
Mittwoch, 18.02.2015
Donnerstag, 19.02.2015
Was noch geschah.
Nachwort
Mittwoch, 13.07.1988
Gelsenkirchen
Der Junge stand in einer Haltung da, als könne er nicht verstehen, was dort gerade passiert war. Sein Oberkörper war zwar nach vorne gebeugt, als wolle er sich auf jemanden stürzen. Doch der Rest des Körpers war merkwürdig spannungslos, seine dünnen Arme hingen schlaff neben seinem schmächtigen Oberkörper. Angesichts dessen, was sich gerade dort vor ihm abspielte, war das nicht nachzuvollziehen. Auf dem Boden des Kellers wälzte sich ein Kind, aus dessen Kehle gurgelnde Laute hervordrangen. Seine Hände krallten sich an seinen Hals. Der Beobachter blieb starr. Vor ihm lag sein Bruder. Sie hatten gespielt, das war im Keller ihres Elternhauses streng verboten. Doch der kleine Bruder hatte ihn überredet. Jetzt lag er da, sie hatten Cowboy und Indianer gespielt, so wie Winnetou und Old Shatterhand. Der Bruder hatte ihn gefesselt, das hatte ihm nicht gefallen. Er hatte angefangen, zu schreien, weil er diese Art Spiel nicht mochte. Gefesselt zu sein machte ihm Angst. Um nicht aufzufallen, hatte der Bruder ihm den Mund zugehalten.
„Hör auf, ist schon gut. Die Eltern hören uns sonst“, hatte er geflüstert. Er hatte genickt. Sein Bruder ließ dann von ihm ab, forderte ihn stattdessen auf, ihn zu fesseln. Das hatte er getan. Legte ihm das Lasso um den Hals und der Bruder rannte los, als sei er ein Wildpferd. Das Lasso zog sich zu. Er ließ das Seil los. Der Bruder fiel, röchelte, seine Beine fuhren wie irre über den Boden. Der Junge verstand nicht, dass es ein Todeskampf war. Er blieb wie versteinert stehen. Dann hörte er das erlösende Trampeln von Füßen auf der hölzernen Kellertreppe. Seine Eltern. Lautes Schreien. Er wurde angerempelt, beiseitegeschoben. Sein Vater machte einige eilige Schritte auf den Bruder zu, er wurde hochgerissen, das Seil von seinem Hals gezerrt. Seine Mutter schüttelte ihn, schaute ihn verzweifelt, beinahe hasserfüllt an. Doch diese Gefühlsregung verstand er nicht. „Was hast du getan?“, schrie sie, stieß ihn dann beiseite, stürzte auf ihren jüngeren Sohn zu, kniete sich schluchzend neben ihren Mann. Der Vater küsste den Bruder, drückte ihm auf die Brust. Immer wieder. Eine nicht endende Ewigkeit lang. Später kamen fremde Männer mit orangeroten Anzügen. Eilten an ihm vorbei, sprachen laut und später ruhig. Sein Bruder wurde fortgebracht und kam nie wieder.
*
Donnerstag, 22.05.2014
New York City, NY, Vereinigte Staaten
In allen Versuchslaboren auf allen Kontinenten dieser Welt galt ein Gesetz: Das Geschöpf dient dem Leben.
Animal servit vitae.
Dieser Spruch stand auch über dem Haupteingang zu den Forschungslaboren, in denen mehrere Menschenaffen in für ihre Verhältnisse kleinen Käfigen lebten. Tierschutz und Tierwohl waren hier wie dort Fremdwörter. Wenn man davon ausgeht, dass ein Schimpanse in freier Wildbahn ein Gebiet von mehreren Quadratkilometern auf der Suche nach Nahrung durchstreift, waren vier Quadratmeter armselig. Eine Zumutung, eine Qual. Zwei von ihnen hatten das Glück, in einer größeren Behausung leben zu können. Dort gab es eine zweite Ebene, es war ein sehr großer Ast darin aufgestellt, mit dem man vom Boden aus kletternd diese zweite Ebene erreichen konnte. Dort gab es ein Nest aus Blättern, die sich der Affe selber dorthin tragen konnte. So sollte der letzte Rest an selbständigem Handeln simuliert werden. Ein kaum zu ertragender Rest für ein freiheitsliebendes Tier. Diese beiden Affen waren die Protagonisten in einem Experiment. Lange hatte der Forschungsleiter nach diesen Tieren gesucht, bis er in Afrika in einem Tierpark fündig geworden war. Dort wurden Tiere versorgt, die in freier Wildbahn nicht überlebensfähig gewesen wären. Diese beiden Affen zeigten ein Verhalten, dass sie von ihren Artgenossen unterschied und auch für diese als gefährlich darstellten. Sie hatten aus welchem Grund auch immer die Affensprache nie gelernt oder wieder verlernt. So wie es Hunde gab, die isoliert aufgewachsen, den Umgang mit ihren Artgenossen nie gelernt hatten. Sumbo und Big T. waren Außenseiter. Die Wildhüter und Tierpfleger, die mit ihnen umgegangen waren, berichteten, dass diese Affen sich manchmal wie wild gebärdeten, dann wieder minutenlang still und regungslos dasaßen und in eine völlig eigene Welt abgeglitten zu sein schienen. Irgendjemand attestierte ihnen ein fast autistisches Verhalten. Durch den Titel in einer Fachzeitung war der Laborleiter auf sie aufmerksam geworden.
‚The autistic chimps‘ war der Titel des Aufsatzes gewesen, den ein afrikanischer Kollege verfasst hatte. Mit diesem Aufsatz besiegelte er das Schicksal von Sumbo und Big T. Seit November 2012 lebten diese beiden Schimpansen jetzt in New York City. Eine Reihe von Versuchen hatte belegt, dass es tatsächlich so eine Art Autismus war, an dem sie litten. Eine Affenvariante.
Der Leiter der Forschungsgruppe schien vor Freude überzuschäumen, als er die Ergebnisse der Tests vor sich hatte. Kurz drauf bekam er die Erlaubnis, mit seinen Forschungen zu beginnen. Tatsächlich schienen die Medikamente, die man den Tieren verabreichte, eine Art Besserung zu bewirken. Die Wachphasen, die von den Kameras gegenüber den beiden Spezialzellen akribisch aufgezeichnet wurden, schienen sich zu verlängern. Auch schienen die Zeiten, die sich die beiden Affen in ihrer ‚alternativen Welt‘ – so nannten die Forscher ihre Abwesenheitsphasen – bewegten, kürzer zu werden. Sie interagierten mit den Pflegern. Man traute sich sogar, sie stundenweise gemeinsam in einem Käfig zusammenzuführen. Auch hier hatte sich die Kommunikation verbessert. Saßen sie anfangs oft teilnahmslos nebeneinander, ohne Kontakt aufzunehmen, kam jetzt die natürliche Affensprache bei ihnen durch. Als sei sie nur ganz tief unten in ihnen verschüttet gewesen. Die Forscher triumphierten schon in einem bisher nie gekannten Maß. Doch dann folgte ein herber Rückschlag. Sumbo lag morgens tot in seinem Käfig. Man studierte die Videoaufzeichnungen. Zuerst hatte der Affe in seinem Nest auf der zweiten Etage gelegen, schreckte dann mitten in der Nacht, genau um 2 Uhr 34 auf, war mit einem Sprung auf dem Ast, kletterte hinunter, rannte gegen das Gitter, prallte von dort aus zurück. Er blieb einige Sekunden erstaunt sitzen, schaute in Richtung der Kamera, als wüsste er, dass diese dort ist. Dann hielt er plötzlich die rechte Hand vor sein Gesicht, als wolle er aus den Linien in seiner Handfläche die Zukunft lesen. Er fixierte die Hand mit einem irren Blick. Verharrte in dieser Stellung für mehrere Minuten, bis er anfing, sich die Handflächen abzulecken. Erst langsam, dann mit einem lauten schmatzenden Geräusch, als würde er beginnen zu fressen. Kletterte dann langsam den Ast hinauf, setzt sich oben an den Rand der zweiten Etage. Die Kameras zeichneten weiter auf, was nun passierte. Er nahm sich einen Ast aus dem Nest, pflückte die Blätter feinsäuberlich ab. Dann begann er, ihn geschickt mit den Zähnen zu schälen, bis er eine Art Werkzeug gebastelt hatte. Mit nach oben gestülpter Oberlippe betrachtete er sein Werk, gab dabei zufrieden grunzend Laute von sich. Plötzlich durchfuhr Sumbo ein Zucken, er riss die Augen auf und stieß einen markerschütternden Schrei aus, die auch Big T. in seinem benachbarten Käfig aus dem Schlaf riss. Sein Blick verwandelte sich in eine angsterfüllte Fratze. Die Pfleger und Forscher hielten sich die Augen zu, als sie das Video etwa eine Stunde später zu sehen bekamen. Mit dem Werkzeug, hinten breit und vorne spitz zulaufend, stach er sich wieder und wieder in die Brust. Das Blut spritzte aus mehreren Wunden, schon war sein Fell über und über blutig, als er plötzlich innehielt, das Werkzeug, dass von seinem Blut nur triefte, so weit als möglich von sich weghielt. Er stand auf, riss die Augen ein letztes Mal auf, schrie so laut, dass Big T. nebenan verzweifelt gegen die Betonwand trommelte, die die beiden Käfige trennte. Dann rammte er sich den Ast mit einer kräftigen Ausholbewegung in die Brust. Genau dorthin, wo da Herz saß. Die Hand hielt den Ast noch ein paar Sekunden lang umklammert, dann sackte Sumbo in sich zusammen und fiel von der Kante aus wie ein Stein auf den Betonboden. Nebenan schrie Big T.
Die Nekropsie des Menschenaffen ergab, dass er sich bereits durch die ersten Stiche lebensgefährliche Verletzungen zugefügt hatte. Keiner sprach das aus, was dieser Primat getan hatte. Doch allen war klar, Sumbo hatte sich umgebracht.
Jetzt konzentrierte sich alles auf Big T. Die Medikamentengabe wurde eingestellt, diskutiert, geändert, verworfen, neu zusammengestellt und wieder verworfen. Während dieser Unsicherheitsphase innerhalb der Forschergruppe bekam der Schimpanse keine Medikamente, mit dem Resultat, dass er wieder in seine alten Verhaltensweisen zurückfiel. Er interagierte nicht mehr mit den Pflegern, saß apathisch in seinem Nest oder auf dem Ast, fraß schlecht. Am 15. Mai des Jahres begann die neue Medikation. Schnell verbesserte sich der Allgemeinzustand des Affen erneut. Er nahm zu, wurde agiler, zeigte Interesse an Intelligenzspielen, die man ihm in den Käfig stellte. Forscher mit Tablets und Kladden lösten sich vor dem Käfig ab. Alles wurde handschriftlich festgehalten und per Video dokumentiert. Big T. war schnell die neue Hoffnung der amerikanischen Forscher. Hatten sie doch zu Anfang der Versuchsreihe mehr auf Sumbo gesetzt, da er jünger war. Der Schimpanse ließ sich von und mit den Pflegern und Forschern fotografieren, man hätte fast denken können, er würde sich bei den Shootings in Szene setzen, als wäre er ein tierisches Modell.
Bis zu den Geschehnissen in der Nacht auf Donnerstag, den 23.5.2014.
Big T. hatte gefressen, noch ein wenig auf dem großen geschwungenen Ast gesessen und hatte sich dann in sein Nest zurückgezogen. Seit dem Tod von Sumbo waren vierzehn Tage vergangen. Die Forscher hatten ihn beinahe vergessen, doch in dieser Nacht wurden sie an seinen Tod auf eine entsetzliche Art und Weise erinnert. Beflügelt durch den Drang, die Ereignisse innerhalb des Käfigs noch präziser analysieren zu können, hatten sie noch zwei weitere Kameras aufgebaut, die es ermöglichten, den Käfig nun aus mehreren Blickwinkeln zu erfassen. Gegen halb zwei erhob sich der Kopf von Big T. aus dem Blätternest, er lauschte, legte den Kopf schief, als müsse er ein sich anschleichendes Raubtier ausmachen. Langsam krabbelte er ganz hervor, trat an den Baumstamm heran und lief aufrecht auf ihm hinunter, nur auf seinen Hinterbeinen. Unten blieb er stehen, lauschte wieder. In dieser Position verharrte er für ein paar Sekunden. Auf allen Vieren schritt er majestätisch und scheinbar beruhigt zu dem großen Ring aus geflochtenen Lianen herüber, der von der Decke des Käfigs hing und in dem er manchmal entspannt saß. Gab dem Ring einen Schubs und sah ihm beim Schwingen zu. Big T. schien sich zu langweilen. Nichts deutete darauf hin, was eine halbe Minute später geschah. Er wölbte seine Oberlippe vor, begann leise zu grunzen. Das Grunzen verstärkte sich, in seinem Gesicht lief eine Veränderung ab. Plötzlich stürzte er nach vorne, schlug mit der linken Hand nach etwas, dass nur er sehen konnte. Ein warnender Ruf erklang. So schrien Schimpansen, wenn sie etwas attackieren oder attackiert werden. Hoch und schrill, mit verzerrtem Gesicht. Der Affe steigerte seine Aggression gegen seinen nicht vorhandenen Gegner. Blieb dann mit einem Mal stehen, schüttelte den Kopf, warf die Arme um sich, als wolle er einen Schwarm Bienen abwehren. Auch diese Attacke lief nach einer halben Minute ins Leere. Er kehrte zurück zu der Stelle, an der der große Ast den Boden berührte, kletterte wieder, nur auf den Hinterbeinen laufend, hinauf, machte oben kehrt und kam unvermittelt zurück. Diese Bewegung vollführte er mehrmals hintereinander, man hätte denken können, er übe für eine Performance. Beim letzten Hinablaufen sah er sich dabei ständig um, als würde er verfolgt. Fing an zu Kreischen. Wieder verzog sich sein Gesicht zu einer Fratze. Maßlose Panik war in seinen Augen zu sehen. So schnell wie nie zuvor kletterte er den Stamm hinauf, schrie und schlug mit den Armen blindlings nach etwas, dass sein Gehirn ihm in diesem Moment vorgaukelte. Floh vor einem imaginären Feind. Die Forscher konnten später nur erahnen, was der Menschenaffe in seinen letzten Momenten erlebt haben musste. Sich mit gezielten Hieben zur Wehr setzend, blieb er vor seinem Nest stehen. Er schien bereit, sein Refugium mit seinem Leben zu verteidigen. Dann veränderte sich sein Gesichtsausdruck, seine Züge erschienen beinahe staunend. Er kam ins Taumeln, verlor die Balance, als hätte ihn ein mit Gift versehener Pfeil getroffen. Ohne sich abzufangen stürzte er aus vier Metern auf den gekachelten Boden des Käfigs. Big T. war schon tot, bevor er dort aufschlug.
Alle Kollegen starrten am Morgen stumm auf die Monitore, sahen sich immer wieder das Video an. Diesmal aus drei Blickwinkeln, doch die Katastrophe war aus allen Richtungen gleich. Der Affe war tot. Sie warteten auf das Ergebnis der eilig durchgeführten Nekropsie. Schon bevor der Arzt ihnen das Ergebnis mitteilte, war ihnen klar, dass ihre Experimente mit dem Tod des Menschenaffen ein jähes Ende finden würden. Big T. hatte einen Herzinfarkt erlitten, der allem Anschein nach durch eine Panikattacke ausgelöst worden war. Gegen Mittag des 23. Mai wurden die Forschungen an dem neuen Medikament eingestellt, das Forscherteam aufgelöst und weitere Versuche bis auf unbestimmte Zeit vertagt.
*
Mittwoch, 04.02.2015
Bonn
Zu der Zeit, als Oliver Hell seine allabendliche Runde mit Bond am Rhein entlang ging, erwachte auf einer Pritsche in einem muffigen Keller ein Mann. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er in die Dunkelheit. Wuchtete sich mit einem Satz vom Bett. Es gab in dem Kellerloch nichts, was seine besondere Aufmerksamkeit hätte erregen können. In der Ecke neben der Tür war nur das monotone Geräusch des alten Kühlschranks zu hören. Durch die mit fleckigen Decken verhängten staubig blinden Fenster drang kein Licht der gelblich schimmernden Straßenlaternen herein, die um diese Uhrzeit schon seit Stunden ihren Dienst verrichteten. Doch irgendetwas hatte ihn alarmiert. Kein Geräusch. Nichts hatte sich bewegt. Nicht einmal eine Ratte, die ihn schon bisweilen in seiner Bleibe besucht hatte. Trotzdem spürte er eine Veränderung. Etwas passierte. Passiert in ihm. Er stand auf, wankte auf die gegenüberliegende Wand zu und tastete mit der Hand nach dem Lichtschalter über dem Waschbecken. Verengte die Augen zu Schlitzen, weil er wusste, was nun auf ihn zukam. Dann drückte er den Lichtschalter herunter. Die plötzliche Helligkeit schmerzte wie die Hölle in seinen Augen. Er kniff die Lider wieder zusammen. Doch der Schmerz blieb nicht nur, er wurde schlimmer. Der Mann presste seine Handflächen gegen die Schläfen und gab einen unterdrückten Schrei von sich. Schrie in sich hinein, bis die Lunge und sein Zwerchfell schmerzten. Biss die Zähne aufeinander, bis sie ein ungesundes Knirschen erzeugten. Doch je stärker er presste, desto schlimmer wurde der Schmerz. Oder hatte das nichts miteinander zu tun? Er riss die Hände abrupt weg von seinem Kopf, ohne Effekt. Der Schmerz fuhr ihm vom Kopf aus in seinen Nacken, von dort aus über den Rücken bis in die Füße, bis in die Zehen. Jetzt hielt er es nicht mehr aus und begann zu schreien, als würde er bei lebendigem Leib in heißem Teer versenkt. Als könne er sich durch rudernde Bewegungen davor retten, begann er, wie in Panik durch den versifften Raum zu rennen. Stieß gegen den stählernen Lattenrost des Bettes, doch der Schmerz, den er hier punktuell spürte, war nichts im Vergleich zu dem, der seinen ganzen Körper mittlerweile erfüllte. Jetzt fielen alle Dämme, er stieß einen markerschütternden Schrei nach dem anderen aus, taumelte gegen die feuerhemmende Stahltür. Rappelte sich hoch. Schlug mit den Fäusten gegen die Tür. Nichts half. Mit voller Wucht schlug er daraufhin seinen Kopf gegen die Tür. Beim ersten Mal gab es nur eine fürchterliche Beule, doch beim zweiten Versuch platzte die Haut auf seiner Stirn auf, Blut spritzte gegen die Tür und auf den dreckigen Fußboden. Sein Kopf ruckte wie getrieben zurück und schlug erneut mit voller Wucht gegen den Stahl. Wieder und wieder. Bis seine Stirn und seine rechte Augenbraue nur noch ein blutiger Klumpen Fleisch waren. Mit einem letzten Aufbäumen sank er in sich zusammen.
*
Donnerstag, 12.02.2015
Bonn Ippendorf
In einem Kellerzimmer, dem man es nicht ansah, dass es eines war, saß ein Junge auf einem Sessel und spielte mit seinem Lieblingsspielzeug: Einem Windrad aus Plastik. Das tat er jeden Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Sein Name war Jerome. Er war an diesem Tag dreizehn Jahre, sieben Monate und sechs Tage alt. Doch Zeit spielte für ihn keine Rolle. Er war Autist und lebte seit seiner Geburt in diesem Zimmer. Es mangelte ihm an nichts, er bekam dreimal am Tage etwas zu essen, man zog ihn morgens an, brachte ihn abends zu Bett. Dazwischen war er allein, allein in seiner Welt. Diese Welt war luxuriös, doch mit diesem Wort konnte er nichts anfangen, es bedeutete ihm nichts, dass er teure Kleidung trug oder Hummer und Kaviar zu essen bekam. Luxus bedeutete für seine Eltern hingegen alles. Fast so viel, wie ihr Ansehen in der Bonner Gesellschaft. Sie gingen auf angesagte Partys, waren gern gesehene Gäste auf den Bällen und Empfängen der Bonner High Society. Man kannte ihre Gesichter, sah sie in den Zeitungen. Doch das Gesicht ihres Sohnes kannte keiner. Niemand ahnte etwas von seiner Existenz. Nachdem die Ärzte schon früh den Verdacht geäußert hatten, dass mit dem Jungen etwas nicht stimmte, verheimlichten die Eltern die Schwangerschaft. Seine Mutter gebar ihren Sohn in Frankreich, auf einer Studienreise, wie die offizielle Lesart war. Als sich herausstellte, dass er Autist war, steckte man ihn in diesen goldenen Käfig und hielt ihn vor der Welt verborgen. Dreizehn Jahre, sieben Monate und sechs Tage lang.
Jerome kannte keine Sonne, nur UV-Lampen an der Decke. Er kannte keinen Regen, nur das Wasser aus der Dusche in seinem zwanzig Quadratmeter großen Badezimmer. Er kannte keinen Wind und keinen Schnee. Er kannte kein Gras unter seinen Füßen und er wusste nicht, wie es war, am Strand entlang zu laufen.
Jerome kannte auch keine Liebe. Was er kannte, war der stets mürrische Gesichtsausdruck seiner Mutter, wenn sie sich um ihn kümmerte. Ihm die Windeln wechselte oder ihn fütterte. Doch er kannte keine Gefühlsregungen, konnte nicht den Hass in ihrem Gesicht lesen. Er wusste nicht, was es bedeutete, wenn sie ihm zuflüsterte: „Warum stirbst du nicht endlich?“
Er konnte auch nicht ergründen, wieso auf ihrem Gesicht nur ein einziger Gedanke zu lesen war: Wieso gerade ich? Wieso muss ich mit einem autistischen Balg gestraft werden? Das passte nicht in ihr Leben. Passte nicht in die feine Gesellschaft, in der sie und ihr Mann sich bewegten. Das alles verstand Jerome nicht. Er kannte nicht den Unterschied zwischen Leben und Tod. Doch nicht ganz 24 Stunden später sollte er ihn kennenlernen.
*
Bonn
Mitten in dem bodenlosen Ozean, durch den er seit mehreren Wochen trieb, kam plötzlich eine Insel in Sicht. Doch vor der rettenden Insel lauerte die Gefahr. Tödlich. Unbekannt.
Der Mann erwachte aus seinem Traum. Geräusche. Fremd und nicht hierhergehörend. Nüstern blähten sich auf. Gefahr. Urinstinkt. Aus dem Dunkel, der bleiernen Schwärze des Vergessenwollens, tauchte plötzlich eine Gestalt auf. Unbekannt. Bedrohlich. Düster. Der Fremde stand in der Tür, seine Silhouette hob sich kaum gegen das Dunkel des Flurs ab. Etwas blitzte auf. Der Mann saß auf der Pritsche, bereit zum Sprung. Unvermittelt blendete ihn ein grelles Licht, er hielt sich die Hand zum Schutz vor die Augen. Ein metallisches Klicken. Noch nie zuvor real gehört, doch er wusste, was es war. Ohne seinen Gegner zu sehen, spannte er alle Muskeln in seinem Körper an. Ein Sprung. Ein gedämpfter Knall. Zwei Körper stürzten hart auf den Boden. Hände suchten nach Halt. Fanden nur Kleidung. Er rappelte sich auf. Die Lampe, dem Angreifer entglitten, lag auf dem schmutzigen Boden. Staubpartikel wirbelten auf in ihrem Schein. Mit weit aufgerissenen Augen starrte der Fremde hinein. Überrascht sah er aus. Und leblos. Der Mann verstand. Er setzte sich auf die Pritsche und versuchte, seinen fliegenden Atem zu beruhigen. Seine Hand fuhr über den kühlen Rahmen, tastete nach der dünnen rauen Decke. Nahm das klumpige Kissen und presste es gegen seinen Bauch. Er verstand, dass es ihm gegolten hatte. Durch das Adrenalin, das durch seinen Körper pulste, dämmerte die Gewissheit. Man hatte ihn töten wollen. Es konnte ihn jederzeit wieder treffen. Sein Brustkorb hob und senkte sich unter seinen gehetzten Atemzügen, sein Herz schlug dazu einen wilden Akkord. Angetrieben von der Neugier, stürzte er auf den Toten zu. Nahm die Taschenlampe vom Boden auf und leuchtete den Raum ab. Hastig flog der Schein hin und her. Hielt plötzlich inne. Mitten im Leuchtkegel lag sie. Die Versuchung. Die Rettung. Die Möglichkeit, dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Ein Ende, das er bestimmte. Langsam ging er zu der Stelle hinüber und hob die Waffe auf. Schwer und kalt lag der Stahl in seiner Hand. Mit der Klarheit eines eisigen Wintermorgens erkannte er seine Chance. Sie haben es getan. Sie haben mir Albträume und den nahen Tod geschickt. Jetzt werde ich ihr Albtraum sein.
*
Freitag, 13.02.2015
Bonn Ippendorf
Ein ihm nicht vertrauter Hauch strich über Jeromes Gesicht. Er ignorierte ihn, so wie er alles Neue ignorierte. Alles hatte seinen Platz und seine Ordnung. So lebte er. So war er es gewöhnt. Ordnung bedeutete Sicherheit. Ohne dass er es so hätte benennen können. Etwas war heute anders. Langsam machte es den Jungen unsicher. Er hob den Blick und erkannte den Grund für den fremden Geruch und diesen unsicher machenden Luftzug. Dieser kam von der Tür. Diese war nicht wie seit Jahr und Tag verschlossen, sondern sie stand einen Spalt offen. Etwas Neues. Bedrohlich. Jerome nahm sich sein Windrad, drehte es wie immer, versuchte die offene Tür zu ignorieren. Gut eine Stunde lang gelang es ihm, der aufkeimenden Neugier zu begegnen, dann legte er das Windrad beiseite und begann zu wippen. Rieb seinen Zeigefinger an seinem Daumen und lauschte. Keine der Geräusche, die er so liebte kamen durch die Tür, nur ein Luftzug, der nach Neugier und nach etwas Fremdem roch. Jerome stand auf und wagte es, sich der offenen Tür zu nähern, langsam und vorsichtig.
Die Welt hinter der Tür zu seinem Gefängnis war riesig und fremd. Und forderte von ihm alles ab. Allein um durch den Flur im Keller zu gehen, brauchte er eine Stunde. Roch an den Teppichen, strich vorsichtig über die Wände, verharrte regungslos an den Türen, fuhr ängstlich zurück, als er in einem Spiegel einen Fremden entdeckte. Mit weit aufgerissenen Augen starrte ihn der Unbekannte an. Bald hatte er sich entfernt und Jerome beruhigte sich wieder. Hinter einer Glastür nahm er einen blauen Schimmer wahr, der seine Neugier entfachte. Vorsichtig betastete er die Tür, bis er den Zweck der Türklinke erkannt hatte. Diese Tür ließ sich öffnen, anders als die zu seinem Gefängnis, das für ihn bisher sein Zuhause und seine Zuflucht gewesen war. Hinter der Tür lag eine Treppe. Jeromes Muskeln hatten noch nie Treppenstufen erklommen, seine Augen noch nie die Weite eines Wohnzimmers wie das seines Elternhauses gesehen. Fasziniert blieb er stehen und seine sonst so trägen Augen nahmen alles auf, was sich ihnen darbot. Die Sessel aus weichem Leder, die Pflanzen, die Möbel aus Zedernholz.
Reizüberflutung. Einem Autisten soll man eine möglichst reizarme Umgebung bieten, keine Spiegel, keine Glastüren, keine Bilder. Doch jetzt stand Jerome in diesem Raum und sah die Gemälde an den weiß gekalkten Wänden, war fasziniert von deren Farbigkeit. Drehte sich im Kreis, berührte vorsichtig die Blätter einer großen Pflanze, deren Namen er nicht kannte, aber deren Geruch er sich sofort merkte. Vor den schneeweißen Sofas blieb er stehen. So etwas kannte er aus seinem Zimmer. Nur nicht so groß. Langsam ließ er sich nieder, roch an dem weichen Leder und streckte sich darauf aus. Ein Geräusch von außerhalb dieses Zimmers ließ ihn aufschrecken. War er nicht alleine? Kam der Fremde zurück? Der aus dem Keller?
Langsam stand er auf, ging bis an die nächste Tür. Von dort war das Geräusch gekommen. Langsam drückte er die Klinke herunter, öffnete die Glastür einen Spalt und verharrte einen Moment lang. Das Geräusch war verklungen. Er öffnete vorsichtig die Tür und trat in den Hausflur. Außer vielen anderen Türen gab es dort nur ein Ding, an dem andere Dinge hingen. Er ging darauf zu, roch daran und erkannte bei einigen davon den Geruch der Person, die ihn in seinem Zimmer besuchte. Sofort stieß er sie von sich und verzog das Gesicht. Er sah sich um. Eine große Tür erregte seine Aufmerksamkeit. Er ging darauf zu, zögerte, rieb wieder Daumen an Zeigefinger. Begann zu wippen. Ohne es zu wissen, spürte Jerome, dass sich hinter dieser Tür etwas komplett anderes verbarg. Er konnte es riechen. Es roch nach Freiheit, nach Verbotenem, nach Gefahr. Jerome kannte diese Begriffe nicht, doch er spürte, als er die Klinke herunterdrückte einen Geruch, der ihn sofort faszinierte. Draußen. Luft. Gerüche. Nicht das Alltägliche, Gewohnte. Es roch nach Abgasen, nach Schnee in der Luft, unbekannt, verlockend. Und als Jerome vor die Tür trat, verließ er sein altes Leben für immer. Hätte er das gewusst, wie hätte er reagiert? Wäre er weitergegangen? Oder hätte er einen Rückzieher gemacht? Einen Autisten wie ihn konnte man das nicht fragen, auch fehlte ihm die Ausdrucksmöglichkeit. Jerome konnte nicht sprechen, das einzige, was an ihm sprach, waren seine Augen. Die waren in diesem Moment rund und neugierig weit geöffnet, als er mehr taumelnd als zielsicher durch den Vorgarten seines Elternhauses ging. Das Gartentor ließ er offen stehen, wandte sich nach rechts, sein Schritt wurde sicherer, er ging weiter, spürte, wie der kalte Februarwind seinen Körper umspielte. Doch das war ihm gleich. Er kannte keine Kälte. Diese Frische verlieh ihm Energie. Er lief weiter, bereit, bis ans Ende der Welt zu laufen, wenn er nur nicht mehr in diesen Keller zurück musste. Jerome fuhr zusammen, als er wieder dieses Geräusch hörte, dass er bereits auf der Couch gehört hatte. Voller Angst, aber auch neugierig und mit offenstehendem Mund betrachtete er ein Auto, das langsam an ihm vorbeifuhr. Er drehte sich langsam, sah dem Fahrzeug hinterher, dünne Fäden liefen ihm aus dem Mund. Er bemerkte es, wischte sie mit dem Unterarm ab. Jerome ging weiter, bis er ans Ende der Straße gelangte. Bog erneut rechts ab, betrachtete eine große Straßenlaterne, blieb unter ihr stehen, trat einen Schritt zurück, etwas fasste ihn an der Schulter. Jerome fuhr herum, doch da war nichts, außer einer Pflanze. Diese roch anders als die, die er zuvor in dem Haus gesehen hatte. Er beruhigte sich von dem Schreck, der ihm durch alle Glieder gefahren war. Wieder blickte er zu der Straßenlaterne hinauf. Das sanfte gelbe Licht beruhigte ihn. Er ging weiter. Links öffnete sich ein Park. Plötzlich hörte er etwas. Stimmen. Schreie. Jerome fuhr zusammen. Wollte sich verbergen, doch da war nichts. Er blieb stehen und begann zu wippen. Wieder schrie jemand. Dann krachte es ganz in der Nähe. Jerome fuhr zusammen, bückte sich und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Er kauerte sich auf die Wiese, begann leise zu wimmern. Er sah, wie sich ein Schatten über ihn legte.
„Wer bist du denn?“, fragte eine Stimme.
Jerome blieb stumm, wippte, wimmerte vor sich hin.
„Wer bist du und wo kommst du jetzt her, verdammt?“
Jerome blieb der Stimme jede Reaktion schuldig.
„Wer bist du?“ Jerome hörte ein metallisches Klicken. Blinzelte, hob den Kopf. Sah den Fremden an. Nein, es war nicht der, den er im Keller gesehen hatte. Jetzt trat er nahe an Jerome heran, er konnte den Fremden riechen.
„Ach du Scheiße, du bist ja noch eine viel ärmere Sau als ich“, sagte die Stimme mitleidvoll. Steckte etwas weg, nachdem es erneut geklickt hatte. Jerome wimmerte weiter. Die Stimme verschwand. Erst viel später traute er sich aufzustehen, sah sich um. Die fremde Stimme war nicht mehr da. Doch ein paar Meter weiter lag etwas. War er das? Hatte er sich hingelegt? Jerome ging zögernd auf ihn zu, betrachtete den, der da lag. Nein, das war nicht der Fremde. Es gab noch einen anderen hier. Doch der rührte sich nicht. Jerome berührte ihn mit dem Fuß. Nichts. Der Fremde schien zu schlafen. Das kannte er. Schlafen. Das dauerte oft lange. Plötzlich spürte er einen Schlag von hinten und jemand schrie ihn an.
„Was hast du mit meinem Mann gemacht? Was hast du gemacht? Wer bist du? Oh Gott, Ralf, was ist mit dir? Steh doch auf!“
Jerome erschrak so, wie noch nie in seinem Leben. Aus seiner Kehle drang ein Schrei wie von einem Löwen und er schlug um sich, um dieses Wesen zu vertreiben, das dem ähnlich sah, dass immer in seinem Zimmer war. Doch es roch anders. Das Wesen wich zurück und lief schreiend davon. Jerome setzte sich und begann aufgeregt zu wippen.
*
Bonn Oberkassel
Gegen 21 Uhr klingelte Oliver Hells Handy. Für einen Moment spielte er mit dem Gedanken, den Anruf nicht anzunehmen, hatte er es sich doch mit einem Glas Wein auf der Couch gemütlich gemacht. Ein Blick auf das Display verriet ihm den Anrufer und damit auch die Dringlichkeit.
„Hell. Wer stört?“, fragte er scherzhaft.
„Sorry, Chef“, entschuldigte sich Jan-Phillip Wendt, sein Stellvertreter, „wir haben hier in Ippendorf einen Toten.“
„Braucht ihr mich dann unbedingt, wenn du schon vor Ort bist?“, fragte Hell und versuchte, eine klitzekleine Chance auf den hervorragenden Bordeaux zu wahren. Wendt brummte etwas, dass Hell nicht verstand. „Wir haben einen Zeugen … oder besser gesagt, wir haben in der Nähe des Mordopfers jemanden aufgefunden … aber das schauen Sie sich besser selber an, Chef“, antwortete er dann doch noch in einem ganzen Satz. Nachdem ihm Wendt die Adresse durchgegeben hatte, verschloss Hell den Bordeaux mit einem bedauernden Seufzen und machte sich auf nach Bonn-Ippendorf. Hoffentlich gibt es nicht wieder Ärger mit irgendwelchen Drogenbanden, wünschte er sich. Mit den seltsamen Andeutungen seines Kollegen konnte er nicht viel anfangen.
*
Bonn Ippendorf
Das erste, was Hell hörte, als er seinen BMW in der Straße mit den gepflegten Vorgärten abgestellt hatte, waren die gellenden Schreie einer Frau, sie gingen ihm durch Mark und Bein. Als er näherkam, meinte er noch eine weitere Stimme zu hören, diese klang aber nicht menschlich in seinen Ohren. So dachte er, als er ein großes Gehölz umrundete, das am Rande eines kleinen Parks stand. Wendt hatte ihm den Fundort genau beschrieben. Mitten in dem Park, hatte er gesagt. Sofort sah er die immer noch schreiende Frau. Eine Beamtin der Bereitschaftspolizei versuchte vergeblich, sie zu beruhigen. Nein, sie wollte sie davon abhalten, dort in die Mitte des Parks zu laufen. Dorthin, wo weitere Beamte um zwei auf dem Boden liegende und kauernde Personen standen. Auch Wendt machte Hell dort aus. Der Kollege stand etwas abseits und Hell fand, dass er einen ratlosen Eindruck auf ihn machte. Hell versuchte, zu ergründen, was dort passierte. Auf dem Rasen lag ein Mensch auf dem Rücken, daneben kauerte die zweite Person, wippte mit dem Oberkörper rhythmisch vor und zurück. Dabei stieß er immer wieder diese Laute aus. Diese Laute, die Hell als nicht menschlich eingeschätzt hatte. Doch sie waren es, wenn auch nicht im eigentlichen Sinne. Aus der Kehle des Mannes, als solcher war er trotz der Dunkelheit zu erkennen, drangen Laute, die einem Löwengebrüll nicht unähnlich waren. Was ging hier vor? Einer der Beamten machte einen Schritt auf den Mann zu. Sofort erklang wieder dieser kehlige gutturale Schrei, der Mann schlug mit seiner Hand zu wie mit einer Pranke. Der Beamte wich zurück. Hells Neugier brachte ihn dazu, seinen Beobachtungsposten aufzugeben und auf die Gruppe zuzugehen. Wendt war sichtlich erleichtert, als er seinen Vorgesetzten erkannte. Sofort kam er auf Hell zu. Der empfing ihn sofort mit Fragen. „Was um Himmels Willen geht hier denn ab? Wer ist das?“, fragte Hell und deutete auf die Gestalt, die jetzt wieder wippend auf dem Boden kauerte. Wendt winkte frustriert ab. „Keine Ahnung, das ist ja der Grund, warum ich Sie hier haben wollte. Er lässt uns nicht an den Toten heran!“
„Und die Frau?“
„Ist die Ehefrau des Opfers“, erläuterte Wendt, „sie hatte ihren Mann dort liegen sehen … ich muss noch anfügen, dass sie direkt dort drüben wohnen … und dann kam dieser junge Mann und hat sie bedroht.“
„Inwiefern?“, fragte Hell und trat einen Schritt näher an die Kollegen heran, blieb aber hinter deren breiten Schultern verborgen. Er betrachtete den Mann. Dieser schien noch ein Kind zu sein, vielleicht sechzehn oder siebzehn Jahre alt. Er trug von der Erde verschmutzte helle Stoffhosen, ein Poloshirt und, was Hell besonders wunderte, Pantoffel. „Gibt es eine Meldung über einen Ausbruch aus einer Geschlossenen?“, fragte er Wendt.
„Haben die Kollegen schon abgefragt, nichts!“
„Der junge Mann trägt teure Kleidung, das Shirt scheint von Lacoste zu sein, ich meine, das Krokodil gesehen zu haben … und Pantoffel! Das sagt mir doch, dass er nicht allzu weit weg von hier wohnen dürfte. Wir müssen die Nachbarschaft befragen. Kannst du das bitte organisieren?“
Wendt nickte.
„Denkst du, er hat den Mann umgebracht?“
„Schwer zu sagen, ohne das Opfer genauer in Augenschein nehmen zu können“, antwortete Wendt.
„Wir müssen den Jungen ruhigstellen, damit die KTU und die Gerichtsmedizin ihre Arbeit aufnehmen können. Sind die informiert?“
Wendt nickte. „Beisiegel war not amused“, sagte er augenzwinkernd.
„Denke ich mir“, gab Hell zurück. Er wusste, dass seine Kollegin von der Gerichtsmedizin in diesen Tagen in Sachen Karneval unterwegs war.
„Bevor Stephanie loslegen kann, müssen wir die Nachbarschaft befragen. Ein solcher Junge muss doch bekannt sein wie ein bunter Hund, gerade in dieser Wohnlage hier“, sagte Hell hoffnungsvoll. Wendt verzog sein Gesicht zu einem gequälten Lächeln. „Soll das heißen: Alarmier die Kollegen oder sollen wir das denen dort überlassen?“, fragte er mit einem Kopfnicken in Richtung der Bereitschaftspolizisten. Hell stieß die Luft aus. „Sieh zu, bei wem du dich unbeliebt machst“, sagte Hell und ging in Richtung der Ehefrau los. Diese hatte sich etwas beruhigt, starrte aber wie gebannt in seine Richtung. Bevor er sie ansprach, atmete er zweimal durch.
*
Mit verheulten Augen und schluchzend konnte ihm die Ehefrau ihren und den Namen ihres Mannes nennen. Sie hießen Birgit und Ralf Jünemann.
„Wer ist dieses Tier? Hat er meinen Mann umgebracht?“, stieß sie hervor, aus ihren Augen sprachen Verzweiflung und Wut.
„Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Kennen Sie den jungen Mann? Er trägt Pantoffel, das lässt den Schluss zu, dass er hier in der Nähe lebt.“
„Nein, ich habe den noch nie gesehen! Wann holen Sie ihn endlich von meinem Mann weg? Oh Gott, was geschieht hier bloß gerade mit uns?“
Hell hatte Verständnis für ihre Verzweiflung und keine Antwort auf ihre Fragen.
„Wir müssen herausfinden, wer er ist. Zuvor können wir nichts tun“, antwortete Hell schmallippig. Die Frau schleuderte ihm ihr Unverständnis entgegen. „Das ist armselig! Was nützen Ihnen denn ihre Waffen, wenn Sie sie nicht einsetzen dürfen?“, fragte sie entrüstet und wandte sich erneut gegen den Griff der Polizistin. Hell gab der Kollegin den Wink, die Frau ins Haus zu bringen. „Besorgen Sie ihr einen Arzt“, versuchte er beruhigend zu klingen. Die Frau wehrte sich weiter aus Leibeskräften, erst mithilfe einer weiteren Kollegin konnten sie die Verzweifelte ins Haus bringen. Hell sah ihnen nachdenklich nach. In der Einfahrt standen zwei Fahrzeuge. Ein SUV und eine Limousine. Geldsorgen hatte diese Familie offensichtlich nicht. Trotzdem gab es einen mörderischen Bruch in ihrem Leben an diesem Tag.
Wo mochte wohl das Motiv für diesen Mord liegen? Und wer zur Hölle war dieser Junge? Warum trug er Markenkleidung und konnte kein Wort sprechen? Hell fuhr sich nachdenklich mit der Hand über das Gesicht und traf einen Entschluss.
*
„Ich werde etwas ausprobieren“, raunte er den Beamten und Wendt zu. Langsam näherte er sich dem Toten, setzte sich dem Jungen gegenüber. Der Tote lag zwischen ihnen. Er vermied es dabei, den Jungen direkt anzuschauen. Bloß nicht bedrohlich wirken, dachte er. Sein Gegenüber schien ihn nicht zu bemerken, daher riskierte Hell einen Blick in das kindlich unschuldige Gesicht. Ebenfalls erkannte er das Logo der französischen Sportmarke jetzt genau. Der Junge hörte für einen Moment auf zu wippen, dann setzte er die Bewegung fort, sah Hell mit einem teilnahmslosen Blick an, der durch ihn hindurch zu gehen schien. Hell schoss der Begriff Autist durch den Kopf, obwohl er von diesem Krankheitsbild keine Ahnung hatte. Er kannte nur das, was man in den Nachrichtenmagazinen wie Spiegel oder Focus darüber lesen konnte. Doch nichts hatte sich festgesetzt, außer dem Begriff selber und der Tatsache, dass Autisten in einer eigenen Welt lebten.
Was soll ich jetzt machen? Gebe ich mich gerade der Lächerlichkeit preis, weil ich untätig vor einer Leiche sitze und einen Jungen anstarre, dessen Blick durch mich hindurchgeht? Er spürte, wie dieser Blick und das stetige Wippen ihn langsam nervös machte. Teilnahmslos betrachtete ihn der Junge. Ohne es zu bemerken fuhr Hells Hand in die Sakkotasche und holte den Autoschlüssel hervor. Er ließ den Schlüssel durch die Hand gleiten, plötzlich stoppte der Junge sein Wippen. Kaum merklich veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Hell registrierte es dennoch. Er hielt den Schlüssel so in der Hand, dass der Junge ihn sehen konnte, bewegte den Arm von links nach rechts vor seinem Körper. Der Blick seines Kontrahenten folgte ihm.
„Möchtest du ihn haben? Komm, hol ihn dir!“, forderte Hell ihn auf, sich dessen bewusst, dass er höchstwahrscheinlich gar nicht verstand, was er da sagte. Er umfasste den Schlüsselanhänger und ließ den elektronischen Schlüssel kreisen. Sofort stoppte wieder das Wippen. Der Blick wurde fast klar, der Junge sprang auf, doch blieb er unschlüssig stehen, starrte auf den sich drehenden Schlüssel. Sofort wollten sich die Beamten auf ihn stürzen, doch Hell hob die Hand. „Zurückbleiben!“, rief er, sah, wie der Junge sich langsam näherte, den Blick auf Hells Hand gerichtet. Der Schlüssel kreiste in seiner Hand. Hell ging ein paar Schritte rückwärts. Wenn der junge Mann den Schlüssel haben wollte, musste er ihm folgen. Plötzlich fuhr aus dem Mund des Jungen ein Laut des Entzückens, er griff nach dem Schlüssel, Hell ließ ihn gewähren und mit einer großen Geschicklichkeit ahmte er die Bewegung nach, die Hell ihm vorgemacht hatte. In dessen Augen war plötzlich so etwas wie Zufriedenheit zu sehen. Ohne dass er Gewalt angewendet hatte, war es Hell gelungen, den Jungen von dem Toten wegzulocken. Mit einer irre schnellen Bewegung drehte der Junge den Schlüssel in der Hand, der Tote auf dem Boden hatte sein Interesse verloren. Wendt trat neben Hell. „Woher wussten Sie …?“, fragte er verblüfft. „Ich wusste gar nichts! War nur nervös, weil der mich so angestarrt hat!“
„Ach ja?“, fragte Wendt und es schien, als glaube er Hell kein Wort.
„Wo sind die anderen?“, fragte Hell jetzt unwirsch.
„Unterwegs“, antwortete Wendt knapp.
„Haben Sie keine Angst um Ihren Schlüssel?“
Hell fuhr sich mit der Hand über den Mund, musterte Wendt.
„Was denkst du? Er steigt jetzt in meinem BMW und fährt davon? Streckt uns noch den Mittelfinger aus dem Fenster entgegen und gibt Gas? Blödsinn! Sieh zu, dass eine Psychologin angefordert wird. Wo bleibt eigentlich Stephanie? Mensch, dieser Karneval bringt alles durcheinander!“ Noch etwas Unverständliches murmelnd, ließ er Wendt stehen, widmete sich wieder dem Jungen. Doch der war bereits wieder in einer anderen Welt. Mit leicht wippendem Oberkörper und diesem sich wild drehenden Schlüssel schien er glücklich zu sein. Wie auf Kommando begann er eine Melodie zu brummen. Hell fuhr zusammen, erschauderte. Was der Junge dort mit tiefem Bass intonierte, war der Walkürenritt aus dem Ring der Nibelungen von Richard Wagner.
*
Hätte Hell seinen Autoschlüssel greifbar gehabt, so wäre er sofort nachhause gefahren, um Bond zu holen. Der ehemalige Polizeihund, der seit ein paar Monaten bei ihm lebte, hätte sofort die Spur des Jungen aufgenommen, hätte sein Zuhause gefunden. Doch die Tatsache, dass dieser Junge weiterhin mit dem Schlüssel spielte und die Zweifel daran, dass diese von Bond aufgespürte Fährte ermittlungstechnisch verwertbar war, ließ ihn den Dienstweg nehmen: Er orderte einen Suchhund an.
Mittlerweile waren Lea Rosin und Sebastian Klauk auch eingetroffen. In getrennten Fahrzeugen, aber zeitlich so nah aufeinander, dass jeder ahnen konnte, dass sie zusammen vom gleichen Ort losgefahren waren. In Hells Team war es bekannt, die beiden waren seit ein paar Monaten ein Paar. Doch nach außen drang bislang kein Wort. Sie wollten es nicht riskieren, aufzufallen. Partnerschaften innerhalb eines Dezernates oder eines Teams wurden nicht gerne gesehen. Über kurz oder lang würde man einem von ihnen nahelegen, die Dienststelle zu wechseln. Selbst Brigitta Hansen, die Oberstaatsanwältin, war bisher nicht eingeweiht. Vielleicht auch nur, um sie vor ihrer Chefin, der Bonner Polizeichefin Britta Keller-Schmitz, nicht in Verlegenheit zu bringen. Früher oder später würde ihre Liebesgeschichte aber ans Licht kommen. Doch bis dahin sollten alle dichthalten. Also gab es auch keine flapsigen Bemerkungen von Wendts Seite, als sie eintrafen.
„Würdet ihr euch bitte darum kümmern, das Elternhaus dieses Jungen ausfindig zu machen“, ordnete Hell an, „ich schicke auch ein Bild auf die Handys. Vielleicht seid ihr ja erfolgreich, bevor der Suchhund eintrifft.“ Sofort machten sie sich auf den Weg. Noch war Hell davon überzeugt, dass man diese Polizeiübung schnell hinter sich bringen würde. Ebenso war er überzeugt, dass dieser Junge kein Mörder war. Doch das sollte die KTU und die Rechtsmedizin ergründen. Als die Gerichtsmedizinerin Doktor Stephanie Beisiegel endlich eintraf, musste er herzlich lachen. Sie trug noch ein Karnevalskostüm, das ihr ausgezeichnet stand. „Du siehst ja zum Anbeißen aus, Stephanie“, sagte Hell, mit einem Blick auf die glänzenden Schuppen ihres Meerjungfrauen-Kostüms.
„Witzig, Oliver, echt witzig. Ich lade dich als Büttenredner zur nächsten Session ein“, entgegnete sie ihm genervt.
„Danke, gerne!“
„Wann kommt die KTU? Ich möchte so schnell wie möglich wieder zurück auf die Veranstaltung“, sagte sie, beugte sich neben den Toten, öffnete ihren Tatortkoffer und streifte sich einen Overall über. „Was haben wir hier?“, fragte sie, streifte sich den rechten Handschuh über. „Der Tote wurde bis vor kurzem von diesem jungen Mann bewacht, aber den haben wir jetzt beruhigt“, begann Hell jetzt ernst zu werden. Beisiegel sah zu dem Angesprochenen hinüber.
„Bewacht? Ist er tatverdächtig?“
„Sag du es mir, er spricht kein Wort. Spielt seit einer Viertelstunde mit meinem Autoschlüssel, dreht ihn in seiner Hand.“
„Autist?“
„Bin ich Arzt oder Psychologe?“
„Nein, nur ein nerviger Kriminalbeamter, der jetzt im Weg steht“, antwortete sie und schob Hell beiseite.
„Was mit ihm hier passierte, ist nicht so schwierig zu entschlüsseln“, antwortete Beisiegel nach kurzer Zeit, „er wurde erschossen, ich würde sagen, mit einer 9mm-Waffe, aus kurzer Distanz, das verrät mir die Schmauchspur.“
Die Medizinerin suchte seinen Blick.
„Wann?“
„Nicht länger als vor einer Stunde, vielleicht auch anderthalb.“
„Wurde er hier getötet?“
„Du kennst doch meinen Standardspruch: Nichts Genaues vor der Obduktion!“
„Du willst doch zurück zur Karnevalsveranstaltung, wann kann ich mit einem Ergebnis rechnen?“
Beisiegel brummte ihre Antwort. „Davon habe ich mich eben verabschiedet. Wenn die KTU durch ist, fange ich in der Rechtsmedizin an.“
„Im Meerjungfrauenkostüm?“, konnte Hell sich nicht verkneifen, musste sich dann aber vor dem nach ihm geworfenen Untersuchungshandschuh wegducken.
„Mach dich nur lustig, du Spaßbremse!“
„Wenn du etwas herausfindest, das uns schnell zum Täter führt, kommt die Spaßbremse mit dir auf den Bonner Rosenmontagszug!“
Beisiegel rollte mit den Augen. „Ob das ein Anreiz ist, weiß ich nicht!“
„Haha!“, sagte Hell und ließ Beisiegel ihre Arbeit weiterführen.
*
Lea Rosin hatte sich auf einen gemeinsamen Abend zusammen mit Sebastian Klauk gefreut. Doch dann klingelten nacheinander ihre Handys, als Wendt sie anrief. Wohl oder übel mussten sie ihren gemütlichen Abend abbrechen. In den ersten vier Häusern in dem Bonner Nobelvorort, in dem hauptsächlich Ärzte und Klinikpersonal aus den nahegelegen Venusberg-Kliniken wohnten, war niemand daheim oder ging trotzdem man von der Straße aus Licht brennen sah, keiner an die Tür. Das Vorhandensein von Polizei in der Straße wurde beinahe als Affront angesehen. Hier passierte kein Verbrechen. Hier wohnte nur die Elite Bonns. Setzte man sich mit dem Verbrechen nicht auseinander, so blieb alles beim Alten. Verdrängungsmodus. Jetzt stand sie mit übler Laune vor einem modernen Haus, ohne jegliche Lust, die dazugehörigen Bewohner kennenzulernen. Auf dem Klingelschild stand Prof. Dr. Benjamin Strotz. Rosin vergewisserte sich, ob hinter den großen Fenstern des ausladenden Wohnzimmers noch Licht zu sehen war. Sie schien Glück zu haben, je nachdem, wie man es sehen wollte. Kurz nachdem sie auf die Klingel gedrückt hatte, reckte sie ihr Gesicht in das Objektiv der Kamera, die sich hinter der kleinen runden Glaskuppel verbarg. Ein Summen erklang, dann eine männliche Stimme. „Ja, wer stört um diese Zeit?“, fragte die Stimme verärgert.
„Entschuldigen Sie bitte die späte Störung, mein Name ist Lea Rosin von der Kriminalpolizei Bonn, ich habe eine wichtige Frage an Sie, haben Sie einen Moment Zeit für mich?“
„Worum geht es?“
„Wir haben in der Nachbarschaft einen hilflosen jungen Mann aufgefunden und wir nehmen an, dass er hier aus der Siedlung stammt. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie sich ein Foto auf meinem Handy ansehen würden“, fragte Rosin an.
„Wir haben keinen Sohn“, antwortete die Stimme energisch.
„Würden Sie sich trotzdem bitte dieses Bild ansehen? Wir müssen das Zuhause des Jungen finden. Er braucht Hilfe“, appellierte Rosin an sein Verständnis. „Interessiert mich nicht, gehen Sie bitte. Wir wollen jetzt zu Bett gehen.“
Ein Klicken sagte Rosin, dass dieses Gespräch beendet war.
Wieso habe ich das genau so erwartet, fragte sich Rosin. Und ging ein Haus weiter.
*
Drinnen, dort, wo Professor Strotz noch immer an der Gegensprechanlage stand, trat jetzt seine Ehefrau neben ihn. „Wir müssen etwas unternehmen, Jerome darf nicht bei der Polizei befragt werden“, sagte sie kalt. Ihr Mann sah sie verständnislos an. „Und was bitte soll ich tun? Hingehen und ihnen sagen: „Das ist unser Sohn, wir haben ihn dreizehn Jahre lang gefangen gehalten?“, fragte Benjamin Strotz scharf zurück.
„Du sollst nicht die Nerven verlieren, Benni. Wir müssen die Kontrolle behalten, sonst entgleitet uns die Situation. Willst du der Grund dafür sein, dass unser Leben außer Kontrolle gerät?“
Benjamin Strotz wandte sich ab. „Nein, natürlich nicht. Aber keiner weiß von Jerome. Und er kann ihnen nicht sagen, wo er wohnt. Er war heute das erste Mal in seinem Leben vor der Tür. Kannst du dir vorstellen, was das für ihn bedeutet?“
„Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber es interessiert mich nicht. Das ist unsere Chance, ihn loszuwerden. Hörst du, Benni! Keine Schuldgefühle mehr, keine Verpflichtung mehr für diesen Sohn, den wir nie haben wollten. Das ist es, was mir im Kopf herumgeht.“
Benjamin Strotz starrte seine Frau Isabelle an. „Das ist nicht dein Ernst, wie kannst du so etwas sagen?“
Sie trat nah an ihn heran. „Doch, genau das ist mein Ernst, Benni. Endlich frei sein! Endlich dieses Geschöpf nicht mehr im Keller wissen, ihn nicht mehr pampern, nicht mehr füttern, nicht mehr in sein gefühlskaltes Gesicht schauen müssen. Das wäre für mich wie eine Neugeburt. Du hast mit dieser nervenaufreibenden täglichen Arbeit nicht viel zu tun. Du gehst tagtäglich in die Klinik, ich habe die Arbeit daheim gehabt. Und nun haben wir die Chance, das zu ändern!“
Benjamin Strotz konnte nicht verstehen, was er da hörte. Ihm kam ein fürchterlicher Gedanke. Doch dieser war zu schrecklich, als das er ihn hätte aussprechen können. Daher ließ er es sein und seine Frau Isabelle im Flur stehen.
*
„Wir haben nur die Spuren des jungen Mannes hier auffinden können“, sagte Dennis Seib, einer der Bonner Kriminaltechniker zu Oliver Hell. „Was bedeutet das?“, fragte Wendt irritiert.
„Wir haben keine weiteren Spuren gefunden“, antwortete Seib erneut, „außer an der Stelle, die wir um den Toten herum untersucht haben, gibt es keine verwertbaren Fußspuren, keine Trittspuren von nackten Füßen oder Vergleichbares. Wir können nicht sagen, wie das Opfer hierhergekommen ist. Die Spuren des jungen Mannes können wir bis an das Ende des Parks verfolgen, aber darüber hinaus hat ebenfalls der Hund die Fährte verloren. Wieso es dazu kommen kann, weiß ich auch nicht, da fragen Sie besser den Hundeführer.“
„Danke, Dennis. Das wird er uns sicher selber erläutern können“, antwortete Wendt und gesellte sich zu Hell, Klauk und Rosin.
„Mysteriöser Zeuge, mysteriöser Tathergang und mysteriöse Spurenlage ergeben zusammen einen mysteriösen Fall“, fasste Hell die Ergebnisse der letzten Stunde zusammen. „Dazu kommen noch unfreundliche Bewohner in den angrenzenden Straßen“, ergänzte Rosin, Klauk pflichtete ihr bei, „Von denen hat keiner etwas gehört, keiner kennt einen Behinderten, der hier in der Nachbarschaft wohnt.“
„Vielleicht sind wir ja auch auf der falschen Fährte“, dachte Hell laut nach, „was wäre, wenn das Opfer in Begleitung des Täters gewesen ist, und dieser junge Mann überhaupt nichts mit ihnen zu tun hat. Wenn er einfach dazugekommen ist, oder erst später das Opfer aufgefunden hat?“
„Aber dann hätte die KTU doch Spuren einer weiteren Person auffinden müssen, die Blutspuren lassen doch eindeutig darauf schließen, dass Herr Jünemann hier an Ort und Stelle erschossen wurde“, warf Wendt ein.
„Und keiner hat einen Schuss gehört, mal wieder typisch.“
„Kennst du doch schon, Sebi, mittlerweile haben die Leute doch alle Schiss, eine Aussage zu machen. Aus Angst davor, dass sie die Rache des Täters zu spüren bekommen“, erläuterte ihm Rosin. Klauk rollte mit den Augen.
„Wenn keiner einen Schuss gehört hat, dann wurde vielleicht ein Schalldämpfer benutzt. Was anderes fällt mir nicht ein“, sagte Wendt.
„Wir müssen darauf warten, was die Ehefrau morgen früh aussagt. Sie kommt um 10 Uhr ins Präsidium. Eine Freundin bleibt über Nacht bei ihr“, sagte Hell mit besorgtem Unterton.
„Was passiert mit dem Jungen?“
„Er bleibt über Nacht in der Psychiatrie. Sie haben ihm ein Beruhigungsmittel gespritzt, damit man ihn überhaupt transportieren konnte. Morgen werden wir einen öffentlichen Aufruf starten, dann finden wir hoffentlich schnell heraus, wohin er gehört“, sagte Hell mitfühlend. Kurze Zeit später löste sich die Runde der Ermittler auf.
*
Gegen 23 Uhr kehrte wieder Ruhe in der kleinen Nebenstraße ein. Nur ein Mann mit einem Hund kehrte eine halbe Stunde später in den Park zurück, hielt seinem Hund einen Gegenstand hin und gab ihm einen kurzen Befehl. Der Hund startete sofort konzentriert seine Suche, so wie er es gelernt hatte. Er schnüffelte im Kreuzgang mal hier, mal da, erreichte den Rand des Parks, von dort aus wurden seine Bewegungen beliebiger, er blieb kurze Zeit später stehen, signalisierte seinem Herrchen dadurch, dass er keine Spur mehr verfolgen konnte. Oliver Hell kehrte enttäuscht zu seinem Fahrzeug zurück, nicht ohne Bond vorher ausgiebig zu loben. Schließlich konnte der Hund nichts dafür, wo nichts zu erschnüffeln war, konnte der beste Suchhund nichts finden.
*
Irgendwo in Bonn
Fünf Kugeln nacheinander schlugen in der Brust von Ralf Jünemann ein. Fast das ganze Magazin. Doch der Arzt lächelte ihn nur an, stand da, als sei mit ihm nichts passiert. Er breitete die Arme aus, schien auf etwas zu warten. Es begann der Reihe nach. Erst rieselte das Blut aus dem ersten Einschussloch, dann verstärkte sich das Rinnsal zu einem steten Lauf. Eine Wunde nach der nächsten öffnete ihre Schleusen. Das Blut lief wie bei einer Quelle aus allen Einschusslöchern, floss auf seine Füße, vereinigte sich vor ihm zu einem See aus Lebenssaft. Jünemann senkte den Blick, hob ungläubig dreinblickend die teuren Slipper an, schien darüber erbost zu sein, dass sie jetzt mit seinem Blut besudelt waren.
„Da musst du schon ein bisschen besser zielen, wenn du mich umbringen willst, du Versager!“, spottete der Arzt. Der Schütze fühlte sich elend, hob die Waffe und schoss erneut. Diesmal in den Kopf des Arztes. Jünemann gesamter Oberkörper wuchtete sich durch den Einschlag zurück, unnatürlich weit. Dann bog er sich langsam wieder nach vorne. Dort, wo zuvor die Nase gesessen hatte, klaffte ein riesiges Loch. Dennoch riss er den Mund auf und lachte. „Du armseliger Wicht! Mehr hast du nicht drauf?“
Plötzlich fühlte er eine Berührung an der Schulter, fuhr entsetzt herum. Dort stand der Junge, den er in dem Park gesehen hatte, nach dem Mord. Er hielt seinen Kopf gesenkt, so wie er es auch dort getan hatte. Die Hand des Jungen lag auf seiner Schulter. Langsam hob er den Kopf, sah ihn mit einem diabolischen Grinsen an.
„So wird das nichts“, sagte er ganz ruhig, griff nach der Waffe. Der Mann wehrte sich nicht dagegen. Der Junge hob den Arm, zielte auf den Arzt, der nach wie vor aus allen Einschusslöchern blutete. Erstaunt hob Jünemann die Augenbrauen, er öffnete den Mund, als wollte er auch den Jungen verspotten. Die Waffe bellte auf, das Krachen echote durch die Nacht. Langsam, wie in Super-Zeitlupe, flog die Kugel auf den Schädel des Arztes zu. Er sah sie auf sich zukommen, hätte Zeit gehabt, dem Projektil auszuweichen. Doch er blieb stehen. Die Kugel näherte sich weiter; Jünemanns Augen fuhren an der Nasenwurzel zusammen, kurz bevor seine Stirn getroffen wurde. Über dem bereits klaffenden Loch in seinem Gesicht drang das Projektil ein. Was dann geschah, ließ den Mann vor Schreck zusammenfahren. Der Einschlag war so heftig, der Schädel wurde regelrecht zerrissen, dann der Brustkorb, gefolgt von seinem restlichen Körper. Fleischfetzen und Knochen flogen an dem Mann vorbei, klatschten gegen sein Gesicht. Hinter ihm stieß der Junge ein heiseres Lachen aus. „Siehst du, so wird das gemacht!“, rief er und der Hall der Worte setzte sich vielfach durch die Nacht fort.
Der Mann fuhr hoch in seinem Kellerloch. Sein Herz trommelte mit harten Schlägen gegen seine Brust, er atmete stoßweise. Ein Albtraum, wie er in der letzten Zeit schon so viele gehabt hatte. Doch dieser blieb speziell. Der Mord. Der Nachhall dieses Erlebnisses blieb noch Stunden in seinem Kopf haften.
*
Samstag, 14.02.2015
Bonn, Präsidium, Königswinterer Straße 500
Wie er es schon seit Monaten gewohnt war, ringelte sich Bond schmatzend neben Hells Schreibtisch in sein Körbchen. Die frühe kühle Gassirunde bei Morgennebel entlang des Rheins hatte er ebenso gut überstanden wie sein Herrchen. Doch Oliver Hell blickte sorgenvoller in den Tag als sein zufriedener Hund. Dieser Mordfall, der genau in die heiße Phase des Bonner Karnevals fiel, und dazu noch die Gedanken an den Jungen, der ihm unendlich leid tat, setzten ihm zu. Wie sehr er es auch von allen Seiten durchdachte, er kam zu keinem Schluss. Wie kam ein junger autistischer Mann in diesen Park? Dazu noch in Pantoffeln. Ebenso konnte er nicht verstehen, dass ihn niemand vermisste. Bond blinzelte einmal, als Hell aufstand, um die Glastafeln mit den Tatortfotos zu bestücken. Auf der einen Seite die Bilder des Opfers, auf der anderen Seite das Bild des verängstigt dreinblickenden Jungen. Unter dem Bild von Ralf Jünemann notierte er, was sie bisher ermittelt hatten: Arzt, 39 Jahre alt, verheiratet, keine Kinder, polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten. Das war‘s. Trotzdem hatte er jemanden so in Rage versetzt, dass er ihm eine Kugel ins Herz geschossen hatte. Wie immer stand die Kardinalfrage im Raum: Wieso? Ein Raubmord kam nicht in Frage. Der Tote trug noch sein Portemonnaie bei sich. Wenn er nicht irgendwelche anderen wichtigen Dokumente bei sich getragen hatte, von denen seine Ehefrau keine Kenntnis hatte, dann konnte man dieses ausschließen. Die Befragung der Kollegen und die weitere Befragung der Ehefrau würden darüber Aufschluss bringen. Und er wurde in unmittelbarer Nähe zu seiner Wohnung getötet. Das legte den Schluss nahe, dass man ihm aufgelauert hatte. Der oder die Täter kannten seinen Wohnsitz. Die Ehefrau hatte ausgesagt, dass sie das Auto ihres Mannes gehört hatte, sich aber dann gewundert habe, dass er auch nach mehreren Minuten noch nicht das Haus betreten hatte. Hell blickte ungeduldig auf seine Armbanduhr. Es war gerade fünf Minuten nach sieben. Mit einem frisch aufgebrühten Kaffee setzte er sich zurück an den Schreibtisch und las erneut den Obduktionsbericht von Stephanie Beisiegel. ‚Hoffentlich bleiben uns weitere Karnevalsleichen erspart‘, hatte sie auf ein gelbes Post It geschrieben. Hell musste lächeln, als er an ihr Kostüm dachte, mit dem sie am Tatort aufgetaucht war. Eine blau geschminkte, mit streng zurückgegelten Haaren versehene Meerjungfrau, die sich dann den weißen Overall der Rechtsmedizin überzog – irgendwie sehr skurril. Er konnte froh sein, jetzt schon die Ergebnisse der Leichenschau auf dem Tisch zu haben und zweifelte daran, dass dies in der Nachbarstadt Köln ebenso abgelaufen wäre. Dafür war er seiner Freundin dankbar. Je schneller sie zu einem Ermittlungsergebnis kamen, desto besser standen die Chancen diesen Mord in den tollen Tagen aufzuklären, an denen im Rheinland so gut wie alles stillstand. Das Klingeln des Telefons holte ihn aus seinen Gedanken.
*
Bonn, Venusbergkliniken
Seine verschwitzten Finger zitterten, umfassten die Zeitung, seine Augen traten fast aus den Höhlen. Doktor Strotz konnte es nicht glauben. Sein Kollege Jünemann war ermordet worden. In unmittelbarer Nachbarschaft. Und sein Sohn Jerome war am Tatort aufgefunden worden. Benjamin Strotz ließ die Zeitung sinken, seine Zunge fühlte sich plötzlich pelzig und trocken an, klebte am Gaumen. Ein Gedanke nach dem anderen reihte sich in seinem Kopf aneinander. Wer hatte Jünemann ermordet? Was hatte Jerome dort zu suchen? Hatte seine Frau die Tür zu seinem Zimmer absichtlich geöffnet? War sein Sohn in Gefahr? Wo befand er sich jetzt? Anders als seine Frau machte er sich ernsthaft Sorgen. Als sich der Nebel des Entsetzens gelegt hatte, er wieder klar denken konnte, plante er seine nächsten Schritte. Als erstes würde er Kontakt zu Birgit Jünemann aufnehmen. Als Kollege ihres Mannes musste er ihr seine Aufwartung machen. Jemand hatte seinen Freund getötet, quasi vor seiner Haustür. In dem Artikel des Generalanzeigers Bonn stand zu lesen, dass die Polizei einen Raub ausschloss und das Motiv im privaten oder beruflichen Umfeld des Getöteten vermutet. Strotz zitterte erneut, als er die Kurzwahltaste mit der Nummer seiner Frau auf dem Telefon drückte.
*
Bonn Ippendorf
Birgit Jünemann stand vor dem Spiegel in ihrem Badezimmer, in ihrer Hand hielt sie den Puderpinsel, doch es wollte ihr nicht gelingen, sich zu schminken. Immer wieder begann sie zu schluchzen und dicke Tränen liefen ihr über die Wangen. Aus dem Spiegel blickten ihr ihre verquollenen Augen entgegen, sie ließ den Puderpinsel ins Waschbecken fallen. Ein Weinkrampf erschütterte ihren zierlichen Körper. Ein unmögliche Vorstellung: Ein Leben ohne Ralf! Wie sollte das gehen? Jede Faser ihres Körpers sträubte sich dagegen. Ihr Leben war in den letzten Jahren in einer stetigen Aufwärtsspirale verlaufen. Man konnte es als mehr als sorglos bezeichnen. Nach dem Studium und der Zeit als Arzt im Praktikum erhielt er eine Anstellung bei einem Facharzt, dann kam der Wechsel an die Bonner Uni-Klinik. Sein Gehalt dort erlaubte ihnen ein sorgenfreies Leben mit einem bescheidenen Wohlstand – so sah es Frau Jünemann. Außenstehende hätten ihre Villa, die beiden kostspieligen Autos und ihren Lebensstil als protzig bezeichnet. Objektiv gesehen hatten sie es geschafft. Mehrmals im Jahr leisteten sie sich teure Urlaube, entweder gemeinsam oder getrennt. Sie hatten sich an diesen Luxus gewöhnt. Und seitdem Ralf vor zwei Jahren in die Forschungsabteilung der Klinik gewechselt war, gab es überhaupt keine finanziellen Sorgen mehr für die Familie, die leidenschaftliche Porsche-Fans waren. Bald hätten ein Porsche Cayenne und ein Porsche 911S vor der Tür gestanden.
Doch jetzt war er tot. Offen gesagt, sie wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Von ihrem Lebensstandard musste sie sich wohl oder übel verabschieden. Ohne sein Geld konnte sie ihren sozialen Status nicht halten. Dieser Gedanke tangierte sie aber nur am Rande. Es überwiegte die Trauer. Sie hatte ihren Mann geliebt und er sie. Er war tot und über etwas anderes konnte sie momentan nicht nachdenken. Mühsam beruhigte sie sich, trocknete sich das Gesicht mit einem weißen Handtuch ab, betrachtete die Puderspuren, die sich auf dem weißen Stoff abzeichneten. Sie sah noch viel verheulter aus als zuvor. Wie sollte sie diese Befragung bei der Polizei hinter sich bringen? Dazu war sie überhaupt nicht in der Lage. Schon spielte sie mit den Gedanken, diesen Termin abzusagen, aus gesundheitlichen Gründen. Genau in diesen Gedanken hinein läutete die Türglocke. Birgit Jünemann fuhr zusammen, krallte ihre Finger in das Handtuch. Wer klingelte um diese Uhrzeit bei ihr? Voller Panik stellte sie sich vor, dass eine Horde neugieriger Reporter bereits vor der Tür lauerte. Sie mit Fragen bombardieren wollte. Sie eilte ins Schlafzimmer, sah vom Fenster aus vorsichtig hinunter in den Vorgarten. Zu ihrer großen Beruhigung war dort niemand zu sehen. Die Anspannung, die sie zuvor gespürt hatte, flog davon. Einigermaßen beruhigt streifte sie sich den Morgenmantel über, ging hinunter ins Erdgeschoss und verharrte regungslos auf der letzten Treppenstufe. Durch die schmale Glasfläche neben der dunklen Holztür meinte sie eine schmale Damenhandtasche zu erkennen. Als sie die Tür eine Spalt öffnete, sah sie ihre Vermutung bestätigt. Vor ihr stand Isabelle Strotz. Als die Frau des Kollegen ihres Mannes ihren Zustand bemerkte, senkte sie mitleidvoll den Kopf, klimperte nervös mit den Augen.
„Meine Liebe, es tut mir unendlich leid. Ich bin untröstlich“, hauchte sie, „kann ich etwas für Sie tun?“