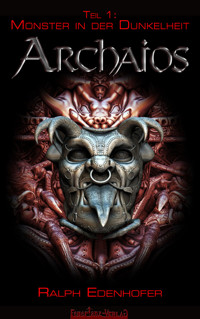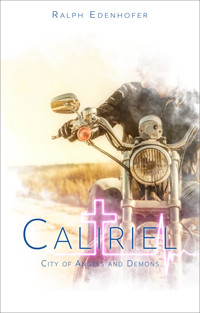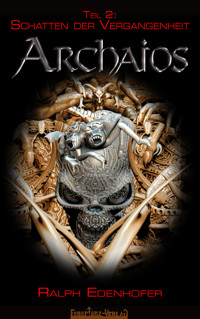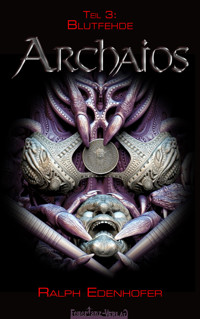
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FeuerTanz-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mein Name ist Leonard von Montesaro. Doch die meisten meiner Art nennen mich den Templer. Aus der Alten Welt kehre ich zurück nach New York, um dort meinen Widersacher herauszufordern. Was ich mitgebracht habe, lässt den Konflikt schnell eskalieren. Aber die Alternative wäre der sichere Untergang. Also werfe ich meine einstigen Überzeugungen über Bord und tue, was notwendig ist. Auch wenn das bedeutet, dass Blut durch die Straßen fließt. Viel Blut. Doch letztlich kenne ich es nicht anders. Schon meine früheren Kämpfe waren grausam und verlustreich. Neunhundert Jahre lang bin ich von einem Schlachtfeld zum nächsten gewandert. Habe im Dienst anderer gekämpft oder für meine eigenen Ziele. Auch wenn Letztere sich oft genug als Lügen herausstellten. Lügen, die sowohl mir selbst als auch der Welt um mich herum unendliches Leid zugefügt haben. Teil 3 der Fantasy-Reihe ARCHAIOS
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Teil 3: Blutfehde
Ralph Edenhofer
feuertanz-verlag.de
Archaios
Teil 1: Monster in der DunkelheitTeil 2: Schatten der VergangenheitTeil 3: Blutfehde
Um keine Neuerscheinung aus der Feder von Ralph Edenhofer zu verpassen, gibt’s hier die Anmeldung zum Newsletter: http://eepurl.com/hKnuUH.
Inhalt
Was bisher geschah
Archaios, Teil 1: Monster in der Dunkelheit
Archaios, Teil 2: Schatten der Vergangenheit
Teil 3: Blutfehde
Mittwoch, 25. Mai 2005, über dem Atlantik
Herbst 1529, Wien, Heiliges Römisches Reich
Donnerstag, 26. Mai 2005, Washington DC, USA
Herbst 1529, Wien, Heiliges Römisches Reich
Freitag, 27. Mai 2005, New York City, USA
Sommer 1530, Jerusalem, Osmanisches Reich
Samstag, 28. Mai 2005, New York City, USA
Frühjahr 1631, Sachsen, Heiliges Römisches Reich
Samstag, 28. Mai 2005, New York City, USA
Frühjahr 1631, Magdeburg, Heiliges Römisches Reich
Sonntag, 29. Mai 2005, New York City, USA
Herbst 1789, Paris, Königreich Frankreich
Sonntag, 29. Mai 2005, New York City, USA
Herbst 1789, Paris, Königreich Frankreich
Montag, 30. Mai 2005, New York City, USA
Frühjahr 1809, Wien, Kaisertum Österreich
Dienstag, 31. Mai 2005, New York City, USA
Epilog: Das Erbe des Templers
Mittwoch, 01. Juni 2005, Wien, Österreich
Mittwoch, 01. Juni 2005, New York City, USA
Mittwoch, 01. Juni 2005, New York City, USA
Anhang
Wie geht es weiter?
Danke
Zum Autor
Personenverzeichnis
New York
Irak
Paris und Revolutionskriege
Wien
Washington D.C.
Dreißigjähriger Krieg
Impressum
Was bisher geschah
Archaios, Teil 1: Monster in der Dunkelheit
Mein Name ist Leonard von Montesaro. Ich bin das, was man landläufig einen Vampir nennt, auch wenn diese Bezeichnung unter meinesgleichen nicht gern verwendet wird.
Seit nunmehr neun Jahrhunderten wandele ich über die Welt. Als Sterblicher habe ich am ersten Kreuzzug teilgenommen und Jerusalem für die Christenheit erobert.
Doch die Alte Welt habe ich schon lang hinter mir gelassen. Seit zwei Jahrhunderten lebe ich in New York. Hier bin ich der Älteste meiner Art. Und der Richter. Ich sorge dafür, dass unsere Gesetze eingehalten werden, dass keiner der unseren über die Stränge schlägt. Und wer es dennoch tut – nun, die Unsterblichkeit kann schnell vorbei sein für die Unvorsichtigen.
Als ich einen marodierenden jungen Vampir zur Strecke bringe und seinen Erzeuger suche, stellt sich allerdings heraus, dass meine Herrschaft über die Stadt, die niemals schläft, infrage gestellt wird. Einer der Alten, ein Archaios – Marduk mit Namen – fordert mich heraus. Und die erste Runde in unserem Ringen geht eindeutig an ihn.
Archaios, Teil 2: Schatten der Vergangenheit
Um gegen Marduk und seine Schergen zu bestehen, benötige ich Hilfe. Mächtige Hilfe. Die einzigen, die dafür infrage kommen, sind die Archaioi der Alten Welt, meine einstigen Todfeinde. Also reise ich nach Europa und begebe mich auf die Suche nach Vitus, dem Römer.
Vor langer Zeit hat er mich zu dem gemacht, was ich bin. Und keine List war ihm zu hinterhältig, um den gottesfürchtigen Tempelritter, der ich damals war, dazu zu bringen, sich freiwillig in seine Dienste zu begeben. Mein ewiger Hass ist ihm gewiss für die Heimtücke, mit der er mich in die Falle gelockt hat. Doch ich habe keine Wahl. Ohne ihn bin ich verloren.
Über Paris, wo ich nach zwei Jahrhunderten ehemaligen Weggefährten wieder begegne, gelange ich schließlich zu meinem Erzeuger. Und zu meiner Blutschwester Constantia, die ich einst geliebt habe wie keine andere Frau zuvor oder danach. Kein einfaches Wiedersehen. Doch der schwerste Schlag kommt, als Vitus mir eröffnet, dass ich selbst längst zu einem der Archaioi geworden bin, einem Herrscher über die Unsterblichen. Nur wenn ich das akzeptiere und mich entsprechend verhalte, würde ich gegen Marduk eine Chance haben.
Tolle Aussichten …
Teil 3: Blutfehde
Mittwoch, 25. Mai 2005, über dem Atlantik
Wie ein Ozean aus silbernem Samt erstreckt sich die mondbeschienene Wolkendecke unter dem Flugzeug. Seit Stunden starre ich gebannt durch das bullaugengleiche Fenster des Minijets, den Constantia mir für die Rückreise nach New York zur Verfügung gestellt hat. Die Unabhängigkeit des Privatjets von Flugplänen sowie die Flugrichtung entgegen der Drehung der Erde ermöglichen es, dem Tageslicht über die gesamte Dauer der Reise zu entgehen. So muss ich mich im Gegensatz zum Hinflug vor einer knappen Woche nicht in einem Sarg verbergen. Die ganze Zeit kann ich aus dem Fenster sehen und den zweiten Transatlantikflug meines Lebens in voller Länge genießen. Die anfängliche Flugangst ist vollständig der Faszination gewichen.
Zu Beginn war ich ein wenig enttäuscht, dass der Himmel über Europa fast durchgehend bedeckt war und sich kaum eine Lücke geboten hat, durch die ich die Lichtsprenkel der Städte sehen konnte. Erst über dem Atlantik sind die Wolken aufgerissen und haben den Blick auf den höchst unspektakulären schwarzen Ozean freigegeben. Doch seit der Mond aufgegangen ist und die Wolkenfelder unter dem Flugzeug sich nach und nach wieder zu einer geschlossenen Fläche vereinigt haben, bietet sich mir ein geradezu unwirklicher Anblick, an dessen entrückter Schönheit ich mich kaum sattsehen kann.
Während meine Augen jedes Detail des silbernen Wolkenmeeres begierig aufnehmen, drehen meine Gedanken sich um die Erlebnisse der letzten Tage. Insbesondere um das gestrige Treffen mit meinem Erzeuger und die ungeheuerlichen Eröffnungen, die er geäußert hat.
Ich sei ein Archaios. Einer der alten Herrscher des ehrwürdigen Geschlechts der Unsterblichen. Ein Monarch der nächtlichen Raubtiere, der seine Stellung durch jahrhundertelange Erfahrung, ein fein gesponnenes Netz von Gefolgsleuten und Verbündeten, vielfach verschachtelte Intrigen sowie die überlegenen Kräfte des Blutes sichert.
Ein geradezu lächerlicher Gedanke.
Mir ist durchaus bewusst, dass Vitus mir das nur aus dem Grund erzählt hat, weil es ihm von Nutzen ist, wenn ich es erfahre, unabhängig davon, ob es wahr ist oder nicht. Er will, dass ich mich Marduk gegenüber für ebenbürtig halte, damit ich gegen ihn antrete. Auf wessen Sieg mein alter Herr dabei setzt, möchte ich gar nicht wissen. Vermutlich ist es ihm sogar egal, denn wer auch immer aus diesem Kampf als Gewinner hervorgeht, wird geschwächt sein. Ich bin fast sicher, dass Vitus mit dem Gedanken spielt, die Chance zu nutzen, um seine Finger nach der Neuen Welt auszustrecken. Seine Erzählungen sind nur Mittel zum Zweck, um mich dazu zu bringen, das zu tun, was er will.
Und dennoch … Je länger ich über seine Worte nachdenke, umso mehr gelange ich zu der Ansicht, dass er tatsächlich recht haben könnte. Erfahrungen habe ich reichlich gemacht in den neun Jahrhunderten meines Daseins auf der Erde. Zumeist bittere Erfahrungen. Doch sie helfen mir, meine Entscheidungen so zu treffen, dass ich die Fehler der Vergangenheit nicht wiederhole. Zwar hat die Welt sich seit der Zeit der Kreuzzüge in einer Weise verändert, die damals niemand auch nur im Entferntesten für möglich gehalten hätte. Aber es gibt eine ganze Reihe von Konstanten, deren Gültigkeit sich seit den Tagen meines sterblichen Daseins erhalten hat. Insbesondere der Umgang der Menschen – und in noch höherem Maß der Nocturni – untereinander hat sich im Grunde kaum weiterentwickelt.
Was die Gefolgsleute betrifft, kann ich mit Vitus’ und Constantias Dienerschaft bei Weitem nicht mithalten. Doch in New York verfüge ich in der Tat über Verbindungen zu einer ganzen Reihe einflussreicher Gruppierungen. Zuvorderst wären dabei die Polizei und das organisierte Verbrechen zu nennen. Mit deren Hilfe habe ich seit Antritt des Amtes als Richter meine Macht gemehrt und meine Feinde in ihre Schranken gewiesen. Und ich habe vor, das weiterhin zu tun.
Ob ich zu den Meistern der Intrige unter meinesgleichen gehöre, sei dahingestellt. Aber ich muss zugeben, dass ich in der Vergangenheit mehr als nur einmal Sterbliche wie Unsterbliche dazu benutzt habe, meine eigenen Interessen zu fördern. Sei es Etienne in Paris oder Veronica in New York. Mit Sicherheit sind meine Verdienste auf diesem Feld mitleiderregend im Vergleich zu den Archaioi der Alten Welt. Aber letztendlich habe ich mich dabei durchaus erfolgreich betätigt.
Bei den Kräften des Blutes hingegen besteht nicht der geringste Zweifel meiner Überlegenheit gegenüber den anderen Unsterblichen in New York und der näheren Umgebung. Zwar sind in einzelnen Gebieten andere Nocturni besser als ich wie zum Beispiel Gianna Linaro in der Kunst des Gedankenlesens, doch beim Bösen Blick ist mir meines Wissens niemand ebenbürtig. Und was die schiere Kampfeskraft anbelangt, kann sich mit Sicherheit keiner mit mir messen – Marduk natürlich ausgenommen.
Ob diese Errungenschaften insgesamt ausreichen, mich für die Mitgliedschaft im elitären Zirkel der Archaioi zu qualifizieren, ist mehr als fraglich. Doch ich muss zugeben, dass mir zumindest kein Grund einfällt, der Vitus’ Aussage grundsätzlich widersprechen würde. Wirklich überzeugt bin ich allerdings noch nicht davon, was mein Blutsvater in mir zu sehen vorgibt. Und selbst wenn es so wäre, würde allein die Erkenntnis, einer der Alten zu sein, etwas an der Situation in New York ändern? Verglichen mit Marduks Macht und Erfahrung sind meine Möglichkeiten lächerlich gering, Archaios hin oder her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Stadt verlässt, sobald ich mich vor ihn hinstelle und verkünde, so wie er einer der Alten zu sein. Vielleicht würde der resultierende Lachanfall ihn kurzzeitig ablenken. Aber wahrscheinlicher ist, dass sein Sinn für Humor dafür nicht ausgeprägt genug ist und er mich einfach hinwegfegt.
Nein, Marduk ist nicht der Adressat für die Nachricht, dass ich ein Archaios bin. Der wichtigste Empfänger dieser Botschaft bin ich selbst.
So wie Vitus gesagt hat, liegt es an mir, mein Verhalten der Situation anzupassen und bei der Verteidigung meiner Domäne wie einer der Alten zu handeln. Diese Erkenntnis ist unabhängig davon, ob ich wirklich einer der Archaioi bin oder ob Vitus mir lediglich einen üblen Streich gespielt hat. Die Strategien der Alten zu übernehmen, ist in jedem Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und da es in Amerika, abgesehen von Marduk, keine weiteren Archaioi gibt, kann ich niemandem außer meinen ohnehin schon erklärten Feinden auf die Füße treten, wenn ich mir das Verhalten der unsterblichen Herrscher der Alten Welt zum Vorbild nehme.
Ganz ohne Opfer würde der Sinneswandel allerdings nicht bleiben. Ich müsste aufhören, meine ohnehin nicht allzu zahlreichen Verbündeten als schützenswerte Freunde anzusehen. Stattdessen sollte ich sie als Schachfiguren betrachten, die im Zweifelsfall geopfert werden, wenn die Situation es erfordert. Eine derart veränderte Sichtweise wäre sicherlich ein nicht unerheblicher strategischer Vorteil. Doch bin ich bereit, diesen Schritt auf dem Weg meiner eigenen Entmenschlichung zu gehen? Bin ich bereit, das zu tun, was ich Vitus all die Jahre vorgeworfen habe und wofür ich ihn zeit meines unsterblichen Daseins gehasst habe? Bin ich bereit, so zu werden wie er? Ein Monster, dessen Ähnlichkeit mit dem Menschen, der es einmal war, auf reine Äußerlichkeiten beschränkt ist? Kann ich den letzten Rest von Moral und Ehre, der mir noch geblieben ist, aufgeben, nur um meine Existenz fortzuführen? Oder gibt es höhere Ziele jenseits meines nackten Überlebens, die derartige Maßnahmen rechtfertigen würden?
Als ich zu meiner Reise in die Alte Welt angetreten bin, habe ich mir eingeredet, ich müsste meine Heimat New York vor dem Übel bewahren, das Marduk zweifellos über sie bringen würde. Doch sollte ich tatsächlich siegreich aus dem Duell mit dem Babylonier hervorgehen, indem ich zu einem unmenschlichen Monster werde, wäre ich dann auch nur einen Deut besser als er? Wäre die Herrschaft des Templers das kleinere Übel für die Stadt, die mir so ans Herz gewachsen ist, dass ich in Erwägung ziehe, endgültig meine Menschlichkeit für sie zu opfern? Ist es möglich, den einmal eingeschlagenen Weg der Bestie wieder zu verlassen, wenn meine Feinde besiegt sind?
Unendlich viele Fragen, auf die ich keine Antworten weiß. Und dennoch muss ich eine Entscheidung treffen.
Beinahe fange ich an zu lachen, als mir in den Sinn kommt, dass Vitus und die anderen Archaioi möglicherweise einst vor derselben Wahl standen. Vielleicht haben auch sie mit den besten Vorsätzen gehandelt, als sie die letzten Bande zu ihrem sterblichen Leben gekappt und sich den scheinbar unausweichlichen Notwendigkeiten ergeben haben. Wie heißt es so passend? Der Weg in die Hölle ist gepflastert mit guten Absichten.
Aber habe ich überhaupt eine Wahl?
Wenn ich nichts unternehme und Marduk das Feld überlasse, werden New York und bald danach vermutlich ganz Nordamerika unweigerlich in die Hände eines monströsen unsterblichen Potentaten fallen. Noch dazu einer, der nicht einmal die Ewigen Gesetze anerkennt, die den Archaioi der Alten Welt zumindest dem äußeren Schein nach heilig sind.
Sollte ich mich ihm entgegenstellen, hat die Stadt wenigstens die Chance, einen etwas wohltätigeren Herrscher zu bekommen. Sofern ich ihn bezwinge und dabei nicht so werde wie er. Nicht gerade übermäßig wahrscheinlich, aber immerhin eine Möglichkeit.
Und sollte ich im Kampf untergehen, würde die Frage meiner eigenen Menschlichkeit sowieso hinfällig. Mein Seelenheil habe ich schon lang aufgegeben. Was also habe ich zu verlieren abgesehen von der Existenz, die ich ohnehin verfluche, seit Vitus mich zu dem gemacht hat, was ich bin?
Scheint, als wäre die Entscheidung gefallen. Ich werde ein Archaios.
Eine Lücke in der seidig glänzenden Wolkenschicht unter mir offenbart fahle Lichter und die Ahnung von Strukturen. Wir haben den Atlantik hinter uns gelassen. Es wird nicht mehr lang dauern, bis wir meine Heimatstadt erreichen. Mit der Ankunft wird mein Dasein in eine neue Phase eintreten. Wenn ich mich ungeschickt anstelle, wird es eine sehr kurze Phase sein, die unmittelbar mit dem endgültigen Tod endet. Doch selbst falls ich siegen sollte, wird nichts mehr so sein, wie es vorher war. Das Beispiel meines Ahnherren und der anderen Archaioi führt mir allzu deutlich vor Augen, dass es kein Zurück gibt, sobald man den Weg der Alten einmal gewählt hat.
Furcht beschleicht mich. Legt ihren eisigen Griff Finger für Finger um mein schweigendes Herz.
Ich bin nach Europa gereist und habe Vitus aufgesucht, damit alles wieder so wird, wie es war, bevor Marduk nach New York gekommen ist. Nun erkenne ich, dass dies unmöglich ist, egal, wie der Kampf ausgeht. Es wird nie mehr so sein, wie es war.
Diese Erkenntnis ist schon für Sterbliche oft erschreckend. Für die Nocturni ist diese Aussicht noch ungleich beängstigender. In ihrer ewig scheinenden Existenz suchen sie verzweifelt nach Ankerpunkten und Konstanten, an denen sie sich in einer sich ständig wandelnden Welt festhalten können und Orientierung finden. Ich bin da keine Ausnahme.
Doch für das, was mir nun bevorsteht, kann ich mir keine Zweifel und kein Zögern leisten. Ich muss die Angst besiegen, sonst wird sie mir permanent im Weg stehen und meine Entscheidungen unmöglich machen. Ich muss den Pfad gehen, der mir als einziges geblieben ist, egal welche Opfer er von mir verlangt.
Ich konzentriere mich auf das, was als Nächstes zu tun ist, wenn ich angekommen bin. Nicht nur, weil mir wenig Zeit bleibt, einen Plan zu entwerfen, sondern auch oder sogar vordringlich, um die Furcht aus meinen Gedanken zu verdrängen.
Vitus hat mir noch mehr mitgeteilt als seine offen ausgesprochenen Ratschläge. Ob beabsichtigt oder nicht, hat er mir eine mögliche Schwäche meines Gegners aufgezeigt, die ich auszunutzen gedenke. Vitus ist von der modernen Welt vollkommen entfremdet. Der Geist der Zeit hat ihn abgehängt und weit hinter sich gelassen. Er ist auf seine jüngeren Ratgeber wie Constantia angewiesen, um die Macht und den Einfluss zu erhalten, die ihm geblieben sind. Marduk ist noch wesentlich älter als mein Erzeuger. Darüber hinaus hat er mehr als zwei Jahrtausende in tiefem Schlummer verbracht und sich einen ihm nicht vertrauten Kontinent als neue Domäne erwählt. Für ihn muss die Entfremdung viel schlimmer sein.
Zwar habe auch ich meine Schwierigkeiten in der Welt von Mobiltelefonen und Internet. Doch ich gehe davon aus, dass es mir noch besser gelingt, mich darin zurechtzufinden, als meinem antiken Gegenspieler. Meine Strategie sollte also darauf abzielen, zuerst seine Helfer und Berater auszuschalten, um ihn seiner Verbindung zur modernen Welt zu berauben. Auf diese Weise führe ich möglicherweise eine Situation herbei, in der ich es wagen kann, ihn direkt anzugehen.
Dafür muss ich allerdings erst einmal herausfinden, wer seine Helfer sind. Der einzige, den ich kenne, ist Massoud. Soweit ich weiß, hält er sich, wenn er nicht unterwegs ist, in unmittelbarer Nähe zu seinem Meister auf. Zumindest war er bei meinem kurzen Besuch in Marduks Wohnstatt dort anwesend. Das macht es schwierig, ihn allein aufzuspüren. Sollte er noch über eine weitere Zuflucht verfügen, ist mir dies nicht bekannt.
Die vier anderen Gefolgsleute, die ich in Marduks Penthouse gesehen habe, waren Sterbliche, von denen ich nicht einmal die unter den Kapuzen verborgenen Gesichter erkennen konnte.
Darüber hinaus ist noch Gianna Linaro zu nennen. Offiziell hat sie sich zwar bei unserem letzten Treffen im Cauchemar zur Neutralität bekannt, doch auf diese Erklärung sollte ich besser nicht allzu viel Hoffnung setzen. Sie hat sich zuvor zu sehr auf Marduks Seite gestellt, um nun untätig zusehen zu können, ob ihr Favorit als Sieger aus dem Kampf hervorgeht. Ihr Lippenbekenntnis verhindert allerdings, dass ich direkt gegen sie vorgehe. Denn wenn ich das täte, würde ich die Absprache brechen, was mir sicherlich wenig Sympathien einbringt. Insofern ist sie vorerst tabu.
Ich muss herausfinden, ob es weitere Vasallen oder wichtige Vertraute gibt, auf die Marduk sich stützt, und wo sie sich aufhalten.
Mir kommt ein Gedanke. In Bruce Randalls Wohnung haben wir neben der Adresse in der New Yorker East Side, unter der wir Marduks Zuflucht gefunden haben, noch eine zweite in Washington D.C. entdeckt. Möglicherweise halten sich dort noch mehr seiner Diener auf. Sollte es so sein, gehe ich davon aus, dass sie im Augenblick nicht mit meinem Erscheinen rechnen. Das könnte mir bei einem Überraschungsbesuch zum Vorteil gereichen.
Der Nachteil von Washington ist natürlich, dass ich dort über keinerlei Vertraute oder sonstige Unterstützung verfüge. Auf fremdem Terrain ohne jegliche Hilfe gegen einen Feind unbekannter Stärke vorzugehen, ist ein nicht unerhebliches Risiko. Aber ist es größer als bei einer spontanen Reise nach Europa auf der Suche nach einem der Alten, der weiß, dass ich ihm ewige Rache geschworen habe? Mein kurzer Abstecher in die Alte Welt hat mir gezeigt, dass ich mich in brenzligen Situationen auf meine Fähigkeiten und insbesondere meine Kampfeskraft verlassen kann. Wenn in Washington nicht ein Unsterblicher von ähnlicher Macht wie Marduk selbst auf mich wartet, sollte ich eine reelle Chance haben, mit allem fertig zu werden, was mich dort erwartet.
Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr komme ich zu dem Entschluss, dass ich vor meiner Rückkehr nach New York der Hauptstadt der Vereinigten Staaten einen Besuch abstatten sollte.
Ich erhebe mich von meinem Sitz. Nasir, der mich wieder auf meinem Flug begleitet, sieht fragend zu mir auf.
»Ich würde gerne eine kleine Anpassung unseres Flugzieles vornehmen«, erkläre ich ihm.
Sein Gesichtsausdruck lässt keinen Zweifel daran, dass er von meinem spontanen Beschluss wenig begeistert ist. »Wohin?«
»Washington D.C. Wäre das möglich?«
Er atmet tief durch. Vermutlich geht ihm Constantias letzter Befehl durch den Kopf, den sie ihm bei unserem Abschied am Flughafen von Wien gegeben hat: ›Sorge dafür, dass es unserem Gast an nichts mangelt, und folge seinen Anweisungen!‹
»Ich werde sehen, was der Pilot dazu sagt.«
Mit einem kaum hörbaren Stöhnen steht er auf und arbeitet sich ins Cockpit vor. Im Gegensatz zu unserem letzten Flug von Paris nach Wien ist die Kabine diesmal nicht mit Särgen vollgestellt. Nur mein eigener, in dem ich bereits die Reise nach Europa angetreten habe, blockiert sperrig den hinteren der beiden Ausstiege. Zusätzlich zu den anderen Zolldokumenten hat meine Blutschwester vorsorglich noch Überführungspapiere für einen Leichnam besorgt, falls das Flugzeug durchsucht wird.
Nachdem Nasir mehr als zwanzig Minuten lang nicht zurückkehrt, begebe auch ich mich ins Cockpit.
Vorn angekommen drehen sich der Pilot, ein ergrauter Endvierziger mit Schnurrbart, und Nasir, der zwischen den beiden Sitzen steht, synchron um und schauen mich an. Der Copilot ist in eine lebhafte Diskussion mit der blechernen Stimme aus dem Funkgerät verwickelt. Offensichtlich gestaltet sich die Änderung des Flugplanes nicht ganz unproblematisch. Nasirs genervter Gesichtsausdruck bestätigt meine Vermutung. Er sieht es nicht als notwendig an, die Situation mir gegenüber zu kommentieren, und wendet seinen Blick wieder nach vorn.
Auch ich schaue durch das Cockpitfenster und genieße den Ausblick, der noch weitaus spektakulärer ist als durch die Bullaugen der Kabine. Unzählige Lichter kleiner und größerer Siedlungen markieren die Küstenlinie, der das Flugzeug folgt. Der Vergleich mit den Landkarten aus meiner Erinnerung lässt mich vermuten, dass wir uns über Connecticut befinden. In der Ferne kann ich Long Island erkennen. Das südliche Ende der Insel, an dem sich New York befindet, ist leider unter Wolken verborgen.
Schließlich beendet der Copilot das Gespräch und verkündet mit starkem wienerischen Akzent: »Wir müssen zuerst nach New York. Nach Washington werden wir erst tagsüber weiterfliegen können.«
Sieht so aus, als würde ich den Sarg doch noch benötigen.
»Dann machen Sie es so!«
Nasir ist offenkundig erleichtert, dass ich mich der Situation so einfach beuge, statt eine wilde Diskussion zu beginnen. Möglicherweise nimmt sein Herr es im Allgemeinen nicht so klaglos hin, wenn seine Pläne nicht umgehend umgesetzt werden. Aber auf einen Tag mehr oder weniger wird es hoffentlich nicht ankommen.
Die Reise nach Europa hat sich ohnehin kürzer und letztlich unproblematischer gestaltet, als ich ursprünglich befürchtet hatte. Außerdem darf ich nicht vergessen, dass ich trotz Constantias ausdrücklicher Anweisungen nur ein Gast bin und Nasir nicht besonders begeistert davon ist, dass er sich um mich kümmern soll. Insbesondere angesichts dessen, was ich Otto, seinem Herrn angetan habe. Als ich Nasir am Flughafen von Wien wieder getroffen habe, war ich einerseits etwas enttäuscht, als er auf meine Anfrage hin berichtet hat, dass sein Herr sich zügig von den Verwundungen erholt, die ich ihm zugefügt habe, und es ihm schon wieder recht gut gehe. Dem ehemaligen SS-Mann hätte ich von Herzen gewünscht, noch lange die Andenken an unsere Begegnung mit sich herum zu tragen. Andererseits bin ich dankbar für die Hilfe, die Vitus und Constantia mir durch die Überlassung des Jets zukommen lassen, was möglicherweise darin begründet ist, dass ich das Leben der Todesboten verschont habe. Für Nasirs Kooperation ist es in jedem Fall hilfreich, dass ich mich Otto gegenüber gnädig erwiesen habe. Ich bin zwar davon überzeugt, dass er die Schmach seines Herrn mit allergrößter Freude rächen würde. Doch seine Rachegelüste sind offenbar nicht stark genug, dass er sich den Anweisungen meiner Schwester widersetzt.
Ohne weiteren Kommentar kehre ich in die Kabine zurück und lasse mich wieder auf meinem Sitz nieder. Eigentlich kommt mir eine Zwischenlandung in New York recht gut zupass. Ich beschließe, den ungeplanten Aufenthalt zu nutzen, um mich über den Stand der Dinge zu erkundigen. Vermutlich haben meine Gegner die Tage, an denen ich weg war, ebenfalls nicht untätig verbracht.
Auch Nasir kehrt aus dem Cockpit zurück und gesellt sich mit mürrischer Miene zu mir. Ich schätze, er ist ungehalten über die spontane Erweiterung der Reise. Ich kann ihm nicht verdenken, dass er meiner Gesellschaft so schnell wie möglich entkommen will. Unsere kurze Bekanntschaft kann man nicht gerade als ungetrübt bezeichnen. Aber er beugt sich stoisch den Umständen. Als langjähriger Vertrauter eines Unsterblichen ist er sicherlich gewohnt, dass nicht immer alles so läuft, wie er es sich vorstellt.
Die verbliebene Zeit des Fluges über genieße ich die Aussicht auf die ostamerikanische Küste. Leider bleiben weite Teile des Landes unter Wolken verborgen. Über Long Island beginnt der Pilot den Landeanflug und das Flugzeug taucht in das weiße Wattemeer ein. Als wir die Wolken schließlich über uns zurücklassen, bietet sich mir ein grandioser Ausblick. Das Lichtermeer von New York stellt alle Städte, die ich in Europa aus der Vogelperspektive gesehen habe, bei weitem in den Schatten. Die leuchtenden Umrisse von Manhattan zeichnen sich deutlich gegen den Hudson und East River ab, die es mit dunklen Fingern einrahmen. Brooklyn und Queens erhellen das südliche Ende von Long Island bis zur Küste des Atlantiks, dessen Schwärze sich nach Osten und Süden hin bis zum Horizont erstreckt. Und in Richtung Westen verliert sich der Glanz von New Jersey allmählich in den Weiten des amerikanischen Festlandes.
Das unbestreitbare Prunkstück des funkelnden Juwelenkästchens unter mir ist jedoch Manhattan. Viele der großen Wolkenkratzer sind selbst aus dieser Höhe unschwer zu identifizieren, allen voran das Empire State Building mit seiner bunt erleuchteten Spitze – meine langjährige Heimstatt. Ich kann mich kaum satt sehen an der Pracht der vertrauten Stadt, die mir aus dieser Perspektive bislang nur von Fotografien bekannt war. Immer mehr Details kommen zum Vorschein – Chrysler Building, Rockefeller Center, weiter im Süden das Woolworth Building –, während das Flugzeug immer tiefer hinabsinkt und schließlich auf dem La Guardia Flughafen zur Landung ansetzt. Die glitzernde Skyline von Manhattan weicht den Signalleuchten der Landebahn, auf der der Pilot die Maschine butterweich aufsetzt.
Willkommen zu Hause.
Ein Blick auf die Uhr zeigt mir, dass ich noch knapp zwei Stunden bis zum Sonnenaufgang habe. Zu wenig für ausgedehnte Exkursionen. Aber für ein paar Telefonate wird es reichen. Nasirs Mobiltelefon wäre die einfachste Wahl. Auch wenn er vermutlich nicht erfreut darüber wäre, würde er es mir wohl überlassen, sollte ich ihn darum bitten. Doch wer weiß, wer da sonst noch mithört. Wenn man von der modernen Technik so wenig versteht wie ich, muss man Vorsicht walten lassen, insbesondere, wenn man anderer Leute Gerätschaften verwendet. Also verlasse ich das Flugzeug, sobald es auf dem Rollfeld zum Stillstand gekommen ist, und marschiere geradewegs auf das Terminalgebäude zu. Die Formalitäten bezüglich Landung, Einreise und Zoll überlasse ich meinem unfreiwilligen Begleiter.
Die Kunst, sich mit der Sicherheit und Selbstverständlichkeit von jemandem zu bewegen, der ›dazugehört‹ und vor niemandem etwas zu verbergen hat, beherrsche ich mit Bravour. Und wo die natürliche Autorität, die ich mir in jahrhundertelanger Übung angeeignet habe, versagt, reicht üblicherweise schon die Andeutung des Bösen Blickes, jedweden Zweifel an meinen Befugnissen im Keim zu ersticken. Auf diese Weise fällt es mir nicht schwer, das Gebäude zu betreten und den Sicherheitsposten und sonstigen Beschäftigten mit einem kurzen Kopfnicken zu demonstrieren, dass alles in Ordnung ist. In einer abgeschiedenen Ecke der Empfangshalle finde ich mein Ziel: einen öffentlichen Fernsprecher. Auch wenn ich selbst kein Mobiltelefon besitze, kommt mir deren weite Verbreitung dennoch zugute. Kaum jemand benutzt noch öffentliche Geräte, so dass ich meist darauf verzichten kann, vor mir in der Warteschlange stehende Leute davon zu überzeugen, dass ihr Gespräch gar nicht so wichtig ist. Auch hier im Flughafen sind die Telefone verwaist. Ich füttere den Apparat mit ein paar Münzen und wähle zuerst Silvios Nummer.
Nach wenigen Sekunden erklingt das vertraute »Pronto!«
»Hallo Silvio.«
Er erkennt meine Stimme sofort. »Mr. Smith. Gut, von Ihnen zu hören.«
Die offenkundige Erleichterung, die in seinen Worten mitschwingt, beunruhigt mich. Für gewöhnlich ist der Mafioso stets nüchtern und pragmatisch.
Ich versuche, mir meine Besorgnis nicht anmerken zu lassen. »Wie ist die Lage? Ist irgendetwas passiert seit meiner Abreise?«
»Nun …« Er stockt. Kein gutes Zeichen. »Es ist wegen Ver… Miss Masters.«
»Was ist mit ihr?«
»Nun … Sie … Sagen wir, ich war ein wenig beschäftigt mit der Entsorgung ihrer Hinterlassenschaften.«
Nicht gut. Meine schlimmsten Befürchtungen bezüglich meines Zöglings scheinen sich zu bewahrheiten.
»Wo ist sie?«
»Ich … Ähm … Ich weiß es nicht. Ich habe sie vor drei Tagen das letzte Mal gesehen. Seitdem ist sie verschwunden.«
Gar nicht gut.
»Hat sie irgendetwas gesagt oder angedeutet, wo sie hin will?«
»Nun ja. Sie hat einen Namen erwähnt. Mike. Mehr nicht. Keine Ahnung, wen sie damit gemeint hat. Aber sie hat … Also ihr Zustand war ein wenig besorgniserregend. Sie schien nicht mehr wirklich Herr ihrer selbst zu sein.«
Ich habe eine grobe Vorstellung, welches Bild sich meinem Vertrauten geboten hat. Ein Vampir, der die Kontrolle über sein Handeln verliert, ist vermutlich selbst für Berufsverbrecher wie Silvio gewöhnungsbedürftig. Es ist kein schöner Anblick, wenn ein zuvor recht umgänglicher Mensch sich Schritt für Schritt in ein blutrünstiges Monster verwandelt, wie es der Reißwolf gewesen ist, und dem nicht endenden Blutrausch anheimfällt. Falls Veronica noch so viel Geistesgegenwart besessen hat, Mike aufzusuchen, ist möglicherweise nicht alles verloren. Aber selbst für meinen gottesfürchtigen, menschenblutverachtenden Freund stellt es eine nicht unbeträchtliche Aufgabe dar, sie vor dem Abgrund zu bewahren. Auf der anderen Seite … Wenn es jemand schaffen könnte, ihr zu helfen, dann wohl Mike. Vermutlich ist sie bei ihm sogar besser aufgehoben als bei mir. Ich befürchte allerdings, ich bin nicht ganz unschuldig daran, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Ihr Schicksal stand auf Messers Schneide, als ich sie für meine Reise nach Europa verlassen habe. Die Zeichen ihres Abdriftens in die Bestialität waren unübersehbar. Ich hätte sie nicht allein lassen dürfen.
»Hast du in den Nachrichten und Zeitungen verfolgt, ob irgendwelche Berichte über … Vorfälle gemeldet wurden, die mit ihrem Zustand in Verbindung stehen können?« Heißt im Klartext: ›Gab es seit ihrem Verschwinden blutige Massaker in der Stadt?‹
Silvio fragt nicht nach, was ich meine. Er versteht, was ich impliziere. »Nein. Nichts Ungewöhnliches.«
Stellt sich die Frage, was auch immer für einen Moloch wie New York als gewöhnlich einzustufen ist. Aber die Spur, die ein marodierender Vampir hinterlässt, sticht üblicherweise sogar aus dem blutigen Grundrauschen der durchaus beeindruckenden New Yorker Verbrechensrate markant hervor.
»Halte die Augen offen!«, weise ich Silvio an. »Und wenn du etwas Verdächtiges entdeckst, geh der Sache nach!«
»Geht klar.« Seine Stimme klingt wieder geschäftsmäßig. »Und was soll ich tun, wenn ich etwas entdecke und sie damit zu tun hat?«
Die korrekte Antwort wäre: ›Lauf weg, so schnell du kannst!‹ Aber das wäre nicht förderlich.
»Versuche, es zu beenden! Aber sei vorsichtig! Wenn sie Amok läuft, wird sie nur schwer aufzuhalten sein. Benutze schwere Geschütze und halte möglichst viel Abstand!«
»Verstanden.«
Die Zuversicht in seiner Antwort ist definitiv fehl am Platz. Sollte er ihr wirklich begegnen, wenn sie sich im dauerhaften Blutrausch befindet, hat er nur geringe Überlebenschancen. Ich hoffe, es kommt gar nicht erst dazu. Gerade jetzt kann ich es mir nicht leisten, einen so wertvollen und zuverlässigen Diener wie Silvio zu verlieren. Aber die Vorstellung eines unkontrolliert kreuz und quer durch die Stadt mordenden Vampirs ist noch beängstigender.
»Hast du etwas von Ludovicz gehört?«, setze ich die Fragestunde fort.
»Nein. Nicht direkt. Aber über einen anderen Kontakt bei der Polizei habe ich erfahren, dass es da neuerdings ein paar interne Querelen gibt. Die Dienstaufsicht ist wohl aktiv geworden und mischt den Laden auf. Angeblich auf Druck der Stadtverwaltung. Aber Genaueres weiß ich nicht.«
Gianna Linaro hat Kontakte zur Stadtverwaltung. Kein gutes Zeichen. Sie weiß, dass ich Verbündete bei der Polizei habe. Sollte die Angelegenheit tatsächlich von ihr angezettelt worden sein, hoffe ich, dass Ludovicz sich aus der Schusslinie gebracht hat.
»Halte auch diesbezüglich Augen und Ohren offen!«
»Mach ich.«
»Also dann.«
Ich will das Gespräch gerade beenden, als Silvio noch einmal nachhakt: »Wann darf ich Sie wieder hier erwarten?«
»Ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen.«
Präziser möchte ich nicht werden. Für den Fall, dass das Telefonat doch irgendwie abgehört wird oder Silvio in die Fänge meiner Gegner gerät, wäre das eine Information, die ich ungern in den falschen Händen wüsste.
Er gibt sich damit zufrieden. »Okay. Verstanden.«
Ich lege auf.
Kurz spiele ich mit dem Gedanken, auch Ludovicz anzurufen. Doch falls er beobachtet wird, ist nicht auszuschließen, dass sein Telefon überwacht wird. Ich werde ihn persönlich aufsuchen, wenn ich endgültig wieder zurück bin. Bis dahin muss er ohne meine Hilfe auskommen. Er ist zweifellos gut darin, sich gegen die interne Dienstaufsicht zur Wehr zu setzen. Er hatte in der Vergangenheit mehr als genug Gelegenheit, diesbezüglich Erfahrung zu sammeln. Ich hoffe nur, dass er nicht mit Gianna persönlich oder anderen Unsterblichen zu tun hatte. Ihren Kräften wäre auch er machtlos ausgeliefert.
Insgesamt keine wirklich guten Nachrichten. Zumindest sieht es so aus, als wären noch nicht alle meine Verbündeten kaltgestellt. Dennoch sollte ich mich möglichst bald wieder zurückmelden.
Insbesondere Veronica geht mir durch den Kopf, während ich mich auf den Rückweg zum Flugzeug mache. Ich hätte sie nicht allein lassen dürfen. Im schlimmsten Fall hat meine Reise zur Folge, dass ich sie verliere. Und das auf die unangenehmste Weise, die ich mir vorstellen kann. Wenn alles schief läuft, werde ich gezwungen sein, das Versprechen einzulösen, das ich ihr einst gegeben habe. Ihrem Dasein ein Ende setzen, bevor sie sich endgültig in ein Monster verwandelt. Allein der Gedanke, sie eigenhändig töten zu müssen, lässt meine Eingeweide verkrampfen. Ich verspüre das dringende Bedürfnis, auf der Stelle den Flughafen zu verlassen und in die Stadt zu gehen, um sie zu suchen. Ihr im Kampf gegen das Dunkel beizustehen, das sich in ihren Adern eingenistet hat und nach Blut verlangt.
Ich will bei ihr sein.
Mitten auf dem Rollfeld bleibe ich unvermittelt stehen. Am östlichen Horizont zeichnen sich die ersten hellen Streifen zwischen den Wolken ab und künden von der nahenden Morgendämmerung. In dieser Nacht werde ich sie sicherlich nicht mehr finden. Dafür ist zu wenig Zeit. Aber bis Manhattan würde ich es vermutlich noch schaffen.
Doch wäre das vernünftig?
Die zurückliegenden Stunden habe ich zu großen Teilen mit den Gedanken daran verbracht, wie ich Vitus’ Ratschläge umsetzen soll. Das Ergebnis war, dass ich weniger Rücksicht auf die Beziehungen zu den Personen in meinem Umfeld nehmen muss, als ich das in der Vergangenheit getan habe. Und nun, kaum dass ich mit den ersten Problemen konfrontiert werde, scheinen alle meine Vorsätze bereits wieder dahin zu sein. Allerdings ist Veronica kein gewöhnlicher Freund oder Vertrauter. Schon vor meiner Abreise habe ich gewusst, dass sie mir so viel bedeutet, wie es seit langer Zeit niemandem mehr gelungen ist. Meine Begegnung mit Constantia hat daran nichts verändert. Ganz im Gegenteil.
Das Wiedersehen mit meiner einstigen Gefährtin, der großen Liebe meiner Vergangenheit, hat mir die Aussichtslosigkeit jeglicher Hoffnung, dieses Glück jemals wiederbeleben zu können, deutlich vor Augen geführt. Damit ist das Hemmnis, das mich seit der Trennung von meiner Blutschwester stets gehindert hat, mich voll und ganz auf neue Liebschaften einzulassen, beseitigt. Nun endlich hätte ich die Chance, ein neues Glück aufzubauen. Vielleicht hat mein Unterbewusstsein bereits Pläne geschmiedet, dies mit Veronica in die Tat umzusetzen. All dies ist natürlich vergebens, wenn die liebevolle junge Frau dem Monster weicht, das der Reißwolf in ihr erweckt hat.
Und dennoch: Ich werde es nicht tun.
Ich setze mich wieder in Bewegung und halte mit strammem Schritt auf das Flugzeug zu, das mich nach Washington bringen soll. Ich werde meine persönlichen Bedürfnisse nach Liebe und Freundschaft hinten anstellen. Mein Überleben, die Zukunft von New York und meine Rolle in dieser Zukunft müssen im Augenblick die höchste Priorität in meinem Tun einnehmen.
Die Entscheidung ist getroffen. Ich werde selbst zu einem der Monster, die ich so lange Zeit bekämpft habe. Von deren Einfluss ich mich unter größten Mühen freigekämpft hatte. Die ich mehr als alles auf der Welt verachte.
Ich werde ein Archaios.
Herbst 1529, Wien, Heiliges Römisches Reich
Der Anblick vor mir weckte unweigerlich Erinnerungen an die letzten Tage des christlichen Jerusalem. Wie damals stand ich auf den Mauern einer Stadt und ließ den Blick in die Ferne schweifen. Keine einzige Wolke verdeckte die Sicht auf die funkelnden Sterne und die silberne Sichel des Mondes. Man konnte es wohl kaum als gutes Omen deuten, dass hoch am Firmament das Feldzeichen unserer Feinde prangte.
Meine Augen senkten sich. Sahen über das Land vor der Stadt, das von Fackeln und Lagerfeuern übersät war, so weit der Blick reichte, an Zahl den Sternen gleich, so schien es.
Wie damals die Heilige Stadt war wiederum eine lächerlich geringe Zahl von Verteidigern eingeschlossen von einer unüberwindlich erscheinenden Streitmacht. Wie damals wehten die Banner der Moslems über den Zelten der Belagerer. Mit ihrer schieren Menge drohten sie, die Kreuze, die auf den Kirchtürmen innerhalb der Stadtmauern ehrfürchtig dem Himmel entgegen strebten, zu ersticken.
Mehr als drei Jahrhunderte waren vergangen, seit Saladin die Kapitale des Königreichs Jerusalem erobert hatte. Drei Jahrhunderte, in denen sich viel ereignet und die Welt sich gewandelt hatte. Drei Jahrhunderte, in denen ich ein Sklave des übermächtigen Willens meines Erzeugers gewesen war. Drei Jahrhunderte, in denen ich die Liebe kennengelernt hatte, als Constantia in mein tristes Dasein getreten war und die Sklaverei, in der ich mich befand, so weit versüßte, dass ich tatsächlich bereit war, mein Schicksal hinzunehmen. Drei Jahrhunderte, in denen Vitus, Constantia und ich darum gerungen hatten, die Macht, die Vitus einst über das sterbende Reich von Konstantinopel ausgeübt hatte, in den Ländern Westeuropas gegen den Widerstand der alteingesessenen Nocturni zu erneuern. Drei Jahrhunderte, in denen ich gelernt hatte, dass alles, was mühevoll erworben worden war, mit einem beiläufigen Handstreich wieder hinweggefegt werden konnte.
Die Liebe zu Constantia verlor ich im Wettstreit um die Gunst unseres Erzeugers. Ein Wettstreit, aus dem ich als Verlierer hervorging. Nun war es meine Schwester, die in Vitus’ Auftrag die Welt der Menschen manipulierte, um uns Macht und Wohlstand zu sichern. Zumindest an dem Wohlstand hatte ich noch eine Weile teilhaben dürfen. Doch auch der war nun dahin.
Den Niedergang des Herzogtums Burgund hatten wir recht gut überstanden. Der Großteil der burgundischen Besitztümer war bei der Hochzeit seiner letzten Erbin Maria mit Kronprinz Maximilian von Habsburg mit dem Familienbesitz der Dynastie aus Wien vereint worden. Sozusagen als Mitgift. Den Rest hatte sich der bei der Brautwerbung unterlegene König von Frankreich in einem langwierigen Krieg einverleibt. Auch die einstige Hauptstadt Dijon war dabei an Frankreich und damit in den Einflussbereich von Vitus’ Erzrivalen Laurent von Paris gefallen. Um endlosen Übergriffen seiner Handlanger aus dem Weg zu gehen, mussten wir wieder einmal eine neue Bleibe suchen. So gingen wir zunächst in die burgundischen Niederlande nach Brüssel. Doch unser Besuch belastete das Verhältnis zu unseren flämischen Verbündeten. Durch Vitus’ bloße Anwesenheit fühlten sie sich in ihrer Freiheit beeinträchtigt – möglicherweise nicht ganz zu unrecht. Außerdem suchte mein Erzeuger stets die Nähe zum Sitz der sterblichen Herrscher des Landes, das er bewohnte. Das war nunmehr Wien in den habsburgischen Stammlanden des Erzherzogtums Österreich.
Natürlich gab es auch in der Stadt an der Donau einige der Unsrigen. Doch ebenso wie in Flandern war keiner der Alten darunter. Dennoch gingen wir davon aus, dort nicht mit offenen Armen empfangen zu werden. Obwohl schon mehr als ein Jahrhundert in der Vergangenheit, war den langlebigen Nocturni noch sehr wohl im Bewusstsein, wie Vitus und Constantia in Burgund die einstige Herrscherin des Landes von ihrem angestammten Platz verdrängt hatten. Von daher stand zu befürchten, dass die Unsterblichen Wiens sich vehement dagegen wehren würden, wenn Constantia versuchte, in der Stadt Gefolgsleute und Verbündete zu gewinnen. Also wählte mein Meister dieses Mal eine andere Taktik.
Anstatt meine Schwester vorzuschicken und zunächst Informationen über die lokalen Machthaber und Verhältnisse zu sammeln, reisten wir alle zusammen nach Österreich. Wir verbargen uns im Gefolge einer Delegation burgundischer und flämischer Adliger, in der sich ein großer Teil unserer wichtigsten Gefolgsleute befand. Es war ein Wagnis, sich ohne umfassendes Wissen über unsere Gegner direkt in ihre Domäne zu begeben. Doch Vitus vertraute auf unsere Fähigkeiten, darunter insbesondere seine Meisterschaft im Bösen Blick, mit dem er so gut wie jeden Willen zu brechen vermochte.
In Wien angekommen, verzichteten wir auf jegliche Subtilität und hinterließen für jeden der Unsrigen eindeutige Spuren unserer Anwesenheit in Form ausgebluteter Leichen. Es dauerte nicht lang, bis der Richter der Stadt uns fand. Doch statt wie erwartet auf eine Horde junger Streuner, die wie überall seit der großen Pestilenz auch hier ihr Unwesen trieben, traf er auf meinen Erzeuger. Vitus hatte trotz der unzweifelhaften Befähigung des Würdenträgers wenig Mühe, ihn zu überwältigen. Mit seinem Blut nahm er auch das Wissen über viele andere Nocturni der Stadt und ihre Zufluchten in sich auf.
Von diesem Moment an stand der Ausgang des Kräftemessens fest. Wir mussten nur ein oder zwei Exempel statuieren, bevor die restlichen Unsterblichen ihren Widerstand aufgaben und sich als Freunde oder Vasallen anbiederten. Durch diese Bündnisse wahrten wir gegenüber Außenstehenden den Anschein, es hätte sich bei unserer Umsiedlung um eine freundschaftliche Aufnahme gehandelt. Vermutlich schenkte niemand dieser Behauptung Glauben, obwohl Constantia sehr überzeugend sein konnte. Doch auf diese Weise hatten alle, die einer Auseinandersetzung mit Vitus aus dem Weg gehen wollten, eine Ausrede, warum sie uns gewähren ließen. Und angesichts unseres Rufes sowie der Macht, die wir in jenen Tagen angehäuft hatten, waren sämtliche Nocturni mit einem gesunden Selbsterhaltungstrieb nur allzu gewillt, über die eine oder andere Verfehlung hinwegzusehen.
Lediglich mit einer alteingesessenen Blutlinie in Böhmen gab es hier und da Auseinandersetzungen. Doch nach einigen kleinen Machtdemonstrationen durch Vitus’ Kräfte und mein Schwert hatte Constantia genug Argumente, um auch diesen Zwist friedlich beizulegen.
So schien es endlich, als hätte mein Herr sein Ziel erreicht. Er war dem Untergang von Byzanz, den er schon nach dem vierten Kreuzzug vorhergesehen hatte, entronnen und hatte ein neues aufstrebendes Herrschergeschlecht gefunden, in dessen Schatten er seine Machtspiele vollführen konnte. Die Habsburger erwiesen sich als würdige Objekte seiner Ambitionen, auch die Welt der Sterblichen nach seinen Wünschen zu gestalten, so wie er es einst in Rom getan hatte. Zwar war es selbst für Constantia, die in der Kunst der Einflüsterung und verdeckten Einflussnahme ihresgleichen suchte, unmöglich, über alle Angehörigen des weit verstreuten Herrschergeschlechtes Kontrolle auszuüben. Doch es gelang ihr, der Stimme ihres Blutsvaters in ganz Europa Gehör zu verschaffen und bedeutende Reichtümer aus dem riesigen Reich zu sammeln. So hatten wir uns in Wien schnell eingelebt und mussten dem Luxus, an den wir uns in Burgund gewöhnt hatten, auch hier nicht entsagen.
Unsere einzige wirkliche Niederlage war, dass sich Kaiser Karl V meist in Spanien und den burgundischen Niederlanden aufhielt, wodurch der mächtigste Vertreter der Habsburger sich unserem Einfluss nahezu vollständig entzog. Ob eine der spanischen Blutlinien der Nocturni oder unsere einstigen flämischen Verbündeten bei dieser Entscheidung nachgeholfen hatte oder der Kaiser seine Wahl unabhängig von unsterblicher Einflussnahme traf, konnte nicht einmal Constantia in Erfahrung bringen. Mir selbst fiel es nicht schwer, diesen Verlust hinzunehmen, schmälerte er unser Wohlergehen in der neuen Heimat doch nicht wesentlich. Meine Schwester jedoch vermochte ihre Unzufriedenheit über den Misserfolg nur schwerlich zu verbergen, insbesondere nicht mir gegenüber. Ich kannte sie schon von frühester Kindheit an und konnte ihre Launen trotz ihrer unzweifelhaften Fähigkeit, ihre wahren Absichten und Motive zu verheimlichen, wohl erkennen.
Ihre Niederlage gab mir in unserem Ringen um Vitus’ Gunst ein wenig Auftrieb. Nachdem ich mich einige Jahre kaum noch an der Gestaltung unserer Zukunft beteiligt hatte und nur Vitus’ Befehle ausführte, wagte ich nun wieder, meine Meinung zu äußern. Zu meinem Erstaunen gab Constantia mir sogar mehrmals recht und unterstützte meine Vorschläge. Fast schien es, als würde in unserer Familie wieder Frieden einkehren. Doch es war nicht mehr als ein Waffenstillstand, der so lange währte, wie unser Dasein nicht vor ernsthafte Herausforderungen gestellt wurde.
Die Herausforderung, die den Frieden beendete, erwuchs uns in Form einer neuen aufstrebenden Macht in der Welt der Sterblichen. Die langjährige Heimstatt meines Blutsvaters, Konstantinopel, und mit ihr das Byzantinische Reich, hatten nach der Eroberung durch die Kreuzfahrer einen langsamen, aber stetigen Niedergang erlebt. Zwar war es den Byzantinern gelungen, die fränkischen Herrscher wieder vom Bosporus zu vertreiben. Doch der unirdisch scheinende Glanz der Metropole, der mich so geblendet hatte, als ich einst erstmals durch ihre Tore geschritten war, war unwiderruflich verloren.
Im Jahre des Herrn 1453 endete die vormals so stolze Herrschaft der Erben Roms endgültig. Nachdem die Osmanen den Großteil des Byzantinischen Reiches bereits zuvor erobert hatten, überwanden sie schließlich auch die Mauern Konstantinopels. Doch die Türken hielten nach dem Fall der ehemals strahlendsten Stadt der Christenheit nicht in ihrem Eroberungsdrang inne. Sie drängten weiter voran in Richtung Westen und unterwarfen ein Reich nach dem anderen. Nur wenigen ihrer Gegner gelang es, den Vormarsch der Osmanen und ihrer Elitetruppen, der Janitscharen, zumindest zeitweise aufzuhalten.
Einer, der eine gewisse Berühmtheit für seinen Widerstand erlangte, war der walachische Fürst Vlad Tepes, den man den Pfähler nannte. Viel später sollte er unter dem Namen Dracula der unter den Menschen bekannteste Vertreter der Unsterblichen werden. Ich glaube allerdings nicht einmal, dass er überhaupt einer der Unsrigen gewesen ist, sondern vermutlich eher ein Unhold. Ich selbst bin weder ihm noch seinem Herrn, so er denn tatsächlich der sterbliche Diener eines Nocturnus war, jemals begegnet.
Letztlich konnte aber auch er das Vordringen der Türken nicht beenden. Scheinbar unaufhaltsam eroberten sie den größten Teil des Königreichs Ungarn und wurden damit zu einer unmittelbaren Bedrohung für die habsburgischen Erblande.
Unter den Unsterblichen erregte der Vormarsch der Türken auf dem Balkan nicht weniger Unbehagen als bei den Menschen. Niemand wusste, ob sich auch in ihren Reihen Nocturni verbargen, so wie es in jenen Tagen in den Königreichen Europas üblich war. Noch schwerer wog, dass von den bekannten Blutlinien der Länder, die unter osmanische Herrschaft fielen, keine Nachricht mehr an die Höfe der nächtlichen Fürsten drang. So fürchteten nicht wenige der Unsrigen um ihre nackte Existenz, wenn die Meldung vom Nahen der Türken zu ihren Zufluchten gelangte.
Als Sultan Süleyman der Prächtige seine Armeen schließlich gegen Wien sandte, ging es uns nicht anders. Ich erinnere mich noch gut an die Worte meines sonst so unerschütterlichen Blutsvaters, als er Constantia und mich zu sich rief: »Diese Bedrohung sollten wir nicht unterschätzen. Die Geschwindigkeit, mit der die Türken ein Königreich nach dem anderen einnehmen, ist erstaunlich. Auf dem Balkan und in Ungarn gab es mächtige Blutlinien der Unsrigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich dem Sultan freiwillig ergeben haben.«
Auch meine Blutschwester war ernstlich besorgt. »Heißt das, unter den Türken sind noch mächtigere Nocturni?«
»Entweder das«, erklärte Vitus, »oder ihre sterblichen Krieger wissen, wie man unsereins besiegen kann.«
Ich sah noch eine weitere Möglichkeit: »Oder sie sind derart effizient in der Erweiterung und Verwaltung ihres Reiches, dass alle Bemühungen der Unsrigen, ihre Herrscher und Amtsträger zu beeinflussen, wirkungslos verpuffen.«
Vitus’ Blick zeigte Zweifel. »Das ist nicht einmal den Sterblichen in Rom und Byzanz gelungen. Und ich kenne keine Reiche mit einer effizienteren Verwaltung als diese beiden.«
»Bis jetzt«, wandte ich ein.
Ihm war anzumerken, dass er sich meinem Gedankengang nicht anschloss. Doch ehe er mir widersprach, meldete Constantia sich zu Wort: »Es ist unerheblich, aus welchem dieser Gründe die Türken ein Königreich nach dem anderen besiegen und unterwerfen. Sie sind eine ernstzunehmende Gefahr und sie rücken auf Wien vor. Und das angeblich mit mehr als hunderttausend Kämpfern. Der Kaiser führt in Italien Krieg gegen die Franzosen und wird uns kaum die notwendigen Truppen schicken, um uns gegen einen derart starken Gegner zur Wehr zu setzen. Wir müssen Wien verlassen.«
»Schon wieder fliehen?« Ich ereiferte mich zusehends. »In Dijon haben wir vor den Franzosen den Schwanz eingezogen und sind hierher gekommen. Jetzt haben wir uns gerade in Wien eingerichtet, da willst du schon wieder weg.«
»Manchmal ist ein strategischer Rückzug das Gebot der Stunde«, hielt sie mir entgegen. »Du denkst zu viel mit deinem Schwertarm. Benutze stattdessen vielleicht mal deinen Kopf!« Sie tippte mir an die Stirn.
»Und du gehst jedem Kampf aus dem Weg. Ich bin immer noch davon überzeugt, wir hätten Dijon gegen Laurent und seine Getreuen halten können, wenn wir in der Stadt geblieben wären.«
»So wie wir die Tempelritter gegen ihn verteidigt haben?«
Ich ballte die Fäuste. Sie wusste nur zu gut, wie sie mich zur Weißglut bringen konnte. Die Erwähnung der Templer und ihres Untergangs war dafür auch nach mehr als zwei Jahrhunderten noch eine sichere Methode.
Vitus’ Intervention hielt mich davon ab, handgreiflich zu werden. »Wenn wir wüssten, welche Gefahr genau auf uns zukommt, und einen Plan hätten, ihr zu begegnen, dann wäre es sicherlich klug zu bleiben und die Verteidiger zu unterstützen. Aber das ist nicht der Fall.«
»Also überlassen wir die Stadt ihrem Schicksal?« Noch war ich nicht bereit, mich zu fügen.
Constantia fixierte mich mit verschränkten Armen. »Denkst du denn, du könntest einen nennenswerten Beitrag zur Verteidigung Wiens leisten?«
»Natürlich. Zeig mir den Sterblichen, der meinem Schwert widersteht! Selbst mit ihren Arkebusen und Musketen können sie mir nicht standhalten. Und meinen beiden Nachkommen und unseren Unholden ebenso wenig. Jeder von ihnen kann es mit einer Übermacht von Gegnern aufnehmen. Egal, ob unter den Angreifern Nocturni sind oder nur Janitscharen, ich werde ihnen zeigen, dass zumindest noch ein Templer übrig ist, der den Muselmanen Einhalt gebietet.«
Sie wiegte den Kopf hin und her. »Vielleicht hast du recht. Wien ist zu wertvoll, um es leichtfertig aufzugeben. Wenn du tatsächlich glaubst, mit deiner Unterstützung für die Verteidiger könnten die Türken aufgehalten werden, dann sollten wir das in Betracht ziehen.«
In mir focht die Aussicht auf einen argumentativen Sieg gegen das wachsende Misstrauen angesichts ihrer Zustimmung. Und kaum redete sie weiter, wurden meine Zweifel bestätigt.
»Vitus als Oberhaupt unserer Blutlinie sollte sich allerdings in Sicherheit begeben. Ich werde ihn begleiten. Sobald die Türken vertrieben sind, kehren wir zurück.«
In Anbetracht dieses Manövers musste ich mich zusammenreißen, ihr nicht auf der Stelle das tote Herz aus dem Leib zu reißen. Meine letzte Hoffnung war, dass Vitus ihr widersprach, doch zu meinem Entsetzen stimmte er ihr zu: »Du hast recht, Constantia. Wir sollten jede Möglichkeit nutzen, uns Wien als Heimstatt zu erhalten. Aber es ist zu gefährlich hierzubleiben, solange wir nicht mehr über die Türken wissen. Wir machen es so, wie du gesagt hast. Leonard bleibt mit seinen Nachkommen hier und steht den Verteidigern bei. Wir gehen vorerst zurück nach Flandern und warten dort, bis der Spuk vorbei ist.«
»Ja, Herr.« Sie wandte sich wieder mir zu und legte die Hand auf meine Schulter. »Aber du, Leonard, musst mir versprechen, dass du dich ebenfalls zurückziehst, sobald du merkst, dass die Stadt trotz aller Anstrengungen nicht mehr zu halten ist. Ich könnte es nicht ertragen, dass du dich hier in höchste Gefahr begibst, während wir in der Ferne ausharren.«
Ich starrte sie an. Wollte ihr ins wunderschöne Antlitz brüllen, sie sollte mir ihre Heucheleien ersparen. Mir stattdessen ins Gesicht sagen, dass sie hoffte, die Türken würden mich vernichten und ihr auf diese Weise endgültig den Sieg im Kampf um die Gunst unseres Blutsvaters sichern. Doch ich blieb stumm. Nickte nur und fügte mich meinem Schicksal.
Bereits in der folgenden Nacht begaben die beiden sich mit dem Großteil unserer Dienerschaft auf die Reise. Lang sah ich den Kutschen hinterher und rang mit der Entscheidung, was ich tun sollte. Doch letztlich hatte ich gar keine Wahl. Mein Herr und Meister hatte mir unzweifelhafte Anweisungen gegeben und ich war nicht in der Lage, mich dagegen aufzulehnen. Nicht einmal, nachdem er weg war.
Also blieb ich in Wien zurück und beobachtete Nacht für Nacht, wie die Feinde näher rückten und die Stadt in den Würgegriff der Belagerung nahmen. Zum Glück führten sie nur leichte Kanonen mit sich, denen die alten Wehrmauern mehr schlecht als recht standhielten.
Doch unter den Osmanen befanden sich Spezialisten, die in den modernsten Belagerungstechniken bewandert waren. Sie gruben Tunnel unter die Fundamente der Befestigungen, in denen sie große Mengen Schießpulver einlagerten und zur Explosion brachten. Die einzig mögliche Abwehr gegen diese Strategie bestand darin, dass die Verteidiger ihrerseits unterirdische Gänge aushoben und versuchten, die Stollen der türkischen Mineure aufzuspüren. Auf diese Weise entbrannte unter den Mauern Wiens ein Krieg im Dunkeln, der tags wie nachts mit unerbittlicher Härte geführt wurde.
Sobald einer der Tunnel der Belagerer aufgespürt wurde, drangen die kaiserlichen Soldaten schwer bewaffnet hinein und machten jeden Gegner erbarmungslos nieder. Mir und meinen beiden Nachkommen ermöglichte diese Form der Kriegführung, unmittelbar am Kampfgeschehen teilzuhaben. So waren wir nicht gezwungen, ohnmächtig mit ansehen zu müssen, wie die Schlachten des Tages ausgegangen waren. Wir waren wie geschaffen für die Kämpfe in der Finsternis. Zusammen mit unseren Unholden standen wir an der vordersten Front, gruben, fochten und labten uns im Dunkel der Tunnel am Blut unserer Feinde.
Zwar hatte ich mir in den vergangenen Jahren die Bedienung der neuen Feuerwaffen angeeignet, doch meine Stärke lag unzweifelhaft im Kampf mit der Klinge. In den Tunneln konnte ich meine Fertigkeiten voll ausschöpfen. Da die Türken Unmengen von Schießpulver in die Gänge brachten, wagten weder Freund noch Feind, hier unten eine Pistole oder Arkebuse abzufeuern.
Wir merkten jedoch bald, dass wir nicht die einzigen unserer Art waren, die an dem Krieg teilnahmen. Mehrfach trafen wir auf Unholde unter den Janitscharen, die die Stollen und Minen erbittert gegen unsere Stoßtrupps verteidigten. Damit wurde Gewissheit, was wir die ganze Zeit befürchtet hatten: Unter den Osmanen befanden sich ebenfalls Nocturni.
Für die Sterblichen, die mit und gegen uns fochten, war es die Hölle. Als ob es nicht schlimm genug gewesen wäre, in den engen Stollen gegen menschliche Gegner antreten zu müssen. Nun wurden sie zusätzlich von bluttrinkenden Monstern gejagt, deren Kampfeskraft kaum einer von ihnen auch nur annähernd gewachsen war. Doch auch wir mussten Verluste hinnehmen. Wenige Nächte, nachdem einer meiner beiden verbliebenen Nachkommen nicht aus den Tunneln zurückgekehrt war, musste ich mit ansehen, wie sein Blutsbruder von feindlichen Unholden in Stücke gerissen wurde. Ich rächte ihn umgehend. Doch seinen arg geschundenen Leib vermochte auch mein Blut nicht mehr zu heilen.
So stand ich nun allein auf dem Wehrgang. Mein Blick fiel auf die Breschen, die die Türken bereits in die Mauern gesprengt hatten. Hinter improvisierten Palisaden hielten mehrere Pikeniere Wache. Bislang hatten die Verteidiger es geschafft, die Löcher in den Wällen erfolgreich gegen alle Angriffe zu halten. Hierbei konnte ich ihnen nicht zu Hilfe kommen, denn die oberirdischen Attacken der Janitscharen fanden stets tagsüber statt. Ich musste mich auf das beschränken, was in meiner Macht stand. Die Türken daran hindern, weitere Teile der Stadtmauern zum Einsturz zu bringen.
Ich rückte mein Kettenhemd zurecht, zog die Sturmhaube auf den Kopf und zurrte meinen Waffengurt fest. Warf einen letzten Blick über die von unzähligen Lagerfeuern gesprenkelte Zeltstadt, die sich auf den Feldern vor Wien erstreckte. Dann stieg ich vom Wehrgang hinab und ging zum Eingang des Stollens in die Tiefe. Ludwig, mein treuer Diener und einzig Verbliebener meiner Unholde, erwartete mich bereits. Seine beiden Äxte waren noch befleckt vom getrockneten Blut der Gegner, die er in der letzten Nacht in Stücke gehauen hatte. Wortlos hielt er mir seinen leeren Becher hin. Ich biss mir in die Hand und füllte das Gefäß zur Hälfte mit meinem Blut. Ludwig grinste und entblößte dabei seine fauligen Zähne, bevor er den Becher mit einem einzigen gierigen Zug leerte. Kein Tropfen entging seiner fleckigen Zunge, mit der er sich ausgiebig über die Lippen leckte. Dann nickte er mir zu, packte seine Äxte und ging voraus in die Dunkelheit.
Der Kampf konnte beginnen.
Donnerstag, 26. Mai 2005, Washington DC, USA
Das Gewicht der Schwertscheide, die unter dem gepanzerten Mantel des Todesboten an meiner Seite hängt, beruhigt mich ein wenig, während ich wieder einmal durch unvertrautes Territorium wandere.
Ich habe zwar amerikanischen Boden betreten. Doch Washington D.C. ist mir nahezu ebenso fremd wie die modernen Metropolen Europas. Legt man die vorherrschende Architektur als Maßstab an, dann würde die Hauptstadt der Vereinigten Staaten ohnehin besser in die Alte Welt passen als nach Amerika. Aufgrund eines Gesetzes, das es allen Bauherren der Stadt verbietet, mit ihren Werken die Kuppel des altehrwürdigen Kapitols aus der Zeit des Bürgerkrieges zu überragen, entbehrt Washington jeglicher Wolkenkratzer. Das einzige Bauwerk der Stadt, das noch höher in dem Himmel ragt, ist das Washington Monument. Es steht in der Mitte der ›The Mall‹ genannten Parkanlage zwischen dem Weißen Haus, dem Lincoln Memorial und eben dem Kapitol, dessen herausragende Stellung in der Skyline gesetzlich geschützt ist. Zu nächtlicher Stunde feierlich erleuchtet markiert der gewaltige Obelisk, der seine ägyptischen Vorbilder bei Weitem überragt, das Zentrum der Stadt und war schon während der Taxifahrt vom Flughafen hierher weithin zu sehen.
Der Taxifahrer hat mich ein paar Blocks entfernt von der Adresse abgesetzt, die wir in Bruce Randalls Akten gefunden hatten. Die verbliebene Strecke lege ich zu Fuß zurück. Auf diese Weise hoffe ich, etwas weniger Aufsehen zu erregen. Oder zumindest, den Zeitpunkt, ab dem ich Aufsehen erregen werde, hinauszuzögern. Ich gehe nicht davon aus, dass mein Besuch friedlich verlaufen wird.
Dass ich keine Ahnung habe, was mich an meinem Ziel erwartet, steigert nicht gerade meine Zuversicht. Seit ich bei Sonnenuntergang in meinem Sarg in der Kabine des Businessjets aufgewacht bin, ist mir mehrmals der Gedanke gekommen, dass mein Besuch hier eigentlich reiner Wahnsinn ist. Meinem Vorsatz, mich von nun an der Strategien der Archaioi zu bedienen, läuft er jedenfalls arg zuwider. Übermäßige Risikobereitschaft hat sicherlich bei keinem Nocturnus zur Erlangung eines herausragenden Alters beigetragen. Auf der anderen Seite gibt es wenige von uns, die sich mit mir im direkten Zweikampf messen können, so dass ich das eine oder andere Wagnis wohl eingehen kann. Meine Kampfeskraft und die Klinge an meiner Seite sind in jedem Fall hilfreich, aus eventuellen brenzligen Situationen wieder herauszukommen.
Ich bin nicht allein auf meinem Streifzug. Die frühsommerlich laue Nacht lockt zahlreiche Nachtschwärmer auf die Straßen. Ich versuche, sie im Auge zu behalten, ohne allzu aufdringlich um mich zu blicken. Nicht auszuschließen, dass ich nicht der einzige Unsterbliche bin, der sich unter den Spaziergängern verbirgt. Als Eindringling in fremdes Territorium ist es überlebenswichtig, mögliche Gegner auszumachen, bevor man selbst entdeckt wird. Doch alle Passanten wirken unverdächtig.
Als ich in die Straße einbiege, in der sich mein Ziel befindet, erhöhe ich meine Wachsamkeit erneut. Falls sich hinter der Adresse tatsächlich eine Zuflucht meiner Feinde verbirgt, muss ich spätestens jetzt mit Gegenwehr rechnen.
Die schwarze Limousine mit den getönten Scheiben, die im Licht einer Straßenlaterne parkt, ist nicht zu übersehen und versetzt mich in höchste Alarmbereitschaft. Fußgänger kann ich keine ausmachen. Dafür entdecke ich in dem Kombi auf der Straßenseite gegenüber zwei Personen. Sich dem Eingang ungesehen zu nähern, ist aussichtslos.
In der Hoffnung, noch nicht entdeckt zu sein, ducke ich mich hinter eines der am Straßenrand geparkten Autos und überblicke die Straße. Die Häuser stehen dicht an dicht, aber sie haben zumeist nur ein oder zwei Stockwerke. Zu niedrig, um über die Dächer zu klettern, ohne von den beiden Beobachtern gesehen zu werden. Der Bürgersteig ist von einzelnen Bäumen und weiteren Fahrzeugen gesäumt. Aus meiner Deckung heraus versuche ich zu ergründen, wie weit ich mich ebenerdig an meine mutmaßlichen Gegner heranschleichen kann, und lege mir im Geiste eine Strecke zurecht. Gebückt beginne ich, mich von Deckung zu Deckung voranzuarbeiten. Ich halte dabei stets Ausschau nach Beobachtern in Autos oder hinter den Fenstern der Reihenhäuser, entdecke jedoch niemanden.
Bis auf weniger als zehn Meter komme ich an die Limousine heran. Aus dieser Entfernung erahne ich hinter den dunklen Scheiben die schemenhaften Umrisse einer weiteren Person. Macht zusammen drei Gegner. Und ich habe keine Ahnung, wie viele sich noch im Inneren des Hauses befinden.
Es wird Zeit herauszufinden, wie überlegen meine Fähigkeiten wirklich sind.
Aus der Hocke heraus sprinte ich geduckt zu der Seite der Limousine, die den Hauseingängen zugewandt ist. Ich warte nicht auf eine Reaktion meiner Gegner, sondern packe den Türgriff des Wagens und zerre mit aller Kraft daran, während ich mich mit dem Fuß abstütze. Wie erwartet ist das Fahrzeug gepanzert und verfügt über verstärkte Schlösser. Doch unter der rohen Gewalt meiner übermenschlichen Muskeln gibt die Tür langsam nach, bis sie schließlich ausreißt und mir mit Schwung entgegenkommt. Ich finde zügig mein Gleichgewicht wieder und stürze mich in das nun offenstehende Innere des Wagens. Der in einen schwarzen Maßanzug gekleidete Mann auf dem Fahrersitz stiert mich vollkommen entgeistert an. Ich rieche seine Panik, seinen Schweiß, höre sein Herz wild pumpen. Ein Sterblicher. Er wird mir nicht widerstehen können.
»Aussteigen! Lauf so schnell und weit du kannst!«
Ich habe den Befehl kaum ausgesprochen, da entriegelt er bereits die Fahrertür, stemmt sie auf und stolpert hektisch über die Straße davon. Wenn meine Anordnung den persönlichen Wünschen meines Opfers entgegenkommt, ist der Böse Blick immer besonders effektiv.
Bleiben noch zwei.
Ich erhebe mich und spähe über das Dach der leeren Limousine. Die Männer in dem Kombi auf der anderen Straßenseite springen gerade aus den Türen. Beide ziehen Pistolen. Sie tragen einfache Straßenkleidung und Lederjacken. Am Gürtel desjenigen, der mir entgegenkommt, entdecke ich eine Dienstmarke der Polizei. Vermutlich ebenfalls Sterbliche.
Nachdem die Zivilpolizisten kurz dem wild flüchtenden Fahrer der Limousine hinterher gegafft haben, wenden sich beide nahezu gleichzeitig mir zu.
Ich deute auf den Fliehenden. »Ihm nach!«
Einer der Beamten setzt sich sofort in Bewegung. Dem anderen bedeute ich mit einer Kopfbewegung, sich seinem Kollegen anzuschließen. Ich kann in seinem Gesicht sehen, wie der Widerstand schmilzt. Dann läuft auch er los.
Das wäre erledigt. Bis hierhin sogar ohne Blutvergießen.
Eilig schaue ich mich um, ob sich weitere Gegner zu erkennen geben, die ich vorher noch nicht entdeckt habe. Aber abgesehen von den drei sich schnell entfernenden Männern bleibt die Straße leer.
Ohne Zeit zu verlieren, wende ich mich dem Haus zu. Zwei Stockwerke. Reiche Stuckverzierungen rund um Türen und Fenster. Vermutlich spätes neunzehntes Jahrhundert. Die Nummer entspricht der Adresse aus Bruce Randalls Akten. Ich bin am Ziel.
Im ersten Stock schiebt jemand den Vorhang zur Seite und sieht zu mir hinunter. Eine Frau. Schätzungsweise um die vierzig Jahre alt. Schulterlange hellblonde Haare. Lange Fangzähne. Eine von uns.
Unsere Blicke treffen sich. Ihre Augen verengen sich zu Schlitzen. Ich neige den Kopf zum Gruß und zwinge ein Lächeln auf meine Lippen. Höflichkeit muss sein.