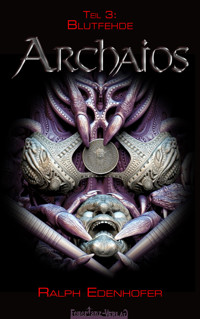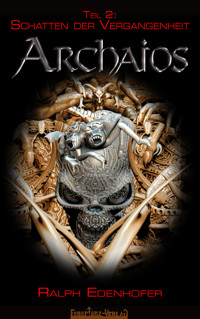
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FeuerTanz-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ich bin der Älteste der Unsterblichen von New York. Ich bin der Richter der Stadt. Mein Wort ist Gesetz. Zumindest war das so, bis ein Feind aufgetaucht ist, um meinen Platz einzunehmen. Mein Name ist Leonard von Montesaro. Doch die meisten meiner Art nennen mich den Templer. Aber reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Ich habe einen Tritt in den Allerwertesten bekommen. Und zwar einen heftigen. Doch wegen einer verlorenen Schlacht aufgeben? Wer das glaubt, der kennt den Templer schlecht. Ohne Hilfe wird es allerdings schwer. Und dem Einzigen, der mir gegen diesen Feind helfen kann, wollte ich eigentlich niemals wieder unter die Augen treten. Aber ich habe keine Wahl. Also kehre ich zurück in die Alte Welt und stelle mich den Schatten meiner Vergangenheit. Und ja, diese Vergangenheit hält viele Schatten bereit. Schatten, die beharrlich den Weg des Tempelritters begleiten, der ich einst gewesen bin. Schatten, die nicht nur mich, sondern am Ende den gesamten Orden ins Verderben führen. Schatten, die gefüllt sind von Blut und Tod. Teil 2 der Fantasy-Reihe ARCHAIOS
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Teil 2: Schatten der Vergangenheit
Ralph Edenhofer
Inhalt
Was bisher geschah
Archaios, Teil 1: Monster in der Dunkelheit
Schatten der Vergangenheit
Sonntag, 15. Mai 2005, New York City, USA
Sommer 1125, Jerusalem, Königreich der Kreuzfahrer
Sonntag, 15. Mai 2005, New York City, USA
Sommer 1125, Jerusalem, Königreich der Kreuzfahrer
Mittwoch, 18. Mai 2005, über dem Atlantik
Sommer 1187, Jerusalem, Königreich der Kreuzfahrer
Freitag, 20. Mai 2005, Paris, Frankreich
Herbst 1189, Akkon, Königreich der Kreuzfahrer
Freitag, 20. Mai 2005, Paris, Frankreich
Frühjahr 1204, Konstantinopel, Byzantinisches Kaiserreich
Samstag, 21. Mai 2005, Paris, Frankreich
Frühjahr 1204, Konstantinopel, Lateinisches Kaiserreich
Montag, 23. Mai 2005, Wien, Österreich
Herbst 1307, Montpellier, Königreich Frankreich
Dienstag, 24. Mai 2005, Wien, Österreich
Sommer 1477, Dijon, Herzogtum Burgund
Wie geht es weiter?
Danke
Zum Autor
Personenverzeichnis
New York
Kreuzzug
Paris
Königreich Frankreich und Herzogtum Burgund
Impressum
Archaios
Teil 1: Monster in der DunkelheitTeil 2: Schatten der VergangenheitTeil 3: Blutfehde
Um keine Neuerscheinung aus der Feder von Ralph Edenhofer zu verpassen, gibt’s hier die Anmeldung zum Newsletter: http://eepurl.com/hKnuUH.
Was bisher geschah
Archaios, Teil 1: Monster in der Dunkelheit
Mein Name ist Leonard von Montesaro. Ich bin das, was man landläufig einen Vampir nennt, auch wenn diese Bezeichnung unter meinesgleichen nicht gern verwendet wird.
Seit nunmehr neun Jahrhunderten wandele ich über die Welt. Als Sterblicher habe ich am ersten Kreuzzug teilgenommen und Jerusalem für die Christenheit erobert. Ich bin ein Tempelritter geworden. Doch meine Gegner waren übermächtig und unmenschlich. Um gegen sie antreten zu können, musste ich so werden wie sie – ein unsterbliches Monster, das sich von Blut ernährt.
Aber die Alte Welt habe ich schon lang hinter mir gelassen. Seit zwei Jahrhunderten lebe ich in New York. Hier bin ich der Älteste meiner Art. Und der Richter. Ich sorge dafür, dass unsere Gesetze eingehalten werden. Dass keiner der unseren über die Stränge schlägt. Und wer es dennoch tut – nun, die Unsterblichkeit kann schnell vorbei sein für die Unvorsichtigen.
Doch als ich einen marodierenden jungen Vampir zur Strecke bringe und seinen Erzeuger suche, stellt sich heraus, dass meine Herrschaft über die Stadt, die niemals schläft, infrage gestellt wird. Einer der Alten, ein Archaios – Marduk mit Namen – fordert mich heraus. Und die erste Runde in unserem Ringen geht eindeutig an ihn. Unsere Begegnung habe ich nur durch Flucht überstanden. Seine Verbündeten haben meine Zuflucht angegriffen und unbrauchbar gemacht. Zusammen mit meiner letzten Getreuen, der Neugeborenen Veronica, muss ich mich in einer Besenkammer im Keller des Empire State Buildings verstecken, um meinen Feinden und der Sonne zu entkommen. Nicht unbedingt die besten Voraussetzungen für den weiteren Kampf. Aber so schnell gebe ich nicht auf.
Schatten der Vergangenheit
Sonntag, 15. Mai 2005, New York City, USA
Pfingstsonntag ist einer der wenigen Tage im Jahr, an denen ich üblicherweise den Glauben pflege, dem ich einst mein Leben gewidmet hatte. Zu der Zeit, da ich als Sterblicher über die Erde gewandert bin, stellte niemand die Wahrheit der Geschichten in der Bibel infrage. Nicht, dass viele Menschen damals gewusst hätten, was in der Heiligen Schrift stand. Außerhalb der Mauern der Klöster konnte kaum jemand lesen, geschweige denn Latein, die einzige Sprache, in der das Wort Gottes niedergeschrieben war. Auch die Gottesdienste wurden ausschließlich in Latein gehalten. Und dennoch waren die Menschen von tiefem, fest verwurzelten Glauben erfüllt. Niemand hat an der Existenz Gottes gezweifelt und selbst diejenigen, die man als Ketzer bezeichnete, stritten letztlich nur für eine andere Auslegung der Evangelien.
Nicht einmal meine Verwandlung in einen Vampir, wie man uns später nannte, hatte meine Gottesfurcht erschüttern können. Erst viel später habe ich begonnen, Zweifel zu hegen, und dies nicht aus eigenem Antrieb, sondern aufgrund der Schriften der Aufklärung. Dabei stellt allein schon meine Existenz jedes Wort der Bibel infrage. Und dennoch habe ich die Jahrhunderte lange Prägung durch die Predigten vom Herrn niemals vollständig ablegen können. Ich will es auch gar nicht.
Bei allen Zweifeln beruht das letzte bisschen Hoffnung, an dem ich mich verzweifelt festklammere, darauf, dass selbst einer Kreatur wie mir Vergebung zuteilwerden kann. Und so suche ich wenigstens an den hohen Feiertagen des Christentums üblicherweise eine Kirche auf.
Einer der zahlreichen Punkte, in denen die unter den Sterblichen verbreiteten Vampirmythen glücklicherweise falsch sind, ist die Abneigung gegen Kruzifixe und andere heilige Symbole. Ich verspüre beim Anblick des Gekreuzigten keinerlei Furcht. Zumindest nicht darüber hinaus, dass ich keine Ahnung habe, was mit meiner Seele geschehen wird, sollte ich doch eines Tages diese Welt verlassen. Sofern ich überhaupt über eine Seele verfüge. Meist verdränge ich diese quälenden Fragen, deren Antworten mir trotz meines langen Daseins verschlossen bleiben. Befasse mich lieber mit weltlicheren Problemen. Nur zu eben jenen speziellen Tagen wie Pfingsten gönne ich mir meine ganz persönlichen theologischen und philosophischen Studien, auch wenn sie mich den Lösungen bisher kein Stück näher gebracht haben. Doch ich befürchte, zunächst werde ich mich heute keinen Glaubensfragen widmen können. Drängendere Problem erfordern meine Aufmerksamkeit, wie mir die Eimer und Besen, zwischen denen ich erwache, eindringlich mitteilen.
»Guten Morgen … nee … Abend. Ach, das bringe ich immer noch durcheinander.«
Die Belustigung in Veronicas Stimme kann ich momentan nicht teilen.
»Mal ’ne Frage«, fährt sie etwas weniger beschwingt fort. »Hast du eigentlich kein Notfallversteck, falls mit deiner Wohnung mal was ist?«
»Doch.« Ich schaue mich in der Besenkammer um. »Das hier.«
Sie wirkt enttäuscht. »Warum nichts Luxuriöseres? Ich dachte, an Geld mangelt es nicht bei dir.«
»Tut es auch nicht. Aber ich bin auch noch nicht völlig verweichlicht. Das hier funktioniert doch.«
Sie zuckt die Achseln. Da keine weiteren Anmerkungen kommen, ist das Thema wohl abgehakt.
Mit einer schwungvollen Bewegung erhebe ich mich, verlasse das zugegebenermaßen nicht sonderlich würdige Tagesquartier kommentarlos und schaue mich um. Auch der Rest des Heizungskellers zeigt keine Anzeichen, dass man hier nach uns gesucht hätte. Eigentlich sollte ich froh sein. Allein die Tatsache, dass wir den Tag unbeschadet überstanden haben, stellt unter den aktuellen Umständen schon einen ausgesprochenen Glücksfall dar. Das war alles andere als selbstverständlich, als wir uns am vergangenen Morgen hier verkrochen haben. Dennoch bin ich nicht sonderlich erfreut. Die Ereignisse der letzten Nacht stellen das im Großen und Ganzen recht angenehme Dasein, das ich in den zurückliegenden hundert Jahren geführt habe, auf ausgesprochen unschöne Weise infrage. Aber immerhin leben wir noch. Das eröffnet uns die Möglichkeit zurückzuschlagen. Zumindest theoretisch.
Die Tasche, in der sich unsere Waffen befinden, in der Hand, marschiere ich mit weit ausholenden Schritten in Richtung Kellerausgang. Veronicas Gebrummel über mein unfreundliches Verhalten ignoriere ich, während sie hinter mir her die Treppe hinauf trottet.
In der Eingangshalle des Empire State Buildings deutet nichts mehr auf den Zwischenfall der vergangenen Nacht hin. Die meisten Touristen und Büroangestellten der ansässigen Firmen streben dem Ausgang entgegen. Veronicas Augen wenden sich dem Fahrstuhl zu, bevor sie sie nach oben dreht und mich anschließend fragend ansieht.
Ich beantworte ihre stumme Frage, ob wir zu meinem Appartement fahren, mit einem Kopfschütteln. »Nicht auszuschließen, dass sie dort auf uns warten.«
Meine jungblütige Begleiterin ist anderer Meinung. »Na und? Schnappen wir sie uns und quetschen sie aus!«
»Das gibt nur unnötigen Ärger. Davon hatte ich vergangene Nacht genug. Außerdem haben wir schon eine Ahnung, in wessen Auftrag sie handeln. Mehr werden wir von ihnen nicht erfahren. Die Sterblichen sind nur Handlanger. Und falls Massoud und seine Unholde oder andere Blutsauger uns da oben eine Falle gestellt haben, um zu vollenden, was ihren menschlichen Killern gestern nicht gelungen ist … Nein. Vergangene Nacht sind wir für meinen Geschmack zweimal zu knapp dem endgültigen Tod entronnen. Bevor ich mich erneut einem Kampf stelle, will ich erst mal mehr darüber erfahren, mit wem wir es zu tun haben. Lass uns gehen!«
Mit einem Schulterzucken fügt sie sich.
Wir verlassen den Wolkenkratzer und betreten die Straße. Es regnet nicht, doch die Kleidung der Passanten und die Pfützen auf dem Pflaster belegen, dass dies noch nicht lange so ist. Dunkle Wolken ziehen eilig über das kleine Stück schwarzen Himmels, das zwischen den hoch aufragenden Fassaden zu sehen ist.
»Und was hat der Obervampir nun vor?«
Der Sarkasmus in Veronicas Stimme verführt mich, ihr meine Klauen in die Kehle zu treiben. Doch ehe ich mitten auf der belebten Straße meine Beherrschung verliere, habe ich mich wieder unter Kontrolle. Ich beschränke mich auf einen tadelnden Blick und ein unterschwelliges Knurren, das außer ihr niemand hören kann. Mir wird bewusst, wie reizbar ich bin. Die aktuelle Situation zehrt an der Fassade der Menschlichkeit, die mich davor bewahrt, dem nächstbesten Passanten die Kehle aufzureißen. Ich muss aufpassen, dem Mob keinen Anlass zu liefern, die Fackeln und Mistgabeln auszupacken und Scheiterhaufen aufzuschichten. Ich mahne mich zur Vorsicht. Ein derartiger Eklat wäre das, was ich im Augenblick am wenigsten gebrauchen kann.
Ohne Veronica eine Antwort zu geben, hole ich mir eine Tageszeitung aus dem nächsten Ständer. Ich bin schon wieder auf der Titelseite. Bereits zum zweiten Mal in dieser Woche. Das ist nicht gut.
Beim Überfliegen des Textes entspanne ich mich ein wenig. Ludovicz scheint gute Arbeit geleistet zu haben. Das Ausmaß des Massakers ist deutlich heruntergespielt. Keine Zeile deutet auf mich oder die Existenz bluttrinkender Monster hin. Wenigstens eine positive Nachricht.
»Und das soll investigativer Journalismus zur zuverlässigen und lückenlosen Information der Allgemeinheit sein?«, merkt Veronica süffisant an, die über meine Schulter hinweg mitgelesen hat.
Muss sie ausgerechnet heute so gute Laune haben?
»’Tschuldigung.« Mühevoll unterdrückt sie ein Grinsen, als sie meinen Gesichtsausdruck offensichtlich richtig deutet.
Mürrisch rolle ich die Zeitung zusammen und stecke sie in meine Manteltasche. Dann steuere ich die U-Bahn an.
»Haben wir noch einen Augenblick Zeit?« Veronica ist hinter meinen weit ausholenden Schritten ein paar Meter zurückgefallen.
Ich halte an und drehe mich zu ihr um. Sie deutet auf die andere Straßenseite in Richtung eines Internetcafés.
»Was ist denn so dringend?«, will ich wissen.
»Ich wollte was nachsehen. Wegen Marduk. Ich hab den Namen schon mal irgendwo gehört.«
»Bevor du ihm begegnet bist?«
Sie verdreht die Augen. »Ja.«
Woher sollte sie den Namen eines alten Vampirs kennen, von dem selbst ich noch nie gehört habe? Ich gehe davon aus, dass sie da irgendetwas durcheinanderbringt. Aber auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass sie tatsächlich etwas über meinen scheinbar übermächtigen Gegner herausfinden kann, bin ich für jede Information dankbar. Was habe ich zu verlieren? Ich nicke und folge ihr über die Straße.
Als wir den Raum mit den rund zwanzig Computern betreten, von denen weniger als die Hälfte besetzt ist, kommen mir neue Zweifel. Auskünfte über Vampire sollte man eigentlich nicht im Internet finden. Zumindest nichts Konkreteres als die üblichen Mythen und Horrorgeschichten. Nicht, dass ich viel Erfahrung mit Computernetzen hätte. Doch ebenso wie für Zeitungen gelten die Ewigen Gesetze auch für digitale Medien. Die Geheimhaltung unserer Existenz gehört zu den fundamentalen Regeln der Nocturni. Und dann ausgerechnet Informationen über einen der Archaioi? Unwahrscheinlich. Aber da wir nun schon mal da sind, lasse ich meine eifrige Mitstreiterin gewähren.
Ich stelle mich hinter den Stuhl, auf dem sie Platz nimmt. Sie beginnt, die Tastatur zu malträtieren. Die Verblüffung, als innerhalb von Sekunden der Name Marduk vielfach auf dem Bildschirm erscheint, lässt meine Gesichtszüge entgleisen.
»Voilà!«, triumphiert Veronica, bevor wir beide beginnen, die Texte unter dem Namen zu lesen. Mir gefällt ganz und gar nicht, was ich dort sehe.
»Stadtgott des antiken Babylon … Seit der Herrschaft des Hammurabi im zweiten Jahrtausend vor Christus Aufstieg zum obersten Gott des Zweistromlandes … Wohnsitz in der Ziggurat, dem Tempelturm von Babylon …« Veronica liest die essentiellen Informationen laut vor. »Ha! Jetzt weiß ich auch wieder, wo ich den Namen gehört habe. Da war eine Reportage im Fernsehen über den Turmbau zu Babel.« Das Grinsen, mit dem sie sich zu mir umsieht, ist fast schon überheblich. »Du solltest mehr History Channel gucken!«
Meine versteinerte Miene dämpft ihre Fröhlichkeit nur geringfügig, als sie fortfährt: »Der Kerl kommt hierher und gibt sich den Namen eines babylonischen Gottes? Ganz schön großkotzig.«
»Lass uns rausgehen!«, presse ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und gehe zum Ausgang. Veronica bezahlt unseren kurzen Aufenthalt und folgt mir in die angenehme Kühle der Straße.
»Was ist?«, fragt sie, während wir nebeneinander hergehen.
»Ich bin nicht sicher, ob er sich erst hier den Namen eines antiken Gottes gegeben hat.« Der Verdacht, den ich hege, sorgt dafür, dass mein totes Herz sich noch kälter anfühlt.
»Sondern?«
Ich brauche ein paar Sekunden, um die Gedanken zu ordnen, die mir durch den Kopf schießen, bevor ich beginne. »Mein Erzeuger, Vitus, hat mir einst erzählt, dass früher viele Nocturni sich mit ihren Nachkommen und Sterblichen umgeben haben und sich von ihnen als Götter verehren ließen. So ähnlich, wie Howard es auf Staten Island macht, aber in weit größerem Ausmaß. Einige von ihnen kennt man noch heute, wenn auch verborgen hinter Mythen und Legenden.«
»Nocturni?«
»Die Nächtlichen. So hat man unseresgleichen damals genannt.«
Nach einer kurzen Pause wird Veronica die Tragweite meiner Erzählung bewusst. Sie bleibt stehen und fixiert meine Augen. »Willst du damit sagen, der Kerl, der da oben in seiner blutigen Badewanne sitzt, hat vor ich weiß nicht wie vielen tausend Jahren auf dem Turm von Babylon gehockt und sich Menschenopfer anschleppen lassen?«
»Vermutlich nicht ganz so. Wie gesagt, die Wahrheit ist hinter Legenden verborgen. Aber der Kerl in der Blutbadewanne ist möglicherweise alt genug, um sich tatsächlich schon damals als Gott ausgegeben zu haben.«
Ihr gelingt es, in drei Worten die Quintessenz dieser Theorie zu formulieren. »Ach du Scheiße!«
Wir setzen uns wieder in Bewegung und steigen schweigend die Treppe zur U-Bahn-Station hinab. Meine Gedanken kreisen um die Tragweite unserer Entdeckung und führen nicht dazu, dass ich mich besser fühle. Wäre ich noch ein Mensch, würde ich erschaudern. Auf dem Bahnsteig in Richtung Downtown stellen wir uns in eine ruhige Ecke.
»Was will der Kerl hier?«, spricht Veronica die Frage aus, die auch mich beschäftigt.
»Das, was er dir erzählt hat. Er will herrschen. Er will meine Stadt.«
»Gibt es in euren Ewigen Gesetzen nicht irgendeinen Paragraphen dagegen, sich in der Stadt eines anderen breitzumachen?«
»Im Prinzip schon. Aber wer soll Marduk anklagen? Das wäre der Job des Richters, doch das bin ich. Was ich gegen ihn auszurichten vermag, haben wir gestern gesehen. Wenn er wirklich zwei- oder dreitausend Jahre oder noch älter ist … Wir können froh sein, dass wir da überhaupt wieder herausgekommen sind.«
Sie nickt nachdenklich. »Mal so ’ne Idee: Wenn du so gute Verbindungen zur Polizei hast, kannst du dann nicht veranlassen, dass die ein Sondereinsatzkommando in Marduks Bude schicken? Tagsüber muss der doch auch schlafen, oder?«
»Ganz so einfach ist es nicht«, widerspreche ich. »Ludovicz kann einiges in Bewegung setzen, aber ein Sondereinsatzkommando … Ich fürchte, das übersteigt seine Möglichkeiten. Zumindest ohne konkreten Anlass. Und außerdem, selbst wenn die da eindringen und Marduk wirklich wehrlos wäre und seine Tagwächter ihn nicht schützen … Was finden die Cops da?« Ich hebe die Augenbrauen. »Ein Becken voller Blut und scheinbare Tote, die entweder schon beim Abtransport zu Staub zerfallen oder in der folgenden Nacht die Leichenhalle, in der sie aufwachen, in Schutt und Asche legen? Ganz schlechte Idee. Das zu vertuschen, würde Ludovicz’ Möglichkeiten definitiv übersteigen. Nein, gegen Marduk kann ich keine Sterblichen in die Schlacht schicken. Das muss ich selbst erledigen.«
»Er scheint solche Bedenken nicht zu haben.«
»Ich bin nicht er.«
»Okay.« Sie belässt es dabei.
Ein Windstoß kündigt das Kommen der U-Bahn an und unterbricht unsere Unterhaltung. Wir steigen ein und besetzen zwei Stehplätze nahe dem Ausstieg. Die Tasche mit den Waffen platziere ich zwischen meinen Füßen.
»Wohin fahren wir eigentlich?«, will Veronica wissen.
»Zu Samantha. Sie ist eine von uns und hat einigen Einfluss in der Gemeinde.«
»Was hast du vor? Verbündete suchen?«
»Zuerst mal herausfinden, wie weit sich Marduks Anwesenheit bereits herumgesprochen hat. Wenn irgendwelche Gerüchte kursieren: Samantha kennt sie.«
»Ah, die lokale Klatschtante.« Veronicas Fähigkeit, Sachverhalte in einfachen, griffigen Formulierungen zu beschreiben, ist bemerkenswert.
Ich stelle mir Samanthas Gesichtsausdruck vor, sollte sie mit der Bezeichnung konfrontiert werden. Der Gedanke entlockt mir trotz meiner Anspannung ein Lächeln. »Wähle deine Worte in ihrer Anwesenheit bitte etwas bedachtvoller! Sie legt sehr viel Wert auf die Einhaltung der Etikette.«
»So wie Gianna?«
»Ja, aber aus anderen Gründen. Gegenüber Gianna Linaro ist die Formalität wichtig, damit wir uns zivilisiert verhalten, obwohl sie und ich einen vergleichbaren Status aufweisen. Samantha legt einfach nur Wert auf gutes Benehmen.«
»Sie ist aber von geringerem Rang als du.«
»Ja.«
»Wie wird das mit eurer Hackordnung eigentlich geregelt? Ist das eine Frage des Alters?«
»Alter ist wichtig. Aber auch die Fähigkeiten, die Ressourcen und die Abstammung spielen eine Rolle. Es ist kompliziert.«
»Und von wem stammt Samantha ab?«
»Von mir.«
Veronica grinst. »Sieh an. Noch mehr Familie.«
Als ich keine Antwort gebe, verharren wir einige Minuten in Schweigen, ehe Veronica die Unterhaltung fortsetzt. »Wie kommt es eigentlich, dass du noch nie von Marduk gehört hast? Ich meine, die offiziellen Informationen, babylonischer Gott und so. Ich dachte, gerade jemand wie du sollte sich mit Geschichte auskennen.«
»Ich kenne den Teil der Geschichte, den ich erlebt habe. Und das, was ich von Vitus und den anderen Archaioi gehört habe, denen ich begegnet bin. Von denen ist aber keiner so alt, dass er durch Babylon spaziert wäre. Mit dem Rest habe ich mich nie allzu intensiv beschäftigt.«
Veronica strahlt mich an. »Dafür hast du ja jetzt mich.«
Ihr Selbstbewusstsein ist fast schon befremdlich. So offen und ohne jeden Anflug von Furcht, ja geradezu respektlos, ist mir gegenüber lange niemand mehr aufgetreten. Zumindest niemand, dem ich nicht kurze Zeit später den Kopf von den Schultern getrennt habe. Doch ihre frechen Kommentare empfinde ich eher als erfrischend und amüsant. Es gelingt ihr, die düsteren Vorstellungen, die mein Denken derzeit beherrschen, in ihre Schranken zu weisen und mich zumindest kurzfristig zu erheitern. Ganz abgesehen davon, dass ihre Fähigkeiten wirklich hilfreich sind. All das ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass sie erst vor weniger als einer Woche auf höchst unsanfte Weise aus ihrem geordneten und beschaulichen Leben gerissen wurde, mit eigenen Händen ihren Lebensgefährten zerfleischt hat und mitten in einem Machtkampf rivalisierender Vampire gelandet ist, von denen einer sein Unwesen möglicherweise bereits im antiken Babylon getrieben hat.
»Warum hast du eigentlich so gute Laune?«, frage ich sie unumwunden.
Sie wird schlagartig ernst und wendet ihren Blick zu Boden.
»Noch gestern Abend hast du mir erzählt, du schaffst das alles nicht.« Ich schmunzele. »Und jetzt bist du diejenige, die mir Mut macht. Was ist passiert?«
»Gestern die Sachen …«, beginnt sie zögerlich und holt dann erst mal weiter aus. »Weißt du, ich habe mich schon immer gefragt, wozu mein Leben gut ist. Den Großteil meiner Jugend habe ich mich nur sinnlos herumgetrieben und zugesehen, dass ich irgendwie über die Runden komme. Das Einzige, was ich geleistet habe, war, bei der Polizei aufgenommen zu werden. Da war ich echt stolz drauf. Aber als ich dann auf Streife angefangen habe, war es wieder nur frustrierend. Die meisten Kollegen sind chauvinistische Machos. Und den ganzen Tag Verkehrsunfälle protokollieren und kleine Gangster festnehmen, die kurz danach eh wieder freigelassen werden, war nicht gerade weltbewegend. Die Vampirgeschichte war am Anfang auch nicht unbedingt aufbauend …« Ihre zuckenden Kiefermuskeln lassen erahnen, dass sie an Jason oder ihre anderen Missgeschicke denkt. Sie sieht mich an, als sie weiter spricht. »Gestern ist mir bewusst geworden, dass ich hier viel mehr auf die Beine stellen kann, als es mir als Mensch jemals möglich gewesen wäre. Ich kann etwas bewegen. Ich kann dir helfen, diesen babylonischen Drecksack dahin zu prügeln, wo er hergekommen ist. Ich kann die Menschen dieser Stadt davor bewahren, in seiner Badewanne zu enden. Ich habe eine Aufgabe. Mein Leben hat einen Sinn.«
Ich nehme ihre Hand in die meine und streiche mit dem Daumen über ihren Handrücken. Sie lächelt.
»Ich gehöre hierher«, fügt sie ihren Ausführungen hinzu.
Meine eigenen schmerzvollen Erfahrungen mit dem Schicksal oder dem, was ich in der Vergangenheit dafür gehalten habe, wecken meine Vorsicht gegenüber derartigen Bemerkungen. Ich weiß nur zu gut, wie sie sich fühlt. Aber ebenso gut weiß ich, dass sie nicht hierher gehört. Wenn es in meiner Macht läge, würde ich dieser aufrichtigen, jungen Frau ihr verlorenes Leben zurückgeben und ihr raten, sie solle es genießen, so gut sie kann. Doch es gibt kein Zurück. Sie ist eine von uns und wird es bis zu ihrem endgültigen Ende bleiben. Warum soll ich es ihr unnötig schwer machen und ihr sagen, dass sie sich irrt? Abgesehen davon bin ich wirklich froh, sie bei mir zu haben. Also schweige ich und erfreue mich weiter an dem Funkeln der Hoffnung in ihren Augen.
In Greenwich Village verlassen wir die U-Bahn. Auf der Straße treibt uns ein auffrischender Wind den Nieselregen ins Gesicht. Wir nehmen beide keine Notiz von dem Wetter, das die wenigen sterblichen Passanten dazu veranlasst, ihre Kragen hochzustellen oder Regenschirme aufzuspannen. Ich führe Veronica zum Eingang des Cauchemar und klopfe an die Stahltür des Kellereingangs. Während wir warten, fällt mein Blick auf das Rennmotorrad, das ein Haus weiter geparkt ist. Die Maschine kommt mir vage bekannt vor. Aber als Lucius’ breites Gesicht das sich öffnende Guckloch ausfüllt, schenke ich ihm meine Aufmerksamkeit.
»Guten Abend«, begrüße ich den Türsteher.
Er reagiert nicht.
»Dürften wir hineinkommen?«, füge ich hinzu. Es ist keine Frage, sondern eine freundliche Drohung. Er versteht sie als solche und schiebt den Riegel zur Seite.
»Dankeschön.« Ich nicke zuvorkommend.
An seinem Bauch vorbei arbeiten wir uns ins Innere des Clubs vor. Aus dem Augenwinkel studiere ich den Gesichtsausdruck des massigen Schwarzen. Er ist alles andere als erfreut. Ich bin heute wohl unerwünscht. Nicht mein Problem.
»Ist das die Sorte Bars, vor der meine Mutter mich immer gewarnt hat?« Fasziniert bestaunt Veronica die Samtvorhänge, die ich zur Seite schlage.
»Falls deine Mutter nicht wollte, dass du dich hungrigen Vampiren hingibst, damit sie von deinem Blut trinken, vermutlich ja.«
»Oh.«
»Lass besser die Finger von den Gästen, bevor wir weiter an deinen Tischmanieren gearbeitet haben!«, weise ich sie an. »Samantha legt Wert darauf, dass auch ihre sterblichen Kunden lebendig nach Hause zurückkommen.«
»Darf ich daran erinnern, dass ich gestern ruhig geblieben bin, während du deine Nachbarn abgeschlachtet hast?«
Ich will gerade ansetzen, ihr zu erklären, dass ich im Gegensatz zu ihr üblicherweise nicht beim Trinken in den Blutrausch falle, sondern wenn meine lang trainierten Kampfinstinkte geweckt werden.
Doch am letzten Vorhang vor der Bar stellt Samantha sich uns in den Weg. »Hallo Leonard. Wie ungewöhnlich, dich so bald schon wieder zu sehen. Nicht, dass ich mich nicht darüber freuen würde.«
Ihre Erscheinung ist wie immer makellos. Die hochgesteckten Haare sitzen ebenso perfekt wie das bodenlange schwarze Kleid, das sich eng an ihren schlanken Körper schmiegt. Das tiefe Dekolleté und der bis zur Hüfte reichende Schlitz geben den Blick auf viel weiße Haut frei. Eine Aussicht, die jeden Mann mit halbwegs gesundem Hormonhaushalt zur Verzweiflung treibt. Der Kontrast ihres durchgestylten Auftritts zu Veronicas zweckmäßiger Garderobe aus Jeans, Hoodie und Schnürstiefeln ist frappierend. Als würden beide in unterschiedlichen Welten leben. Samanthas verachtungsvoller Blick lässt keinen Zweifel daran, dass sie das ebenso sieht und nicht gewillt ist, dem Eindringling freiwillig Zutritt in ihr Reich zu gewähren. Doch ihre Wünsche stehen hier nicht zur Debatte.
»Wir müssen mit dir sprechen, Sam«, herrsche ich sie an.
»Wir?« Es ist erstaunlich, wie viel Abscheu sie in eine einzige Silbe zu legen vermag.
»Sam, das ist Veronica. Veronica, Samantha«, stelle ich die beiden kurz angebunden vor. »Können wir nun hinein?«
»Es … ist heute ein wenig ungünstig.« Die Unsicherheit in ihrer Stimme ist nur minimal und wäre jemandem, der sie weniger lang kennt als ich, vermutlich gar nicht aufgefallen. »Wäre es möglich, das zu verschieben?«
»Nein.« Ich wende den Bösen Blick nicht an, doch ich fixiere ihre Augen intensiv genug, um dies spontan ändern zu können. Nach und nach bröckelt ihr Widerstand. Dass sie sich mir überhaupt so heftig widersetzt, ist ungewöhnlich. Sie weiß, dass sie gegen mich keine Chance hat. Ich konzentriere mich darauf, hinter ihre kunstvoll geschminkte Fassade zu sehen. Gedanken lesen gehört, wie bereits erwähnt, nicht zu meinen Stärken. Wenn ich wissen will, was im Kopf meines Gegenübers vorgeht, befehle ich ihm üblicherweise, es mir mitzuteilen. Das ist effektiver, wenn auch nicht sonderlich subtil. Doch obwohl es bei Vampiren weitaus schwieriger ist als bei Sterblichen, kann ich Samanthas Angst geradezu riechen. Ich komme wohl wirklich in einem ungünstigen Augenblick. Sehr interessant. Ohne Gegenwehr lässt sie sich zur Seite schieben.
In der Bar sind nur wenige Gäste. Ich erkenne Samanthas Nachkommen Carl. Des Weiteren Zoë und Francis aus Brooklyn, den ältesten schwarzen Vampir der Stadt. Er ist, wie üblich, in seine altmodische Armeejacke mit Stehkragen gekleidet. Neben ihm lehnt der Wilde Jake mit nietenbesetzter Lederjacke und demonstrativem Pokerface lässig am Tresen und hebt zwei Finger an die Stirn, um mich zu begrüßen. Der Motorradhelm auf dem Tisch bestätigt meinen Verdacht bezüglich der Maschine vor dem Eingang.
Insgesamt steht uns ein repräsentativer Querschnitt durch die unsterbliche High Society von New York gegenüber. Ich bin zunächst erstaunt, keine Sterblichen zu sehen. Nicht einmal Candy, die sonst immer hinter der Bar steht, ist zugegen. Dann verstehe ich Samanthas Besorgnis. Wir sind in eine Versammlung geplatzt, zu der wir nicht eingeladen waren. Den Gesichtern der Anwesenden nach zu urteilen, sind wir nicht nur unerwartet, sondern sogar im höchsten Maße unerwünscht. Angesichts der aktuellen Lage in der Stadt ist das bedenklich.
Ich lasse meinen Blick über die Runde schweifen und fixiere die Augen jedes einzelnen im Raum. Keiner von ihnen hält mir lang stand. Damit wären die Formalitäten geklärt.
Ich wende mich Samantha zu. »Nette Gesellschaft heute Abend. Gibt es etwas, wovon ich wissen sollte?«
»Nein.« Ihr Einwand kommt zu schnell, als dass er beiläufig klingen würde. »Nur ein informelles Treffen.«
Sie wechselt das Thema und wird ein ganzes Stück gelassener, als sie sich meiner Begleiterin zuwendet. »Und eine gute Gelegenheit, unsere neue Freundin kennenzulernen. Hallo Veronica, willkommen im Cauchemar. Wir alle sind furchtbar neugierig, mehr über dich zu erfahren. Stammst du aus New York?«
Mit ihrem spontanen Wechsel von abgrundtiefer Verachtung zu übertriebener Freundlichkeit überrollt sie die Angesprochene wie ein Schnellzug. Die in höchstem Maße herablassende Verwendung des ›du‹ in dieser Situation entgeht Veronicas Aufmerksamkeit.
»Ähm, ja«, ist alles, was sie hervorbringt.
»Wie wundervoll. Wie lange bist du schon unter uns?«
Ich springe helfend zur Seite. »Sie ist mir bei einigen aktuellen Untersuchungen behilflich.«
»Als Futter?« Jakes Miene ist anzusehen, dass er seine gemurmelte Andeutung bereut, sobald sie seinen Mund verlassen hat. Als ich ihn angesichts der Unverschämtheit instinktiv anknurre, faucht er zurück.
»Bitte!« Samantha stellt sich demonstrativ zwischen uns, um erst gar keinen Streit entstehen zu lassen. »In diesem Haus wird keine Gewalt geduldet. Dies gilt auch für dich.« Sie funkelt mich an. »Dies ist eine Zusammenkunft gemäß den Ewigen Gesetzen. Halte dich bitte an die Regeln, Leonard!«
Schnell habe ich mich wieder unter Kontrolle und bringe ein überzeugendes Lächeln zustande. »In diesem Fall ist es als Gastgeberin deine Pflicht, denjenigen zurechtzuweisen, der die Provokation ausgesprochen hat.«
Sie fügt sich dem Protokoll und baut sich vor Jake auf. Er kämpft noch damit, die Beherrschung wieder zu erlangen. »Jake, noch so ein Ausrutscher und ich muss Euch bitten, die Zusammenkunft zu verlassen.«
Ich beäuge kurz die übrigen Anwesenden. Alle sind aufs Äußerste angespannt und sprungbereit. Das Einzige, was ihre Instinkte im Zaum hält, sind Samanthas Bemühungen, den Frieden zu wahren. Und die Zweifel, ob sie es alle zusammen mit mir aufnehmen könnten. Sie ahnen, dass meine scheinbare Gelassenheit nicht auf mangelnde Kampfbereitschaft schließen lässt. Möglichst unauffällig öffne ich den Reißverschluss der Tasche in meiner Hand, um im Notfall schnell an mein Schwert zu kommen.
Ein Klopfen an der Tür dringt durch die zahlreichen Stoffbahnen hinter dem Eingang und lässt alle aufhorchen. Nur Jake und ich widerstehen dem Drang, die Augen der Quelle des Geräusches zuzuwenden und starren uns an Samantha vorbei weiter feindselig an. Keiner regt sich, während wir zuhören, wie Lucius die Tür öffnet. Zwei Personen betreten den Club. Das scharfe Klacken eines Paars hoher Absätze deutet auf mindestens eine Frau hin. Ich drehe mich etwas zur Seite, um die Neuankömmlinge nicht im Rücken zu haben. Veronica nimmt eine gute Position ein, um meine Flanke zu decken. Ob dies auf ihre Polizeiausbildung oder ihre wachen Instinkte zurückzuführen ist, vermag ich nicht zu sagen. Es spielt auch keine Rolle, so lang ich mich auf sie verlassen kann.
Eine schlanke Frauenhand schiebt den letzten Samtvorhang zur Seite. Gianna Linaro betritt den Raum. Ich fahre blitzartig mit der Hand in die mittlerweile offene Tasche und schleudere noch beim Herausziehen meines Schwertes die Scheide von der Klinge.
»Leonard!« Samanthas gellender Schrei lässt mich innehalten. »Frieden, bitte! Das gilt für alle!«
Giannas zusammengekniffene, rot unterlaufene Augen und ihr weit aufgerissener Mund mit den langen Fangzähnen stehen im krassen Gegensatz zu ihrer Garderobe. Der maßgeschneiderte schwarze Hosenanzug ist definitiv nicht für körperliche Auseinandersetzungen geschaffen. Langsam senke ich die Schwertspitze. Auch Gianna gibt die Kampfstellung auf. Sie strafft ihre Kleider und rückt den Ausschnitt zurecht, um ihre gewohnte geschäftsmäßige Erscheinung wieder herzustellen.
»Seid gegrüßt, Templer.« Jedes Wort aus ihrem Mund ist von tiefer Feindseligkeit erfüllt und scharf wie ein Messer. »Ihr kennt Massoud ja bereits.«
Nach ihrer Ankunft bin ich nicht überrascht, als der dunkelhäutige Orientale durch den Samtvorhang tritt. Ihm ist anzusehen, dass er sich in dem Geschäftsanzug mit Krawatte nur bedingt wohl fühlt. Am liebsten würde ich ihm sofort die Klinge in die Eingeweide treiben. Doch durch die beiden Neuankömmlinge hat sich das Kräfteverhältnis im Raum erheblich verschoben. Bevor ich etwas unternehme, muss ich sicherstellen, dass nicht alle gleichzeitig auf Veronica und mich losgehen. Die kurze Auseinandersetzung mit Jake ist hierfür nicht unbedingt die beste Ausgangsposition.
»Interessante Gäste hast du hier, Samantha.« Ich wende die Augen nicht von meinen Feinden ab, während ich rede. »Gianna, ich muss Euch leider mitteilen, dass Euer kleines Attentat auf mich fehlgeschlagen ist.«
»Attentat?« In gespieltem Erstaunen hebt sie die Augenbrauen. »Wovon sprecht Ihr?«
»Ich weiß, dass das letzte Nacht im Empire State Building Eure Handlanger waren. Vindicator Security Services befindet sich doch in Eurem Besitz, oder? Es war ziemlich eindeutig, zu wem diese Leute gehörten.«
Sie hält meinem Blick stand. »Ich weiß nicht, worauf Ihr Euch bezieht, Templer. Aber falls ich meine Sicherheitsleute zu einem Attentat auf Euch schicken sollte, würde ich ihnen raten, Euch tagsüber anzugreifen.«
»Leugnen wird Euch nicht helfen. Ich weiß, was ich gesehen habe. Wie lange habt Ihr Euren Verrat schon geplant?« Ich bemühe mich um einen lässigen Plauderton. »Die Immobilientransaktion läuft ja bereits seit einiger Zeit.«
Sie ringt sichtlich mit sich, ob sie die unschuldige Fassade aufrechterhalten soll, ehe sie antwortet: »Eigentlich wollte ich die Sache Massoud und seinen Verbündeten überlassen. Aber Ihr musstet ja unbedingt in meinen Geschäften herumschnüffeln.«
Samanthas entnervte Stimme unterbricht unser Wortgefecht. »Dürfte ich fragen, was hier vorgeht?«
Ich antworte zuerst. »Gianna, wollt Ihr die Geschichte erzählen, wie Ihr dazu gekommen seid, Euch gegen den Richter Eurer Stadt zu stellen und ihm ein Mordkommando auf den Hals zu hetzen?«
»Zu Mordkommandos habe ich nichts zu sagen«, beharrt sie weiter. »Aber warum ich Euch nicht länger folge, erläutere ich gern. Zu diesem Zweck bin ich ja schließlich hergekommen.«
Sie wendet sich der allgemeinen Runde zu. Massouds Augen zucken immer wieder kurz von mir zu den übrigen Anwesenden. Er ist sich seiner Sache absolut nicht sicher und kann dies erheblich schlechter verbergen als Gianna. Ich widerstehe dem Drang, meinen Blick von ihm abzuwenden, und demonstriere damit meine Überlegenheit. Vielleicht gelingt es mir, ihn auf diese Weise zu einer Unachtsamkeit zu provozieren, die die anderen gegen ihn aufbringt. Doch vermutlich hat Giannas Geschichte hierauf einen größeren Einfluss.
»Die Herrschaft Leonards, des Templers, über Manhattan hat ein Ende. Ein weitaus Mächtigerer der Unseren hat beschlossen, sich hier anzusiedeln und die Stadt als seine Domäne zu beanspruchen.« Sie sieht mich mitleidig an. »Nehmt es bitte nicht persönlich, Leonard. Ich bin Euch zutiefst dankbar, dass Ihr mir damals gestattet habt, mich hier niederzulassen und habe immer gern mit Euch Geschäfte gemacht. Doch die Dinge haben sich geändert.«
»Geschäfte, ja?« Ich spucke ihr die Worte entgegen. »Geschäfte, das ist alles, was für Euch zählt. Der Marktwert von Loyalität steht derzeit wohl nicht besonders hoch.«
»Ihr beschämt mich, Leonard. Ich achte Loyalität als ein hohes Gut. Aber sie endet genau dort, wo sie in den sicheren Untergang führt. Ihr seid zweifellos stark und machtvoll, doch gegen den neuen Herren von New York werdet selbst Ihr nicht bestehen können.« Die nächsten Worte richtet sie wieder an die Versammlung. »Für diejenigen, die ihr Dasein in dieser Stadt fortzuführen gedenken, gibt es keine Wahl. Akzeptiert den neuen Herrscher oder Ihr werdet untergehen.«
Samantha mischt sich wieder ein: »Und dieser neue Herrscher ist er?« Sie deutet auf Massoud.
»Nein Mylady, ich bin nur sein untertäniger Diener.« Durch seinen Akzent erhalten die Worte eine intensive Betonung. »Mein Herr ist einer der ältesten von uns, der noch über die Erde wandelt. Er ist vor einiger Zeit aus langem Schlaf erwacht und hat diese Stadt zu seinem Herrschaftssitz erkoren. Er wird New York zur bedeutendsten Metropole der Unsterblichen erheben. Jeder, der sich ihm anschließt, wird reich belohnt werden. Doch wer sich ihm widersetzt, ist unweigerlich der Vernichtung preisgegeben.« Bei den letzten Worten sieht er mir in die Augen. »Wenn Ihr ihn um Vergebung bittet, Templer, seid vielleicht auch Ihr in seiner Streitmacht willkommen.«
Ich muss meine ganze Selbstbeherrschung bemühen, um ihm nicht an die Kehle zu springen. »Danke, ich verzichte auf diese Ehre.«
Jake meldet sich zu Wort und spricht Massoud an: »Wer ist Euer Chef? Einer der Alten aus Europa?« Seine Stimme ist nicht gerade von Begeisterung erfüllt. Gut für mich.
Massoud lächelt. »Die, die Ihr die Alten nennt, sind nichts im Vergleich zu meinem Meister. Keiner von ihnen kommt ihm an Macht gleich. Er war bereits einer der mächtigsten Unsterblichen, als Europa noch darauf gewartet hat, die Segnungen der Zivilisation zu erfahren.«
»Gab es in dieser mythischen Zeit schon Namen?« In der Vergangenheit hat Jakes vor Sarkasmus triefender Tonfall mich oft genug an den Rand des Blutrausches geführt. Nun zehrt er an Massouds Geduld. Ich lächele innerlich, während ich seinen Kampf beobachte.
»Er hat viele Namen …«
»Marduk«, fällt Veronica ihm ins Wort. »Sein Name ist Marduk. Und er hat sein Unwesen schon im antiken Babylon getrieben, vor einigen tausend Jahren.«
Ich höre ersticktes Keuchen und sehe entgleisende Gesichter angesichts der Enthüllung meiner Begleiterin. Ob dies nur an dem Alter liegt, das sie genannt hat, oder ob irgendjemand mit dem Namen etwas anfangen kann, vermag ich nicht zu beurteilen.
Massoud sieht Veronica finster an, hält sich jedoch mühsam unter Kontrolle. »Ja, so ist es.«
»Und dieser Marduk will, dass wir ihm die Füße küssen?« Jake hatte schon immer eine Abneigung gegen Autoritäten. Wir sind in den vergangenen Jahren oft genug aneinandergeraten. Es steht ihm ins Gesicht geschrieben, dass er die Aussicht, sich einem noch Älteren als mir zu unterwerfen, nicht im Geringsten begrüßt.
Massoud bemüht sich um einen beiläufigen Tonfall, als er antwortet: »Marduk fordert lediglich die Anerkennung seiner Herrschaft und Autorität. Er wird denen, die dies respektieren, umfangreiche Freiheiten gewähren, die weit hinausgehen über das, was Euch heute zugestanden wird.« Ein Seitenblick in meine Richtung zeigt allen Anwesenden, wen er für die aktuellen Beschränkungen verantwortlich macht.
Die letzte Bemerkung alarmiert Samantha. »Was wollt Ihr damit sagen?«
Massoud hält seine Augen auf mich gerichtet. »Ich will damit sagen, dass die Richter und ihre willkürlichen Gesetze uns daran hindern, unser wahres Potential zu entfalten und unseren angestammten Platz in der Welt einzunehmen.«
Samantha erkennt die Tragweite der Aussage. »Soll das heißen, Euer Herr respektiert die Ewigen Gesetze nicht? Sie sind die Grundlage unseres Daseins. Ohne sie herrscht Anarchie.«
»Ihr versteht mich falsch, Mylady«, stellt Massoud klar. »Mein Meister verfügt über Fähigkeiten, die geeignet sind, die Spuren unserer Existenz weitaus effektiver zu verbergen als der Templer. Er kann die Sterblichen dazu bringen, keine Fragen zu stellen und über ungewöhnliche Vorkommnisse hinwegzusehen. Und er ist bereit, diese Fähigkeiten zu Eurem Wohl anzuwenden.«
»Um die Blutbäder zu vertuschen, die er und seine Mordbande anrichten?« Veronica ist kurz davor, die Beherrschung zu verlieren. »Oh ja, das wird ein wundervolles Gemetzel und keiner merkt was. Tolle Aussichten!«
Ihrem Ausbruch folgen ein paar Sekunden des Schweigens. Jeder beäugt misstrauisch sein Gegenüber. Die Spannung ist beinahe körperlich spürbar.
Jake hat sich offenbar wieder vollständig unter Kontrolle und beendet die Stille: »Ich will mit Euren Machtkämpfen nichts zu tun haben. Das gibt nur Ärger. Haltet mich da raus!«
Seine Erklärung bricht den Bann. Der von ihm aufgezeigte Weg eröffnet den Anwesenden eine Möglichkeit, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen.
Francis, der das Geschehen bisher kommentarlos beobachtet hat, meldet sich als nächster zu Wort: »So wie ich es sehe, betrifft diese Auseinandersetzung lediglich diejenigen, die die Herrschaft über die Stadt anstreben. Da dies außerhalb meiner Ambitionen liegt, werde ich keine Partei ergreifen, sondern mich dem Sieger unterordnen.«
Veronica erhebt die Stimme: »Das heißt, Ihr seid bereit, die blutigen Exzesse dieses babylonischen Monsters hinzunehmen? Und dafür was weiß ich wie viele Menschen abschlachten zu lassen?« Ihre Augen funkeln vor Zorn.
Ich lege ihr die Hand auf den Arm, um sie zurückzuhalten. Dann wende ich mich an den dunkelhäutigen Vampir, um eine Eskalation zu vermeiden. »Wir akzeptieren Eure Neutralität, Francis.«
Er nickt. Ich erkenne einen Anflug von Dankbarkeit in seinen Augen.
Jake präzisiert seine ursprüngliche Aussage: »Für mich dasselbe. Neutralität. Ich werde mich nicht einmischen.«
Zoë und Carl schließen sich an. Nicht, was ich erhofft habe, aber im Augenblick werde ich hier nicht mehr erreichen.
Als Letztes bekundet Samantha, unparteiisch zu bleiben. »Also dann steht unser Entschluss fest. Wir werden uns nicht in den Machtkampf einmischen und denjenigen von uns, die heute nicht hier sind, dasselbe empfehlen. Nur auf diese Weise können wir verhindern, dass die Stadt durch den Kampf in den Untergang gerissen wird. Und daran kann wohl keiner von uns interessiert sein.« Sie wendet sich Massouds Begleiterin zu. »Werdet auch Ihr dies anerkennen, Gianna?«
Die Angesprochene zögert, ehe sie antwortet. »Ich bin nicht sicher, ob dies noch möglich ist, nach den Anschuldigungen, die der Templer gegen mich vorgebracht hat.«
»In diesem Fall werde ich ausnahmsweise einmal nicht nachtragend sein, Gianna«, wende ich ein. »Samantha hat recht. Eine Ausweitung des Konfliktes dient nicht dem Wohl der Stadt, das uns allen am Herzen liegen sollte. Daher werde ich auf jegliche Vergeltung für Eure vergangenen Fehltritte verzichten, falls Ihr Euch fortan neutral verhaltet.«
Sämtliche Augen richten sich auf sie und warten auf ihren Entschluss.
»Also gut«, erklärt sie nach einer kurzen Pause und einem stillen Blickwechsel mit Massoud. »Ich werde mich aus allen künftigen Kämpfen heraushalten, bis eine Entscheidung gefallen ist, und den Sieger meiner uneingeschränkten Loyalität versichern.« Ihr Tonfall lässt keinen Zweifel daran, dass sie sicher ist, wer der Sieger sein wird. »Was ist mit Euch, Veronica?«
Die ehemalige Polizistin ist zunächst etwas verdattert angesichts Giannas unerwartetem Manöver. Sie sieht sich einem halben Dutzend erwartungsvoller Augenpaare gegenüber.
Schließlich strafft sie sich. »Ich werde nicht neutral sein. Nach allem, was ich bislang gesehen habe, werden die sterblichen Bewohner New Yorks großes Leid zu ertragen haben, wenn dem seine Bande hier das Sagen hat.« Sie richtet ihren Finger auf Massoud. »Und außerdem ist es bei mir etwas Persönliches. Immerhin ist sein durchgeknallter Nachwuchs dafür verantwortlich, dass ich überhaupt hier bin.«
»Du solltest dankbar sein für das Geschenk, das du erhalten hast, Kind«, erwidert der Orientale.
Nur mein fester Griff um Veronicas Arm hindert sie daran, ihn anzuspringen.
»Ruhig!«, befehle ich ihr nachdrücklich.
Sie gehorcht, funkelt Massoud jedoch weiterhin aus blutunterlaufenen, zu schmalen Schlitzen verengten Augen an.
Als wieder Ruhe eingekehrt ist, ergreift Samantha das Wort: »Ich denke, es wird uns gelingen, die Unsterblichen von Manhattan mit Ausnahme Massouds und Veronicas zu überzeugen, sich ebenfalls neutral zu verhalten. Nur so können wir einen Krieg unter den Unsrigen verhindern. Doch wie sieht es mit den benachbarten Domänen und deren Herren aus?«
Ihre Frage richtet sich insbesondere an Francis, der sich zwar häufig in Manhattan aufhält, seinen Wohnsitz jedoch jenseits des East Rivers hat.
»Ich kann nicht für Lobo sprechen«, er bezieht sich auf den derzeit tonangebenden Vampir in der schnell wechselnden Serie der Herren von Brooklyn, »doch so, wie ich die Dinge sehe, betrifft diese Angelegenheit zunächst nur Manhattan. Ich denke nicht, dass sich jemand aus Brooklyn einmischen wird.«
»Und die anderen Feiglinge werden sich auch heraushalten«, ergänzt Jake, »zumindest, bis der Sieger feststeht. Dann werden sie alle angekrochen kommen, ein Riesenaufhebens darum machen, dass sie von Anfang an auf seiner Seite gestanden haben und ihre ewige Treue bekunden.«
Seine nicht sonderlich respektvolle, aber vermutlich zutreffende Prognose lockt ein Lächeln auf mein Gesicht. Auch Veronica entfleucht ein amüsiertes Kichern. Doch nicht alle Anwesenden können unsere Belustigung teilen.
»Jake!«, fährt Samantha ihn an. »Bitte haltet Eure Zunge im Zaum.«
Ihre andauernden Bemühungen, den Frieden zu wahren und ein Blutbad in ihren vier Wänden zu vermeiden, zehren an ihrer Geduld. Sie scheint mittlerweile selbst kurz davor, dem Blutrausch anheimzufallen und dem nächsten, der eine Provokation von sich gibt, an die Kehle zu gehen. Es grenzt ohnehin an ein Wunder, dass eine Zusammenkunft von neun Vampiren so lang vergleichsweise friedlich verlaufen ist. Insbesondere angesichts der überaus gereizten Grundstimmung. Doch alle Beteiligten haben viel zu verlieren, nicht zuletzt ihr Leben. Und noch vor dem unstillbaren Hunger und der ausgeprägten Territorialität ist der Selbsterhaltungstrieb das bestimmende Element unter unseren Instinkten.
Jake steht von seinem Barhocker auf und schnappt sich den Motorradhelm. »Ich glaube, ich verschwinde. Hier ist ja eh alles gesagt.« Sein Blick richtet sich auf mich. »Schätze, Eure Bitte neulich im Fairyland, Euch zu benachrichtigen, falls ich etwas über Neuankömmlinge erfahre, hat sich damit erledigt, oder?«
Ich würdige die rhetorische Frage keiner Antwort.
Nacheinander schaut Jake mich und Massoud an. »Ihr sagt Bescheid, wenn die Sache geregelt ist?«
Gianna antwortet an unserer Stelle: »Ihr werdet es merken, sobald der Kampf entschieden ist.«
»Gut, bis dann! Ich hab Hunger.« Mit einem kurzen Nicken verabschiedet er sich von Samantha und dem Rest der Versammelten, bevor er zwischen den Vorhängen in Richtung des Ausgangs verschwindet.
Als Nächstes erhebt sich Francis von der Wand, an die er sich gelehnt hatte. »Jakes Wortwahl ist ein ewiges Ärgernis, aber in der Sache hat er recht. Wir sind hier wohl fertig. Jetzt ist es an uns, das, was hier besprochen wurde, unseren Brüdern und Schwestern mitzuteilen. Vielen Dank für Eure Gastfreundschaft, Samantha. Gianna. Massoud. Templer.« Er verneigt sich zum Abschied leicht vor allen Angesprochenen, dann folgt er Jake eilig. Vermutlich wird er versuchen, ihn einzuholen, um draußen noch ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Die beiden verstehen sich trotz ihrer höchst unterschiedlichen Manieren recht gut, soweit ich weiß.
Zoë ist die Nächste und verlässt das Cauchemar schweigend. Carl scheint bleiben zu wollen.
»Vielleicht sollten wir getrennt gehen«, schlägt Gianna mir gegenüber vor.
»Das wäre wohl besser.« Mit galantem Schwertschwung trete ich einen Schritt vom Eingang weg, um Ihr und Massoud Platz zu machen.
Sie verabschiedet sich förmlich von Samantha. Massoud funkelt mich mit siegesgewissem Lächeln an, bevor er der Gastgeberin zunickt und hinter Gianna den Club verlässt.
Erst als wir hören, wie Lucius die Tür hinter ihnen schließt, entspanne ich mich und packe das Schwert weg.
»Danke Samantha«, flüstere ich.
»Wofür?« Ihre Stimme ist immer noch gereizt. »Dass gerade eben dein Untergang besiegelt wurde? Oder habe ich es falsch verstanden, dass du allein gegen dieses uralte babylonische Monster und seine Brut antreten willst?«
»Nicht allein!«, protestiert Veronica.
Samantha mustert sie mit einer Mischung aus Verärgerung und Mitleid, würdigt den Einwand aber keines Kommentars. »Gegen einen derart Alten hast nicht einmal du eine Chance.«
»Was ist denn die Alternative?«, entgegne ich. »Soll ich die Stadt Marduk, Massoud und ihren Unholden überlassen?«
»Unholde? In New York?« Samantha sieht mich mit schreckgeweiteten Augen an.
Sie ist zu jung, als dass sie die Ära, in der die Mächtigen unter uns sich mit Horden bluttrinkender marodierender Sterblicher umgeben haben, miterlebt hätte. Doch diejenigen, die die Massaker der Unholde selbst gesehen haben, so wie ich, halten das Andenken an diese schreckliche Entartung wach. Darin sind wir so gut, dass auch die Jungblütigen bei der bloßen Erwähnung des Namens Furcht und Abscheu verspüren. Natürlich gibt es immer wieder experimentierfreudige Vampire, die trotz des Tabus herausfinden wollen, ob die Unholde wirklich so schlimm gewesen sind wie in den alten Geschichten. Aber jeder, der diesen Weg wählt, wird von den Archaioi und Richtern gnadenlos gejagt und ohne Verhandlung mit dem Tod bestraft. Dies mag sicherlich dazu beigetragen haben, dass jeder Zivilisierte unserer Art voller Abscheu von den Unholden spricht – oder besser gar nicht.
Samanthas Gesicht ist unschwer zu entnehmen, dass sie diese legendären Schrecken lang vergangener Zeiten nicht mit dem Hier und Jetzt ihrer Heimatstadt in Verbindung zu bringen vermag. Auch Carl, der zuvor nur mäßiges Interesse an unserer Konversation gezeigt hat, sieht mich mit ungläubiger Miene an.
»Sie haben Unholde auf New York losgelassen?«, wiederholt Samantha ihre Frage.
Ich nicke. »Als wir Massoud vorletzte Nacht zum ersten Mal getroffen haben, war er in Begleitung von zweien.«
»Bist du sicher, dass es Unholde waren?«
»Samantha, ich habe in der Vergangenheit genug von ihnen gesehen und war, wie du weißt, vor meiner Verwandlung selbst einer von ihnen. Ich erkenne Unholde, wenn ich gegen sie kämpfe.«
»Aber … das verstößt gegen die Gesetze …« Sie ist immer noch fassungslos.
»Willst du Marduk darauf hinweisen?« Ich kann den sarkastischen Unterton nicht aus meinen Worten verbannen.
Langsam fängt sie sich wieder. Dass sie weiterhin irritiert ist, merke ich jedoch daran, dass ihrer Stimme die übliche Verachtung fehlt. »Ich verstehe das nicht. Ich dachte, gerade die Alten drängen auf die Einhaltung der Ewigen Gesetze.«
»Ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll«, entgegne ich. »Wenn dieser Marduk wirklich aus dem alten Babylon stammt, ist er weitaus älter als alle der Unsrigen, von denen ich jemals gehört habe. Vielleicht glaubt er, über den Gesetzen zu stehen. Möglicherweise ist das sogar so. Und außerdem ist meines Wissens noch nie einer der Archaioi aus Europa oder Asien in die Neue Welt gereist. Die meisten von ihnen halten Amerika immer noch für barbarenverseuchte Wildnis. Marduk ist in vielerlei Hinsicht anders als die Archaioi, die ich kennengelernt habe. Ich weiß noch nicht, wie das alles zusammen passt.«
Samantha denkt kurz nach, bevor sie weiter spricht: »Ist Gianna bewusst, auf was sie sich da eingelassen hat?«
»Ich denke schon. Das Killerkommando, das sie vergangene Nacht auf mich gehetzt hat, bestand zumindest teilweise auch aus Unholden.«
»Du bist sicher, dass das auf ihr Konto gegangen ist?«
»Ziemlich. Und seit ihrer Reaktion, als ich sie darauf angesprochen habe … Ja, ich bin sicher.«
Das Zucken in ihrer Wange verrät, wie aufgebracht sie ist. »Das heißt, auch sie ignoriert die Gesetze?«
»Gianna war schon immer ausschließlich auf ihren Vorteil bedacht. Sie nutzt jede Gelegenheit, um so viel Macht zu erlangen wie möglich. Wenn ihr neuer Gönner ihr gestattet, ihren Lakaien übermenschliche Kraft zu verleihen, lässt sie sich das nicht entgehen.«
»Nun, zumindest wird sie jetzt hoffentlich etwas vorsichtiger sein und ihre Unterstützung für Marduk weniger offensichtlich erscheinen lassen.« Samantha teilt offenbar meine Einschätzung, dass Giannas Versprechen, sich aus der Auseinandersetzung zwischen Marduk und mir herauszuhalten, nicht mehr als ein Lippenbekenntnis war.
»Ich denke, nun solltet ihr gehen«, fügt sie hinzu, »sonst wird noch meine Neutralität angezweifelt, weil ich zu lange mit dir beratschlage. Ich wünsche dir viel Glück für deinen Kampf, Leon, und ich fürchte, du wirst es brauchen.«
Ich hätte mir etwas aufmunterndere Worte gewünscht. Aber wenn ich bedenke, was ich mir von Samantha üblicherweise alles anhören muss, kann ich mich vermutlich glücklich schätzen.
»Auch dir viel Glück, Sam«, antworte ich. »Für den Fall, dass bald Marduk über Manhattan herrscht, wirst du es benötigen.«
Samantha und Veronica beschränken ihre gegenseitigen Abschiedsgrüße auf ein Nicken, begleitet von finsteren Blicken. Die Aversion der beiden Frauen gegeneinander ist beinahe spürbar. Ich bedenke Carl, der die ganze Zeit über im Hintergrund wartet, mit einem stillen Gruß, den er ebenso beantwortet. Dann verstaue ich das Schwert in der Tasche und strebe dem Ausgang entgegen. Veronica scheint es noch eiliger zu haben und ist bereits vorausgegangen.
Als wir Lucius passiert haben und die Straße betreten, vergewissere ich mich zunächst durch einen ausgiebigen Rundumblick, dass wir nicht erwartet werden. Mit dem Verlassen des Cauchemar haben wir die Sicherheit des gemäß unserer gerade geschlossenen Abmachung zumindest inoffiziell neutralen Bodens hinter uns gelassen. Auf den Straßen New Yorks können von nun an hinter jeder Ecke Gegner lauern. Die Begegnung mit dem Flammenwerfer letzte Nacht hat mir die Skrupellosigkeit meiner Feinde eindringlich vor Augen geführt. Dass ich derzeit nicht einmal über eine gesicherte Zuflucht mit vertrauenswürdigen Tagwächtern verfüge, macht die Lage nicht besser. Doch im Augenblick kann ich keine Gefahr erkennen. Die einzigen Bewegungen auf der menschenleeren Straße sind feine Wassertropfen, die durch den auffrischenden Wind von Häusern und Bäumen heruntergeweht werden und Wellen auf den Pfützen hinterlassen, die den Asphalt bedecken. Ich beschließe, nicht zur U-Bahn-Station zurückzukehren, sondern marschiere in die entgegengesetzte Richtung. Ich glaube zwar nicht, dass man uns bereits auflauert, aber wozu unnötige Risiken eingehen, selbst wenn sie nur gering sind?
Veronica protestiert nicht. Vermutlich gehen ihr ähnliche Gedanken durch den Kopf. Willkommen in den Reihen der paranoiden Unsterblichen.
»War das okay, dass ich nicht bei der Neutralität mitgemacht habe?«, will sie wissen, als wir das Spalier der Wohnhäuser entlang schreiten.
»Ja. Es hätte ohnehin niemand geglaubt, wenn du etwas anderes behauptet hättest. Außerdem ist Massoud genau so wenig unparteiisch.«
»Und was ist von Gianna zu halten?«
»Wie Samantha gesagt hat: Sie wird vorsichtiger sein müssen, wenn sie Marduk weiter helfen will, um zumindest den Schein der Neutralität zu wahren. Das könnte ein wertvoller Vorteil sein. Sie verfügt über umfangreiche Ressourcen, die sie nun nicht mehr offen in die Schlacht werfen kann. Falls uns das den Besuch einer weiteren Killertruppe erspart, hat sich der Abend schon gelohnt.«
»Aber dein eigentliches Ziel war doch, Verbündete zu gewinnen, oder nicht?«
Sie schafft es, mit einer einfachen Frage meine ganzen Bemühungen zu zerstören, mir selbst gegenüber das Ergebnis unseres Besuches im Cauchemar schönzureden. Das Problem ist, dass sie mit ihrer Unterstellung absolut recht hat. Mein Ansinnen, Samantha und über sie ihre zahlreichen Bekannten für mich zu gewinnen, wurde gerade zunichtegemacht. Auf der anderen Seite hatten Massoud und Gianna vermutlich dasselbe vor, so dass ich ihre Pläne genauso durchkreuzt habe, wie sie die meinen.
Veronica wertet mein Schweigen offensichtlich als Zustimmung und fährt fort, unangenehme Fragen zu stellen: »Die anderen sind sich ja ziemlich sicher, dass du keine Chance hast. Ist das wirklich so?«
Abrupt bleibe ich stehen und bedenke sie mit einem finsteren Blick.
»Ich frag ja nur«, beeilt sie sich, entschuldigend hinzuzufügen. »Vor einer Woche habe ich Vampire noch für Märchenfiguren gehalten. Ich will nur wissen, woran ich bin. Und was ich davon halten soll, wenn mir plötzlich babylonische Gottheiten leibhaftig gegenüberstehen.«
»Er ist kein Gott!«, widerspreche ich trotzig. »Er hat diesen Namen nur angenommen, um seine Gefolgsleute zu beeindrucken.«
Veronicas Gesichtsausdruck sehe ich an, dass dieser feine Unterschied die Sache in ihren Augen nicht besser macht.
»Du hast ja recht«, gebe ich zu. »Also, wenn er wirklich der ist, für den wir ihn halten, sieht es nicht gut aus. Die Archaioi verfügen über Kräfte, denen niemand widerstehen kann außer einem anderen der Alten. Und Marduk ist nach allem, was wir wissen, sehr alt.« Ein Seufzer dringt über meine Lippen. »Ohne Verbündete werden wir diesen Kampf wohl nicht gewinnen. Vielleicht wäre es besser, wenn du dich von mir fernhältst. Du bist noch jung. Du …«
»Kommt nicht infrage! So schnell gebe ich nicht auf und du solltest das auch nicht tun! Immerhin haben wir es geschafft, aus Marduks Allerheiligstem zu entkommen. Das heißt, er ist nicht allmächtig. Wir können seine Pläne durchkreuzen. Wir müssen nur herausfinden, wie wir ihn treffen können, wo seine Schwachpunkte sind, und da zuschlagen, wo es ihm wehtut.« Ihre Augen funkeln vor Zorn, während sie weiter auf mich einredet. »Ich habe mit Massoud noch eine Rechnung offen und du bist meine einzige Chance, sie zu begleichen. Hey, du bist der Richter von New York! Es ist dein Job, solchen Drecksäcken wie Marduk und Massoud zu zeigen, dass sie hier nicht treiben können, was sie wollen. Die können doch nicht einfach hierherkommen und haufenweise Leute abschlachten, um ihre Badewanne mit Blut zu füllen. Irgendjemand muss da was gegen unternehmen und ich glaube, das sind wir.«
Beeindruckende Ansprache. Ich habe schon einige Jungblütige mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein getroffen. Die meisten von ihnen, die derartige Reden schwingen, werden bald von der harten Realität unserer nächtlichen Existenz eingeholt. Mehr als einer von ihnen hat am eigenen Leib erfahren, dass die Unsterblichkeit überraschend schnell zu Ende sein kann. Ich bin daher über mich selbst erstaunt, dass ich mich dazu hinreißen lasse, über Veronicas Worte nachzudenken.
Irgendjemand muss etwas dagegen unternehmen. Ist das so?
Ich habe erlebt, wie auf Geheiß der Archaioi unzählige Menschen auf grausamste Art abgeschlachtet worden sind. Wie die heimlichen Herrscher der Unsterblichen aus einer Laune heraus blühende Städte und ganze Länder in blutige Moraste aus Tod und Verderben verwandelt haben. Diese vampirischen Gemetzel sind zwar selbst in Europa mittlerweile Geschichte. Sie wurden durch die noch unendlich viel schrecklicheren Untaten abgelöst, die die Sterblichen sich dank der Fortschritte in Waffentechnik und Kriegsführung gegenseitig anzutun gelernt haben. Doch in unseren Jahrhunderte umfassenden Erinnerungen sind die Blutbäder der Vergangenheit noch allzu präsent. Die Ewigen Gesetze sind der Garant für unser Bestreben, derartiges nie wieder geschehen zu lassen.
Bei dem Gedanken an Korridore voller aufgestapelter Kisten mit den Überresten von Marduks Mahlzeit verspüre ich einen unbändigen Widerwillen dagegen, dieses babylonische Ungeheuer gewähren zu lassen. Ihm zu erlauben, New York – meine Stadt – mit Unholden zu überschwemmen und in ein Schlachthaus zu verwandeln.
Ich gebe zu, dass ich niemals besonders großes Interesse daran hatte, New York zu einem Hort immerwährenden Friedens zu machen. Die hohe Kriminalitätsrate der Stadt ist einfach zu geeignet, die Ausschweifungen und Verfehlungen derjenigen ihrer Bewohner zu vertuschen, die sich von menschlichem Blut ernähren. Doch das wenige, was ich bislang von Marduks Tun gesehen habe, geht weit über alles hinaus, was ich als Richter zu tolerieren bereit wäre. Und ich habe die Befürchtung, er wird sein Handeln nicht wesentlich verändern, sollte er die Herrschaft erlangen. Die Versammlung im Cauchemar hat erwiesen, dass in der Tat niemand außer Veronica und mir gewillt zu sein scheint, etwas dagegen zu unternehmen. Und Jakes Prognose, dass die Herren der anderen Domänen vor Marduk buckeln werden, ist vermutlich ebenfalls zutreffend.
Würden sie sich gegen ihn stellen, wenn sie von seinen Untaten wüssten? Wenn sie mit eigenen Augen das blutgefüllte Becken sähen? Zumindest Gianna hat einen Einblick in die Machenschaften des selbsternannten neuen Herren von New York erhalten und dennoch für ihn Position bezogen. Was ihr Vorteil in diesem Handel ist, weiß ich nicht. Aber wenn Marduk Gianna kaufen kann, wird es ihm auch gelingen, die anderen Vampire der Stadt auf seine Seite zu ziehen. Meine Erfahrung mit ihnen zeigt ziemlich eindeutig, dass ihnen die Einhaltung der Ewigen Gesetze nur so lang an ihren toten Herzen liegt, wie es jemanden gibt, der sie ihnen aus den Leibern reißt, wenn sie es nicht tun. Es hängt also wohl an mir, ihn aufzuhalten. Bleibt die nächste Frage: Wie tue ich das? Beweist unsere erfolgreiche Flucht aus seinem Domizil wirklich seine Verwundbarkeit? Ist er nicht so allmächtig, wie ich und die anderen Unsterblichen der Stadt es von einem Vampir seines Alters vermuten? Hat er tatsächlich einen Schwachpunkt, der ihn besiegbar macht? Ich erinnere mich, wie er scheinbar mühelos meinen Schwerthieb aufgefangen hat. Meine übliche Methode, meinen Gegnern im offenen Kampf gegenüberzutreten, wird in diesem Fall nicht von Erfolg gekrönt sein. Und auch die Anwendung des Bösen Blickes ist gegen einen derartigen Feind absolut aussichtslos. Womit meine Möglichkeiten ziemlich ausgeschöpft wären. Das Einzige, was wir erfolgreich vollbracht haben, ist, ihm zu entkommen. Doch selbst falls uns dies noch einmal gelingt, wird es uns kaum zum Sieg verhelfen. Keine guten Aussichten.
»Also, was ist?«, unterbricht Veronica meine Gedanken.
»Ich weiß nicht, wie wir ihn besiegen sollten«, fasse ich meine Überlegungen zusammen. »Du hast gesehen, wozu er fähig ist. Dagegen komme selbst ich nicht an.«
»Okay. Wer könnte wissen, wie man ihn besiegt?«
Es ist erstaunlich, wie sie es immer wieder schafft, mich mit ihren einfachen, scheinbar naiven Fragen aus dem Konzept zu bringen.
Als ich sie nur verdutzt anschaue, statt zu antworten, fährt sie fort: »Er ist einer von diesen Archadingens. Den Alten. Vielleicht kann ein anderer von denen uns helfen? Oder halten die alle zusammen?«
Veronicas Mutmaßung entlockt mir ein leises Prusten. »Zusammenhalten? Die Archaioi? Ganz bestimmt nicht. Die sind mehr als alle anderen von uns darauf bedacht, ihre Domänen abzugrenzen und permanent damit beschäftigt, Intrigen zu spinnen, um sich gegenseitig zu schaden.«
»Hört sich doch gar nicht so schlecht an.« Sie trällert beinahe triumphierend. »Dann müssen wir nur noch einen von denen finden, der was gegen Marduk hat.« Ein entwaffnendes Grinsen breitet sich über ihr Gesicht aus.
Ihr Vorschlag ist derart abwegig, dass ich einen Augenblick benötige, bevor ich überhaupt wieder Worte finde. »Veronica, die Archaioi sollte man aus allem, in das sie sich nicht sowieso schon von allein einmischen, tunlichst heraushalten. Der eine, mit dem wir es hier zu tun haben, bedeutet bereits mehr Ärger, als wir brauchen können. Wenn wir weitere von ihnen in die Sache hineinziehen, wird es nur noch schlimmer.«
Sie baut sich vor mir auf und stemmt die Fäuste in die Hüften. »Was bitte soll denn noch schlimmer werden? Er reißt sich deine Domäne unter den Nagel, du kannst ihn nicht besiegen und niemand will uns helfen. Mir scheint, unsere Optionen sind derzeit recht übersichtlich: Entweder glorreich untergehen oder so schnell wie möglich verschwinden. Beides gefällt mir nicht besonders gut. Die einzige Alternative besteht darin, Hilfe zu holen und dabei nicht wählerisch zu sein. Und wer kann uns gegen einen der Alten helfen? Jemand, der genauso mächtig ist und nichts lieber macht, als seinesgleichen in die Suppe zu spucken: Einer der Alten.«
Ich erinnere Veronica mit ein paar Gesten daran, dass wir offen auf einer Straße stehen – wenn im Augenblick auch außer uns niemand zu sehen ist – und die Lautstärke ihrer Ausführungen dem Thema nicht angemessen ist.
»’Tschuldigung«, flüstert sie. »Gehen wir woanders hin!«
Während wir durch das nächtliche Greenwich Village schlendern, fährt sie leiser fort: »Wo findet man eigentlich die Nächsten der Alten?«
»In Europa. Soweit ich weiß, ist vor Marduk kein einziger von ihnen je über den Atlantik gekommen.«
»Wieso denn das? Allesamt Stubenhocker?«
Ihre überaus respektlosen Bemerkungen über diese uralten, machtvollen Kreaturen, die man sonst nur flüsternd zu erwähnen wagt, bringen mich immer wieder zum Schmunzeln.
»Sie alle sind über tausend Jahre alt. Die meisten noch viel mehr. Mit dem Alter verändert sich die Wahrnehmung der Zeit. Sie betrachten die Entdeckung Amerikas immer noch als ein neuartiges Ereignis. Für sie ist die Neue Welt eine ungezähmte Wildnis bar jeder Zivilisation und Kultur. Und an diesem tief in ihren unsterblichen Köpfen verwurzelten Weltbild kann auch der History Channel nicht viel ändern. Sie leben in ihrer eigenen Welt, die mit der der Sterblichen nur am Rande etwas zu tun hat. Und darüber hinaus haben sie sich über die Jahrhunderte eng in ihre lokalen Netze aus Handlangern, Verbündeten und Informanten eingesponnen. Keiner von ihnen ist bereit, dies durch einen Umzug auf einen anderen Kontinent aufs Spiel zu setzen.«
»Sag ich doch: Allesamt Stubenhocker!« Ihr Grinsen ist wieder zurück.
Ich seufze.
»Und warum ist Marduk anders?«, fragt sie.
»Ich weiß es nicht.« Nach einem Moment des Überlegens fahre ich fort: »Vielleicht müssen wir wirklich erst einmal mehr über ihn herausfinden.«
»Sag ich doch.«
Unser Spaziergang führt uns auf eine belebtere Straße. Trotz des schlechten Wetters und der fortgeschrittenen Stunde sind hier noch zahlreiche Nachtschwärmer unterwegs, so dass wir unser Gespräch aussetzen. Vermutlich würde keiner der Passanten, der über den Lärm der vorbeifahrenden Autos auf der nassen Straße hinweg ein paar Wortfetzen unserer Diskussion aufschnappt, irgendeinen Verdacht schöpfen. Doch in der augenblicklichen Situation riskiere ich lieber ein wenig Paranoia als die zufällige Begegnung mit einem von Marduks oder Massouds Vertrauten. Veronica scheint die Dinge ähnlich zu sehen.
Ich winke ein Taxi heran.
»Wo geht’s jetzt hin?«, fragt sie.
»Zur Mafia.« Ich steige in den Wagen ein.
Ich nenne dem Fahrer eine Adresse in Little Italy. Sobald auch meine Begleiterin Platz genommen hat, fährt er los.
Die Fahrt dauert nur wenige Minuten. Das Taxi hält vor einem italienischen Restaurant im Erdgeschoss eines fünfstöckigen Gebäudes, über dessen Front sich das stählerne Gerippe einer Feuerleiter erstreckt. Ich bezahle den Fahrer, steige aus und betrete das Lokal.