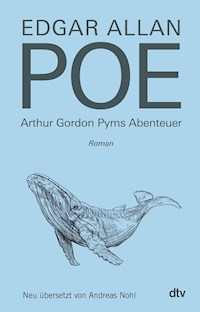
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der einzige Roman des Pioniers der amerikanischen Literatur Arthur Gordon Pym ist voll jugendlicher Abenteuerlust und Leichtsinn und möchte um jeden Preis die große, weite Welt sehen. Mithilfe seines besten Freundes wird er blinder Passagier auf dem Walfänger ›Grampus‹. Aber als die Besatzung eine Meuterei anzettelt, muss er, eingesperrt im Bug des Schiffes ohne Wasser und Brot, um sein Leben bangen. Doch die Rettung im letzten Moment ist erst der Anfang: Schiffbruch, Kannibalismus und Begegnungen mit blutrünstigen Insulanern erwarten Arthur auf seiner haarsträubenden Odyssee ans Ende der Welt. Edgar Allan Poes einziger Roman ist metafiktionale Spielerei, Reisebericht, Bildungsroman und spirituelle Allegorie in einem und verspricht eine außergewöhnliche und rätselhafte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Edgar Allan Poe
Arthur Gordon Pyms Abenteuer
RomanAus dem amerikanischen Englisch von Andreas Nohl Mit einem Nachwort und Anmerkungen des Übersetzers
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Die Abenteuer
von Arthur Gordon Pym
aus Nantucket.
Mit der detaillierten Schilderung einer Meuterei und einem abscheulichen Gemetzel an Bord der amerikanischen Brigg Grampus auf ihrem Weg in die Südsee im Juni 1827.
Des Weiteren mit einem Bericht über die Rückeroberung des Schiffs durch die Überlebenden, ihren Schiffbruch und die anschließenden schrecklichen Hungerqualen, ihre Rettung durch den britischen Schoner Jane Guy, die kurze Fahrt auf diesem Schiff im Antarktischen Ozean, dessen Kaperung und das Massaker an der Besatzung auf der Inselgruppe auf dem 84. Breitengrad südlicher Breite; zusammen mit den unglaublichen Abenteuern und Entdeckungen im äußersten Süden, welche auf dieses furchtbare Unglück folgten.
Vorwort
Als ich vor einigen Monaten nach den außergewöhnlichen Abenteuern in der Südsee und anderswo, von denen die folgenden Seiten handeln, in die Vereinigten Staaten zurückkehrte, geriet ich per Zufall in eine Gesellschaft von Gentlemen in Richmond, Va., die sich lebhaft für alle Einzelheiten der Regionen interessierten, die ich bereist hatte, und mich ständig bestürmten, es sei meine Pflicht, meinen Bericht der Öffentlichkeit vorzulegen. Ich hatte aber verschiedene Gründe, dies abzulehnen – einige rein privater Natur, die niemanden als mich selbst betreffen, andere eher nicht. Eine Überlegung, die mich abhielt, war, dass ich die meiste Zeit meines Fernseins kein Tagebuch geführt hatte und daher fürchtete, nach der bloßen Erinnerung nichts zu Papier bringen zu können, was genau und zusammenhängend genug gewesen wäre, um so wahr zu erscheinen, wie es tatsächlich ist, wenn ich nur den natürlichen und unvermeidbaren Hang zur Übertreibung vermied, dem wir alle erliegen, wenn wir ausführlich Geschehnisse beschreiben, welche eine machtvolle Wirkung auf unsere Einbildungskraft hatten. Ein weiterer Grund war, dass die zu erzählenden Begebenheiten so unwahrscheinlicher Natur waren, dass ich – unbelegt, wie meine Behauptungen nun einmal sein mussten (außer durch das Zeugnis einer einzigen Person, noch dazu eines Halbindianers) – nur von meiner Familie und solchen meiner Freunde Glauben erhoffen konnte, die aufgrund ihrer Erfahrung meiner Aufrichtigkeit Vertrauen schenkten – während das große Publikum meine Schilderungen lediglich als dreiste und raffinierte Erfindung ansehen würde. Doch einer der Hauptgründe, der mich davon abhielt, dem Vorschlag meiner Ratgeber zu folgen, war der Zweifel an meinen Fähigkeiten als Autor.
Unter den Gentlemen in Virginia, die ihr großes Interesse an meinen Ausführungen bekundeten, insbesondere an dem Teil, der sich mit dem antarktischen Ozean befasst, befand sich Mr. Poe, bis vor kurzem Redakteur des Southern Literary Messenger, einer monatlich erscheinenden Zeitschrift, die von Mr. Thomas W. White in Richmond publiziert wird. Er, neben anderen, riet mir nachdrücklich, sofort einen vollständigen Bericht meiner Erlebnisse niederzuschreiben und der Klugheit und dem Menschenverstand des Publikums zu vertrauen – und beharrte mit großer Überzeugungskraft darauf, dass mein Buch, wie unbeholfen, soweit es den bloßen Schreibstil betreffe, es auch immer daherkommen sollte, gerade durch seine etwaige Ungewandtheit um so eher als wahrhaft aufgenommen würde.
Ungeachtet dieser Sichtweise konnte ich mich nicht durchringen, seiner Empfehlung zu folgen. Er schlug dann später vor (nachdem ich mich in der Sache nicht bewegte), ich solle ihm erlauben, in seinen eigenen Worten auf Grundlage der Fakten, die ich selbst lieferte, eine Erzählung über den ersten Teil meiner Erlebnisse zu verfassen und sie im Southern Messenger unter dem Deckmantel der Fiktion zu publizieren. Dagegen hatte ich nichts einzuwenden und gab meine Einwilligung, allerdings unter der Bedingung, dass mein wirklicher Name beibehalten werden sollte. Zwei Nummern der vorgeblichen Fiktion erschienen daraufhin im Januar und Februar 1837 im Messenger – und damit es auch wirklich für jeden als Fiktion erkennbar war, wurde im Inhaltsverzeichnis der Zeitschrift den Artikeln Mr. Poes Name vorangestellt.
Die Aufnahme, die dieser Kunstgriff fand, veranlasste mich schließlich, eine sachgemäße Zusammenstellung der betreffenden Abenteuer vorzunehmen und zu publizieren; denn es hatte sich herausgestellt, dass trotz des Anscheins des Erfundenen, der so geschickt um jenen Teil meiner Ausführungen gewoben war, welcher im Messenger erschien (ohne eine einzige Tatsache zu verändern oder zu verdrehen), das Publikum ihn keineswegs als erfundene Erzählung empfand – dass sogar mehrere Briefe an Mr. P.’s Adresse gesendet wurden, die genau die gegenteilige Überzeugung zum Ausdruck brachten. Ich kam deshalb zu dem Schluss, dass die Tatsachen meiner Erzählung genügend Evidenz für ihre eigene Wahrhaftigkeit mit sich brachten und dass ich infolgedessen wenig öffentliche Skepsis zu fürchten hatte.
Nach dieser Darlegung wird unmittelbar erkennbar sein, wie viel ich von dem Nachfolgenden für meine eigene Feder reklamiere, und ebenso, dass nichts auf den ersten Seiten, die Mr. Poe geschrieben hat, falsch dargestellt wurde. Selbst für jene Leser, die den Messenger nicht gelesen haben, wird es unnötig sein, darauf hinzuweisen, wo sein Teil endet und mein eigener beginnt. Der Unterschied im Stil ist unübersehbar.
New York, Juli 1838 A.G. Pym
IVorwitzige Abenteurer
Ich heiße Arthur Gordon Pym. Mein Vater war ein angesehener Schiffsbedarfshändler in Nantucket, wo ich geboren bin. Mein Großvater mütterlicherseits war ein viel beschäftigter Anwalt. Er hatte in allem, was er anfasste, Erfolg und mit Aktien der Edgarton New Bank, wie ihr früherer Name war, gewinnbringend spekuliert. Mittels dieser und anderer Aktivitäten hatte er eine ansehnliche Summe Geld zurückgelegt. Für mich empfand er, glaube ich, mehr Zuneigung als zu sonst jemandem in der Welt, und ich durfte erwarten, nach seinem Tod den größten Teil seines Vermögens zu erben. Er schickte mich, als ich sechs war, auf die Internatsschule des alten Mr. Ricketts, einem Gentleman mit nur einem Arm und exzentrischem Wesen – so gut wie jedem, der einmal in New Bedford war, ist er wohlbekannt. Ich blieb auf seiner Schule, bis ich sechzehn war, und verließ sie dann, um Mr. E. Ronalds Akademie oben auf dem Berg zu besuchen. Hier befreundete ich mich mit dem Sohn von Mr. Barnard, einem Kapitän zur See, der in der Regel für Lloyd & Vredenburgh auf See war – Mr. Barnard ist in New Bedford ebenfalls recht bekannt und hat bestimmt viele Verwandte in Edgarton. Sein Sohn hieß Augustus, und er war fast zwei Jahre älter als ich. Er war mit seinem Vater auf der John Donaldson auf Walfangtour gewesen und sprach dauernd über seine Abenteuer im Südpazifik. Ich ging häufig mit zu ihm nach Hause und blieb den ganzen Tag über, manchmal auch die ganze Nacht. Wir schliefen im gleichen Bett, und er hielt mich regelmäßig fast bis zum Morgengrauen wach, indem er mir Geschichten über die Eingeborenen der Insel Tinian und über andere Orte erzählte, die er auf seinen Reisen besucht hatte. Es ließ sich nicht vermeiden, dass ich mit der Zeit ein Interesse für die Dinge entwickelte, von denen er sprach, und schließlich Sehnsucht verspürte, zur See zu fahren. Ich besaß ein Segelboot mit Namen Ariel, das an die fünfundsiebzig Dollar wert war. Es hatte ein Halbdeck oder eine Art Unterstand und war wie eine Schaluppe getakelt – ich habe ihre Tonnage vergessen, aber es hatten zehn Personen darauf Platz, ohne sich auf die Füße zu treten. Mit diesem Boot unternahmen wir die verrücktesten Fahrten der Welt; und wenn ich jetzt daran zurückdenke, erscheint es mir wie das reinste Wunder, dass ich noch am Leben bin.
Von einem dieser Abenteuer werde ich berichten, sozusagen als Prolog zu einer längeren Erzählung über Ereignisse von größerer Tragweite. Eines Abends gab es bei Mr. Barnard eine Gesellschaft, und Augustus und ich waren gegen Ende ziemlich angetrunken. Wie zumeist in solchen Fällen zog ich es vor, mir das Bett mit ihm zu teilen, statt nach Hause zu gehen. Er schlief, so schien mir, ganz ruhig ein (es war fast ein Uhr nachts, als die Gesellschaft auseinanderging) und ohne ein Wort über sein Lieblingsthema zu verlieren. Als ich etwa eine halbe Stunde nach unserem Zubettgehen gerade einzudösen begann, sprang er plötzlich auf und schwor mit einem schauderhaften Fluch, er würde sich für keinen Arthur Pym der ganzen Christenheit schlafen legen, wenn draußen eine so großartige Südwestbrise wehe. Selten hatte mich etwas so verblüfft. Ich wusste nicht, was er vorhatte, und dachte, der Wein und die Schnäpse hätten ihn vollständig übermächtigt. Er sprach dann aber ganz unaufgeregt weiter, sagte, er wisse, dass ich ihn für betrunken hielte, dass er aber in seinem ganzen Leben nie nüchterner gewesen sei. Er habe es nur satt, fügte er hinzu, in einer so grandiosen Nacht wie ein Hund im Bett zu liegen, und er sei entschlossen, aufzustehen, sich anzukleiden und mit dem Boot eine Spritztour zu machen. Ich kann kaum beschreiben, was in mich gefahren war, aber kaum hatte er es ausgesprochen, durchströmte mich größte Lust und Begeisterung, und ich fand seine verrückte Idee das Schönste und Vernünftigste auf der Welt. Das Wetter war fast stürmisch und, so spät im Oktober, bitterkalt. Ich sprang trotzdem aus dem Bett und sagte ihm, ich sei genauso unerschrocken wie er und genauso wenig geneigt, wie ein Hund im Bett zu liegen und genauso für jeden Spaß und jede Spritztour zu haben wie nur irgendein Augustus Barnard in Nantucket.
Wir schlüpften hastig in unsere Sachen und eilten hinunter zum Boot. Es ankerte am alten verfallenen Kai beim Holzlager von Pankey & Co. und wurde mit der Bordwand gegen die rohen Balken geschmettert. Augustus stieg ein und begann erst mal, das Wasser auszuschöpfen, denn es war fast zur Hälfte vollgelaufen. Danach hissten wir Klüver und Großsegel und stachen beherzt vor dem Wind in See.
Der Wind blies, wie schon gesagt, steif aus Südwest. Die Nacht war klar und kalt. Augustus hatte das Steuerruder übernommen, und ich postierte mich beim Mast auf dem Halbdeck. Wir flogen nur so dahin – keiner von uns hatte seit dem Ablegen vom Kai ein Wort gesagt. Erst jetzt fragte ich meinen Kameraden, welchen Kurs er steuern wollte und wann wir wohl zurückkehren würden. Er pfiff eine Weile vor sich hin und antwortete dann in barschem Ton: »Ich steche in See – du kannst ja nach Hause gehen, wenn dir das lieber ist.« Ich wandte ihm den Blick zu und erkannte sofort, dass er trotz seiner vorgetäuschten Nonchalance sehr erregt war. Ich konnte ihn im Mondlicht deutlich sehen – sein Gesicht war blasser als Marmor, und seine Hand zitterte so heftig, dass er kaum die Ruderpinne halten konnte. Ich merkte, dass etwas schiefgelaufen war, und wurde ernsthaft besorgt. Damals wusste ich nur wenig über Navigation und war nun komplett auf die seemännischen Fähigkeiten meines Freundes angewiesen. Überdies hatte der Wind plötzlich zugelegt, denn wir verließen rasch den Windschatten des Landes – und dennoch schämte ich mich, mir meine Beklommenheit anmerken zu lassen, und verharrte fast anderthalb Stunden in trotzigem Schweigen. Doch dann hielt ich es nicht länger aus und meinte, es sei an der Zeit umzukehren. Wieder dauerte es fast eine Minute, bevor er antwortete oder meinen Vorschlag überhaupt zur Kenntnis nahm. »Immer schön langsam«, sagte er schließlich, »Zeit genug – nach Hause – schön langsam.« Eine solche Antwort hatte ich erwartet, aber es lag etwas in dem Ton dieser Worte, das mich mit einem unbeschreiblichen Grauen erfüllte. Ich sah ihn noch einmal aufmerksam an. Seine Lippen waren bleich, und seine Knie schlackerten so heftig, dass er kaum stehen konnte. »Herrgott nochmal, Augustus«, schrie ich voller Angst, »was hast du? Was ist los? Was hast du vor?« »Los«, stammelte er, offenbar aufs Äußerste überrascht, ließ im gleichen Moment das Steuerruder los und stürzte vornüber auf den Boden des Boots. »Was los ist – wieso, nichts ist – los. Wir fahren nach Hause – m-m-merkst du das nicht?« Da traf mich die ganze Wahrheit wie ein Blitz. Ich sprang zu ihm hin und richtete ihn auf. Er war betrunken – sturzbetrunken –, er konnte weder stehen noch sprechen oder sehen. Seine Augen waren vollkommen glasig, und als ich ihn in meiner äußersten Verzweiflung wieder losließ, rollte er wie ein runder Holzklotz ins Leckwasser, aus dem ich ihn herausgezogen hatte. Offenbar hatte er im Lauf des Abends sehr viel mehr getrunken, als ich vermutet hatte, und sein Verhalten im Bett war die Folge eines extremen Rauschzustands gewesen, der es häufig, wie beim Wahnsinn, dem Opfer erlaubt, so aufzutreten, als befände sich der Betreffende im Vollbesitz seiner Sinne. Die kühle Nachtluft tat jedoch ihr Übriges – seine geistige Energie ließ unter ihrem Einfluss nach –, und die verschwommene Wahrnehmung, die er in diesem Moment ohne Zweifel von seiner gefährlichen Lage hatte, trug zur Beschleunigung der Katastrophe bei. Er war nicht mehr bei Besinnung, und das würde sich wahrscheinlich auch in den nächsten Stunden nicht ändern.
Es ist kaum möglich, sich von meiner Panik eine Vorstellung zu machen. Die Dünste des vor Kurzem genossenen Weins waren verflogen und ließen mich doppelt verzagt und unentschlossen zurück. Ich wusste, dass ich vollkommen außerstande war, das Boot zu lenken, und dass ein heftiger Wind und die starke Strömung der Ebbe uns der Vernichtung entgegentrieben. Offensichtlich braute sich hinter uns ein Sturm zusammen. Wir hatten weder Kompass noch Proviant, und wenn wir unseren Kurs beibehielten, so viel war klar, wären wir vor Tagesanbruch außer Sichtweite der Küste. Diese und Heerscharen von anderen, ebenso bangen Gedanken schossen mir wirr durch den Kopf und lähmten mich für einige Augenblicke so, dass ich keiner körperlichen Anstrengung mächtig war. Das Boot sauste mit ungeheurer Geschwindigkeit durchs Wasser, voll vor dem Wind, ohne Reff im Klüver oder im Hauptsegel, den Bug komplett unter der Gischt. Es war ein reines Wunder, dass es nicht querschlug. Denn Augustus hatte, wie gesagt, das Ruder losgelassen, und ich war viel zu aufgeregt, um auf die Idee zu kommen, es selbst zu übernehmen. Doch zum Glück blieb das Boot auf Kurs, und langsam gewann ich ein gewisses Maß an Geistesgegenwart zurück. Immer noch nahm der Sturm furchterregend zu, und wann immer wir mit dem Bug aus einem Wellental auftauchten, schlug die See über unserem Heck zusammen und überflutete uns. Ich war zudem vor Kälte so betäubt in allen Gliedern, dass ich fast nichts mehr spürte. Schließlich nahm ich allen Mut der Verzweiflung zusammen, sprang zum Hauptsegel und ließ es mit einem Rutsch herunter. Wie man vielleicht hätte erwarten können, flog es über den Bug und saugte sich so voll Wasser, dass es den Mast gleich mit über Bord gehen ließ. Dieser zweite Unfall allein rettete mich vor dem augenblicklichen Untergang. Nur noch mit dem Klüver sauste ich jetzt vor dem Wind, nahm gelegentlich noch gewaltige Sturzwellen auf, musste aber Gott sei Dank den unmittelbaren Tod nicht mehr fürchten. Ich nahm das Steuerruder und atmete freier, denn ich sah die Möglichkeit vor mir, noch einmal davonzukommen. Augustus lag nach wie vor bewusstlos auf dem Boden des Boots, und da er in Gefahr war zu ertrinken (das Wasser stand fast einen Fuß hoch, wo er gestürzt war), richtete ich seinen Oberkörper auf und band ihn in sitzender Position mit einem Tau an einem Ring am Deck der Kombüse fest. Nachdem ich also alles, so gut ich es in meinem verfrorenen und aufgewühlten Zustand konnte, in Ordnung gebracht hatte, befahl ich mich Gott und beschloss, was auch immer da kommen mochte, mit Fassung zu ertragen.
Kaum hatte ich mich dazu durchgerungen, erscholl plötzlich wie aus den Kehlen von tausend Dämonen ein lautes und langes Kreischen oder ein Schrei, der die ganze Atmosphäre um das Boot herum und darüber auszufüllen schien. Solange ich lebe, werde ich die grauenvolle Todesangst nicht vergessen, die ich in diesem Augenblick empfand. Meine Haare standen mir zu Berge – das Blut stockte mir in den Adern – mein Herzschlag setzte aus – und ohne auch nur ein einziges Mal den Blick zu heben, um die Ursache meines Entsetzens zu erkennen, fiel ich der Länge nach bewusstlos auf den Körper meines gestürzten Freundes.
Als ich wieder zu mir kam – in der Kajüte eines großen Walfängers (namens Penguin), der Nantucket anfuhr –, standen mehrere Personen um mich herum, und Augustus, bleicher als der Tod, rieb eifrig meine Hände. Da ich die Augen öffnete, lösten seine dankbaren Freudenrufe bei den rauen Gesellen, die uns umstanden, abwechselnd Gelächter und Tränen aus. Warum wir überlebt hatten, war bald geklärt. Wir waren von dem Walfänger untergepflügt worden, der mit so viel Segeln, wie er riskieren konnte, Richtung Nantucket kreuzte und infolgedessen fast im rechten Winkel zu unserem eigenen Kurs unterwegs war. Mehrere Männer hielten vorne Ausschau, sahen unser Boot aber erst, als es unmöglich war, einen Zusammenstoß zu vermeiden – ihre plötzlichen Warnrufe waren es, die mich aufgeschreckt hatten. Das riesige Schiff, so erzählten sie mir, fuhr mit solcher Leichtigkeit über uns hinweg, wie unser eigenes kleines Gefährt über eine Feder geglitten wäre, und ohne dabei in seiner Fahrt im mindesten behindert zu werden. Kein Schrei kam vom Deck des Opfers – es war nur ein knirschendes Geräusch zu hören, das im Geheul von Wind und Wasser unterging, als die zerbrechliche Jolle vom Wasser verschluckt wurde und unter dem Kiel ihres Zerstörers entlangschabte. Doch das war alles. Im Glauben, unser Boot (das, wie man sich erinnern wird, entmastet war) sei nur ein herrenlos dahintreibendes Ruderboot, wollte der Kapitän (Kapitän E.T.V. Block aus New London) seinen Kurs fortsetzen, ohne sich weiter mit der Sache aufzuhalten. Zum Glück schworen zwei Männer vom Ausguck Stein und Bein, sie hätten jemanden an unserem Steuer gesehen und es sei vielleicht noch möglich, ihn zu retten. Es entspann sich eine Debatte, bis Block wütend wurde und schließlich sagte, es sei nicht seine Aufgabe, »ständig nach Nussschalen Ausschau zu halten«, das Schiff werde »wegen solchen Unfugs nicht seinen Kurs ändern«; und wenn dort ein Mann überfahren wurde, dann sei es »niemandes Schuld als seine eigene« – er solle »ruhig ertrinken und zur Hölle gehen« oder etwas in der Art. Henderson, der erste Maat, mischte sich daraufhin ein. Er war, wie auch der Rest der Mannschaft, zu Recht ungehalten über ein solches Maß an abscheulicher Herzlosigkeit. Er sprach freiheraus, da er die Besatzung auf seiner Seite wusste. Er erklärte dem Kapitän, seiner Ansicht nach gehöre er an den Galgen, und jedenfalls werde er solche Befehle nicht befolgen, und wenn er, sowie er an Land komme, dafür gehängt werde. Er schritt nach achtern, stieß Block (der sehr blass geworden war und nichts erwiderte) zur Seite, ergriff das Steuer und gab mit fester Stimme das Kommando zum Wenden. Die Männer rannten an ihre Posten, und das Schiff wendete geschickt. Das alles hatte knapp fünf Minuten gedauert, und es schien nahezu ausgeschlossen, dass noch jemand gerettet werden konnte – vorausgesetzt, dass sich überhaupt jemand auf dem Boot befunden hatte. Doch, wie der Leser weiß, kamen Augustus und ich mit dem Leben davon; und unsere Rettung wurde offenbar durch zwei solcher fast unglaublichen Zufälle ermöglicht, welche die Weisen und Frommen dem besonderen Walten der Vorsehung zuschreiben.
Während das Schiff noch weiter durch den Wind wendete, ließ der Steuermann das Beiboot aussetzen und sprang, glaube ich, mit just den beiden Männern hinein, die behauptet hatten, mich am Steuer gesehen zu haben. Sie hatten gerade die Leeseite des Schiffs verlassen (der Mond schien immer noch hell), als dieses sich lange und mächtig windwärts neigte und Henderson im gleichen Augenblick von der Bank aufsprang und seiner Crew zubrüllte, sie sollten rückwärts rudern. Er befahl nichts anderes, nur voller Ungeduld: »Rückwärts rudern! Rückwärts!« Die Männer legten sich ins Zeug, wie sie nur konnten; doch jetzt hatte das Schiff beigedreht und volle Fahrt aufgenommen, obwohl alle Mann an Bord die größten Anstrengungen unternahmen, die Segel einzuholen. Ungeachtet der damit verbundenen Gefahr klammerte sich der Maat an die Groß-Rüsten, sowie sie in seine Reichweite kamen. Mit einem weiteren gewaltigen Stampfen hob sich die Steuerbordseite des Schiffs fast bis zum Kiel aus dem Wasser, und da wurde der Grund für seine Sorge sichtbar. Der Körper eines Mannes hatte sich aufs Merkwürdigste an der glatten und glänzenden Unterseite des Schiffs verhakt (die Penguin war kupferfest und ihr Boden mit Kupfer verkleidet) und schlug bei jeder Bewegung des Rumpfs heftig dagegen. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, bei jedem neuen Überholen des Schiffs und bei der ständigen Gefahr, dass das Boot voll Wasser lief, wurde ich schließlich aus meiner gefährlichen Lage befreit und an Bord gehievt – denn der besagte Körper war mein eigener. Anscheinend hatte sich einer der Spantenbolzen gelockert und sich durch das Kupfer gebohrt und bei mir, als ich unter dem Schiff hindurchglitt, festgehakt und mich dergestalt am Rumpf fixiert. Der Bolzenkopf war durch den Kragen meiner grünen Flanelljacke und hinten in meinen Nacken gedrungen und dann zwischen zwei Sehnen gleich unter meinem rechten Ohr wieder nach außen getreten. Ich wurde sofort ins Bett gepackt, obwohl alles Leben aus mir gewichen schien. Ein Wundarzt befand sich nicht an Bord. Dafür kümmerte sich der Kapitän sehr aufmerksam um mich – um, wie ich annehme, in den Augen der Mannschaft sein grässliches Betragen im vorangegangenen Teil des Abenteuers wiedergutzumachen.
In der Zwischenzeit hatte Henderson erneut vom Schiff abgestoßen, obgleich der Wind jetzt in Orkanstärke blies. Nach wenigen Minuten stieß er auf einige Trümmer unseres Boots, und kurz darauf behauptete einer der Männer, er könne inmitten des Sturmgebrauses in Abständen Hilfeschreie hören. Dies führte dazu, dass die kühnen Seemänner mehr als eine halbe Stunde lang ihre Suche fortsetzten, obgleich Kapitän Block ihnen wiederholt signalisierte, sie sollten zurückkehren, und jeder Moment auf dem Wasser in einem so zerbrechlichen Boot tödliche Gefahr bedeutete. Es ist wirklich kaum zu fassen, dass das kleine Beiboot, in dem sie sich befanden, auch nur für einen Augenblick der Zerstörung entging. Es war allerdings für den Walfang gebaut und, wie ich mittlerweile glaube, mit Luftkanistern ausgestattet – so wie manche Rettungsboote, die an der Küste von Wales eingesetzt werden.
Nachdem sie während des oben erwähnten Zeitraums vergeblich gesucht hatten, entschieden sie, zum Schiff zurückzukehren. Kaum hatten sie diesen Entschluss gefasst, nahmen sie einen schwachen Schrei von einem dunklen, schnell vorbeitreibenden Gegenstand wahr. Sie folgten ihm und holten ihn bald ein. Es war das komplette Verdeck vom Unterstand der Ariel. Daneben zappelte Augustus offenbar im letzten Todeskampf. Als sie ihn zu fassen bekamen, stellte sich heraus, dass er mit einem Tau an dem schwimmenden Brett festgebunden war. Dieses Tau, wie man sich erinnern wird, hatte ich selbst um seinen Leib geschlungen und an einem Ringbolzen befestigt, um ihn aufrecht zu halten, und dies, so zeigte sich nun, war letztendlich der Grund, warum er überlebt hatte. Die Ariel war nicht sonderlich stabil zusammengebaut und daher bei der Kollision in Stücke gegangen; das Verdeck des Unterstands wurde, wie zu erwarten, durch die Wucht des hereinstürzenden Wassers von den Seitenwänden abgerissen und stieg (vermutlich mit anderen Wrackteilen) an die Oberfläche – Augustus trieb mit nach oben und entkam so einem schrecklichen Tod.
Es dauerte über eine Stunde, nachdem er an Bord der Penguin gebracht worden war, bevor er etwas über sich selbst sagen oder begreifen konnte, welche Art von Unglück unserem Boot widerfahren war. Endlich wurde er vollkommen wach und schilderte ausführlich, wie es ihm im Wasser ergangen war. Als er das erste Mal wieder zu Bewusstsein kam, war er untergetaucht und wurde in unfassbarer Geschwindigkeit im Kreis herumgewirbelt, wobei sich das Seil drei- oder viermal stramm um seinen Hals schlang. Einen Augenblick später ging es rasch aufwärts, bis sein Kopf mit voller Wucht gegen etwas Hartes schlug und er erneut die Besinnung verlor. Als er das nächste Mal zu sich kam, konnte er schon ein wenig klarer denken, fühlte sich aber immer noch hochgradig benommen und verwirrt. Er wusste jetzt, dass eine Havarie geschehen war und dass er sich im Wasser befand; sein Mund war jedoch über der Wasseroberfläche, sodass er leidlich atmen konnte. Wahrscheinlich trieb das Verdeck in diesem Moment schnell vor dem Wind und zog ihn, der auf dem Rücken lag, hinter sich her. Solange er diese Position beibehalten konnte, war es kaum möglich zu ertrinken. Doch bald schleuderte ihn eine Sturzwelle aufs Verdeck, an dem er sich, so gut er konnte, festklammerte und dabei immer wieder um Hilfe schrie. Kurz bevor Mr. Henderson ihn entdeckte, musste er vor Erschöpfung loslassen, rutschte ins Meer zurück und gab sich auf. Während seines ganzen Überlebenskampfs konnte er sich weder an die Ariel noch an den Hergang oder die Ursache seines Unglücks erinnern. Ein allgemeines Gefühl von Schrecken und Verzweiflung hatte seine Geisteskräfte vollständig paralysiert. Als er schließlich geborgen wurde, war er keines Gedankens mehr fähig; und nachdem man ihn an Bord der Penguin gebracht hatte, dauerte es, wie schon erwähnt, fast eine Stunde, bis er sich seiner Lage bewusst wurde. Was mich selbst betrifft – ich wurde aus einem Zustand, der nah am Tod war, wiederbelebt (nachdem dreieinhalb Stunden lang alle anderen Mittel versagt hatten) durch kräftiges Abreiben mit in heißem Öl getränkten Badetüchern – eine Maßnahme, die Augustus vorgeschlagen hatte. Die Wunde an meinem Nacken sah zwar scheußlich aus, erwies sich aber als relativ harmlos, und ich erholte mich bald davon.
Die Penguin lief gegen neun Uhr morgens in den Hafen ein, nach einem der schwersten Stürme, der je vor Nantucket getobt hatte. Wir beide, Augustus und ich, schafften es, pünktlich bei Mr. Barnard zum Frühstück zu erscheinen – das zum Glück wegen der nächtlichen Gesellschaft verspätet stattfand. Ich nehme an, am Tisch waren alle zu übermüdet, um unseren ramponierten Zustand zu bemerken – der einer eingehenden Prüfung natürlich nicht standgehalten hätte. Aber Schuljungen können wahre Wunder der Verstellungskunst vollbringen, und ich glaube wahrhaftig, dass keinem unserer Freunde in Nantucket der leiseste Verdacht kam, dass die ungeheuerliche Geschichte, die von einigen Seeleuten in der Stadt erzählt wurde – sie hätten auf offener See ein Schiff gerammt und dreißig oder vierzig arme Teufel ersäuft –, irgendetwas mit der Ariel, meinem Kameraden oder mir zu tun hätte. Wir beide haben danach oft über die Sache gesprochen – aber nie ohne tiefes Erschauern. In einem unserer Gespräche gestand Augustus mir, in seinem ganzen Leben habe er niemals ein so panisches Entsetzen empfunden wie an Bord unseres kleinen Boots, als er plötzlich das Ausmaß seiner Trunkenheit erkannte und merkte, dass er ihr hilflos ausgeliefert war.
IIDas Versteck
Haben wir uns einmal über etwas ein günstiges oder ungünstiges Urteil gebildet, ziehen wir selbst aus den einfachsten Fakten keine sicheren Schlussfolgerungen mehr. Man möchte annehmen, dass eine Katastrophe wie die soeben beschriebene meine aufkeimende Leidenschaft für das Meer deutlich abgekühlt hätte. Doch im Gegenteil, ich habe nie eine größere Sehnsucht nach den wilden Abenteuern des Seemannslebens empfunden als in der Woche nach unserer wundersamen Rettung. Diese kurze Zeit reichte aus, um in meiner Erinnerung die Schatten zu löschen und all das herrlich Aufregende und Pittoreske der soeben überstandenen Gefahr in lebendigem Licht erstrahlen zu lassen. Meine Gespräche mit Augustus wurden immer häufiger und fesselten mich täglich mehr. Er erzählte seine Erlebnisse auf See (von denen mehr als die Hälfte, wie ich heute glaube, frei erfunden war) so eindrucksvoll, dass mein begeisterungsfähiges Temperament und meine zwar düstere, aber durchaus glühende Vorstellungskraft sich der Faszination nicht entziehen konnten. Es ist übrigens merkwürdig, dass er meine Gefühle besonders dann für das Seemannsleben einnahm, wenn er Schreckensgeschichten von Leid und Verzweiflung erzählte. Für die helle Seite des Gemäldes hatte ich nur begrenzt Sympathie. Meine Zukunftsvisionen handelten von Schiffbruch und Hunger, von Tod oder Gefangenschaft bei barbarischen Horden, von einem Leben, das voll Kummer und Tränen auf einer grauen öden Felseninsel dahinsiechte, unerreichbar in einem unbekannten Ozean. Solche Vorstellungen oder Sehnsüchte – denn auf Sehnsüchte lief es hinaus – sind, wie man mir seither versichert hat, bei den zahlreichen Melancholikern unter den Menschen recht weit verbreitet; zu der Zeit, von der ich spreche, sah ich sie als prophetische Vorausblicke auf ein Schicksal, das mir in einem gewissen Maß vorherbestimmt schien. Augustus ließ sich ganz und gar auf meine Stimmungslage ein. Es ist sogar wahrscheinlich, dass unsere enge Verbundenheit zu einem teilweisen Austausch unseres Charakters führte.
Etwa achtzehn Monate nach dem Untergang der Ariel wurde die Reederei Lloyd und Vredenburgh (eine Firma, die, wie ich glaube, mit den Messrs. Enderby in Liverpool zusammenhängt) damit beauftragt, die Brigg Grampus zu überholen und für den Walfang auszurüsten. Das Schiff war ein alter Kasten und selbst, als alles so weit wie möglich hergerichtet war, nur bedingt seetüchtig. Ich konnte mir kaum erklären, warum ausgerechnet diese Brigg vor anderen und guten Schiffen, die sich im Besitz der gleichen Eigentümer befanden, den Vorzug bekam – aber so war es. Mr. Barnard wurde mit dem Kommando betraut, und Augustus sollte ihn begleiten. Während die Grampus noch seeklar gemacht wurde, stellte er mir des Öfteren vor Augen, welch fabelhafte Gelegenheit sich doch jetzt böte, meiner Reiselust zu frönen. Er fand in mir einen keineswegs abgeneigten Zuhörer – doch ließ sich die Sache nicht so einfach bewerkstelligen. Mein Vater sprach sich nicht direkt dagegen aus; aber meine Mutter bekam bei der bloßen Erwähnung des Plans einen hysterischen Anfall; und vor allem schwor mein Großvater, von dem ich einiges zu erwarten hatte, er würde mich enterben, wenn ich das Thema je wieder aufs Tapet brächte. Doch diese Probleme, weit davon entfernt, mein Verlangen abzukühlen, gossen nur Öl ins Feuer. Ich war entschlossen, koste es, was es wolle, mitzufahren; und nachdem ich Augustus meine Absicht mitgeteilt hatte, brüteten wir über einem Plan, um sie in die Tat umzusetzen. In der Zwischenzeit hütete ich mich, vor meinen Angehörigen irgendetwas von der Reise verlauten zu lassen, und da ich mich scheinbar meinen üblichen Studien widmete, ging man davon aus, ich hätte den Plan aufgegeben. Ich habe seitdem über mein damaliges Verhalten oft voller Missfallen und staunender Verwunderung nachgedacht. Die enorme Heuchelei, mit der ich damals mein Vorhaben beförderte – eine Heuchelei, die lange Zeit jedes Wort und jede Handlung meines Lebens durchdrang –, war für mich nur zu ertragen durch die wilde und glühende Sehnsucht, mit der ich der Erfüllung meiner lange gehegten Reiseträume entgegensah.
Bei der Ausführung meines raffinierten Täuschungsmanövers war ich natürlich gezwungen, viele Dinge Augustus zu überlassen, der den größten Teil des Tages auf der Grampus zu tun hatte, wo er die Vorbereitungen für seinen Vater in der Kajüte und dem angeschlossenen Laderaum überwachte. Abends freilich versäumten wir nicht, uns zu treffen und über unsere Hoffnungen zu sprechen. Nachdem so fast ein ganzer Monat vergangen war, ohne dass uns irgendein erfolgversprechender Plan eingefallen wäre, erklärte er mir schließlich, er habe alles Notwendige entschieden. Ich hatte einen Verwandten, der in New Bedford lebte, einen Mr. Ross, in dessen Haus ich gelegentlich zwei oder drei Wochen am Stück verbrachte. Die Brigg sollte etwa Mitte Juni (Juni 1827) in See stechen, und wir vereinbarten, dass mein Vater ein oder zwei Tage, bevor sie auslief, einen kurzen Brief von Mr. Ross erhalten sollte, worin dieser wie üblich mich bat, herüberzukommen und zwei Wochen mit Robert und Emmet (seinen Söhnen) zu verbringen. Augustus übernahm es, den Brief abzufassen und zustellen zu lassen. Nachdem ich angeblich nach New Bedford aufgebrochen war, sollte ich meinen Freund aufsuchen, der für mich ein Versteck auf der Grampus herrichten wollte. Das Versteck, versicherte er mir, würde bequem genug sein, um sich darin mehrere Tage aufzuhalten, während derer ich mich nicht blicken lassen durfte. Erst wenn die Brigg so weit auf See war, dass eine Umkehr nicht mehr infrage kam, sollte ich, sagte er, offiziell in der Kajüte mit all ihrem Komfort untergebracht werden. Und was seinen Vater betraf, so würde der über den gelungenen Streich nur herzlich lachen. Wir würden genug Schiffen begegnen, mit denen wir einen Brief nach Hause zu meinen Eltern schicken könnten, worin ich ihnen mein Abenteuer erklärte.
Endlich war Mitte Juni, und alles war bereit. Der Brief war geschrieben und zugestellt, und an einem Montagmorgen verließ ich das Haus, um vorgeblich das Postschiff nach New Bedford zu nehmen. Ich ging jedoch geradewegs zu Augustus, der an der Straßenecke auf mich wartete. Nach unserem ursprünglichen Plan hätte ich mich bis zum Einbruch der Dunkelheit fernhalten und erst dann an Bord der Brigg schleichen sollen, aber da uns jetzt dichter Nebel in die Karten spielte, kamen wir überein, mich unverzüglich zu verstecken. Augustus ging voraus zum Kai, und ich folgte ihm in kurzer Entfernung, eingehüllt in einen schweren Matrosenmantel, den er mir mitgebracht hatte, sodass ich nicht leicht erkannt werden konnte. Gerade als wir um die zweite Ecke bogen, nachdem wir an Mr. Edmunds Brunnen vorbeigegangen waren, wer steht da plötzlich vor mir und sieht mir direkt ins Gesicht? Der alte Mr. Peterson, mein Großvater! »Du meine Güte, was soll das denn, Gordon?«, sagte er nach einer langen Pause, »also, was soll … wem gehört denn dieser dreckige Mantel, den du da anhast?« »Sir!«, erwiderte ich und nahm, so gut es mir in der Zwangslage gelang, eine Miene beleidigter Überraschung an und sprach in schroffstem Ton: »Sir! Sie sind wohl schief gewickelt. Erst mal heiß ich nich Goddin, und was fällt Ihnen überhaupt ein, dass Sie meinen neuen Mantel dreckig nennen, Sie Lump Sie!« Meiner Treu, ich musste mich mächtig zusammenreißen, um nicht lauthals loszulachen angesichts der komischen Art, wie der alte Gentleman diese handfeste Zurechtweisung entgegennahm. Er wich zwei oder drei Schritte zurück, wurde zuerst blass und dann puterrot, er riss seine Brille hoch, schob sie wieder herunter und ging mit erhobenem Schirm auf mich los. Dann hielt er in vollem Lauf inne, als ob ihm plötzlich etwas einfiele. Schließlich drehte er sich um, humpelte die Straße hinunter, zitternd vor Wut, und zischte zwischen seinen Zähnen: »Taugt nichts – neue Brille – dachte, es wäre Gordon – verdammter Nichtsnutz von Teerjacke.«
Nachdem wir so knapp davongekommen waren, gingen wir nun mit größerer Vorsicht weiter und gelangten sicher an unser Ziel. Es waren nur ein oder zwei Seeleute an Bord, und diese waren vorne mit den Lukendichtungen auf der Back beschäftigt. Kapitän Barnard, wie wir wohl wussten, hatte einen Termin bei Lloyd und Vredenburgh und würde bis spätabends dort bleiben, sodass wir von ihm nichts zu befürchten hatten. Augustus ging als Erster an Bord des Schiffs, und ich folgte ihm kurz darauf nach, ohne dass die beiden arbeitenden Männer mich bemerkten. Wir gingen schnurstracks in die Kajüte, wo wir niemanden vorfanden. Sie war höchst komfortabel ausgestattet – etwas ungewöhnlich für ein Walfangschiff. Es gab vier fabelhafte Kammern mit breiten und bequemen Kojen. Mir fiel auch ein großer Ofen auf und ein bemerkenswert dicker und wertvoller Teppich, der den Boden der Kajüte und der vier Kabinen bedeckte. Die Decke war ganze sieben Fuß hoch, und, kurzum, alles erschien mir geräumiger und behaglicher, als ich es mir vorgestellt hatte. Doch Augustus ließ mir kaum Zeit, mich umzusehen; er bestand vielmehr darauf, ich müsse mich so schnell wie möglich verstecken. Er führte mich in seine eigene Kabine, die auf der Steuerbordseite der Brigg gleich neben den Schotten lag. Hinter uns riegelte er sofort die Tür ab. Mir schien, ich hätte noch nie einen schöneren kleinen Raum gesehen. Er war etwa zehn Fuß lang und hatte nur eine Koje, die, wie schon erwähnt, breit und bequem war. In dem Teil der Kammer, der den Schotten am nächsten lag, waren noch vier Quadratfuß Platz, und dort befanden sich ein Tisch, ein Stuhl und ein Hängeregal voller Bücher, hauptsächlich Reiseliteratur. Es gab viele weitere kleine Annehmlichkeiten in dem Raum, worunter, was ich nicht auslassen sollte, eine Art Safe oder Eisspind war, in dem Augustus mir eine Menge Delikatessen, sowohl Essen wie Getränke, zeigte.
Er drückte jetzt in der soeben beschriebenen Ecke auf eine bestimmte Stelle des Teppichs und erklärte mir, dass ein Teil des Bodens, etwa vierzig Zentimeter im Quadrat, säuberlich ausgesägt und dann wieder eingesetzt worden sei. Auf den Druck hin hob sich das Geviert an einem Ende, sodass er mit seinen Fingern darunter greifen konnte. Auf diese Weise öffnete er die Klappe der Falltür (auf welcher der Teppich mit Reißnägeln befestigt war), und ich sah, dass sie in den hinteren Laderaum hinunterführte. Als Nächstes zündete er mit einem Streichholz eine kleine Kerze an, steckte sie in eine Blendlaterne und kletterte damit durch die Öffnung. Er forderte mich auf, ihm zu folgen. Das tat ich, und daraufhin zog er die Klappe an einem Nagel, der unten aus ihr herausragte, über das Loch – sodass das Stück Teppich sich wieder an seiner alten Stelle einpasste und nicht die Spur einer Bodenöffnung mehr zu sehen war.
Die Kerze leuchtete so schwach, dass ich mir nur mit größter Mühe meinen Weg durch das Gewirr aus Latten und Brettern bahnen konnte, in dem ich mich wiederfand. Doch allmählich gewöhnten sich meine Augen an die Düsternis, und ich kam, während ich mich am Rockschoß meines Freundes festhielt, besser voran. Nachdem wir durch unzählige enge, gewundene Gänge gekrochen waren, brachte er mich schließlich zu einer eisenbeschlagenen Kiste, wie man sie manchmal zur Verschickung von feinen Töpferwaren benutzt. Sie war fast vier Fuß hoch und ganze sechs lang, aber sehr schmal. Darauf lagen zwei große leere Ölfässer und auf diesen wiederum eine Unmenge von Strohmatten bis zum Boden der Kajüte hochgeschichtet. Der übrige Raum war vollgestopft mit einem wilden Chaos aus allem möglichen Schiffsgerät sowie einem Durcheinander von Kästen, Körben, Fässern und Ballen, sodass es an ein Wunder grenzte, dass wir überhaupt einen Weg zur Kiste gefunden hatten. Ich erfuhr später, dass Augustus all diese Dinge mit Absicht so in dem Laderaum verstaut hatte, um mir ein perfektes Versteck zu schaffen – wobei ihm nur ein einziger Mann geholfen hatte, der aber nicht mit der Brigg ausfuhr.
Mein Freund zeigte mir jetzt, dass sich eins der Kopfbretter der Kiste nach Belieben entfernen ließ. Er schob es zur Seite und offenbarte das Innere der Kiste, das mich außerordentlich erfreute. Eine Matratze aus einer der Kabinenkojen bedeckte den ganzen Boden, und ansonsten enthielt sie alles an Annehmlichkeiten, was sich auf so kleinem Raum versammeln ließ. Dennoch hatte ich genug Platz für mich selbst, konnte aufrecht sitzen oder ausgestreckt liegen. Unter anderem gab es einige Bücher, Feder, Tinte und Papier, drei Decken, einen großen Krug voll Wasser, eine Dose mit Schiffszwieback, drei oder vier große Dauerwürste, einen enormen Schinken, eine gebratene kalte Hammelkeule sowie ein halbes Dutzend Flaschen mit Kräuterschnäpsen und Likören. Ich nahm sogleich von meiner kleinen Behausung Besitz, und zwar, dessen bin ich mir gewiss, mit größerer Befriedigung, als sie je ein König bei Betreten seines neuen Schlosses empfand. Augustus zeigte mir nun, wie ich das offene Ende der Kiste schließen konnte, dann hielt er die Kerze nah an die Decke und wies mich auf eine schwarze Peitschenschnur hin, die dort befestigt war. Diese, so sagte er, führte von meinem Versteck durch all die Windungen des Holzgerümpels zu einem Nagel, der in der Decke des Achterraums gleich unter der Falltür steckte, die in seine Kabine führte. Anhand dieser Schnur würde ich also leicht ohne seine Hilfe meinen Weg nach draußen finden, falls irgendein unvorhergesehenes Malheur dies notwendig machen sollte. Jetzt nahm er von mir Abschied, ließ mir die Laterne mit einem reichlichen Vorrat an Kerzen und Streichhölzern da und versprach, mich so oft zu besuchen, wie es ihm unbemerkt möglich war. Das war am 17. Juni.
Ich blieb drei Tage und Nächte (soweit ich es abschätzen konnte) in meinem Versteck, ohne es zu verlassen, abgesehen von zwei Malen, als ich mich zwischen zwei Lattenkisten gleich gegenüber der Öffnung stellte, um meine Glieder zu strecken. Während der ganzen Zeit sah ich von Augustus nichts; aber das beunruhigte mich nicht weiter, weil ich wusste, dass die Brigg jeden Moment in See stach, und in dem allgemeinen Trubel fand er sicher kaum Gelegenheit, zu mir herunterzukommen. Schließlich hörte ich, wie die Falltür geöffnet und wieder geschlossen wurde, und schon rief er leise nach mir, fragte, ob alles in Ordnung sei und ob mir etwas fehle. »Nein«, erwiderte ich, »ich fühle mich so wohl wie nur möglich. Wann läuft die Brigg aus?« »In weniger als einer halben Stunde«, antwortete er. »Das wollte ich dir mitteilen, und außerdem hatte ich die Befürchtung, dass du dir Sorgen wegen meines Fernbleibens machst. Ich werde eine ganze Weile nicht mehr herunterkommen können, vielleicht dauert es noch einmal drei oder vier Tage. Oben an Deck läuft alles gut. Wenn ich hochgehe und die Falltür zumache, kannst du an der Peitschenschnur entlangkriechen bis zu der Stelle, wo der Nagel eingeschlagen ist. Dort findest du meine Taschenuhr – die kannst du vielleicht gut brauchen, um nach der Zeit zu sehen, weil du ja kein Tageslicht hast. Ich nehme an, du weißt gar nicht, wie lange du schon hier unten bist – erst drei Tage –, heute ist der Zwanzigste. Ich würde dir die Uhr zu deiner Kiste bringen, aber ich fürchte, dass man mich schon vermisst.« Damit ging er wieder nach oben.
Etwa eine Stunde später spürte ich deutlich, dass sich die Brigg in Bewegung setzte, und gratulierte mir dazu, endlich auf einer echten Seereise zu sein. Ganz erfüllt von diesem Gedanken, wollte ich mich so wenig betrüben wie möglich und den Gang der Dinge abwarten, bis ich die Kiste mit dem geräumigeren, wenn auch kaum bequemeren Quartier der Kabine vertauschen durfte. Meine erste Sorge galt der Uhr. Ich ließ die Kerze brennen, tastete mich an der Schnur durchs Dunkel und durch unzählige Windungen, von denen mich manche, wie ich herausfand, nach langer mühsamer Strecke zurück an eine Stelle führten, die nur ein oder zwei Fuß von einer früheren Position entfernt war. Schließlich erreichte ich den Nagel, nahm den Gegenstand, für den ich ausgezogen war, an mich und kehrte damit sicher zurück. Jetzt sah ich mir die Bücher an, die mit solchem Bedacht bereitgelegt waren, und wählte die Expedition von Lewis und Clarke an die Mündung des Columbia River aus. Damit unterhielt ich mich eine Weile, bis ich müde wurde. Ich löschte sorgfältig das Licht und fiel bald in tiefen Schlummer.





























