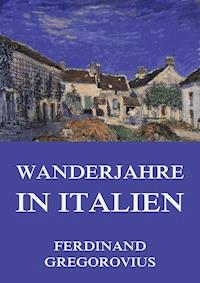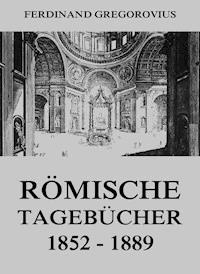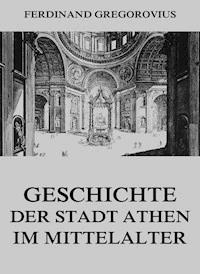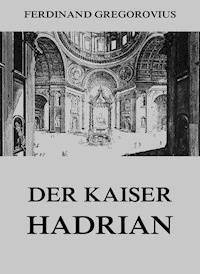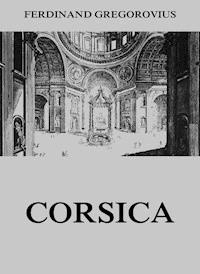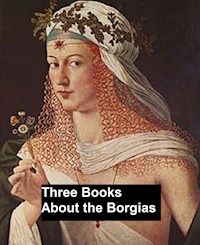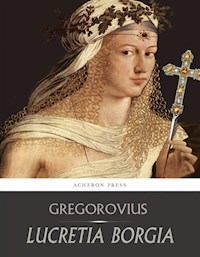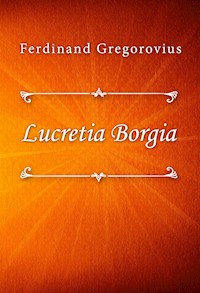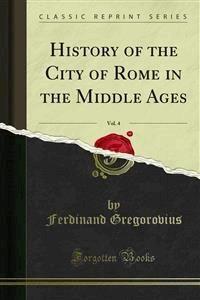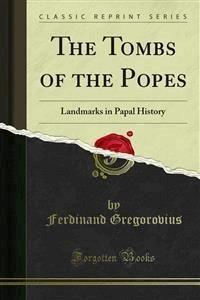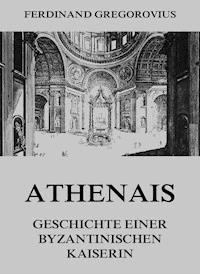
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
1882 veröffentlichte Gregorovius die Monographie "Athenais, Geschichte einer byzantinischen Kaiserin", welcher die Übersetzung eines Gesangs ihres Gedichtes "Cyprianus und Justina" beigegeben ist, gewissermaßen "der ersten dichterischen Behandlung des Themas der Faustsage" (3. Aufl. 1892). Athenais war die geistvolle Tochter des heidnischen Philosophen Leontius, trat zum Christentum über, wurde als Gemahlin Theodosius' II. Kaiserin Eudokia (421 - 441 oder 444) und endete, seit 450 Witwe, ihr Leben ca. 460 zu Jerusalem im Exil. Ihre Geschichte interessierte G. um so mehr, als sie ihm "eine zweifache Metamorphose Griechenlands versinnbildlichte: den Übergang vom Heidentum in das Christentum und vom Hellenentum in das Byzantinertum". So konnte er mit der Erzählung der Geschicke der Athenais wieder eine höchst anschauliche, lehrreiche Schilderung jenes Umwandlungsprozesses verbinden, der ihn, wie ähnliche andere Übergangsperioden, ausnehmend fesselte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Athenaïs – Geschichte einer byzantinischen Kaiserin
Ferdinand Gregorovius
Inhalt:
Ferdinand Gregorovius – Biographie und Bibliographie
Athenaïs – Geschichte einer byzantinischen Kaiserin
Vorwort.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
Cyprianus und Justina
Zweiter Gesang: Das Bekenntniß des Cyprianus.
Athenaïs – Geschichte einer byzantinischen Kaiserin, F. Gregorovius
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849640743
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Ferdinand Gregorovius – Biographie und Bibliographie
Deutscher Geschichtschreiber und Dichter, geb. 19. Jan. 1821 zu Neidenburg in Ostpreußen, gest. 1. Mai 1891 in München, studierte in Königsberg Theologie und Philosophie, trieb aber dann poetische und historische Studien, veröffentlichte seit 1841 mehrere belletristische Werke, unter andern »Werdomar und Wladislaw, aus der Wüste Romantik« (Königsb. 1845, 2 Tle.), dann die bedeutendere Arbeit: »Goethes Wilhelm Meister in seinen sozialistischen Elementen« (das. 1849), der die kleineren Schriften: »Die Idee des Polentums« (das. 1848) und »Die Polen- und Magyarenlieder« (das. 1849), folgten. Die Frucht gründlicher historischer Studien waren die Tragödie »Der Tod des Tiberius« (Hamb. 1851) und die »Geschichte des römischen Kaisers Hadrian und seiner Zeit« (das. 1851, 3. Aufl. 1884; engl., Lond. 1898). Im Frühjahr 1852 begab sich G. nach Italien, das er seitdem vielfach durchwanderte, und wo er sich bis 1874 aufhielt. 1880 unternahm er eine Reise nach Griechenland, 1872 nach Ägypten, Syrien und Konstantinopel. Seitdem lebte er abwechselnd in Rom und in München. Interessante Ergebnisse seiner Beobachtungen und Studien in Italien enthalten das treffliche Werk über »Corsica« (Stuttg. 1854, 2 Bde.; 3. Aufl. 1878; auch ins Englische übersetzt) und die u. d. T. »Wanderjahre in Italien« (5 Bde.) gesammelten, in wiederholten Auflagen erschienenen Schriften: »Figuren. Geschichte, Leben und Szenerie aus Italien« (Leipz. 1856), »Siciliana, Wanderungen in Neapel und Sizilien« (1860), »Lateinische Sommer« (1863), »Von Ravenna bis Mentana« (1871) und »Apulische Landschaften« (1877). Daran schloss sich »Die Insel Capri« (Leipz. 1868, mit Bildern von K. Lindemann-Frommel; 3. Aufl. 1897). Auch sein idyllisches Epos »Euphorion« (Leipz. 1858, 6. Aufl. 1891; von Th. Grosse illustriert, 1872) atmet südliche Luft und klassischen Geist. Er lieferte auch eine gelungene Übersetzung der »Lieder des Giovanni Meli von Palermo« (Leipz. 1856, 2. Aufl. 1886). »Die Grabdenkmäler der römischen Päpste« (Leipz. 1857, 2. Aufl. 1881; engl., Lond. 1903) sind eine Vorstudie zu seinem Hauptwerke, der »Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter« (Stuttg. 1859–73, 8 Bde.; 5. Aufl. 1903 ff.), worin er Rom als Residenz der Päpste und als Mittelpunkt der mittelalterlichen Geschichte mit geschichtlichem Verständnis und unter Würdigung seiner Bau- und Kunstdenkmäler behandelt. Die Stadt Rom beschloss die Übersetzung des Werkes ins Italienische (»Storia della città di Roma nel medio evo«, Vened. 1874–1876, 8 Bde.) und ernannte G. zum Ehrenbürger. Auch ins Englische wurde das Werk übersetzt. Später erschienen von ihm: »Lucrezia Borgia« (Stuttg. 1874, 2 Bde.; 4. Aufl. 1906; franz., Par. 1876; engl., Lond. 1904), eine Ehrenrettung der berüchtigten Frau; »Urban VIII. im Widerspruch zu Spanien und dem Kaiser« (Stuttg. 1879, von G. selbst ins Italienische übersetzt, Rom 1879); »Athenais, Geschichte einer byzantinischen Kaiserin« (Leipz. 1882, 3. Aufl. 1891); »Korfu, eine ionische Idylle« (das. 1882); »Kleine Schriften zur Geschichte der Kultur« (das. 1887–92, 3 Bde.) und »Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter« (Stuttg. 1889, 2 Bde.). Auch gab er die »Briefe Alexanders v. Humboldt an seinen Bruder Wilhelm« (Stuttg. 1880) und einen von ihm aufgefundenen Stadtplan Roms (»Una pianta di Roma delineata da Leonardo da Besozzo Milanese«, Rom 1883) heraus. Nach seinem Tod erschienen: »Gedichte« (hrsg. vom Grafen Schack, Leipz. 1891), »Römische Tagebücher« (hrsg. von Althaus, Stuttg. 1892; 2. Aufl. 1894), »Briefe von Ferd. G. an den Staatssekretär Herm. v. Thile« (hrsg. von H. v. Petersdorff, Berl. 1894), »Ferdinand G. und seine Briefe an Gräfin Ersilia Caetani Lovatelli« (hrsg. von Siegmund Münz, das. 1896, die Zeit 1866–91 umfassend, nebst kurzer Biographie). Nach dem Tode seines Bruders vermachte G. seiner Vaterstadt sein Vermögen.
Athenaïs – Geschichte einer byzantinischen Kaiserin
Vorwort.
Schon vor einigen Jahren hatte ich mir vorgestellt, daß es lohnend sein könnte, die Geschichte jener Philosophentochter Athenaïs zu schreiben, welche im fünften Jahrhundert als die byzantinische Kaiserin Eudokia durch ihren Geist und ihre Erlebnisse berühmt gewesen ist. Erst mein Aufenthalt in Athen im Frühjahr 1880 hat mich dazu angeregt, diesen Plan aufzunehmen.
Wenn man auf der Akropolis Athens, vor dem Tempel der Nike Apteros, oder der Parthenos sitzend, in die Betrachtung der Geschichte Griechenlands sich versenkt, so erscheinen dort der erregten Phantasie deutlicher und persönlicher die Gestalten der Vorzeit, und bald ist man, wie Odysseus im Reiche der Schatten, von einem Chor hellenischer Geister umringt, an die man manche Frage richten möchte. Ich erinnerte mich dort auch jener genialen Athenerin, deren Schicksale ich in ihren Umrissen kannte, und zwar aus der Geschichte ihrer Tochter Eudoxia, der Gemalin des römischen Kaisers Valentinian III.
Nach meiner Rückkehr von Athen zog ich das Material für eine Biographie der Athenaïs aus den byzantinischen Geschichtschreibern. Ich überzeugte mich dabei, daß eher noch eine Anschauung jener rätselhaften Zeit, als ein lebendiges Porträt der berühmten Frau zu gewinnen sei. Doch das hat mich nicht von meinem Vorsatze abgeschreckt. Denn zu anziehend ist der Prozeß jener Epoche selbst, wo das antike Heidenthum in der Stadt Platos den letzten Verzweiflungskampf mit dem christlichen Glauben kämpft; wo die alten Götter des Olymp in einem schauerlichen Weltbrande untergehen; wo die großen Barbarenkönige Alarich, Genserich und Attila wie apokalyptische Reiter ihren Verheerungszug durch die Länder der alten Cultur nehmen; wo die großen christlichen Theologen, ihre Verbündete in der Vernichtung der schönen antiken Welt, Hieronymus, Augustinus, Johannes Chrysostomus, die beiden griechischen Gregore, Cyrillus und der Papst Leo I., das dogmatische Lehrgebäude der Kirche feststellen; und wo endlich jene seltsame asiatisch-griechische Schöpfung der Geschichte, die wir den Byzantinismus nennen, ihre erste bestimmte Physiognomie zu zeigen beginnt.
Nun bietet sich als ein Mittelpunkt, um welchen solche und andere Erscheinungen sich aufreihen lassen, gerade Athenaïs Eudokia dar, weil sie selbst das Heidentum mit dem Christentum verbindet, indem sie aus jenem in dieses, und aus dem noch antik-philosophischen Athen in das orthodox-christliche Byzanz übertritt. Wenn nicht schon solche geistige Gegensätze ihr Leben merkwürdig machten, so würden dies in jedem Falle die wundervollen Scenen thun, auf welchen sich dasselbe bewegt hat; denn diese sind die Städte Athen, Constantinopel und Jerusalem, und zwar im fünften Jahrhundert. Eine Anschauung von ihnen in jener Uebergangsepoche zu gewinnen, war für mich ein Reiz mehr, der mich nach dem Gegenstande zog.
Die Deutschen, deren Forschungslust kaum noch ein verborgener Winkel im Leben der Welt entgangen ist, haben diesen Stoff noch nicht geschichtlich behandelt. Ich kenne überhaupt nur eine kleine Schrift über Athenaïs, welche Wilhelm Wiegand, Director des Gymnasiums zu Worms, unter dem Titel »Eudoxia, Gemalin des oströmischen Kaisers Theodosius II.« im Jahre 1871 veröffentlicht hat. (Der Name muß Eudokia geschrieben werden.) Der Verfasser hat sein Buch als »ein culturhistorisches Bild zur Vermittlung des Humanismus und des Christentums« bezeichnet. Ich habe es mit Genuß gelesen, und wünsche ihm mehr Verbreitung, als es gefunden zu haben scheint. Es ist das Product eines durch die hellenische Literatur gebildeten und philosophisch geschulten Mannes; seinem Stoff aber hat er durch novellistische Erfindung einen erhöhten Reiz zu geben geglaubt.
Nun liegt nichts näher, als die Versuchung, die wunderbare Geschichte der Athenaïs in Novellenform zu behandeln, und das hat bereits im 18. Jahrhundert ein Franzose, Baculard d'Arnaud, in einem sentimentalen Roman gethan. Ich wundere mich, daß von unseren heutigen Dichtern, welche gerade Zustände und Zeiten, die vom modernen Bewußtsein am weitesten abgelegen sind, mit so vielem Geschick und Erfolge in sogenannten culturhistorischen Romanen dargestellt haben, keiner an Athenaïs sich versucht hat, und doch hat Kingsley in seiner »Hypatia« gezeigt, wie dankbar für einen reflectirenden Dichter eben diese Epoche des im Christentum untergehenden Hellenismus sein kann.
Ich bestätige indeß das Urteil Georg Finlay's, der in seinem geistvollen Buche »Griechenland unter den Römern« gesagt hat: »Das ereignißvolle Leben Eudokias, der Gemalin Theodosius II., braucht keine romantischen Begebenheiten aus orientalischen Märchen zu borgen; es erfordert nur einiges Genie seines Erzählers, um ein reiches Gewebe der Romantik zu entfalten.«
Wenn meine Leser solches Talent in dieser Schrift vermissen, werden sie doch in ihr überall die Wahrheitsliebe des Geschichtschreibers finden, welcher jede willkürliche Zuthat abgelehnt und aus allen historischen Quellen geschöpft hat, um auf dem Hintergrunde der Zeit die Gestalt der Athenaïs in ihrer geschichtlichen Wirklichkeit erscheinen zu lassen. Die Natur dieser Quellen aber ist solche, daß nur eine Skizze daraus hervorgehen konnte: vielleicht um so besser für den Leser, weil er hier noch selbstthätig bleiben kann, während er in einem kleinen Rahmen immer eine Fülle von Dingen gewahrt, die ihm Perspectiven in das große Weltleben eröffnen.
Ich habe meiner Schrift die Uebersetzung eines Gesanges des Gedichts der geistvollen Kaiserin beigegeben, welches Cyprianus und Justina heißt. Diese Dichtung wird jedem Leser willkommen sein, denn sie läßt die geistigen Züge der Zeit schärfer hervortreten. Das griechische Original ist im heroischen Versmaß geschrieben. Aber sein tief gehender Inhalt paßt so wenig zu unserm immer leicht aus seinen Zügeln fahrenden deutschen Hexameter, daß ich den Jambus gewählt habe, der eine recht philosophische Versart ist.
Meine Uebersetzung beansprucht nicht das Lob solcher philologischen Treue, als die lateinische in der Ausgabe des Florentiners Bandini vom Jahre 1762 verdient. Diese ist hexametrisch. Wer den griechischen Text zur Hand nimmt, wird begreifen, daß bei der oft rätselhaften tief dunkeln Natur des Gedichtes seine wortgenaue Wiedergabe nicht überall möglich war. Die Fülle, Würde und Energie des griechischen wie des lateinischen Hexameters machen bei der Gewalt der antiken Sprache außerdem vieles Mittelmäßige noch immer genießbar, wenn dasselbe in einer modernen Sprache geradezu unerträglich wird. Meine Leser werden es billigen, daß ich einiges Unbedeutende und Unverständliche fortgelassen, oder große Längen und Wiederholungen des Originals durch Zusammenziehung vermieden habe.
Das Gedicht der Kaiserin Athenaïs Eudokia ist bei uns so gut wie unbekannt; und niemals ist von ihm, so viel ich weiß, eine deutsche Uebersetzung versucht worden. Sein literarischer Wert aber ist kein geringerer als dieser, daß es die erste dichterische Behandlung eines Themas ist, dessen modernste Gestalt die Faustsage genannt werden kann.
München, im October 1881.
F. G.
I.
Im vierten und fünften Jahrhundert unserer Zeitrechnung hatte die Stadt Athen nur noch eine literarische Bedeutung als Hochschule für einen großen Teil der griechisch redenden Völker. Der Glaube an die alten Götter Homer's lebte hier mit den dichterischen und philosophischen Traditionen hartnäckiger fort, als irgend wo anders in dem ganzen römischen Reiche. Er stand im Schutze alter akademischer Institute, ruhmvoller Erinnerungen der Geschichte, und herrlicher Monumente der Vergangenheit.
Der Vorzug des geistig schon längst trümmerhaften Athen war noch immer dieser, das »Hellas in Hellas« zu sein, wo die Begeisterung für die antike Literatur durch die Declamationen der Rhetoren und Sophisten, und vor allem in der berühmten Akademie Platos genährt wurde. Noch gab es Nachfolger des unsterblichen Philosophen auf seinem Lehrstule, während die drei andern Schulen alter Weisheit erloschen waren.
Athen war noch immer das Ziel für die ideale Sehnsucht und die Wißbegierde ausländischer Jugend. Wie die Erzählungen von der Schönheit der hehren Stadt der Pallas Athene, und von den Hörsälen der dortigen Philosophen den Sophisten Libanius in seiner Heimat nicht hatten ruhen lassen, so trieb noch später, im Jahre 429, derselbe Ruf und dieselbe Hoffnung den jungen Proklus von Alexandria nach Athen. Dort studirt zu haben galt als ein beneidenswertes Glück, welches überall in der Welt auf Ehre und Bewunderung Anrecht gab.
Dies zeigt ein Brief, den der geistvolle Neuplatoniker Synesius von Cyrene, der Schüler der Philosophin Hypatia, als er den Plan gefaßt hatte nach Athen zu reisen, an seinen Bruder Euoptius geschrieben hat:
»Oft stürmen Privatpersonen und Priester mit Träumen auf mich ein, welche sie für Offenbarungen ausgeben, mir Unheil drohend, wenn ich nicht so bald als möglich nach dem heiligen Athen mich aufmache. Wolan, wenn Du einem Schiffer aus dem Piräeus begegnest, so schreibe an mich; denn dort werde ich die Briefe in Empfang nehmen. Aus dieser Reise nach Athen werde ich nicht allein den Nutzen ziehen, mich von gegenwärtigen Uebeln frei zu machen, sondern ferner nicht mehr nötig haben, Menschen, die von dort hergekommen sind, wegen ihrer Gelehrsamkeit ohne weiteres anzustaunen. Solche Leute sind von uns andern Sterblichen in nichts verschieden, zumal was das Verständniß des Aristoteles und Plato betrifft, aber sie schreiten unter uns einher wie Halbgötter unter Maulthieren, weil sie die Akademie und das Lykeion und die bunte Halle des Zeno gesehen haben, die aber nicht mehr eine bunte ist, denn der Proconsul hat die Gemälde daraus hinweggenommen, und so die Herren gehindert, im Weisheitsdünkel groß zu thun.«
Auf zahllosen Stätten Athens lebten die Erinnerungen an die großen Menschen und Werke des Altertums. Lehrer und Schüler wandelten noch voll Andacht an den Abhängen des sophokleischen Kolonós, auf der mit Denkmälern erfüllten Gräberstraße vor dem Dipylon, in den Olivenhainen am Kephissos, und unter den Platanen der Akademie, deren Fortbestand durch alte und neue Vermächtnisse für immer gesichert war. Die unsterblichen Dichter, die Philosophen und Redner Griechenlands schienen auf diesem geheiligten Boden in einer fortwirkenden Persönlichkeit gegenwärtig zu sein. Man zeigte noch ihre bescheidenen Wohnhäuser und die Scenen ihrer Thätigkeit.
Wenn der hier studirende Jüngling die äußere Gestalt Athens betrachtete, so konnte ihm die Kluft, die ihn von der classischen Vorzeit trennte, nicht einmal übermäßig groß erscheinen. Wenn er die breite Treppe zur Akropolis emporstieg, auf deren weißglänzender Felsenfläche noch der Erzkoloß der Athena Promachos, das Werk des Phidias, aufrecht stand, so sah er alle jene Bauwerke unversehrt, die diese Götterburg zum unvergleichlichen Denkmal nicht nur der Stadtgeschichte Athens, sondern der gesammten Cultur des hellenischen Geistes gemacht hatten: die Propyläen, den Niketempel, den Parthenon, das Erechtheion; und noch standen viele antike Weihgeschenke und Meisterwerke der Kunst an ihrem Ort.
Auf den Marmorsesseln des noch vollkommen erhaltenen Dionysostheaters konnte er niedersitzen, den Blick auf das sonnige Meer von Aegina und Salamis richten, und Verse jener großen Dichter recitiren, deren Stücke einst auf dieser erhabensten Schaubühne der Welt das Volk der Athener begeistert hatten.
Die Grotten des Pan und Apollo, die Straße der choragischen Dreifüße, der Areopag, die Pnyx, das panathenaische Stadium über dem Ilissos, der Prachttempel des olympischen Zeus, und der des Ares, die Agora, das Prytaneum, alle diese und andere Monumente des antiken Lebens der Athener standen noch, wie zur Zeit des Pausanias, wenn auch verlassen und öffentlich nicht mehr geehrt.
Bei solchem localen Verkehr mit den Genien des Altertums, mußte das Studium in Athen zu einem fortgesetzten Heroencultus werden, und einer Einweihung gleich sein in die Mysterien der Weisheit an ihrem eingeborenen Sitz. Man mag sich vorstellen, welchen magischen Zauber all' dies auf die Gemüter der jungen Ausländer üben mußte. Gregor von Nazianz, welcher bis zu seinem dreißigsten Jahre mit seinem Freunde Basilius in Athen studirt hatte, gestand, daß der Aufenthalt in dieser noch hartnäckig heidnischen Stadt der christlichen Jugend verderblich sei, aber er selbst riß sich nur mit Wehmut von ihr los. Nichts, so sagte dieser große Kirchenvater, ist so schmerzlich, als die Empfindung, von Athen und den Studiengenossen dort zu scheiden.
Nirgend konnte es ein idealeres Local für wissenschaftliche und künstlerische Studien geben. Dies entzückende Stück Erde Attika war die wundervollste Idylle der Welt, und Athen das durch die Jahrhunderte geweihte Heiligtum der Musen. Nichts störte hier die gedankenvolle Einsamkeit. Der Zusammenhang mit den Dingen und Ereignissen draußen war nur mittelbar und zufällig. In dem ausgestorbenen Hafen Piräeus zeigten sich keine Kriegsschiffe mehr; selbst große Handelsschiffe waren dort selten. Die byzantinische Regierung Achajas hatte ihren Sitz nicht in Athen, sondern in dem reicheren Korinth.
Das municipale und allgemeine Leben der Athener bewegte sich fast ausschließlich um die Angelegenheiten der akademischen Hörsäle. Wir haben Berichte von dem Treiben der Professoren und Studenten dort, die ein Gemälde darbieten, vielfach demjenigen ähnlich der Hochschulen Bologna und Padua im Mittelalter, oder der Universitäten Göttingen und Halle im achtzehnten Jahrhundert.
Aus den Provinzen Asiens und Afrikas, aus Bithynien, Pontus und Armenien, aus Syrien und Aegypten und aus dem europäischen Hellas, strömte noch immer die griechisch redende, lernbegierige Jugend nach Athen. Selbst von Hypatia, der Zierde des alexandrinischen Museums, wird geglaubt, daß sie in Athen studirt hatte. Auch das lateinische Abendland hörte noch nicht ganz auf, von dort seine Bildung in der Wissenschaft der Griechen zu holen. Noch im fünften Jahrhundert hat der berühmte Boethius Jahre lang in Athen studirt, derselbe letzte Weise Roms, der im Todeskerker, obwol ein Christ, nicht die christliche Religion, sondern die antike Philosophie zu seiner Trösterin herbeigerufen hat.
Das Christentum verhielt sich zu den heidnischen Studien minder feindlich in Athen als an andern Orten. Die Bekenner der neuen Religion hatten, während ihrer Verfolgungen in der Kaiserzeit, in Griechenland minder zu leiden gehabt. Dies beweist die auffallend geringe Zahl der Griechen, namentlich aber der Athener im Katalog der Märtyrer. Vielleicht hatte in keiner andern hellenischen Stadt von Ruf und Bedeutung der christliche Glaube es schwerer, Anhänger zu gewinnen und Fortschritte zu machen, als in Athen. Die hier vom Apostel Paulus und seinem Schüler Dionysos vom Areopag gestiftete Gemeinde war, so darf man glauben, minder zahlreich, als jene in Patras und Korinth.
Im vierten und fünften Jahrhundert erscheint die bischöfliche Kirche Athens in durchaus bescheidenen Verhältnissen, und ohne jede hervorragende geistliche Macht. Sie konnte auf dem dürren Felsenboden Attikas nicht durch Güterbesitz reich sein, noch war sie irgend durch eine theologische Schule berühmt. Die dogmatischen Kämpfe innerhalb der byzantinischen und orientalischen Kirche konnten in der Stadt des Plato keinen fruchtbaren Boden finden. Nur als legendäre Namen, geschichtlich unsicher und in ihrer Reihe lückenhaft, sind überhaupt Bischöfe Athens in langem Jahrhunderten für uns sichtbar. So ist aus dem vierten Säculum nur Pistos bekannt, der beim Concil zu Nicäa anwesend war; im fünften Jahrhundert erscheinen nur die Namen von drei athenischen Bischöfen.
Sicherlich hielt ein großer Teil der Athener noch immer den Glauben an die olympischen Götter fest, und entschieden war die Mehrheit der Professoren heidnisch. Kein namhafter Rhetor oder Philosoph Athens im vierten und fünften Jahrhundert ist, soviel wir wissen, Christ gewesen. Kein Christ aber nahm deshalb Anstoß, Schüler eines gelehrten Heiden zu sein. Denn noch gab es, trotz der Schriften großer Kirchenväter, keine christliche Schule: es bestand nur die eine Wissenschaft der Alten, und diese, das Gemeingut aller Gebildeten, konnte nur bei heidnischen Grammatikern und Philosophen gelernt werden.
Der gefeierte Patriarch Constantinopels, Johannes Chrysostomus, welcher die Verführung der christlichen Jugend durch den ausschließlichen Unterricht bei heidnischen Lehrern beklagte, war selbst Schüler des Sophisten Libanius in Antiochia gewesen. Die berühmten Kirchenväter Basilius von Cäsarea und Gregor von Nazianz hatten in Athen aus den Quellen heidnischer Beredsamkeit mit gleicher Begeisterung ihre attische Bildung geschöpft, wie eben jener Libanius, wie der Sophist Himerius und der kaiserliche Prinz Julian. Dieser Apostat des Christentums würde in seinen eigensinnigen Bemühungen um die Wiederherstellung der untergehenden Religion der Hellenen kaum so weit gegangen sein, wenn er nicht in Athen seine Studien gemacht hätte. Es war hier, unter den Tempeln und Standbildern der Götter Griechenlands, wo ihn im Jahre 355 seine Ernennung zum Cäsar überraschte; und von hier aus hat er dann seine geschichtliche Laufbahn angetreten.
So war Athen noch immer eine gesuchte Bildungsanstalt, die mit den großen Schulen in Constantinopel, in Alexandria und Antiochia wetteifern konnte. Aber die Vereinsamung und die Entfernung dieser Stadt des Perikles und Plato von den geschichtlichen Strömungen der auf neuen Bahnen fortschreitenden Menschheit, und ihre Teilnamlosigkeit an den großen geistigen Kämpfen und Lebenslagen, welche diese umgestalteten, verurteilten Athen dazu, nur als heiliges Museum des Altertums fortzudauern, nur noch ein literarisches und antiquarisches Schattendasein zu führen. Und hier würde die Kehrseite der Idealität Athens darzustellen sein, der fossile Zustand einer in ihre Erinnerungen versunkenen Provinzialstadt, welche kein politisches Leben mehr besaß, sondern nichts war als die veraltende Akademie einer untergehenden Wissenschaft, aus der kein das Bewußtsein der Menschheit entzündender und kein den Geist der Welt reformirender Gedanke mehr ausgehen konnte.
II.
Wir kennen die Persönlichkeiten mancher Lehrer der Wissenschaften in Athen während des vierten Jahrhunderts aus dem »Leben der Sophisten« des Eunapius. Es sind darunter einige zu ihrer Zeit hoch angesehene Männer, wie Julianus von Cäsarea, Proäresius und Libanius, Musonius, Aedesius und Himerius. In der Reihe solcher Berühmtheiten steht aber nicht der Sophist, dessen geistvolle Tochter Athenaïs das Diadem der byzantinischen Kaiserin getragen hat. Nur durch ihren wunderbaren Glanz und Ruhm ist sein Name überhaupt auf die Nachwelt gekommen.
Dieser glückliche Mann war Leontius. Der Afrikaner Olympiodorus, welcher während der Regierung der Kaiser Arcadius und Theodosius des Zweiten als Dichter, Geschichtschreiber und Staatsmann in Constantinopel vielen Einfluß genoß, hat erzählt, daß er auf einer Reise einmal nach Athen gekommen sei, und hier durch seine Bemühungen den Leontius, obwol wider dessen Willen, auf den sophistischen Lehrstul eingesetzt habe. Das Jahr, in welchem dies geschah, ist unbekannt.
Leontius sträubte sich, den noch immer viel begehrten »Tron des Sophisten«, das heißt des öffentlichen Lehrers der griechischen Redekunst, zu besteigen, und so eine Ehre anzunehmen, welche ihn zum Scholarchen der Jugend in Athen machte. Wenn er ein ruheliebender Mann war, so mußte er sich vor den unausbleiblichen Angriffen der Neider und vor der Eifersucht der Pedanten fürchten, und seine Weigerung spricht vielleicht dafür, daß der Ehrgeiz in ihm geringer war, als die sokratische Tugend der Bescheidenheit und Selbsterkenntniß.
In diesem von seinem Freunde Olympiodor begünstigten Sophisten darf man ohne jedes Bedenken den Vater der Athenaïs erkennen. Seine Lebensschicksale aber sind ganz unbekannt. Wir wissen nicht einmal, ob er Athener von Geburt gewesen ist. Wie viele andere Redekünstler und Philosophen, welche aus Städten Asiens oder Afrikas nach Athen herübergekommen waren und dann daselbst das Bürgerrecht und eine bleibende Stellung gewannen, konnte auch Leontius aus der Fremde eingewandert gewesen sein. Der Name Athenaïs, welchen er seiner Tochter gab, beweist nur seine Liebe zu Athen, seinen Enthusiasmus für die attische Weisheit und seinen Glauben an die alten Götter des Olymp. Der Weisheitsgöttin Athene hatte der Sophist sein Kind geweiht in einer Zeit, wo das hellenische Heidentum dem unrettbaren Untergange entgegen ging.
Leontius konnte kaum mehr der Schüler irgendeines der berühmten Rhetoren gewesen sein, welche, wie Proäresius und Himerius, der Hochschule Athen hohen Ruf und Bedeutung verliehen hatten. Diese letzte Glanzperiode der griechischen Beredsamkeit war vorübergegangen, und ihr Epigone auf dem öffentlichen Lehrstul gehörte schon den Zeiten des Verfalls der Rhetorik an.
Als Knabe erlebte Leontius die fantastische und fruchtlose Reaction des Kaisers Julian gegen das ihm verhaßte Christentum. Als Jüngling und Mann sah er den Zusammensturz des Hellenismus im ganzen Römerreich durch die Verfolgungsedicte des ersten Theodosius sich beschleunigen, und noch im Todesjahre dieses Kaisers (395) brach die verhängnißvolle Invasion der Gothen Alarichs über die Städte Griechenlands herein.
Diese furchtbaren Werkzeuge der Zertrümmerung der antiken Welt hat der Vater der Athenaïs wahrscheinlich in Athen selbst mit Augen gesehen. Die Einnahme der alten Hauptstadt aller griechischen Bildung durch nordische Barbarenvölker bezeichnete, wenn sie sich auch in Folge eines Vertrages ohne Greuel vollzogen hatte, einen geschichtlichen Abschnitt im Leben der Hellenen.
Zwar hörte seit dieser Katastrophe die athenische Hochschule nicht auf fortzubestehen: die Lehrstüle der Sophisten erhielten sich, und die neuplatonische Philosophie fand bald nachher in dem Athener Plutarch ein angesehenes Oberhaupt. Aber nach Naturgesetzen mußte jetzt Athen immer tiefer sinken, gleich Rom, nachdem auch diese Weltstadt nur vierzehn Jahre später von denselben Gothen erobert und geplündert war.
Das wegwerfende Urteil des Synesius von Cyrene über den Zustand Athens beweist, wie immer es erklärt werden mag, den Verfall des geistigen Lebens dort. Er schrieb an seinen Bruder folgenden Brief:
»Ich möchte gern aus Athen so viel Gewinn ziehen, als Du immer wünschen kannst; und schon komme ich mir vor, als habe ich um eine Hand breit an Weisheit zugenommen. Nichts hindert mich, Dir davon eine Probe abzulegen. Denn ich schreibe Dir ja aus Anagyrus, und ich habe Sphettus, Thria, Kephisia und Phaleron mit Augen gesehen. Trotzdem sei doch der Schiffspatron verdammt, der mich hierher gebracht hat. Das heutige Athen besitzt nichts Erhabenes mehr, als die berühmten Namen seiner Oertlichkeiten. Und wie von einem geschlachteten Opferthier nur das Fell bekundet, daß es einst ein lebendiges Geschöpf gewesen ist, so ist auch von der aus dieser Stadt hinweggewanderten Philosophie nichts anderes mehr für den Bewunderer übrig geblieben, als der Anblick der Akademie und des Lykeion, und fürwahr auch der gemalten Stoa, von welcher die Philosophie des Chrysippus ihren Namen empfangen hat. Diese Stoa aber ist keine gemalte mehr; denn der Proconsul hat jene Gemälde hinweggenommen, welchen der Thasier Polygnot sein Kunstgenie eingehaucht hatte. In unsern heutigen Tagen zieht Aegypten die Saaten groß, welche es von Hypatia empfangen hat, aber die Stadt Athen, die einstmals der Sitz der Weisen gewesen ist, hat heute nur noch Ruf durch ihre Honigkrämer. Dasselbe gilt von dem Zwiegespann der weisen Plutarche, welche nicht durch den Ruf ihrer Weisheit die Jugend in die Hörsäle locken, sondern durch die Honigkrüge vom Hymettos.«