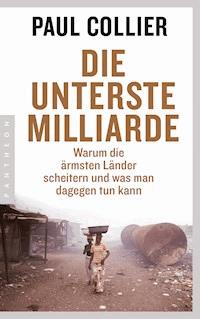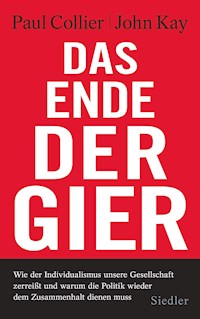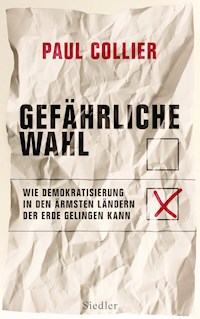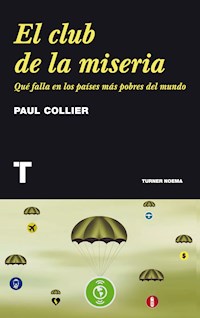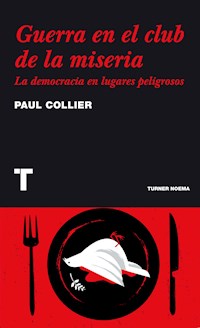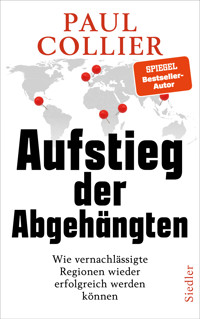
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Warum wir eine neue, lokal orientierte Wirtschaftspolitik brauchen
In Europa und auf der ganzen Welt finden sich Orte, die einst wohlhabend waren und heute abgeschlagen sind: arme Regionen in reichen Ländern, wie das englische South Yorkshire, oder vollends abgehängte Länder wie Sambia und Kolumbien. In seinem augenöffnenden Buch erklärt Bestsellerautor Paul Collier, warum diese Regionen den wirtschaftlichen Anschluss verloren haben und was geschehen muss, damit sie wieder aufholen können. An vielen Beispielen zeigt er, dass gängige marktwirtschaftliche Annahmen überholt sind, Entwicklungschancen verhindern und ökonomische Krisen sogar verstärken. Um wachsende Ungleichheit und ein drohendes globales Armutsproblem abzuwenden, braucht es eine neue Wirtschaftspolitik, die individuelle Lösungen zulässt: Colliers regionalökonomischer Ansatz verdeutlicht, dass sozialer Zusammenhalt, gemeinsame Ziele und schnelles Lernen die Schlüssel für eine zukunftsfähige Gesellschaft sind, die echte Chancen auf Teilhabe für alle ermöglicht. Und er ist so auch eine hoffnungsvolle Vision für eine bessere Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Vision des Wirtschaftsbuchpreisträgers für eine Welt, in der Wohlstand für alle möglich ist
In Europa und auf der ganzen Welt finden sich Orte, die einst wohlhabend waren und heute abgeschlagen sind: arme Regionen in reichen Ländern, wie das englische South Yorkshire, oder vollends abgehängte Länder wie Sambia und Kolumbien. In seinem augenöffnenden Buch erklärt Bestsellerautor Paul Collier, warum diese Regionen den wirtschaftlichen Anschluss verloren haben und was geschehen muss, damit sie wieder aufholen können. An vielen Beispielen zeigt er, dass gängige marktwirtschaftliche Annahmen überholt sind, Entwicklungschancen verhindern und ökonomische Krisen sogar verstärken. Um wachsende Ungleichheit und ein drohendes globales Armutsproblem abzuwenden, braucht es eine neue Wirtschaftspolitik, die individuelle Lösungen zulässt: Colliers regionalökonomischer Ansatz verdeutlicht, dass sozialer Zusammenhalt, gemeinsame Ziele und schnelles Lernen die Schlüssel für eine zukunftsfähige Gesellschaft sind, die echte Chancen auf Teilhabe für alle ermöglicht. Und er ist so auch eine hoffnungsvolle Vision für eine bessere Welt.
»Eine unerlässliche, globale und multidisziplinäre Analyse des Problems der Chancenungleichheit.«
Financial Times
Paul Collier, geboren 1949 in Sheffield, ist einer der wichtigsten Wirtschaftswissenschaftler der Gegenwart. Er war Leiter der Forschungsabteilung der Weltbank und lehrt als Professor für Ökonomie an der Universität Oxford. Seit vielen Jahren forscht er über die ärmsten Länder der Erde und untersucht den Zusammenhang zwischen Armut, Kriegen und Migration. Sein Buch »Die unterste Milliarde« (2008) sorgte international für große Aufmerksamkeit und wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Lionel Gelber Prize und der Corine. Im Siedler Verlag erschienen außerdem »Gefährliche Wahl« (2009), »Der hungrige Planet« (2011), »Exodus« (2014) – eines der wichtigsten Bücher zur Migrationsfrage – sowie »Gestrandet« (2017, mit Alexander Betts). Sein Buch »Sozialer Kapitalismus!« wurde 2019 mit dem Deutschen Wirtschaftsbuchpreis ausgezeichnet. Zuletzt erschien »Das Ende der Gier« (2021, mit John Kay).
Besuchen Sie uns auf www.siedler-verlag.de
Paul Collier
Aufstieg der Abgehängten
Wie vernachlässigte Regionen wieder erfolgreich werden können
Aus dem Englischen von Thorsten Schmidt
Die Originalausgabe erschien 2024
unter dem Titel Left Behind
bei Allen Lane, einem Imprint von Penguin Random House UK.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024, Paul Collier
All rights reserved
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024
Siedler Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Fabian Bergmann
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagmotiv: © Shutterstock/airdone und infinetsoft
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-21509-5V001
Inhalt
1. Am Wendepunkt
Teil I Abwärtsspirale
2. Neue Revolutionen, zerfallende Gewissheiten
3. Versteckte Verzweiflung
4. Versteckte Privilegien: Divergierende Lebenschancen
Teil II Aufwärtsspirale
5. Führungsstärke
6. Regionale Erneuerung »von unten nach oben«
7. Inklusiver Wohlstand
8. Urbanisierung: Oase oder Todesfalle?
9. Der goldene Käfig
10. Die tragenden Säulen des Staates aufbauen
11. Moralische Normen und Gemeinwohl
12. Unterstützer, keine Heilsbringer
Nachwort: Verlorene Zeit aufholen
Dank
Anmerkungen
Register
1. Am Wendepunkt
In diesem Buch geht es um Gebiete, die einst wohlhabend waren, aber mittlerweile abgehängt sind. Sie finden sich überall auf der Welt, als verarmte Landstriche selbst in reichen Ländern. So brach die Stahlindustrie, die in South Yorkshire – dem nordenglischen Metropolitanbezirk, in dem meine Heimatstadt Sheffield liegt – jahrhundertelang das Rückgrat der örtlichen Wirtschaft gebildet hatte, in den 1980er-Jahren zusammen. Heute ist die Region die ärmste in ganz England. Auch in Ländern mit mittlerem Einkommen ist das Phänomen weit verbreitet: Die ehemals prosperierende karibische Küstenregion Kolumbiens ist heute viel ärmer als die Boomregion um die Hauptstadt Bogotá. Manchmal sind auch ganze Länder wirtschaftlich abgestiegen. Sambia im südlichen Afrika war einst reicher als Chile, beides bedeutende, miteinander konkurrierende Kupferexporteure; heute beträgt das mittlere Einkommen der Sambier weniger als ein Zehntel desjenigen der Chilenen. Doch nicht nur Sambia insgesamt ist zu einem abgehängten Land geworden, vielmehr gibt es innerhalb seiner Grenzen Regionen wie etwa den Copperbelt, das einst größte Kupferabbaugebiet des Kontinents, die ihrerseits stärker von dem Abwärtstrend erfasst wurden und heute weit hinter der wohlhabenderen Hauptstadt Lusaka hinterherhinken. Als abgehängte Region in einem abgehängten Land ist der Copperbelt doppelt benachteiligt. Ich arbeite in all diesen Gebieten und höre dort immer wieder zwei brennende Fragen: Warum sind wir zurückgefallen? Was können wir tun, um wieder Anschluss zu finden?
Als Ökonom, der eine gründliche Ausbildung in der vorherrschenden angloamerikanischen Denkschule der Wirtschaftswissenschaften erhalten hat, weiß ich, dass es – nach herrschender Lehre – zwei Antworten auf Fragen nach den geeigneten wirtschaftspolitischen Rezepten für Gebiete gibt, die von einem Schock getroffen wurden. Der intellektuelle Ursprung dieser beiden Antworten findet sich in der Chicagoer Schule; einer ihrer bekanntesten Vertreter, Nobelpreisträger Milton Friedman, veranschaulichte eine komplexe Theorie darüber, warum man den Marktkräften vertrauen kann, die Dinge wieder ins Lot zu bringen, durch die Metapher einer Harfe mit gespannten Saiten: Negative Schocks wie etwa der Zusammenbruch einer Bergbauindustrie entsprechen demnach dem Zupfen der Harfensaiten – auch wenn sie eine Zeit lang schwingen, werden sie bald wieder in ihren Anfangszustand zurückkehren. Der Schock wird zu sinkenden Löhnen und Immobilienpreisen führen, dies wird neue Gelegenheiten für gute Geschäfte schaffen, und weil der Markt gierig nach solchen Chancen ist, strömen Gelder herein, was Löhne und Preise wieder nach oben treibt.
Diese Idee war allerdings eine »vorschnelle Gewissheit«, die sich als falsch erwies. Trotzdem wurde sie rasch zur vorherrschenden Lehrmeinung, ich selbst habe diese Theorien am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford gelehrt. In den 1980er-Jahren gehörten sie zu den anerkannten Axiomen der dominierenden wirtschaftswissenschaftlichen Lehre, strikt daran festzuhalten galt als Ausweis rationalen Denkens.
Das britische Treasury (Schatzamt) hat diese Lehre allerdings viel dogmatischer umgesetzt als seine Pendants in allen weiteren großen Volkswirtschaften. Die Finanz- und Wirtschaftsministerien in Kontinentaleuropa oder den USA wurden entweder von anderen Denkschulen beeinflusst oder handelten weniger doktrinär, pragmatischer. (Obgleich Friedman und die Chicagoer Schule während der Präsidentschaft von Ronald Reagan die Wirtschaftspolitik prägten, war der Monetarismusin den USA nie unangefochten.) Zudem verfügt das Treasury über eine außerordentliche Machtfülle, während die abgehängten Regionen Großbritanniens kaum noch eigene Machtbefugnisse besitzen. Ihre Geschichte steht beispielhaft für das, was geschieht, wenn eine bestimmte ökonomische Doktrin im Rahmen höchst ungleicher politischer Machtverhältnisse mit unerbittlicher Konsequenz verfolgt wird: Und genau das verleiht dieser Geschichte globale Relevanz. Sie verdeutlicht, was in vielen anderen hochzentralisierten, aber ärmeren Ländern wie Sambia und Kolumbien, in denen ebenfalls einige Regionen weit zurückgefallen sind, geschah bzw. noch immer geschieht.
Gewissheit ist immer gefährlich – sie führte auch zum Desaster der Vereinigten Staaten im Vietnamkrieg: Das Buch Die Torheit der Regierenden der amerikanischen Historikerin Barbara Tuchman, unter anderem eine scharfe Abrechnung mit dem von 1961 bis 1968 amtierenden US-Verteidigungsminister Robert McNamara, gipfelt in der vernichtenden Bemerkung, er habe »die Gabe der unerschütterlichen Überzeugung« besessen. Seine grenzenlose Selbstüberschätzung basierte auf dem unbedingten Glauben an die Macht der Quantifizierung. McNamara war überzeugt davon, dass die USA den Krieg in Vietnam gewinnen würden, und setzte mehrere Präsidenten so massiv unter Druck, bis sie ihm glaubten.1 Auch das britische Schatzamt besitzt die Gabe der Gewissheit. Unabhängig davon, was mit einer Region geschah, die von einem Schock getroffen wurde, stellte es seine Ideen nie infrage.
Als Teenager las ich Voltaires satirischen Klassiker Candide, in dem die Witzfigur Dr. Pangloss vorkommt, der glaubt, dass alles, was geschieht, immer zum Besten sei und wir in der besten aller möglichen Welten leben. Voltaire nahm die prärevolutionäre katholische Kirche Frankreichs und ihre Gewissheit von der Güte Gottes aufs Korn. Dadurch, dass Dr. Pangloss in Situationen, in denen sein Eingreifen entscheidend hätte sein können, passiv bleibt, ist er wiederholt für Katastrophen verantwortlich, verspürt aber nie den geringsten Zweifel, dass er sich richtig verhalten hat.
Die Überzeugungen Friedmans und des britischen Finanz- und Wirtschaftsministeriums wären einer Voltaire’schen Satire würdig: Ihre Rezepte sind nichts anderes als »Wirtschaftspolitik à la Pangloss«, streng nach dem Motto: Wir sind die Treuhänder des Geldes der Steuerzahler. Es ist unsere Pflicht, jedem spitzfindigen Argumentieren in eigener Sache und jedem Versuch, Marktkräften Fesseln anzulegen, entgegenzutreten. Als Experten wissen wir es besser, und daher ist es unsere Pflicht, unsere Autorität walten zu lassen: Kein Ort verdient irgendeine Sonderbehandlung. Der Markt hat recht. Öffentliche Gelder sollen »ortsblind« sein. Der Markt weiß es am besten, also werden öffentliche Mittel immer dorthin fließen, wo bereits private Investitionen getätigt wurden.
Diese Art von Logik erzeugte eine mustergültige Katastrophe.
Die einzigen Hocheinkommensländer der Welt, in denen dieser gefährliche Unsinn mit geradezu religiösem Eifer umgesetzt wurde, waren England und Wales, die beiden südlicheren der vier Landesteile Großbritanniens.2 Ab der Mitte der 1970er-Jahre straffte das Treasury seine Kontrolle über Gebietskörperschaften, was die absehbare Folge hatte, dass alle englischen und walisischen Regionen hinter London und dessen Umland zurückfielen, als öffentliche Gelder privaten Investitionen nach Südostengland hinterherjagten. Die Gebiete, die sich unter der immer weiter verschärfenden Kontrolle des Schatzamtes befanden, wurden schon bald zu denen mit der größten Ungleichheit in der gesamten westlichen Welt, während das Ministerium Machtbefugnisse erhielt, die eine beispiellose Zentralisierung der Regierungsgewalt ermöglichten.
Diese Divergenz aller anderen Gebiete Südostenglands führte zu wachsenden politischen Spannungen. Im Jahr 2022 erreichte der politische Druck aus den Regionen einen Höhepunkt. Eine an sich marktgläubige konservative britische Regierung räumte offen ein, dass der Markt nicht allerorten gleich segensreich gewirkt habe, und richtete daher öffentlichkeitswirksam ein neues Ministerium für die Angleichung der Lebensverhältnisse (Levelling Up) ein. Wenn der Markt funktioniert hätte, dann gäbe es keine Notwendigkeit, irgendetwas anzugleichen. Der Minister an der Spitze der neuen Institution kündigte ein detailliertes Dreijahresprogramm an, in dessen Rahmen er neue regionale Ausgaben anderer Ministerien koordinieren wollte. Der Minister war ein intelligenter und fähiger Mann, und sein Programm war eindrucksvoll. Durch seine Medienauftritte gelang es ihm, in der breiten Bevölkerung ein Bewusstsein für die brutalen Folgen der früheren Politik des Schatzamtes zu schaffen. Aber als Strategie, um einen Einstellungswandel in Whitehall herbeizuführen, dem Zentrum des Londoner Regierungsbetriebs, war die neue Initiative ein Fehlschlag. Das Treasury sah in dem neuen Ministerium einen weiteren Fall von lokaler und regionaler Einmischung (in seine Angelegenheiten).
Der ultimative Trumpf des Schatzamtes war die Tatsache, dass es das Budget des neuen Ministeriums kontrollierte. Obwohl dieses gegenüber der Bevölkerung als das Flaggschiff-Programm der Regierung angekündigt worden war, belief sich das Budget, welches das Treasury ihm gewährte, erstaunlicherweise auf null. Seine einzige Finanzierungsquelle waren Gelder, die innerhalb jenes Budgets umgeschichtet wurden, welches das Treasury bereits dem Innenministerium zugebilligt hatte und in dem die Mittel für das Levelling Up nur einen kleinen Teil ausmachten. Aber selbst dieses Geld erzürnte das Treasury, sodass es seine Kontrolle verstärkte, indem es jeden Penny, der den lokalen Gebietskörperschaften zugewiesen wurde, genau unter die Lupe nahm. Dieses Gebaren verhinderte Ausgaben auf so erfolgreiche Weise, dass am Ende des ersten Jahres nur 5 Prozent des wie gesagt ohnehin sehr bescheidenen Levelling-Up-Budgets verausgabt worden waren: Das Flaggschiff konnte aufgrund fehlenden Treibstoffs nicht auslaufen.
Aber das Mantra der »Ortsblindheit«, mit dem diese Politik gegenüber abgehängten Regionen gerechtfertigt wurde, galt nicht für Entscheidungen, die sich auf London bezogen, wo das Treasury seinen Sitz hat. So wurden etwa, während für das neue Ministerium kein Geld aufzutreiben war, Mehrkosten für den Bau einer Ost-West-Verbindung für den Zugnahverkehr – die 2022 fertiggestellte, glamourös das Londoner Stadtzentrum durchquerende Elizabeth Line – sang- und klanglos abgesegnet. Der entsprechende Betrag in Höhe von 5 Milliarden Pfund übertraf allein schon deutlich die nicht verausgabten Levelling-Up-Gelder. In der Organisationskultur des Treasury spiegelte sich schlimmstenfalls eine Doppelmoral wider: auf Maßlosigkeit hinauslaufende Selbstüberschätzung im Umgang mit der erfolgreichen Zentralregion Großbritanniens und arrogante Gleichgültigkeit gegenüber den vernachlässigten, abgehängten Gebieten.
Das Dogma von den regionalen wirtschaftlichen Selbstheilungskräften ist falsch. Es hatte tragische Folgen für Millionen von Menschen, und selbst an ökonomischen Standardkriterien gemessen ist es ein schlechtes Modell, das in systematischer Weise zu Fehlprognosen führt. Bevor ich begann, an diesem Buch zu arbeiten, hatte ich einzelne Aspekte davon infrage gestellt, aber im Zuge des Schreibens ging mir plötzlich auf, wie falsch es ist. Statt der gleichen Vorgehensweise überall brauchen wir Maßnahmen, die auf den lokalen Kontext zugeschnitten sind. Anders als es die Neunmalgescheiten an der Universität Chicago oder im Londoner Schatzamt glauben – dass flächendeckend der gleiche Kurs zu fahren sei –, sollten die Menschen vor Ort entscheiden, denn sie können viel besser beurteilen, was in ihrem Kontext Erfolg verspricht. Oft kann niemand wissen, was am besten funktioniert, bis sich aus diesen lokalen Variationen Muster herausschälen. Statt eines dirigistischen Führungsstils brauchen wir bescheidene Führungspersönlichkeiten, die dadurch Vertrauen gewinnen, dass sie ihre persönlichen Interessen opfern.
Einige Jahre lang habe ich mich in bahnbrechende Forschungsgebiete jenseits der Wirtschaftswissenschaften vertieft. Ohne diese geistige Horizonterweiterung hätte ich den beschriebenen beglückenden Geistesblitz nie gehabt – die Belohnung, die die akademische Forschung antreibt. Ich empfand ein Gefühl von Freiheit und freudiger Erregung, als ich endlich die Fesseln der Dogmen abgestreift hatte, die leidvolle, ja grausame Folgen hatten. Auch die Wirtschaftswissenschaften selbst sind nicht stehen geblieben; bahnbrechende Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Regionalökonomik können heute erklären, warum die von Friedman als positiv dargestellten Marktkräfte in Wirklichkeit schädlich sind und wirtschaftliche Abwärtsdynamiken noch verschärfen. Aber die wirklich bedeutenden Fortschritte im Verständnis menschlichen Verhaltens fanden in anderen Disziplinen statt.
Die bemerkenswerten jüngsten Fortschritte auf dem Gebiet der evolutionären Sozialpsychologie bestätigen, dass wir Menschen außergewöhnlich prosoziale Säugetiere sind. Die Evolution hat uns zu Lebewesen gemacht, die voneinander lernen und mit der Zeit eine gemeinschaftsbasierte kollektive Intelligenz herausgebildet haben, die unser Handeln leitet. Wir leben in »ortsbezogenen Gemeinschaften«, deren kollektive Intelligenz unsere Kinder anleitet, und wir verbringen den größten Teil des Tages in »arbeits(platz)bezogenen Gemeinschaften«, deren kollektive Intelligenz neu eingestellte Mitarbeiter anleitet. In jeder dieser Gemeinschaften kommen wir mit anderen Menschen zusammen, um gemeinsam Ziele zu verfolgen, die für den Einzelnen unerreichbar wären. Aber diese Gemeinschaften können sich auf ihren Wegen in die Zukunft auseinanderentwickeln. Einige Regionen und Organisationen können zu Gefangenen von irreführenden Ideen werden, durch die sie den Anschluss verlieren, während andere zufällig auf Ideen stoßen, die dem Wohlstand förderlich sind. Grundsätzlich vermögen abgehängte Gemeinschaften von erfolgreicheren zu lernen, aber der Austausch von Ideen zwischen ihnen funktioniert nicht unbedingt mühelos. Die Tatsache, dass Gemeinschaften aufgrund ihrer »ideellen« Unterschiede möglicherweise divergieren, bestätigt den Kernpunkt der neuen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Regionalökonomik: Abgehängte Regionen können aufgrund der negativen Auswirkungen von Marktkräften und deren Fehlinterpretationen durch die jeweilige Gemeinschaft auf einen Pfad geraten, auf dem das Wachstum dauerhaft niedriger ist als in erfolgreichen Gebieten.
Die Sozialpsychologie gibt uns auch Aufschlüsse darüber, wie eine abgehängte Gemeinschaft durch das Formulieren neuer gemeinsamer Ziele ihren Rückstand wieder aufholen kann. Ihre hoffnungsvolle Botschaft wird durch eine brillante und disruptive Erkenntnis erhärtet, die der bisherigen biologischen Lehrmeinung zuwiderläuft. Menschen verhalten sich genauso wie Bäume in einem Wald, die sich durch verteilte Intelligenz miteinander vernetzen, um gemeinsame Ziele wie die Abwehr eines Parasiten zu erreichen: In vielen unserer Handlungen realisieren wir mithilfe des Autopiloten unserer verteilten Intelligenz gemeinsame Ziele. Die Fortschritte auf dem Gebiet der Sozialpsychologie und der Biologie zeigen, wie stark unsere Handlungen von unserer jeweiligen Gemeinschaft beeinflusst werden.
Dies steht in deutlichem Gegensatz zu der noch immer weitverbreiteten wirtschaftswissenschaftlichen Annahme, wonach unsere Handlungen das Ergebnis rationaler Kalküle egoistischer Individuen seien. Obgleich diese Ideen noch immer in regionalökonomische Modelle eingebettet sind, basieren sie auf einer allzu simplen Theorie der Evolution aus den 1950er-Jahren, wonach nur die egoistischen Individuen überleben. Mit einiger Verspätung lassen manche Wirtschaftsmodelle diese unhaltbare Annahme hinter sich und stützen sich auf eine andere, aber weiterhin individualistische psychologische Theorie, die sogenannte Entscheidungstheorie, die unsere Fähigkeit zur Entscheidungsfindung geringschätzt: Sie stellt unser Gehirn so dar, als wäre es ein unzuverlässig arbeitender, dysfunktionaler Computer, der anfällig für Verzerrungen ist, die von denen, die es besser wissen, korrigiert werden müssen. Aber nur wenige Ökonomen sind bereits mit der – von sozialpsychologischer Seite vorgebrachten – jüngsten Kritik an dieser Theorie der Entscheidungsfindung vertraut. Denn die angeblichen Schwächen des individuellen Gehirns verblassen angesichts der bemerkenswerten kognitiven Leistungen von Menschen in einer vernetzten Gemeinschaft: Aus gutem Grund verlassen wir uns auf unsere kollektive Intelligenz.
Dies führt uns vor Augen, wie wichtig Beziehungen innerhalb von Gemeinschaften sind. Neue moralphilosophische Ideen haben die sozialpsychologischen Erkenntnisse ergänzt und die 40-jährige »Eiszeit« des Utilitarismus beendet, in der herzliche Beziehungen und Vertrauen innerhalb von Gemeinschaften als moralisch irrelevant angesehen wurden.[1]
Die Politikwissenschaft kann die unverzichtbare Rolle des Staates heute viel besser erklären: jene Funktionen, die nicht nur nützlich, sondern konstitutiv sind – die »tragenden Säulen« des Staates bilden. Gesellschaften besitzen sie nicht von Anfang an, vielmehr müssen sie aufgebaut werden. Einige Gesellschaften, wie etwa die haitianische, waren nicht in der Lage, diese Stützkonstruktion zu errichten, und bewegen sich daher am Rand der Anarchie. Andere, wie etwa Russland, sind zwar mächtig, aber wegen ihrer unkontrollierten Machtballung repressiv. Die Politikwissenschaft hat begonnen, diese Unterschiede zu erklären und sie mit der Moralphilosophie guter Führung zu verknüpfen.
Schließlich hat jenes neue Fachgebiet, das komplexe Entscheidungsfindung im Kontext radikaler Ungewissheit erforscht, überzeugende Belege dafür geliefert, dass es wichtig ist, zügig aus Experimenten zu lernen. Es erklärt die außergewöhnliche Fähigkeit mancher Führungspersönlichkeiten, Unsicherheiten zu überwinden und ihre Gesellschaft auf ein neues gemeinsames Ziel einzuschwören. Diese Fähigkeit kann zum Guten eingesetzt werden, wie es bei dem ukrainischen Staatspräsidenten Selenskyj der Fall ist, aber auch zum Schlechten, wie beim nordkoreanischen Despoten Kim Jong-un. In beiden Fällen stehen diese Fortschritte in direktem Zusammenhang mit anderen Disziplinen, denen wir neue Erkenntnisse über gute Führung verdanken.
Neue Forschungsprojekte beruhen auf Entdeckungen aus der Vergangenheit. Die Kritik an fest verwurzelten ökonomischen Dogmen – die Politik solle »ortsblind« sein, der Markt richte es am besten, und das Wirtschafts- und Finanzministerium wisse es am allerbesten – setzt grundlegende ökonomische Gesetzmäßigkeiten für abgehängte Regionen nicht einfach außer Kraft. Diese können den Rückstand nicht dadurch aufholen, dass sie sich in Nostalgie und Provinzialismus flüchten. Vielmehr wird ihre zukünftige Wirtschaftsstruktur im Rahmen eines schrittweisen Entdeckungsprozesses aufgebaut, aus dem sich erweist, wie ihre Arbeitskräfte produktiver werden können.
Die Humanwissenschaften sind im Zuge ihrer Fortschritte komplexer geworden: Sie zeigen, dass viele Effekte, die früher die ausschließliche Domäne einzelner Fachgebiete waren, auf Wechselwirkungen zurückzuführen sind, die fachübergreifend betrachtet werden müssen. Damit eröffnet sich die ferne Möglichkeit einer integrierten Humanwissenschaft, die in der Lage sein wird, die prädiktive und normative Kraft besserer Modelle zur Lösung einer Vielzahl verzwickter menschlicher Probleme zu nutzen. Einige davon wurden erst in jüngster Zeit entdeckt, nachdem bis dato vernachlässigte Muster näher unter die Lupe genommen wurden.
Bis sich besagte Möglichkeit ergeben wird, benötigen wir etwas Bescheideneres: vorläufige Antworten, die sich bemühen, die neuen Erkenntnisse einzubeziehen, sich aber auf viel enger gefasste Fragestellungen von praktischer Dringlichkeit konzentrieren. Statt fachspezifischer Modelle, die präzise, aber völlig falsche Antworten geben, brauchen wir integrierte Modelle, die offen zugeben, dass sie nicht präzise, aber doch annähernd richtig sind. Die beiden Fragen, die wir beantworten müssen, sind diejenigen, die von den Abgehängten aufgeworfen werden: Warum haben wir den Anschluss verloren? Wie können wir den Rückstand wieder aufholen? Abgehängte Regionen benötigen etwas, das es ihnen ermöglicht, die ökonomischen Dogmen, denen sie hörig waren, hinter sich zu lassen.
Eine neue Idee auf dem Prüfstand
Weil mich das Thema seit Langem interessierte, erklärte ich mich bereit, auf einer Tagung über Konfliktforschung am Department of War Studies des Londoner King’s College die Grundsatzrede zu halten.3 Zwei Wochen vor meiner Keynote befahl Wladimir Putin den Angriff auf die Ukraine. Dies wurde nun zwangsläufig zu meinem Thema, und so sah ich mir die Prognosen an, die Konfliktmodellierer erstellt hatten: Mit einer an Gewissheit grenzenden Selbstsicherheit sagten sie einhellig voraus, die russischen Invasoren würden die Ukraine sehr schnell niederwerfen. Ich hatte mich bereits hinreichend mit den weiter oben erwähnten bahnbrechenden neuen Erkenntnissen in den Humanwissenschaften vertraut gemacht, um zu erkennen, dass diese Vorhersagen falsch waren: Zwar waren sie präzise, aber von schlechten Modellen abgeleitet. Und so lehnte ich mich weit aus dem Fenster und verkündete einem überraschten Publikum, dass Putin keinen Erfolg haben werde.
Und ich wagte nicht nur die Vorhersage, dass Putin nicht den von ihm erwarteten raschen Sieg davontragen werde, vielmehr bestand auch Grund zu der Annahme, dass der ukrainische Präsident Selenskyj mehr erreichen könnte, als nur zu überleben – sein Land könnte diesen Krieg sogar gewinnen. Er ist ein glänzender Redner und hat mehrere geniale taktische Schachzüge vollbracht, angefangen mit seiner heldenhaften Zusicherung, in Kiew zu bleiben, was ihm moralische Autorität verlieh. Seine nächste Meisterleistung war eine nüchterne Einschätzung dessen, was er erreichen konnte und was nicht: Ihm gelang, was in der Sozialpsychologie eine »realistische Metakognition« genannt wird. Er wusste, dass er westliche Regierungen durch moralische Appelle dazu bringen konnte, ihm Waffen zu liefern. Er wusste, dass er sich die moralische Autorität erworben hatte, um Männer im wehrfähigen Alter dazu aufzurufen, ihren lokalen Milizen beizutreten. Er wusste, dass er als russischsprachiger Ostukrainer ein ukrainisches Volk, durch das tiefe sprachliche und politische Gräben verliefen, zusammenbringen konnte. Er wusste, dass allabendliche Fernsehansprachen die Moral der ukrainischen Bevölkerung stärken würden. Aber er kannte auch seine Grenzen: Er verfügte nicht über das militärische Wissen, um vom Zentrum des Landes aus den Widerstand zu planen, und übertrug diese Aufgabe daher den lokalen Milizen.
Sein dritter genialer Schachzug bestand darin, Befürchtungen, die Ermächtigung der Milizen zu eigenverantwortlichem Handeln könnte als eine möglicherweise von den Russen ausgenutzte Schwäche angesehen werden, dadurch entgegenzutreten, dass er die drei entscheidenden Vorteile hervorhob, die mit dieser Delegation verbunden waren. Die Milizen kannten die örtlichen Geländeverhältnisse viel besser als die russischen Soldaten, was sie im Gefecht begünstigte. Da jede Miliz eigenverantwortlich verschiedene Taktiken erproben konnte, würden die Ukrainer rasch lernen, was in konkreten Situationen am besten funktionierte. Selenskyjs Gegner ist ein eitler Mann, der seine militärische Sachkompetenz weit überschätzte und von Speichelleckern umgeben war, die so große Angst vor ihm hatten, dass sie ihn nicht offen und ehrlich über Rückschläge informierten. Sein stümperhafter, übertrieben detailorientierter und von Kontrollzwängen geprägter Führungsstil demoralisierte die russischen Truppen. Dagegen fanden die ukrainischen Milizen durch praktisches Ausprobieren heraus, welche Taktiken sich bewährten, und ihre lokalen Erfolge wurden stolz hervorgekehrt und öffentlich gelobt. Dies sorgte dafür, dass im Lauf der Zeit die Moral der beiden Streitkräfte immer weiter auseinanderklaffte.
Präsident Selenskyj und ich hatten die gleichen objektiven Daten gesehen, die auch in die herkömmlichen Modelle eingespeist wurden. Aber wir hatten diese Daten zu einem realistischen Gesamtbild zusammengefügt, das den Modellierern entgangen war. Gefangen in einem präzisen, aber falschen Modell, hatten sie selbstbewusst die klaren Vorteile aufseiten der Ukraine fälschlicherweise als erdrückende Nachteile angesehen. Präsident Selenskyj ist einerseits hinreichend selbstbewusst, um auf seine anfängliche Intuition zu hören, andererseits hinreichend demütig, um zu erkennen, dass er zügig lernen musste. In ihrem Zusammenspiel bildeten seine Ideen die Grundlage für eine wohlkoordinierte Folge von Handlungen, die sich mit den Stufen einer Wendeltreppe vergleichen lassen. Aufgrund seines hohen persönlichen Einsatzes und seines Muts genießt er bei seinen ukrainischen Mitbürgern so großes Vertrauen, dass er sie dazu überreden konnte, mit ihm die Treppe hinaufzugehen. Beim Aufstieg brachte sie nicht nur jede Stufe ihrem Ziel näher, den Eindringling erfolgreich abzuwehren, sondern sie nahmen die bekannte Szenerie unter sich mit einem Mal auch aus einer völlig neuen Perspektive wahr. Sie sahen ihnen seit Langem vertraute Merkmale ihrer Wohnorte, ihrer Nation und deren Geschichte mit neuen Augen. Eigentümlichkeiten, die sie früher als Nachteile angesehen hatten, erschienen ihnen jetzt als Stärken, die Russland fehlten. Die Bewohner einiger Gemeinden erkannten, dass ihre örtlichen Fabriken von zentraler Bedeutung für die europäische Autoindustrie waren. Und landesweit wurde den Menschen erstmals richtig bewusst, dass die Ukraine zu einer Kornkammer der Welt geworden war. Doch die neu gewonnene Perspektive mochte auch dem Gegner gelten und enthüllen, warum die Ukrainer Putin keinen Deut trauen sollten: Schließlich ist in seinem Russland der sowjetische Diktator Stalin wieder gesellschaftsfähig geworden – jener Mann, der durch Geheimdienstterror und eine bewusst herbeigeführte Hungersnot für Millionen Tote in der Ukraine verantwortlich war.
Ich erkannte, dass viele der Stufen von Selenskyjs Wendeltreppe – selbstaufopfernde Führung, Delegieren von Machtbefugnissen und Kommunizieren einer hoffnungsvollen, aber auch glaubhaften Strategie – weitgehend auch bei anderen großen Herausforderungen geeignet sind. Die Umdeutung charakteristischer Merkmale der Ukraine in Vorteile führte zu Verhaltensänderungen, die sich ebenso leicht für eine ökonomische wie für eine militärische Agenda einsetzen lassen. Sie können die wirtschaftlichen Aussichten abgehängter Regionen als vermeintlich hoffnungslose Fälle genauso entscheidend verändern wie die vermeintlich hoffnungslosen militärischen Aussichten der Ukraine.
Die Wendeltreppe ist ein rudimentäres Modell, das mit den bemerkenswerten jüngsten Fortschritten in den Humanwissenschaften, die sich auf abgehängte Regionen anwenden lassen, vereinbar ist. Ich werde diese im nächsten Kapitel darlegen: Das neue kombinierte Modell liefert im Unterschied zu einem präzisen, aber falschen ökonomischen Modell annähernd richtige Vorhersagen. Das Adverb »annähernd« soll daran gemahnen, dass dieses Buch ein Leitfaden, kein Lehrbuch ist.
Wie für ein schlechtes Konfliktmodell gilt auch für ein schlechtes Wirtschaftsmodell: Unangebrachtes Vertrauen in seine Richtigkeit kann davon abhalten, in den Daten nach Mustern zu suchen, die nicht mit dem Modell vereinbar sind. Ich werde die Belege präsentieren, die übersehen wurden, obwohl sie klar und deutlich sichtbar waren. Sie zeigen, welche schrecklichen Folgen die falschen ökonomischen Dogmen haben. Darüber hinausgehend werde ich zeigen, dass viele Regionen weltweit, die einen Zusammenbruch erlebten, sich deshalb wieder vollständig davon erholten, weil sie Strategien anwandten, die das Bild der Wendeltreppe symbolisch einfängt. Ihre Strategien waren erfolgreich, obwohl sie nicht mit der herrschenden marktwirtschaftlichen Doktrin vereinbar sind. Gegenwärtig befinden sich einige der abgehängten Regionen, die seit Jahrzehnten von der allgemeinen weltwirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt sind, im frühen Stadium einer ähnlichen wirtschaftlichen Erholung. Die Welle globaler Krisen hat sie destabilisiert. Diejenigen von uns, die in wirtschaftlich erfolgreichen Gebieten leben, haben eine bescheidene Rolle als Unterstützer, die wir bislang jedoch noch nicht erfüllen, weil unsere vermeintlichen Gewissheiten uns verblendet haben.
Dieses Buch würdigt den Einfallsreichtum und den Mut, mit denen arme Regionen weltweit ihr Geschick wenden. Es legt die Grundzüge einer neuen Ökonomik regionaler Transformation dar – die Prinzipien und praktischen Maßnahmen, mit denen diese Erfolge erreicht wurden. In den folgenden Kapiteln werden Sie nicht nur in die Realitäten jener um den wirtschaftlichen Anschluss kämpfender Regionen eintauchen, die ich zu Beginn dieses Kapitels erwähnte – die karibische Küstenregion Kolumbiens, den Copperbelt Sambias und South Yorkshire in Nordengland –, sondern auch in die Transformationen, die dort bereits in vollem Gange sind. Das einst bettelarme Bangladesch hat sich zu einem wachstumsstarken Schwellenland gemausert; das ehedem separatistische Baskenland, das von Terroranschlägen und erbitterten politischen Streitigkeiten erschüttert wurde, ist zu einer spanischen Vorzeigeregion geworden; und im bislang lediglich von Taiwan als unabhängiger Staat anerkannten Somaliland am Horn von Afrika, einer vernachlässigten autonomen Region in einer konfliktreichen Weltgegend, ist in aller Stille eine friedliche Gesellschaft mit starkem innerem Zusammenhalt entstanden.
Obgleich jede dieser Gesellschaften einzigartig ist, gibt es doch zwei Merkmale, die ihnen gemeinsam sind: zielorientiertes gemeinschaftliches Handeln und schnelles Lernen. Zielorientiertes gemeinschaftliches Handeln – das Erfolgsgeheimnis von Somaliland – meint die Gesamtheit der klugen Maßnahmen, mit denen Menschen ihren sozialen Zusammenhalt stärken, indem sie ein gemeinsames Ziel verfolgen. Schnelles Lernen, das China unter Deng Xiaoping in den 1980ern und 1990ern beispielhaft vor Augen führte, meint pragmatisches Experimentieren und die Bereitschaft, von anderen (Ländern) zu lernen.
Diese unerhörte Erfolgsgeschichte wird in Teil II erzählt, der das Herzstück dieses Buches bildet. In Teil I hingegen ist der Ton ein ganz anderer: Hier beschreibe ich, wie schädliche Ideologien und eine »Politik der Gier« diese Erfolge behinderten. Dadurch haben sie – vermeidbarerweise – Millionen von Menschen ihrer Entwicklungschancen beraubt.
Im nächsten Kapitel vollziehen wir nach, wie diese Ideologien entstanden sind und wie sie heute durch Revolutionen, die von neuen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen angestoßen wurden, zerstört werden. In den beiden darauffolgenden Kapiteln präsentiere ich Ihnen überraschende neue Erkenntnisse über zwei weltweit bedeutsame Prozesse, von denen bislang kaum Notiz genommen wurde: »Versteckte Verzweiflung« (Kapitel 3) befasst sich mit dem globalen Armutsproblem, das sich für die 2030er-Jahre abzeichnet; »Versteckte Privilegien« (Kapitel 4) widmet sich dessen Gegenstück, der Herausbildung einer neuen gesellschaftlichen Klasse in den Wohlstandsländern, die gegenüber dem Rest der Bevölkerung derart begünstigt ist, dass sie eine regelrechte neue Aristokratie bildet.
Schmerz vor Freude, Wut vor Jubel.
1 Zu einem späteren Zeitpunkt seines Lebens lernte ich McNamara, der nach seiner Zeit als Verteidigungsminister von 1968 bis 1981 Präsident der Weltbank war, persönlich kennen: Er bereute seine Fehler zutiefst und engagierte sich leidenschaftlich, um abgehängten Regionen, insbesondere in Afrika, zu helfen. Aber in gewisser Hinsicht bleibt sein früheres hohes Selbstvertrauen in Anbetracht seiner Erfolgsbilanz erstaunlich. Vor seinem Einstieg in die Politik war er Präsident des Autobauers Ford, wo seine allzu selbstsicheren Vorhersagen von Verbraucherpräferenzen zu dem Marketingdesaster der Marke Edsel führten. Danach nahm er seinen Hut, um Verteidigungsminister zu werden.
2 Schottland entzog sich der Kontrolle des Treasury, sobald die schottischen Nationalisten das wirtschaftliche Potenzial erkannten, das sich durch die Entdeckung von Ölvorkommen in der Nordsee auftat, und mit dem ebenso simplen wie bestechenden Slogan »Es ist Schottlands Öl« daherkamen. Auch Nordirland entschlüpfte dem Griff des Schatzamts, allerdings aus dem ganz anderen Grund, dass die Beendigung der terroristischen Gewalt der Irisch-Republikanischen Armee (IRA) von der Übertragung von Befugnissen auf eine gemeinsame protestantisch-katholische Verwaltungskörperschaft abhing. Beide Länder hatten bald ihre eigenen Parlamente.
3 Mein Buch Wars, Guns and Votes (2009) resümiert einen Teil meiner diesbezüglichen Arbeiten.
Teil I Abwärtsspirale
2.Neue Revolutionen, zerfallende Gewissheiten
Vor Selbstbewusstsein strotzend, hat in Großbritannien das mächtige Zentrum London den abgehängten Regionen des Landes eine einheitliche Politik auferlegt. Diese Haltung und Vorgehensweise sind intellektuell nicht länger haltbar, wie wegweisende neuere Forschungsergebnisse in sämtlichen Humanwissenschaften nachgewiesen haben. Ein guter Ausgangspunkt ist die Entdeckung des Syndroms der Fragilität.
Wider den naiven Optimismus: das Syndrom der Fragilität
Wir wissen, dass eine Region, sobald sie erst einmal ihre Kernindustrien verloren hat, sich keineswegs aus eigener Kraft wieder erholt, sondern vielmehr in der Regel in einen sich selbst aufrechterhaltenden Prozess des Niedergangs eintritt. Um zu verstehen, warum dies so ist, wollen wir uns zwei Jollen vorstellen, die an einem windigen Tag auf dem Meer segeln. Die eine hält Kurs, während die andere von einer heftigen Windbö getroffen wird und kentert: Ihre Crew weiß nicht, was sie tun muss, um das Boot wieder aufzurichten. Wenn der Wind abflaut, sind die Segel beider Jollen vertikal ausgerichtet: Das eine zeigt zum Himmel, das andere zum Meeresboden. Wissenschaftlich gesprochen befinden sie sich in lokal stabilen Gleichgewichten.
Wenn der Wind wieder auffrischt, steuert die Mannschaft der aufrecht gebliebenen Jolle weiter ihr Ziel an. Die Crew der umgeschlagenen Jolle dagegen kann nichts anderes tun, als sich an das Boot zu klammern, das ziellos mit der Strömung dahintreibt. Das anfängliche Missgeschick des Kenterns hat Folgewirkungen, die es verstärken und verschlimmern: Dies ist das Wesen eines Syndroms.
Die Abwanderung von Arbeitskräften und die Veränderung von Investitionsstandorten innerhalb eines Landes entsprechen dem, was mit diesen Jollen geschieht. Wenn eine Stadt ihre Kernindustrien verliert, »kentert« sie; Städte, die mehr Glück haben, »segeln weiter«. Investoren, die das Geschehen vom Strand aus mitverfolgen, schätzen ein, welche Stadt die besseren Ziel-, sprich Entwicklungschancen hat. Sie investieren quasi in die Jolle, die nicht gekentert ist, und das verstärkt die Divergenz. Die Mitglieder der Mannschaft der umgekippten Jolle beginnen, sich gegenseitig die Schuld am Kentern zu geben, und aufgrund ihres Streits können sie sich nicht auf eine Methode verständigen, um das Boot wieder gemeinsam aufzurichten. Während sie ihre Zeit, im Wasser treibend, sinnlos vergeuden, vergrößert sich die Divergenz weiter. Die stärksten Schwimmer der Crew geben das Boot auf, retten sich an Land, und einige versuchen später vielleicht, sich der Mannschaft der nicht umgeschlagenen Jolle anzuschließen.
Menschen, die in Wohlstandsregionen ein erfolgreiches Leben führen, verstehen oft nicht die wahren Gründe für den Niedergang weniger wohlhabender Gebiete. Sie nehmen an, dass entweder mit den Regionen selbst oder aber ihren Bewohnern etwas nicht stimme. Wenn es an den Regionen liege, dann müssten die Menschen diese eben verlassen. Und wenn die Menschen etwas falsch machten, müssten sie sich ändern. Die politische Rechte tendiert dazu, die Schuld für das Scheitern beim Einzelnen zu suchen; die politische Linke dagegen neigt dazu, ganze Gesellschaften durch Umerziehung zu verändern.
Die herrschende wirtschaftswissenschaftliche Lehre teilt diese Fehleinschätzungen, geht aber noch einen Schritt weiter, indem sie Abhilfe von Marktkräften erwartet; sie beharrt darauf, dass es etwas Gutes sei, wenn Investitionen von der »gekenterten« Stadt zu der abwanderten, die sich über Wasser gehalten habe. Darin müsse sich eine effizientere Kapitalallokation widerspiegeln. In gleicher Weise gelte: Wenn Arbeitskräfte als Reaktion auf wachsende Lohnunterschiede zwischen Städten umzögen, würden sie produktiver werden. Die Traditionalisten beginnen sich nur dann Sorgen zu machen, wenn Arbeitskräfte nicht abwandern: Vielleicht hängt dies ja damit zusammen, dass der Anreiz aufgrund des Lohngefälles durch übermäßig großzügige öffentliche Sozialleistungen gedämpft wird.
Aber Marktkräfte heilen das Syndrom keineswegs, vielmehr verschlimmern sie es. Bei bescheidenen Zielen, wie etwa der passgenauen Koordinierung zwischen Produzenten und Konsumenten, können sie recht erfolgreich wirken, aber mit der unvergleichlich komplexeren Aufgabe, die beste zukünftige Verteilung florierender Städte in einem Land festzulegen, sind sie überfordert. Ob eine Stadt prosperiert, hängt von Erwartungen in Bezug auf ein breites Spektrum zukünftiger Entscheidungen ab. Wird die Kommunalverwaltung eine Baugenehmigung erteilen? Wird die Zentralregierung Mittel bereitstellen? Werden Gesetze, die zu Investitionshemmnissen wurden, geändert werden? Werden zivilgesellschaftliche Organisationen wie Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände den Prozess unterstützen oder sich dagegen stellen? Wird Tesla die Zukunft des Automobils bestimmen, oder werden von der EU finanzierte Innovationen des Verbrennungsmotors, die von der Notwendigkeit veranlasst sind, Arbeitsplätze zu sichern, Elon Musks Vision batteriebetriebener Computer auf Rädern ausbremsen? Wie Marktkräfte diese grundverschiedenen Verhaltensweisen so koordinieren sollen, dass dabei ein beispiellos effizientes räumliches Muster von Städten in einem Land herauskommt, bleibt selbst denjenigen ein Rätsel, die unerschütterlich an die Kräfte des Marktes glauben.
Das Rätsel wird noch größer, wenn wir das Konzept der Pfadabhängigkeit betrachten. Der Kurs der beiden Segelcrews – ihre Pfade – weicht nun voneinander ab: Ob sie das Ziel erreichen würden, hing von diesem anfänglichen, unvorhersehbaren Windstoß ab. Der Gegensatz zwischen den beiden Mannschaften – die eine segelt fröhlich gen Ziel, während die andere mit der Strömung im Wasser dahintreibt – veranschaulicht das Wesen der Pfadabhängigkeit. Selbstsicher an der Überzeugung festzuhalten, dass ein ideales Ergebnis unvermeidlich sei, ist ein trotziger Glaubensakt in einem falschen doktrinären Glaubenssystem. Friedmans Vergleich einer Volkswirtschaft mit den Saiten einer Harfe war sowohl ein hübsches Bild für ein Modell als auch ein Rückzug von der Wissenschaft in die Sphäre des Glaubens.
Das Syndrom, das abgehängte Regionen entwickeln, wenn sie ihre Kernindustrien verlieren, basiert auf einer Kette von Wechselwirkungen: Der Verlust wirtschaftlicher Chancen wird durch soziale und politische Effekte verstärkt. Menschen verlieren ihre Arbeitsplätze, ihre Familien zerfallen, sie weichen auf Selbstmedikation aus, und Kinder wachsen in zerrütteten Familienverhältnissen auf. Vor Kurzem wurde für diese Kette von Wechselwirkungen der oben schon eingeführte Begriff »Syndrom der Fragilität« geprägt.[1] Investoren glauben nicht länger daran, dass die wundertätigen Wirkungen der Marktkräfte zwangsläufig zur Erneuerung führen, vielmehr geben sie zu, dass der Preismechanismus allein machtlos ist, wenn die Kernindustrien einer Region zusammenbrechen. Während Preise das entscheidende Element der von Friedman ins Feld geführten Marktkräfte sind, dürften sie kaum in der Lage sein, die Entscheidungen zwischen Politikern, Zivilgesellschaft, Finanziers, Unternehmen und privaten Haushalten so zu koordinieren, dass eine wirtschaftliche Wiederbelebung erreicht wird. Investoren sind realistischer als Friedman: Sie erwarten, dass ein ökonomischer Zusammenbruch von Dauer ist. Sie verlagern ihr Geld in Gebiete, die keinen Kollaps erlitten haben – wieder im Bild gesprochen, zugunsten nicht gekenterter Jollen. Ein wirtschaftlicher Zusammenbruch erzeugt negative Erwartungen, die sich dann selbst erfüllen.
Die abgehängten Gebiete in Großbritannien und den USA gemahnen uns eindringlich daran, dass eine Abwärtsspirale überall einsetzen kann. Die anfängliche Ursache eines Zusammenbruchs hat oft nichts mit den Entscheidungen zu tun, die in der Region getroffen wurden, wie es in den USA in Pittsburgh und in Großbritannien in South Yorkshire der Fall war, wo die Stahlindustrie Anfang der 1980er-Jahre zusammenbrach. Die Einwohnerzahl von Pittsburgh halbierte sich, die Stadt geriet wirtschaftlich ins Hintertreffen. Aber letztendlich hatte sie die Kraft zur Erneuerung: Auf der Rangliste der erfolgreichsten US-Städte steht sie heute auf Platz zwölf. Auch South Yorkshire wurde zu einer abgehängten Region, aber die Reaktion darauf und das Ergebnis sahen ganz anders aus. Obgleich die Arbeitslosigkeit steil anstieg, wanderten die Menschen nicht ab. Und die Region konnte sich auch nicht revitalisieren: Ihre Wirtschaft geriet in eine Abwärtsspirale, und sie wurde zur ärmsten Region Englands. Die Erklärung dieser Unterschiede ist ein guter Ausgangspunkt, um zu verstehen, welche politischen Maßnahmen in abgehängten Gebiete ergriffen werden sollten.
In South Yorkshire verließ man sich, wie überall in England, vollständig auf Marktkräfte, ohne aktives Eingreifen der Politik. Die Stahlindustrie fiel einer nationalen makroökonomischen Politik zum Opfer, die Anfang der 1980er-Jahre eingeführt wurde und das exportorientierte verarbeitende Gewerbe im gesamten Land traf. Insgesamt 20 Regionen erlebten einen schweren wirtschaftlichen Niedergang. Die eingehende Analyse des ökonomischen Abstiegs dieser Gebiete erlaubt es uns, die konkurrierenden Vorhersagen über die weitere Entwicklung zu testen: das marktoptimistische Modell im Gegensatz zu den sich selbst erfüllenden Divergenzerwartungen, die das Syndrom der Fragilität postuliert. Nur eine der 20 Regionen erholte sich, in den anderen war der Niedergang von Dauer. Noch schlimmer für die Vertreter der herrschenden ökonomischen Lehre: Die eine Ausnahme, die rund 100 Kilometer östlich von Birmingham gelegene Industriestadt Corby, blühte nur deshalb wieder auf, weil sie so schwer getroffen worden war, dass sowohl die Kommunalverwaltung als auch die Zentralregierung eingreifen mussten.[2] Langfristige staatliche Eingriffe in Corby, die Marktfundamentalisten ein Grauen sind, bewirkten eine Umkehr der Erwartungshaltungen und retteten die Stadt. Die Maßnahmen, die die Wirtschaft wieder ankurbeln sollten, wirkten erfolgreich, aber statt dieses erfolgreiche Beispiel eingehend zu analysieren, wurde es ignoriert, weil die Revitalisierung gemäß der im britischen Schatzamt vorherrschenden Theorie nicht hätte funktionieren dürfen.
Die Stahlindustrie in Pittsburgh und South Yorkshire wurde deshalb so außergewöhnlich schwer getroffen, weil zwei negative Faktoren zusammenwirkten. Im Jahr 1980 hatten sowohl die USA als auch Großbritannien neue Regierungen, mit Ronald Reagan beziehungsweise Margaret Thatcher an der Spitze, die sich Friedmans monetaristische Ideen zu eigen gemacht hatten. Dies führte zu einer starken Aufwertung ihrer beiden Währungen, sodass britischer und amerikanischer Stahl auf den Weltmärkten nicht mehr wettbewerbsfähig war. Gleichzeitig wollte die südkoreanische Regierung eine international wettbewerbsfähige Stahlindustrie aufbauen und pumpte zu diesem Zweck massiv öffentliche Mittel in den Sektor. Bezeichnenderweise überlebte die deutsche Stahlindustrie den Angriff der koreanischen Konkurrenz, weil Friedmans Ideen in der Bundesrepublik nicht auf fruchtbaren Boden fielen. Die Stahlregionen waren dank finanzieller Förderung durch den Staat und privater Investitionen in der Lage, wettbewerbsfähig zu bleiben. So kam es in den drei Ländern zu folgenden unterschiedlichen Situationen: Die deutsche Stahlindustrie erlebte keinen Niedergang; in Pittsburgh machten zwar die Stahlwerke dicht, aber dann lockte die Stadt neue Firmen für hoch qualifizierte Arbeitskräfte an; und in South Yorkshire schlossen die Stahlfabriken ebenfalls, aber der Region gelang es nicht, gleichwertigen Ersatz dafür zu finden. Wie lassen sich diese drei unterschiedlichen Ergebnisse erklären? Deutschland betrieb nicht nur auf Bundesebene aktive Wirtschaftspolitik, hinzu kam, dass sowohl die Gelder selbst als auch die Entscheidungen über deren Verwendung den Landesregierungen und Kommunalverwaltungen übertragen wurden. In Deutschland und den USA wird über die Verwendung öffentlicher und privater Finanzmittel schon seit Langem auch auf kommunaler und regionaler Ebene entschieden, und beide Länder haben starke zivile Institutionen wie etwa Universitäten aufgebaut, die tief in ihren jeweiligen Kommunen verankert sind. In England fehlte all dies.
Disruptive Psychologie
Nicht nur ein Segelboot und eine lokale Ökonomie haben zwei Gleichgewichtszustände, sondern auch die Organisationen, in denen wir arbeiten und die viele der Chancen maßgeblich beeinflussen, die sich uns bieten, ein sinnerfülltes Leben zu führen. Neuere sozialpsychologische Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass wir nicht die gierigen, eigennützigen und rationalen Individuen sind, als die uns die meisten Wirtschaftsmodelle hinstellen. Vielmehr hat uns die Evolution zu einer ungewöhnlich sozialen Spezies ausgeformt, und wir sind bereit, für das Wohl unserer Gemeinschaft auf die Verfolgung individueller Interessen zu verzichten. Wenn diese natürlichen Instinkte die Gelegenheit dazu bekommen, dann manifestieren sie sich. Wenn unser Arbeitgeber uns dazu ermuntert, selbstständige Teams zu bilden, um Probleme gemeinsam zu lösen, dann verdienen wir nicht nur unseren Lebensunterhalt, sondern haben auch das Gefühl, sinnvolle Arbeit zu verrichten. Aber wenn wir schlecht behandelt werden, wenn unser Chef uns mit Argusaugen beobachtet und uns kein Raum für Eigeninitiative gegeben wird, dann kann uns das herunterziehen. Jeder von uns wird zu dem gierigen, egoistischen Individualisten, zu dem uns die traditionelle wirtschaftswissenschaftliche Lehre erklärt hat.
Noch erstaunlicher ist, dass die besagten neueren Forschungsergebnisse Folgendes zeigen: Die meisten unserer Entscheidungen sind von der kollektiven Intelligenz unserer Gemeinschaft – ihrem gespeicherten Erfahrungswissen – geprägt. Innerhalb dieser kollektiven Intelligenz sind einige Wissenshäppchen hochspezifische technische Lösungen für Aufgaben, die es zu bewältigen gilt – beziehungsweise kognitive Gadgets. Gesellschaften, denen solche Gadgets (Werkzeuge) fehlen, die unabdingbar für Wohlstand sind, stagnieren entweder so lange, bis sie sich neu erfunden haben, oder sie lernen von den Gesellschaften, die über diese Instrumente verfügen.[3]
Mit dem Zusammenbruch ihrer Kernindustrien verlieren abgehängte Regionen oft auch die Organisationen, die Menschen sinnerfüllende Tätigkeiten bieten. Pittsburgh und South Yorkshire waren »ortsbasierte« Gemeinschaften, mit denen sich Arbeitskräfte und Firmeneigner identifizierten. Die Stahlfirmen waren »arbeits(platz)basierte« Gemeinschaften, in denen Konflikte zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern durch wechselseitige Loyalität abgeschwächt wurden. Das Bessemer-Verfahren zur Stahlerzeugung erfordert Fertigkeit und Urteilsvermögen: Die Arbeiter wurden Mitwirkende an dem beeindruckenden Prozess der Umwandlung von Eisenerz in glänzenden Stahl, der mit der geheimnisvollen alchemistischen Transmutation vergleichbar ist. Arbeiter und Vorgesetzte taten sich zusammen, um von beiden Gruppen erstrebte Ziele gemeinsam zu verfolgen. Ein Beispiel war die Gründung der ersten Universität in South Yorkshire, deren Stiftungsvermögen durch eine gemeinsame Kraftanstrengung aufgebracht wurde: Die Stahlgewerkschaften organisierten eine Spendenkampagne und erreichten, dass jedes ihrer Mitglieder einen Wochenlohn beisteuerte, und die Familie Firth, der das größte Stahlunternehmen gehörte, verdoppelte die dabei zusammengekommene Summe aus eigener Tasche.
Durch die Verstaatlichung der Stahlindustrie im Jahr 1967 wurde in South Yorkshire die wirkmächtige Verbindung von Orts- und Arbeitsplatzbindungen geschwächt. Die Maßnahme verlagerte das Zentrum der Entscheidungsfindung von den Managern und Arbeitern in Nordengland auf Politiker in London. Im Jahr 1980 beteiligten sich die Stahlarbeiter aus South Yorkshire an einem landesweiten Streik gegen die neue konservative Regierung Thatcher, der große öffentliche Aufmerksamkeit erregte. Betriebswirtschaftlich gesehen, kam der Ausstand zur Unzeit, da er zeitlich mit dem Entstehen der neuen Konkurrenz aus Korea zusammenfiel. Während die unmittelbare Folge der Zentralisierung und Politisierung der Entscheidungen darin bestand, den Niedergang der Industrie zu beschleunigen, führten sie auf längere Sicht dazu, dass sich die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen in South Yorkshire dauerhaft verschlechterten. Das Schicksal der zweiten Kernindustrie der Region, Kohle, war eine noch extremere Version des Stahldramas. Während der Energiekrise Ende der 1940er-Jahre hatten große Kohlebergwerke die gleiche gesellschaftliche Bedeutung und den gleichen Glanz wie Stahl.[4] Doch die Verstaatlichung begann früher und gipfelte 1984 in einem einjährigen, stark politisierten Streik; wie in der Stahlindustrie beschleunigte er den Niedergang und führte zu einer dramatischen Verschlechterung der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen.1
Nach dem Zusammenbruch der Kernindustrien und dem Verlust sozial verantwortungsbewusster Firmen wie Firth schufen die neuen Unternehmen, die sich in South Yorkshire ansiedelten, nur Arbeitsplätze für Geringqualifizierte. Sie kamen lediglich wegen der billigen Büromieten und verzweifelten Menschen, die bereit waren, ermüdende Arbeit für niedrige Löhne zu leisten. Callcenter und Lagerarbeit passten gut zu dem entwürdigenden Modell der engen Überwachung, das mit Anreizen verknüpft war. Die Zusammensetzung der Unternehmen wandelte sich von solchen, die den Weg nach oben ebneten, zu solchen, die den Abstieg beschleunigten; von solchen, die Zusammenhalt und Teamgeist förderten, zu solchen, die sich auf Hierarchien der Demütigung stützten. Die ablehnende Haltung der örtlichen Bevölkerung zu Privatunternehmen wurde zwangsläufig immer stärker.
Während Pittsburgh über die lokalen Ressourcen verfügte, um sich aus eigener Kraft zu erneuern, erlagen andere »gekenterte« amerikanische Städte dem Syndrom und wurden abgehängt. In einigen wurde die gesamte Arbeiterschaft entwurzelt, eine Tragödie, die auf plastische Weise in dem Buch und dem Film Nomadland eingefangen wird, in denen ältere Wanderarbeiter auf der Suche nach befristeter Beschäftigung jede feste Verbindung zu einem urbanen Zentrum verloren haben.2 Zu solchen totalen Katastrophen kam es in England nicht, weil die sozialen Sicherungssysteme, auch wenn sie gemessen an europäischen Standards bescheiden sind, besser finanziert sind als in den USA. Menschen konnten überleben, indem sie öffentliche Leistungen mit einem Niedriglohnjob verknüpften. Daher beschlossen die meisten, an dem Ort zu bleiben, dem sie sich verbunden fühlten.
Die Sozialpsychologie liefert uns eine plausible Erklärung dafür, warum der Kapitalismus sowohl florierende »arbeitsplatzgebundene« Gemeinschaften in egalitären und dezentral gesteuerten Gesellschaften wie Dänemark als auch abstoßende Hierarchien der Demütigung in Regionen wie South Yorkshire hervorbringen kann. Sie erklärt auch, warum eine lokale Gemeinschaft oftmals zerfällt, sobald der wirtschaftliche Niedergang einsetzt: Die Menschen beginnen, sich gegenseitig die Schuld am Scheitern zu geben. Das kleine Land Wales, das nur halb so viele Einwohner wie Dänemark hat, verdeutlicht diesen traurigen Prozess, es ist noch ärmer als South Yorkshire. Mein walisischer Kollege David Tuckett und ich führten im Jahr 2020 eine Reihe von Interviews mit Menschen, die einen Querschnitt der Gesellschaft darstellten.[5] Wir stießen auf weitverbreitete Uneinigkeit. Vertreter der walisischen Regierung beschuldigten die walisischen Unternehmen, die sich dafür revanchierten, indem sie sich über die walisische Regierung beschwerten. Zudem herrscht zwischen den walisischen Regionen auch wechselseitige Antipathie. In Nordwales sprechen noch immer viele Menschen das Walisische, weshalb man sich dort bei der walisischen Regierung erfolgreich dafür einsetzte, das Beherrschen der Sprache zu einer Einstellungsvoraussetzung im Arbeitsleben zu machen. In Südwales, wo Walisischsprachige eine Minderheit sind, wird dies als Hemmnis für die Schaffung von Arbeitsplätzen angesehen. Einmal lud mich die walisische Regierung nach Swansea ein, um bei ihrem All Wales Economic Summit eine Rede zu halten. Die vielen Teilnehmer aus der südwalisischen Metropole hatten wiederum ihre eigene Erklärung für die Probleme der Stadt: die Begünstigung von Cardiff, der 70 Kilometer entfernten Nachbarin, die auch die walisische Hauptstadt ist. Die Bevölkerung von Wales ist gespalten; es haben sich wechselseitige Antipathien entwickelt, die verhindern, dass die Menschen gemeinsam eine Strategie entwickeln, um ihre Probleme anzugehen.
Es ist nur ein kurzer Schritt von gegenseitigen Vorwürfen zu Selbstvorwürfen: Manche verinnerlichen den Glaubenssatz, dass sie den Anschluss verloren haben, weil sie oder der Ort, an dem sie leben, in irgendeiner Weise ungenügend wären. Wir dehnten unsere Befragungen auf South Yorkshire aus und sprachen mit Lehrern, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie Schüler ihre Situation beurteilten. Ein paar typische Sätze, mit denen sie ihre Einstellung zum Ausdruck brachten, lauteten zum Beispiel: »Der Süden denkt, dass wir dumm sind. Also gut, dann sind wir halt dumm. Warum sollten wir uns anstrengen? Wir würden doch sowieso scheitern.« Viele dieser Schüler waren Nachfahren der Menschen, die den Weg für die industrielle Revolution bereitet hatten. In der Region befindet sich zum Beispiel das erste Industriewerk der Welt, das von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt wurde. Aber statt stolz auf dieses Erbe zu sein, ließ man es verkommen. Damit ging zugleich das Selbstbewusstsein früherer Generationen verloren, die fest an ihre Innovationskraft geglaubt hatten.
Von Selbstvorwürfen ist es wiederum nur ein kurzer Schritt zum Verlust des Glaubens an die eigene Handlungsfähigkeit oder, im Jargon der Sozialpsychologie, zu erlernter Hilflosigkeit beziehungsweise erlernter Abhängigkeit. Das schrecklichste Beispiel, mit dem ich selbst in Berührung kam, ist Haiti, eine Gesellschaft, die im 18. Jahrhundert durch die Sklaverei traumatisiert wurde. Im Jahr 1804 befreiten sich die Haitianer dann in heroischer Weise von ihren Unterdrückern, und dies hätte die Grundlage eines dauerhaften Gefühls des Stolzes sein können. Stattdessen taumelte die haitianische Gesellschaft in weitere Tragödien. Erlernte Abhängigkeit ist Trägheit aus Verzweiflung, bei der sich die Menschen selbst jegliche Handlungsmacht absprechen. Für ihre Probleme machen sie ausschließlich Kräfte verantwortlich, die stärker sind als sie selbst. Ein haitianischer Student führte ein Beispiel an: Viele Haitianer glaubten, wenn sie krank würden, sei dies darauf zurückzuführen, dass sie ein böser Nachbar verhext habe – Magie sei also daran schuld, und sie selbst könnten nichts dagegen tun. Und somit warten Politiker und hohe Staatsbeamte mit Entscheidungsgewalt nach Hurrikanen und Erdbeben passiv ab, bis ausländische Hilfsorganisationen einfliegen, die ihnen helfen, sich von den Folgen der Katastrophe zu erholen. Haitianer arbeiten hart und wissen sich zu helfen: In den USA und in Kanada sind sie sehr erfolgreich. Aber wie in South Yorkshire hat Verzweiflung die Haitianer in ihrer Heimat psychisch gebrochen.
Manchmal beklagen selbst außergewöhnlich wohlhabende Menschen öffentlich ihre Ohnmacht – dadurch, dass sie einen ernsten Zustand bagatellisieren, entwerten sie ihn. Aber diejenigen, die am ehesten den Glauben daran verlieren, dass sie selbst etwas ändern können, sind schwache Gruppen, die von mächtigen angegriffen werden. Das am besten erforschte Beispiel sind die abgehängten Regionen in den USA, wo sich dieser Verlust des Glaubens an die eigene Handlungsmacht in besonders tragischer Weise in den »verzweiflungsbedingten Todesfällen« manifestiert, die Anne Case und Nobelpreisträger Angus Deaton, beides Ökonomen, dokumentiert haben. Die Lebenserwartung der Abgehängten sinkt. Der an der Universität Stanford lehrende Sozialpsychologe Greg Walton hat die genaue Abfolge von Gedanken analysiert, die Menschen in gelernte Abhängigkeit einschließt: Sie führen jeden Rückschlag auf das Wirken übermächtiger Kräfte zurück, die sich gegen sie verschworen haben, und ziehen, wie die Schüler in Yorkshire, den Schluss, dass es nichts bringe, sich anzustrengen. Die gelernte Abhängigkeit nistet im Innern und veranschaulicht das Syndrom der Fragilität, bei dem sich niedrige Erwartungen von selbst bewahrheiten. Sie liefern eine Rechtfertigung dafür, sich keine Mühe mehr zu geben, was die Betreffenden noch tiefer in Passivität einschließt, wenn dem nichts entgegengesetzt wird.
Die Sozialpsychologie erklärt auch das Phänomen der gesellschaftlichen Fragmentierung. Wenn ich an dem Ort, an dem ich lebe, keine sozialen Kontakte habe und mein Arbeitsplatz von einer Hierarchie der Demütigung geprägt ist, dann verkümmert mein Gemeinschaftsgefühl. Sobald die guten Zeiten vorbei sind, kann ich nur noch der verlorenen Vergangenheit nachtrauern. Die daraus resultierenden Einstellungen in den abgehängten Regionen der USA wurden in zwei soziologischen Studien analysiert. Die Soziologin Arlie Hochschild konzentriert sich auf das Gefühl von Verlassenheit und Verlust, das Menschen empfinden, die Fragmentierung erleben,[6] während der Politologe Eric Kaufmann ihre unschönen Folgen, wie etwa Feindseligkeit gegenüber ethnischen Minderheiten und Einwanderern, dokumentiert und kritisiert. Dies sind zwei Seiten derselben Tragödie: Menschen, die nach dem Verlust der Gemeinschaft, die ihrem Leben Sinn gab, tief verunsichert sind, suchen nach Sündenböcken.[7]
Kehren wir zurück in eine abgehängte englische Region: Ein Ereignis in meiner Heimatstadt Sheffield veranschaulicht das Gefühl des Verlusts, dem Hochschild begegnete. Als das örtliche John-Lewis-Kaufhaus 2021 dichtmachte, trauerten die Bewohner der Stadt: Blumen und kleine Dankesgaben wurden an der Eingangstür abgelegt, wie wenn sie ein Grabstein wäre. In dieser außergewöhnlichen Trauerbekundung über den Verlust eines Kaufhauses spiegelte sich der Ruf von John Lewis als bester britischer Arbeitgeber wider. Unter einem neuen, aggressiven Management, das letztlich entschied, die Filiale in Sheffield zu schließen, hatte das Unternehmen dieser Tradition den Rücken gekehrt und treue, langjährige Mitarbeiter entlassen. Die Blumen versinnbildlichten den tiefen Fall von John Lewis, nachdem in dem Unternehmen eine Hierarchie der Demütigung Einzug gehalten hatte.
Manchmal entlädt sich der Frust über den Verlust in kollektiver Wut, Frustration und Unvernunft. Die Demütigung einer Gemeinschaft kann eine kollektive Abneigung gegenüber erfolgreichen Gruppen auslösen. Ich sehe darin ein Aufbegehren gegen Autoritäten: Rebellion. Man findet dieses Verhalten überall auf der Welt, aber im globalen Maßstab liefern die USA und Großbritannien besonders eindringliche Beispiele.3 Im Jahr 2016 hatten London und dessen Umland in Bezug auf Wohlstandsniveau und Wirtschaftskraft alle anderen Regionen Englands weit hinter sich gelassen, als das mittlerweile berühmte Referendum abgehalten wurde – vordergründig über die Frage, ob Großbritannien in der Europäischen Union verbleiben oder aus ihr austreten sollte. Alle drei nationalen politischen Parteien sprachen sich für den Verbleib aus, und auch in London selbst stimmte eine deutliche Mehrheit dafür. Alle anderen englischen Regionen stimmten für den Austritt. Das Ausmaß, in dem eine Region abgehängt worden war, sagte zuverlässig vorher, ob sie für Austritt gestimmt hatte. Dabei war die Abstimmung nicht in erster Linie eine Auflehnung gegen Brüssel, das lediglich ein Prozent des britischen Volkseinkommens kontrollierte: Sie war eine Rebellion gegen London, das 40 Prozent erwirtschaftete. Später im gleichen Jahr führte eine ähnliche Rebellion der abgehängten Regionen in den USA dazu, dass Donald Trump Präsident wurde. Sowohl der Brexit als auch der Einzug Trumps ins Weiße Haus waren Akte, durch die sich die abgehängten Regionen ins eigene Bein schossen: Der Schaden war insgesamt groß, am größten aber in den Regionen, die rebelliert hatten. Wer sollte für diese Torheit zur Verantwortung gezogen werden? Die Antwort auf diese Frage führt uns zu einer weiteren Reihe von disruptiven Ideen: der Revolution in der Moralphilosophie.
Disruptive Moralphilosophie: kontributive Gerechtigkeit
Die Verantwortung für Rebellionen aus Verzweiflung tragen nicht nur – nicht einmal überwiegend – die Rebellen selbst. Schuld daran sind vielmehr mächtige Personen, die in den Jahrzehnten, in denen sich die Schere der Ungleichheit immer weiter öffnete, ohne dass etwas dagegen getan wurde, an den Schalthebeln saßen. Diese Nachlässigkeit ist der Grund dafür, dass so viele Regionen den Anschluss verloren.
Dem Brexit und den US-Präsidentschaftswahlen von 2016 gingen wütende Debatten voraus, aber sie waren keine echten Dialoge, an denen sich jeder auf Augenhöhe beteiligen konnte. Ein echter Dialog ist ein Austausch zwischen Gleichgestellten, die sich bemühen, einander zu verstehen; es ist kein Brüllwettbewerb zwischen wütenden Schwachen und herablassenden Starken. Man könnte einen solchen Dialog mit einem Tischtennisspiel vergleichen: Die bloße Teilnahme bedeutet bereits, dass man die Regeln akzeptiert. Die Regeln des Dialogs sollen unlauteres Verhalten ausschließen und setzen eine wechselseitige Bereitschaft voraus, nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Selbst wenn sie nicht gefunden werden, besteht eine wechselseitige Verpflichtung, einzusehen und anzuerkennen, dass die andere Seite ein Recht auf einen eigenen Standpunkt hat.
In Dialogen bildet sich ein gemeinsames Verständnis einer Situation heraus, das den verschiedenen Gruppen innerhalb einer Gesellschaft ermöglicht, ein gemeinsames Ziel zu definieren und sich auf eine Strategie zur Erreichung dieses Ziels zu verständigen. Jean-Jacques Rousseau war der erste Sozialwissenschaftler, der erkannte, dass die Evolution uns die Bereitschaft zur Kooperation mitgegeben hat: Der von ihm geprägte Begriff des Gesellschaftsvertrags bedeutete letztlich nichts anderes, als dass Menschen dadurch, dass sie sich bereitfanden, miteinander zu kooperieren, in der Lage waren, statt Kaninchen Hirsche zu fangen – also größere Beute machten, als wenn jeder für sich auf die Jagd gegangen wäre. Aber Rousseau ging nicht weiter. David Hume und sein Freund Adam Smith führten das entscheidende Konzept der Gegenseitigkeit ein: Anders als bei einem förmlichen Vertrag wird die wechselseitige Verpflichtung nicht vom Staat durchgesetzt, sondern durch Beziehungen wechselseitigen Vertrauens. Die entscheidende Rolle der Reziprozität hat Michael Sandel von der Harvard University in seinem Buch Vom Ende des Gemeinwohls (2020) dargelegt. Er führt das Konzept der kontributiven Gerechtigkeit (Beteiligungsgerechtigkeit) ein: Die Fairness gebietet es, dass jeder Mensch in einer Gesellschaft die Pflicht hat, das, was ihm möglich ist, zur Verwirklichung dieses gemeinsamen Ziels beizutragen. Dies verschafft ihm nicht nur Selbstachtung, sondern bringt ihm auch die Achtung anderer ein. Damit sich das praktisch umsetzen lässt, müssen alle – auch die Schwachen – hinreichend handlungsmächtig sein, um einen Beitrag leisten zu können.
Wie andere auch, können die Schwachen auf vielfältige Weise etwas beisteuern – etwa indem sie ihre Stimme in den Dialog einbringen oder ihre Lebenserfahrungen in abgehängten Regionen mit denen teilen, die es besser getroffen haben als sie. Die Mächtigen wiederum müssen ihre eigenen überlauten Stimmen dämpfen, den Schwachen zuhören und deren Helden ehren, statt das Lob ihrer eigenen zu singen. Vor allem aber können sich die Schwachen an einem Vorhaben, das dem Wohl der Gemeinschaft dient, beteiligen, indem sie es materiell unterstützen. Dies haben die Stahlarbeiter, die freiwillig einen Teil ihres Lohnes für das Stiftungskapital der Universität Sheffield spendeten, auf großartige Weise vor Augen geführt. Aber damit dies geschieht, müssen die Mächtigen dafür sorgen, dass die Schwachen Einkommen in ausreichender Höhe erhalten, um überhaupt einen Teil spenden zu können – so wie die Stahlbarone von Yorkshire bereit waren, ihren Arbeitern existenzsichernde Löhne zu zahlen.
Die Schwachen rebellieren, wenn die Mächtigen nicht bereit sind, auf sie zuzugehen. Wie Michael Sandel konstatiert, haben die Erfolgreichen in Großbritannien, den USA und einigen anderen Ländern die Schwachen, zum Beispiel die Arbeiter, und ihre Sorgen und Werte verachtet. In der Folge blies ihnen der kostspielige Wind der Polarisierung heftig ins Gesicht. In einer polarisierten Gesellschaft weisen die Schwachen jegliche Verpflichtung zurück, einen Beitrag zum Ganzen zu leisten.
Die genial einfache Methode der Google-Wortzählungen in Medien liefert empirische Belege dafür, dass in den USA die Akzeptanz der Gegenseitigkeit schwindet. Das Verhältnis von »ich« zu »wir« beschreibt im Verlauf des 20. Jahrhunderts eine u-förmige Kurve: Der Anfang sowohl des 20. als auch des 21. Jahrhunderts war eine Zeit des Egoismus, während die amerikanische Gesellschaft in der Mitte des 20. Jahrhunderts gemeinschaftsorientierter wurde. Seit dem Jahr 2000 ist die Kurve leider nach oben geschossen – was für ein beispielloses Interesse am Selbst spricht.[8]
Vielleicht geraten die niederschmetternden Lehren zweier Weltkriege mehr und mehr in Vergessenheit, und dies ist möglicherweise ein Faktor, der die Umschwünge mit erklärt. Sowohl in Großbritannien als auch in den USA waren mächtige Geschäftsleute während des Ersten Weltkriegs nicht bereit, materielle Opfer zu bringen. In den 1920er-Jahren war ihre Gier, wie von John Maynard Keynes zitiert, vom konservativen britischen Premierminister Stanley Baldwin in dem Satz »eine Menge Männer mit harten Gesichtern, die aussehen, als hätten sie ordentlich vom Krieg profitiert« verewigt worden, aber es änderte sich nichts, und die Krisen häuften sich: in Großbritannien der Generalstreik von 1926, in den USA der Große Börsenkrach von 1929, auf den 1931 die Weltwirtschaftskrise folgte.
Eine Politik tiefgreifender Erneuerung begann in den USA im Jahr 1933 mit Präsident Roosevelts New Deal, der anerkannte, dass staatliche Eingriffe in abgehängten Regionen für den sozialen Zusammenhalt unverzichtbar waren. Nach dem Angriff auf Pearl Harbor befreite ein neuer Konsens die USA von ihrem Isolationismus und löste weitere staatliche Eingriffe in die Wirtschaft aus. In Großbritannien hatte die Altersgruppe derjenigen, die in den 1920er-Jahren erwachsen wurden, aber bis in die 1940er-Jahre hinein zu jung waren, um nach politischer Macht zu streben, aus dem verheerenden Egoismus der Mächtigen die Lehre gezogen, dass sie jetzt selbst Opfer bringen müssten, um den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Nach dem Kriegseintritt der USA und Großbritanniens begann diese Gruppe, sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der Privatwirtschaft zu arbeiten. Großbritannien konnte keine Lebensmittel mehr einführen, und dem sich daraus ergebenden Problem der Knappheit versuchte man durch Rationierung Herr zu werden. Da jeder Anspruch auf die gleiche Menge an Lebensmitteln hatte, ernährten sich Menschen aus dem Arbeitermilieu trotz des Krieges besser: Die nationalen Ernährungsstandards stiegen tatsächlich. Sowohl dies als auch der New Deal waren gelebte kontributive Gerechtigkeit.4
Nach dem Krieg wurden zwei Kandidaten, von denen man dies nicht erwartet hatte, in die Spitzenämter gewählt. In den USA galt Harry S. Truman als ein Niemand und sicherer Verlierer, der bloß Franklin D. Roosevelts Handlanger gewesen war; in Großbritannien hatte Winston Churchill den Labour-Mann Clement Attlee mit der sarkastischen Bemerkung abgefertigt: »Er hat allen Grund, demütig zu sein.« Aber beide hinterließen ein bemerkenswertes Vermächtnis: die Vereinten Nationen (UN) und die Nordatlantische Vertragsorganisation (NATO), die die Grundlagen für die internationale Sicherheit legten; den Internationalen Währungsfonds (IWF), die Weltbank und das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT), die die Grundlagen für wirtschaftlichen Wohlstand legten. Attlee und Truman, zwei anspruchslose, bescheidene Männer, die in einer Zeit der Krise und Unsicherheit an die Macht kamen, erreichten viel, obwohl sie mit »radikaler Ungewissheit«, wie dies heute genannt wird, klarkommen mussten.
Die Wiederentdeckung radikaler Ungewissheit[9]
Radikale Ungewissheit ist die Herausforderung, die ein Problem darstellt, für das es keine bekannte Lösung gibt: die Situation, in der sich Attlee und Truman wiederfanden. Aus ihr folgt unter anderem, dass die meisten Lösungen, die wir für solche Probleme finden, wahrscheinlich nicht dauerhaft funktionieren, und dies galt auch für die Errungenschaften Attlees und Trumans.5
In der wirtschaftlichen Sphäre stützten sich die beiden Staatsmänner auf die keynesianische Idee, Vollbeschäftigung lasse sich mithilfe ausgeklügelter Vorhersagemodelle aufrechterhalten: Der Staat wisse es am besten. Doch nach 30-jähriger Vollbeschäftigung lösten die Ölschocks der 1970er-Jahre eine Stagflation aus, und die keynesianischen Ideen wurden zugunsten von Milton Friedmans Gegenrevolution aufgegeben, die die Devise »Der Staat weiß es am besten« durch den Slogan »Der Markt weiß es am besten« ersetzte. Der Kult des Marktes starb während der Weltfinanzkrise von 2008/2009, als verzweifelte und ideenlose Entscheidungsträger auf den Keynesianismus zurückgriffen, um den Zusammenbruch der Weltwirtschaft zu verhindern, einen ähnlich peinlichen Tod. Aber als 2022 ein unerwarteter Inflationsschub in kürzester Zeit die Erwartungen auf den Arbeitsmärkten veränderte, offenbarten sich die Schwächen des Keynesianismus, die ihn schon in den 1970er-Jahren dem Untergang geweiht hatten.
Im politischen Bereich hielten sich die Erfolge von Truman und Attlee länger. Die bedeutenden Errungenschaften der Sozialdemokratie im Gesundheitswesen, im Rentensystem und bei den Sozialprogrammen überdauerten mindestens bis zu den Reagan-Thatcher-Jahren und in mancher Hinsicht noch länger. Aber im Jahr 2023, als die durch die Häufung von Schocks, die durch COVID, den Klimanotstand und den Krieg in der Ukraine verursacht wurden, ausgelösten Fiskalkrisen angeschlagene Regierungen ins Wanken brachten, war die Welt ein weiteres Mal voller Ungewissheiten.[10]