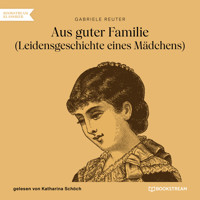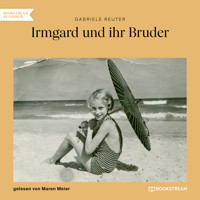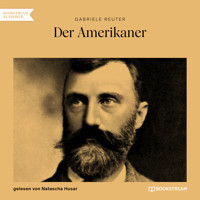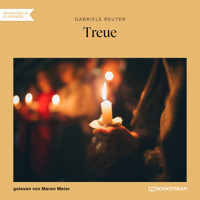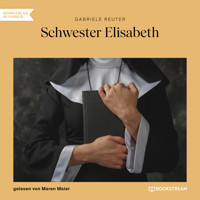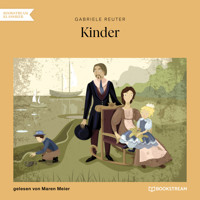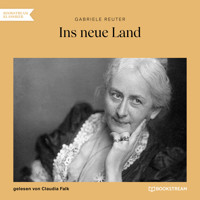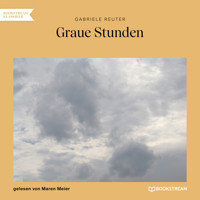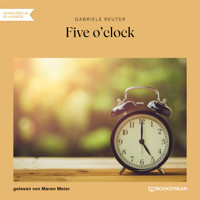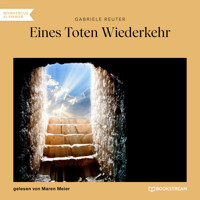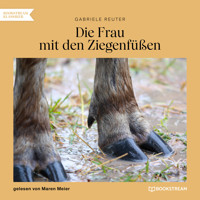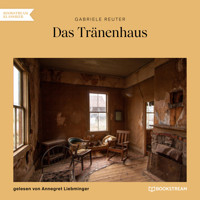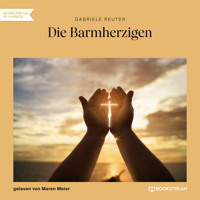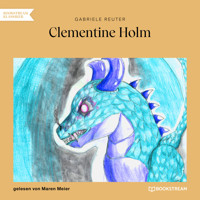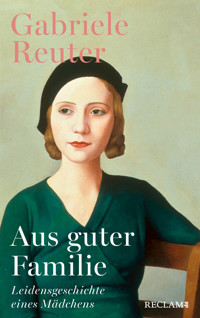
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Effi Briests vergessene Schwester Die junge, verträumte Agathe wächst in einem großbürgerlichen Haushalt auf und möchte eigentlich alles richtig machen. Doch immer wieder eckt sie in der konservativen Gesellschaft des jungen Kaiserreichs an, weder ihre jugendliche Sehnsucht nach Freiheit und Selbstentfaltung noch ihr Wunsch nach Liebe erfüllen sich. Als ihr Bruder ihre Mitgift verspielt, steht ihr nicht einmal mehr eine Vernunftehe offen. Agathe verzweifelt und wird in eine Heilanstalt eingewiesen. Gabriele Reuter wurde mit dem Roman schlagartig berühmt und dieser zu einem Bestseller. »Ein bekannter ›Frauenrechtler‹ soll, so las ich, geäußert haben, wenn er Kultusminister wäre, so würde er dieses Buch in Hunderttausenden von Exemplaren drucken und verteilen lassen. Er täte ungemein wohl daran.« Thomas Mann
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gabriele Reuter
Aus guter Familie
Leidensgeschichte eines MädchensRoman
Reclam
2024 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH
Coverabbildung: Antonio Donghi: Frau im Café. akg-images / Cameraphoto © VG Bild-Kunst, Bonn 2024
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2024
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962295-8
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011496-4
www.reclam.de
Inhalt
Erster Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
Zweiter Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Zu dieser Ausgabe
Nachwort
Erster Teil
I.
Breit und hell fiel ein Strahl der Frühlingssonne durch das verstaubte Bogenfenster einer Dorfkirche. Er durchschnitt als warmer, glänzender Streifen die graue Dämmerung und verlor sich hinter weißem Gitter in den schattigfeuchten Tiefen des Pfarrstuhles, den mehrere festlich gekleidete Herren und Damen besetzt hatten. Mitten in der Lichtbahn stand die Konfirmandin vor dem Altar. Das kleine Kreuz auf ihrer Brust glühte gleich einem überirdischen Symbol, und wie ein Kranz weltlicher Herrlichkeit flimmerte, von tausend Goldfunken durchsprüht, das braune Haar über dem rosenroten, tränenbetauten, feierlichen Kindergesicht.
Sie stand ganz allein an dem heiligen Orte, durchschauert von der Bedeutung des Augenblicks – bangend, das Gelübde auszusprechen, das auf ihren Lippen schwebte und sie für ein Leben der Wahrheit und der Heiligung unwiderruflich verpflichten sollte.
Hinter ihr, zwischen den schmalen Holzbänken, hörte sie das Gepolter einiger niederknieenden Tagelöhnerkinder, die bereits die Einsegnung empfangen hatten. Agathe wünschte plötzlich mit krankhafter Heftigkeit, unter den peinlich glattgekämmten und rotgeseiften Köpfen, den ungeschickten Gestalten dort sich verbergen, sich an der Gemeinschaft mit ihnen stärken zu können.
Ihr Herz wollte sein Schlagen aussetzen, eine Furcht ergriff sie, ein Schwindel, indem sie auf die Knie sank und den Kopf mit dem Gefühl neigte, es müsse in der nächsten Minute ihr Dasein, das froh empfundene Dasein, gegen einen Zustand von fremder Schauerlichkeit, voll erhabener Schmerzen und beklemmender Wonnen eingetauscht werden.
Über sich hörte Agathe die sanfte, ernstfeierliche Stimme des Geistlichen die Frage an sie richten: ob sie dem Teufel, der Welt und allen ihren Lüsten entsagen, ob sie Christo angehören und ihm folgen wolle. In süßer Schwermut hauchte sie »ja«, fühlte die Berührung der segnenden Hände auf ihrem Haupte und versuchte mit gewaltsamer Anstrengung, alle ihre Sinne einzutauchen in die Anbetung der ewigen Gottheit – des Herrn, der über ihr schwebte.
Aber sie vernahm das Rauschen ihres eigenen seidenen Kleides; ein gerührtes Flüstern und unterdrücktes Schluchzen drang aus dem Pfarrstuhl, wo ihre Eltern saßen, zu ihren Ohren; sie hörte ein Gesangbuch irgendwo polternd zur Erde fallen und eine gemurmelte Entschuldigung – sie lauschte auf die falschen Töne, die der Küster bei seiner leisen Orgelbegleitung griff – sie musste an ein Buch denken, an eine anstößige Stelle, die sie verfolgte … Tränen quollen unter ihren gesenkten Lidern hervor, krampfhaft falteten sich ihre Hände, auf den schwarzen Handschuhen sah sie die Tränentropfen nasse Flecke bilden – sie konnte nicht beten …
Nicht in dieser Stunde? Nicht während weniger Sekunden konnte sie Gott allein angehören? Und sie hatte geschworen, für ihr ganzes Leben dem Irdischen abzusagen! Sie hatte einen Meineid geleistet – eine untilgbare Sünde begangen! Mein Gott, mein Gott, welche Angst!
Versuchte der Teufel sie? Es gab doch einen Teufel. Sie fühlte ganz deutlich, wie er in ihrer Nähe war und sich freute, dass sie nicht beten konnte. Lieber Gott, verlass mich doch nicht! – Vielleicht kam die Prüfung über sie, weil sie in der Beichte, die sie hatte niederschreiben und dem Geistlichen überreichen müssen, nicht aufrichtig gewesen … Hätte sie sich so entsetzlich demütigen sollen … das bekennen? Nein – nein – nein – das war ganz unmöglich. Lieber in die Hölle!
Der Schweiß brach ihr aus, so peinigte sie die Scham.
Das konnte sie doch nicht aufschreiben. Tausendmal lieber in die Hölle!
Jetzt nicht daran denken … Nur nicht denken. Wie war es denn anzustellen, um Macht über das Denken zu bekommen? Sie dachte doch immer … Alles war so geheimnisvoll schrecklich bei diesem christlichen Glaubensleben. Sie wollte es ja annehmen … Und sie hatte ja auch gelobt – nun musste sie – da half ihr nichts mehr!
Mit einem unerträglichen Zittern in den Knien begab das Mädchen sich an ihren Platz zurück. Der Gesang der Gemeinde und das Spiel der Orgel schwollen stärker an, während der Geistliche die Vorbereitungen zum Abendmahl traf, aus der schöngeformten Kanne Wein in den silbernen Kelch goss und das gestickte Leinentuch von dem Teller mit den heiligen Oblaten hob.
Das Licht der hohen Wachskerzen flackerte unruhig. Agathe schloss geblendet die Augen vor dem hellen Sonnenschein, der die Kirche durchströmte und in dem Milliarden Staubatome wirbelten. War die Himmelssonne nur dazu da, alles Verborgene zu schrecklicher Klarheit zu bringen?
In stumpfem Erstaunen hörte sie neben sich zwei ihrer Mitkonfirmandinnen leise flüstern – flachsköpfige Mädchen, die einen Duft von schlechter Pomade um sich verbreiteten.
»Wiesing – wo is dien Modder?«
»Sei möt uns’ lütt Kalf börnen.«
»Ju! Hewet et ji all? Dat’s fin! Dat kunnst mi ok gliek vertellen!«
»Klock Twelf hat’s de Bleß bracht. Wie sünd all die Nacht in’n Stall west!«
Wie konnte man über so etwas in der Kirche reden, dachte Agathe. Ein Zug hochmütiger Missachtung bewegte ihre Mundwinkel. Sie wurde ruhiger, sicherer im Gefühl ihres heißen Wollens. Eine Müdigkeit – eine Art von seliger Ermattung beschlich sie bei dem Gesange jenes alten mystischen Abendmahlsliedes:
Freue dich, o liebe Seele,
Lass die dunkle Sündenhöhle,
Komm ans helle Licht gegangen.
Fange herrlich an zu prangen.
Denn der Herr voll Heil und Gnaden
Will dich jetzt zu Gaste laden,
Der den Himmel kann verwalten
Will jetzt Zwiesprach’ mit dir halten.
Eile, wie Verlobte pflegen,
Deinem Bräutigam entgegen.
Der da mit dem Gnadenhammer
Klopft an deines Herzens Kammer.
Öffn’ ihm deines Geistes Pforten,
Red’ ihn an mit süßen Worten:
Komm, mein Liebster, lass dich küssen,
Lass mich deiner nicht mehr missen.
Nun war es nicht der erhabene Gott-Vater, der das Opfer forderte, nicht mehr der Heilige Geist, der unbegreiflich-furchtbare, der mit den Gluten des ewigen Feuers seinen Beleidigern droht, der niemals vergibt – jetzt nahte der himmlische Bräutigam mit Trost und Liebe.
»Wer da unwürdig isset und trinket, der sei verdammt« – heißt es zwar auch hier. Aber über das Mädchen kam eine frohe Zuversicht. Vor ihr inneres Auge trat Jesus von Nazareth, wie ihn die Kunst, wie ihn Tizian gebildet hat, in seiner schönen, jungen Menschlichkeit – ihn hatte sie lieb … Ein schmachtendes Begehren nach der geheimnisvollen Vereinigung mit ihm durchzitterte die Nerven des jungen Weibes. Der starke Wein rann feurig durch ihren erschöpften Körper – ein sanftes, zärtliches und doch entsagungsvolles Glück durchbebte ihr Innerstes – sie war würdig befunden, seine Gegenwart zu fühlen.
Auch Agathes Eltern, ihr Bruder, ihr Onkel und die Frau des Predigers, in dessen Hause sie seit einigen Monaten lebte, nahmen das Abendmahl, um sich in Liebe dem Kinde zu verbinden. Darum hatte der Geistliche zuerst seine ländlichen Konfirmanden und deren Angehörige absolviert und dann die Tochter des Regierungsrates und ihre Familie zum Tisch des Herrn treten lassen. So stand denn Agathe umgeben von all denen, die ihr die Nächsten waren auf dieser Welt.
Gleichgültig sahen die mürrischen alten Bauern, die schläfrigen Knechte, voll Neugier aber die Pächter- und Taglöhnerfrauen dem Gebaren der Fremden zu. Der stattliche Herr mit dem Orden, der den hohen Hut im Arm trug, konnte eine Bewegung in seinen Zügen trotz der würdevollen Haltung nicht verbergen. Er wandte seinen Kopf zur Seite, um mit der Fingerspitze eine leichte Feuchtigkeit von den Wimpern zu entfernen. Das vermerkten die Frauen mit Genugtuung. Und dann weckte das schwarze Atlaskleid und der Spitzenumhang der Mutter leise geraunte Bewunderung. Die Regierungsrätin selbst jedoch hatte die Empfindung, ihr Kleid wirke aufdringlich in dieser bescheidenen Umgebung, und als sie zum Altar trat, hielt sie die Schleppe ängstlich und verlegen an sich gedrückt, dabei weinte sie und seufzte von Zeit zu Zeit tief und schmerzlich. Als die Gemeinde den letzten Vers sang, stahlen sich ihre Finger nach Agathes Hand und drückten sie krampfhaft. Kaum war der Gottesdienst zu Ende, so umarmte Frau Heidling ihre Tochter mit einer Art von kummervoller Leidenschaft, die wenig für die Gelegenheit zu passen schien, und murmelte mehrere Mal unter Tränen: mein Kind, mein süßes, geliebtes Kind! – ohne mit ihrem Segenswunsch zu Ende gelangen zu können.
Doch die bewegte Mutter durfte das Kind nicht an ihrem Herzen behalten. Der Vater verlangte nach ihr, Onkel Gustav, Bruder Walter, Frau Pastor Kandler – alle wollten ihre Glückwünsche darbringen. Ein jeder gab dabei noch an der Kirchtür dem Mädchen ein wenig Anleitung, wie sie sich dem kommenden Leben gegenüber als erwachsener Mensch zu verhalten habe.
Sie hörte mit verklärtem Lächeln auf dem verweinten Gesichtchen alle die goldenen Worte der Liebe, der älteren Weisheit. So schwach fühlte sie sich, so hilfsbedürftig und so bereit, jedermann zu Willen zu sein, alles zu beglücken, was in ihre Nähe kam. Sie war ja selbst jetzt so glücklich!
Ihr Bruder, der Abiturient, lief aufmerksam nochmals in die Kirche zurück, ihr vergessenes Bouquet zu holen, während alle anderen sich auf den Weg zum Pfarrhaus begaben. Agathe wartete auf ihn, sah ihn dankbar an und legte den Arm in den seinen. So folgten sie den Eltern.
»Verzeihe mir auch alle meine Ungefälligkeiten«, murmelte Agathe demütig dem Abiturienten zu. Walter errötete und brummte etwas Unverständliches, indem er sich vor Verlegenheit von der Schwester losriss.
»Na, Jochen – was macht der Braune?«, schrie er dem Pastorskutscher zu, setzte mit Anlauf und geschicktem Turnersprung über einen auf dem sonnenbeglänzten Hof stehenden Pflug hinweg und verschwand mit Jochen in der Stalltür. Agathe ging allein ins Haus. Es waren einige Pakete für sie gekommen, die man ihr vorenthalten hatte, um sie am Morgen vor der heiligen Handlung nicht zu zerstreuen. Nur das schöne Kreuz an seiner goldenen Kette hatte Papa ihr beim Frühstück um den Hals gelegt. Jetzt durfte sie sich wohl schon ein wenig der Neugier auf die Geschenke von Verwandten und Freundinnen hingeben.
In der niedrigen, an diesem Frühlingstage noch etwas kellerig-kühlen guten Stube des Pfarrhauses erquickten sich die Erwachsenen an Wein und kleinen Butterbrötchen. Agathe verspürte keinen Hunger. Sie setzte sich eifrig mit ihren Paketen auf den Teppich, riss an den Siegeln, schlug sich mit den Packpapieren herum. Ihre Wangen brannten glühendrot, die Finger zitterten ihr.
»Aber, Agathe, zerschneide doch nicht all die guten Bindfaden«, mahnte ihre Mutter. »Wie du immer heftig bist!«
»Wenn ein Mädchen geduldig Knoten lösen kann, so bekommt es einen guten Mann«, ergänzte die Pastorin aus dem Nebenzimmer, wo der Esstisch gedeckt wurde.
»Ach, ich will gar keinen Mann!«, rief Agathe lustig, und ritsch – ratsch flogen die Hüllen herunter.
»Na – verschwör’s nicht, Mädel«, sagte der dicke Onkel Gustav und guckte mit listigem Lächeln hinter seinem Gläschen Marsala hervor. »Von heute ab musst du ernstlich an solche Sachen denken.«
»Das wollt’ ich mir verbeten haben«, fiel die Regierungsrätin ihm ins Wort; den Ton durchklang das Siegesbewusstsein, welches die Mütter sehr junger Töchter erfüllt: Kommt nur, ihr Freier, ihr … heiraten soll mein Kind schon – aber wer von euch ist eigentlich gut genug für sie?
»Rückerts Liebesfrühling!«, schrie Agathe da plötzlich laut auf und schwenkte ein kleines rotes Büchelchen so entzückt in der Luft, dass alles um sie her in Gelächter ausbrach.
»Zur Konfirmation? Etwas früh!«, bemerkte Papa verwundernd und tadelnd.
»Gewiss von Eugenie?«, fragte die Regierungsrätin; sie antwortete sich selbst: »Natürlich – das ist ganz wie Eugenie.«
Inzwischen kam der Inhalt eines zweiten Paketes zu Tage.
»Geroks Palmblätter – von der guten Tante Malvine«, berichtete Agathe diesmal ruhiger mit andächtiger Pietät.
»Ach – das wonnige Armband! Gerade solches hab ich mir gewünscht! Eine Perle in der Mitte! Nicht wahr, Mama, das ist doch echt Gold?« Sie legte es gleich um ihr Handgelenk. Knips! sprang das Schlösschen zu.
»– Und hier wieder ein Buch! Der prachtvolle Einband! Des Weibes Leben und Wirken als Jungfrau, Gattin und Mutter … Von wem denn nur? Frau Präsident Dürnheim. Wie freundlich! – Nein, aber wie freundlich! Sieh doch nur, Mama! Das Weib als Jungfrau, Gattin und Mutter mit Illustrationen von Paul Thumann und anderen deutschen Künstlern!«
»Nein – nein – wie ich mich aber freue!«
Agathe sprang mit einem Satz vom Teppich auf und tanzte vor ausgelassenem Glück in der Stube zwischen den gelben und braunen Papieren herum; die losen Löckchen auf ihrer Stirn, die Kette und das Kreuz auf ihrer Brust, der Liebesfrühling und das Weib als Jungfrau, Gattin und Mutter, das sie beides zärtlich an sich drückte – alles hüpfte und tanzte mit.
Die erwachsenen Leute auf dem Sofa und in den Lehnstühlen lächelten wieder. Wie reizend sie war! Ach ja – die Jugend ist etwas Schönes!
Endlich fiel Agathe ganz außer Atem bei ihrer Mutter nieder, warf ihr all ihre Schätze in den Schoß und rieb wie ein vergnügtes Hündchen den braunen Kopf an ihrem Kleide.
»Ach – ich bin ganz toll«, sagte sie beschämt, als Mama leise ihr Haupt schüttelte. Agathe fühlte ein schlechtes Gewissen, weil Pastor Kandler gerade jetzt eintrat. Er hatte den Talar abgelegt und trug seinen gewöhnlichen Hut in der Hand.
»Du gehst noch aus?«, fragte seine Frau erschrocken.
»Ja – wartet nicht auf mich mit dem Essen. Ich muss doch bei Groterjahns gratulieren – ich höre, dass ihre Familie durch ein Kälblein vermehrt worden ist«, sagte er mit der gutmütigen Ironie des resignierten Landgeistlichen, der längst erfahren hat, dass er die Dorfleute nur durch sein persönliches Interesse für ihre materiellen Sorgen fügsam zur Anhörung der christlichen Heilslehre macht. »Ich bestelle also Wiesing zu heut Abend herauf – du wolltest doch wohl selbst mit ihr sprechen, liebe Cousine?«, fragte er die Regierungsrätin:
»Ja – wenn das Mädchen Lust hätte, in die Stadt zu ziehen, möchte ich es schon einmal mit ihr versuchen«, antwortete diese.
Agathe saß bei Tisch vor einem Teller, der mit gelben Schlüsselblumen umkränzt war, zwischen Vater und Mutter. Der Konfirmandin gegenüber hatte Pastor Kandler seinen Platz, neben ihm leuchtete Onkel Gustavs rosiges Gesicht aus den blonden Bartkoteletten über der weißen vorgesteckten Serviette. Die Pastorin war von dem Regierungsrat geführt worden. Unten, zwischen der Jugend, saß eine alte Näherin, die stets das Osterfest im Pfarrhause zuzubringen pflegte. Nach jedem Gang zog sie ihr Messer zwischen den Lippen hindurch, um ja nichts von den prächtigen Speisen und der nahrhaften Sauce zu verlieren. Walter fühlte sich in seiner Abiturientenwürde sehr gekränkt, weil man ihm die zahnlückige Person als Nachbarin gegeben hatte, und es war ihm fatal, dass er nicht recht wusste, ob es schicklicher von ihm sein würde, sie anzureden oder ihre Gegenwart einfach zu übersehen. Die Regierungsrätin warf gleichfalls unbehagliche Blicke auf die alte Flickerin, denn sie dachte, ihr Mann möchte vielleicht an deren Gegenwart Anstoß nehmen.
Aber auf den Regierungsrat Heidling wirkte sie nur sanft belustigend. Er war ja ganz im Klaren darüber, dass er sich unter naiven, weltfremden Leutchen befand. Mit wohlüberlegter Absicht hatte er seine Tochter nicht im Kreise ihrer Freundinnen bei dem Modeprediger in M. konfirmieren lassen, sondern bei dem bescheidenen Vetter seiner Gattin. Er schätzte eine positive Frömmigkeit an dem weiblichen Geschlecht. Für den deutschen Mann die Pflicht – für die deutsche Frau der Glaube und die Treue.
Dass der Fonds von Religion, den er Agathe durch die Erziehung mitgegeben, niemals aufdringlich in den Vordergrund des Lebens treten durfte, verstand sich bei seiner Stellung und in den Verhältnissen der Stadt ebenso von selbst, wie das Tischgebet und die alte Flickerin hier in dem pommerschen Dörfchen an ihrem Platz sein mochten. »Luise« von Voß fiel ihm ein – in jungen Jahren hatte er das Buch einmal durchgeblättert. Es tat seiner Tochter gut, diese Idylle genossen zu haben. Agathe war frisch und stark und rosig geworden in dem stillen Winter, bei den Schlittenfahrten über die beschneiten Felder, in der klaren, herben Landluft. Sein Kind hatte ihm nicht gefallen, als es aus der Pension kam. Etwas Zerfahrenes, Eitles, Schwatzhaftes war ihm damals an ihr aufgefallen. Nur das nicht! Er stellte ideale Forderungen an die Frau.
Unwillkürlich formten sich ihm die Gedanken zu rednerischen Phrasen. Er schwieg bei den Gesprächsversuchen der Pastorin und spielte mit der gepflegten Hand an dem graublonden Bart.
Inzwischen schlug schon Pastor Kandler an sein Glas. Die Regierungsrätin zog aus Vorsicht, sobald er sich räusperte, ihr feuchtes Battisttuch – es war ihr Brauttaschentuch – hervor. Und das war gut, denn unaufhörlich tropften ihr bei seinen Worten die Tränen über das verblühte matte Antlitz, dessen Wangen eine fliegende, nervöse Röte angenommen hatten. Er sprach so ergreifend! Er rührte ihr an so vieles!
Die Grundlage der Rede bildete das Bibelwort: Alles ist euer – ihr aber seid Christi. Pastor Kandler suchte in seiner Phantasie nach einer naturwahren Beschreibung der Freuden, die das Leben einer modernen jungen Dame der feinen bürgerlichen Gesellschaft ihr zu bieten habe: in der Familie, im Verkehr mit Altersgenossinnen, durch Natur, Kunstbestrebungen und Lektüre. Er deutete auch andere Glückseligkeiten an, die ihrer warteten – denn es war nun einmal der Lauf der Welt – hold, unschuldig, wie sie da vor ihm saß, das liebe Kind, in ihrem schwarzseidenen Kleidchen, die braunen Augen aus dem weichen, hellen Gesichtchen andächtig auf ihn gerichtet – wie bald konnte sie Braut sein. Alles ist euer!
Aber wie soll dieses »Alles« benutzt werden? Besitzet, als besäßet ihr nicht – genießet, als genösset ihr nicht! – Auch der Tanz – auch das Theater sind erlaubt, aber der Tanz geschehe in Ehren, das Vergnügen an der Kunst beschränke sich auf die reine, gottgeweihte Kunst. Bildung ist nicht zu verachten – doch hüte dich, mein Kind, vor der modernen Wissenschaft, die zu Zweifeln, zum Unglauben führt. Zügle deine Phantasie, dass sie dir nicht unzüchtige Bilder vorspiegele! Liebe – Liebe – Liebe sei dein ganzes Leben – aber die Liebe bleibe frei von Selbstsucht, begehre nicht das ihre. Du darfst nach Glück verlangen – du darfst auch glücklich sein – aber in berechtigter Weise … denn du bist Christi Nachfolgerin, und Christus starb am Kreuz! Nur wer das Irdische ganz überwunden hat, wird durch die dornenumsäumte Pforte eingehen zur ewigen Freude – zur Hochzeit des Lammes!
Agathe musste wieder sehr weinen. Aufs Neue erfasste sie das ängstigende Bewusstsein, welches sie durch alle Konfirmandenstunden begleitete, ohne dass sie es ihrem Seelsorger zu gestehen wagte: Sie begriff durchaus nicht, wie sie es anzustellen habe, um zu genießen, als genösse sie nicht. Oft schon hatte sie sich Mühe gegeben, dem Worte zu folgen. Wenn sie sich mit den Pastorsjungen im Garten schneeballte, versuchte sie, dabei an Jesum zu denken. Aber bedrängten die Jungen sie ordentlich, und sie musste sich nach allen Seiten wehren, und die Lust wurde so recht toll – dann vergaß sie den Heiland ganz und gar. – Schmeckte ihr das Essen recht gut – und sie hatte jetzt immer einen ausgezeichneten Appetit –, sollte sie da tun, als ob es ihr nicht schmeckte? Aber das wäre ja eine Lüge gewesen.
Wahrscheinlich hatte sie das Geheimnis des Spruches noch gar nicht verstanden. Ach – sie fühlte sich der Gemeinschaft gereifter Christen recht unwürdig! Aber es war doch wunderhübsch, nun konfirmiert zu sein – und es war auch an der Zeit, sie wurde doch schon siebzehn Jahre alt.
Hatte der Pastor dem Kinde seine Verantwortung als Himmelsbürgerin klarzumachen gesucht, so begann der Vater Agathe nun die Pflichten der Staatsbürgerin vorzuhalten.
Denn das Weib, die Mutter künftiger Geschlechter, die Gründerin der Familie, ist ein wichtiges Glied der Gesellschaft, wenn sie sich ihrer Stellung als unscheinbarer, verborgener Wurzel recht bewusst bleibt.
Der Regierungsrat Heidling stellte gern allgemeine, große Gesichtspunkte auf. Sein Gleichnis gefiel ihm.
»Die Wurzel, die stumme, geduldige, unbewegliche, welche kein eigenes Leben zu haben scheint und doch den Baum der Menschheit trägt …«
In diesem Augenblick wurde noch ein Geschenk für Agathe abgegeben. Der Landbriefträger hatte es als Dank für das am Morgen erhaltene reichliche Trinkgeld trotz des Feiertages von der kleinen Bahnstation herübergebracht.
»Ach nein! – Das schickt Mani!«, sagte Agathe und wurde rot. »Er hatte es versprochen, aber ich dachte, er würde es vergessen.«
»Dein Vetter Martin, von dem du so viel erzählst?«, erkundigte sich die Pastorin neugierig.
Agathe nickte, in glücklichen Erinnerungen verstummend.
Herweghs Gedichte. Und die Sommerferien bei Onkel August in Bornau – der sonnenbeschienene Rasen, auf dem sie gelegen und für die glühenden Verse geschwärmt hatte, die Martin so prachtvoll deklamieren konnte … Wie sie sich mit ihm begeisterte für Freiheit und Barrikadenkämpfe und rote Mützen – für Danton und Robert Blum … Agathe schwärmte dazwischen auch für Barbarossa und sein endliches Erwachen …
Sie hatte Martin seitdem noch nicht wiedergesehen. Er diente jetzt sein Jahr. Ach, der gute, liebe Junge.
Agathe war zu beschäftigt, das Buch aufzuschlagen und ihre Lieblingsstellen nachzulesen, um zu bemerken, dass eine peinliche Stille am Tische entstanden war.
Als sie emporsah, begegnete ihr Blick dem von verhaltenem Lachen ins Breite gezogenen Gesicht von Onkel Gustav, der sich eifrig mit dem Öffnen einer Champagnerflasche beschäftigte. Pastor Kandler stand auf, ging schweigend um den Tisch herum und nahm ihr den Herwegh aus der Hand. Er trat zu dem Regierungsrat und zeigte ihm hier und da eine Stelle. Beide Herren machten ernste Mienen. Es lag etwas Unangenehmes in der Luft.
»Dass der Bengel noch so dumm wäre, hätte ich ihm doch nicht zugetraut«, brach der Regierungsrat ärgerlich los.
»Mein liebes Kind«, sagte Pastor Kandler beschwichtigend zu Agathe, »ich denke, wir heben dir das Buch auf und bitten Vetter Martin, es gegen ein anderes umzutauschen. Es gibt ja so viele schöne Lieder, die für junge Mädchen geeigneter sind und dir besser gefallen werden.«
Agathe war ganz blass geworden.
»Ich hatte mir Herweghs Gedichte gewünscht«, stieß sie ehrlich heraus.
»Du kanntest wohl das Buch nicht?«, fragte ihr Vater mit derselben beängstigenden Milde, die des Pastors Vorschlag begleitete. Man wollte sie an ihrem Konfirmationstage schonen, aber es war sicher – sie hatte etwas Schreckliches getan!
»Doch!«, sagte sie eilig und leise und setzte noch schüchterner hinzu: »Ich fand sie schön!«
»Du wirst einige gekannt haben«, entschuldigte Pastor Kandler. Sein Blick haftete eindringlich auf ihr. Sollte das sanfte Kind ihn mit ihrer innigen Hingabe an das Christentum getäuscht haben? Woher plötzlich dieser Geist des Aufruhrs?
»Was gefiel dir denn besonders an diesen Gedichten?«, prüfte er vorsichtig.
»Die Sprache ist so wunderschön«, flüsterte das Mädchen verlegen.
»Hast du dir nie klargemacht, dass diese Verse mit manchem, was ich dich zu lehren versuchte, in Widerspruch stehen?«
»Nein – ich dachte, man sollte für seine Überzeugung kämpfen und sterben!«
»Gewiss, mein Kind, für eine gute Überzeugung. Aber für eine törichte, verderbliche Überzeugung soll man doch wohl nicht kämpfen?«
Agathe schwieg verwirrt.
Vater und Seelsorger sprachen miteinander.
»Das sind doch besorgliche Symptome«, sagte der Regierungsrat. »Ich verstehe meinen Neffen absolut nicht! In des Königs Rock! Geradezu unerhört!«
»Ich glaube, wir brauchen die Sache nicht so ernst zu nehmen«, meinte Pastor Kandler, mit seinem stillen, ironischen Lächeln den Regierungsrat betrachtend. »Die Jugend hat ja schwache Stunden, wo ein berauschendes Gift wohl eine Wirkung tut, die bei gesunder Veranlagung schnell vorübergeht. Das wissen wir ja alle aus Erfahrung!« Er legte das anstößige Buch beiseite und ging auf seinen Platz zurück.
»Wäre den Herrschaften nicht ein Stückchen Torte gefällig?«, fragte die Pastorin freundlich.
Onkel Gustav ließ von einer Champagnerflasche, die er mit weitläufiger Feierlichkeit behandelte, weil sie seine Beisteuer zum Feste war, den Pfropfen mit einem Knall in die darüber gehaltene Gabel springen. Die beiden Pastorsjungen jauchzten über das Kunststück, der schäumende Wein floss in die Gläser, man erhob sich und stieß an. Der Schatten, den die blutdürstige Revolutionslust der Konfirmandin auf die Gesellschaft geworfen, war der alten, stillbewegten Heiterkeit gewichen. Nur in Agathes braunen Augen war noch etwas Sinnendes zurückgeblieben. Onkel Gustav klopfte dem Nichtchen begütigend die volle Wange und rief dabei mit seinem jovialen Lachen:
»Vorläufig doch mehr Blüte als Wurzel!«
Dann flüsterte er Agathe ins Ohr: »Dummes Ding – Geschenke von netten Vettern packt man doch nicht vor versammelter Tischgesellschaft aus!«
Leider war Onkel Gustav selber ein Familienschatten. Er hatte keine Grundsätze und brachte es deshalb auch zu nichts Rechtem in der Welt. So heiratete er z. B. eine Frau, die allerlei Abenteuer erlebt hatte und sich schließlich von einem Grafen entführen ließ. Das mochten ihm die Verwandten nicht verzeihen. Agathe hatte ihn trotzdem lieb. Er war so gut; bot sich die Gelegenheit, einem Menschen in kleinen oder großen Dingen zu helfen, so fand man ihn gewiss bereit. Was er sagte, konnte freilich nicht sehr ins Gewicht fallen. Agathe blieb nachdenklich. »Alles ist euer«, war ihr eben versichert worden, und gleich darauf nahm man ihr das Geschenk ihres liebsten Vetters fort, ohne sie auch nur zu fragen. Widerspruch wagte sie natürlich nicht. Sie hatte ja Gehorsam und demütige Unterwerfung gelobt für das ganze Leben.
Später, als die Erwachsenen in allen Sofaecken des Pfarrhauses ihr Verdauungsschläfchen hielten – man war ein bisschen heiß und müde geworden von dem reichlichen Mittagsmahl und dem Champagner –, ging Agathe den breiten Gartenweg hinter dem Hause auf und nieder. Die Jungen hatten den Befehl erhalten, sie heute nicht zu stören und zum Spielen zu holen, wie sonst. Sie machten mit Walter einen Spaziergang. Die Pastorin half, ungesehen von den Gästen, der Magd in der Küche beim Tellerwaschen; von dorther tönte bisweilen ein Geklapper, sonst herrschte Stille in Hof und Garten. Agathe hörte mit heimlichem Vergnügen ihre seidene Schleppe über den Kies rauschen, hatte die Hände gefaltet und bat den lieben Gott, er möge ihr doch nur den Ärger aus dem Herzen nehmen. Es war doch zu schrecklich, dass sie heut, am Konfirmationstage, ihrem Pastor und ihrem Vater böse war! Hier fing gewiss die Selbstüberwindung und die Entsagung an. Sie war doch noch recht dumm! Ein so gefährliches Gift für schön zu halten … Der Anfang von Martins Lieblingsliede fiel ihr ein:
»Reißt die Kreuze aus der Erden.
Alle sollen Schwerter werden –
Gott im Himmel wird’s verzeih’n«
Ja, das war schon eine fürchterliche Stelle, und auf die war Onkel Kandler gewiss gerade gestoßen. Aber doch – es lag so eine Kühnheit darin – und dann wurde der liebe Gott ja doch auch besonders um Verzeihung gebeten. Das hatte Agathe immer sehr gefallen in dem Liede.
Aber so war es fortwährend: Was einem gefiel, dem musste man misstrauen.
Sie blickte fragend und zweifelnd gerade in den hellblauen Frühlingshimmel hinauf. Kein Wölkchen zeigte sich daran, er war unendlich heiter, und die Sonne schien warm. Es gab noch fast keinen Schatten im Garten, die goldenen Strahlen konnten überall durch die Baumzweige auf die Erde niedertanzen. Und das Singen und Jubeln der Vögel hörte nicht auf.
Schade, dass sie morgen nach der Stadt zurück musste, gerade nun es hier so reizend wurde – täglich schöner! Seit gestern hatte sich alles schon wieder verändert. Busch und Strauch trugen nicht mehr das Grau des Winters – wie durchsichtige bunte Schleier lag es über dem Gezweig. Trat man näher und beugte sich herzu, so sah man, dass die Farbenschleier aus tausend und abertausend kleinen Knöspchen zusammengesetzt waren. Nein, aber wie süß! Agathe ging von einem zum andern. Dunkelrot schimmerte es an den knorrigen Zweigen der Apfelbäume, die sich über den Weg streckten, grünweiß hoch oben an dem großen Birnbaum, und schneeig glänzte es schon von den losen Zweigen der sauren Kirschen. Bei den Kastanien streckten sich aus braunglänzenden klebrigen Kapseln wollige grüne Händchen neugierig heraus, und die Herlitze war ganz in helles Gelb getaucht. Der Flieder – die Hainbuche – jedes besaß seine eigene Form, seine besondere Farbe. Und das entfaltete sich hier still und fröhlich in Sonnenschein und Regen zu dem, was es werden sollte und wollte.
Die Pflanzen hatten es doch viel, viel besser als die Menschen, dachte Agathe seufzend. Niemand schalt sie – niemand war mit ihnen unzufrieden und gab ihnen gute Ratschläge. Die alten Stämme sahen dem Wachsen ihrer braunen, roten und grünen Knospenkinderchen ganz unbewegt und ruhig zu. Ob es ihnen wohl weh tat, wenn die Schnecken, die Raupen und die Insekten eine Menge von ihnen zerfraßen?
Agathe streichelte leise die borkige Rinde des alten Apfelbaumes.
Sollten die Vögel vielleicht das Ausschelten übernommen haben? Das war eine komische Vorstellung, Agathe kicherte ganz für sich allein darüber. Ach bewahre – die Vögel hatten um diese Zeit schon furchtbar viel mit ihrem großen Liebesglück zu tun. Ob es wohl auch Vögel gab, die eine unglückliche Liebe hatten? Na ja – die Nachtigall natürlich! Übrigens – ganz genau konnten das die Dichter auch nicht wissen.
Ach – wäre sie doch lieber ein Vögelchen geworden oder eine Blume!
Auf einem ganz schmalen Pfade ging Agathe endlich zum Mühlteich hinab. Er lag am Ende des Gartens, der sich vom Hause her in sanfter Senkung bis zu ihm streckte. Weil die Pastorsjungen beständig ins Wasser gefallen waren, hatte man den Weg zuwachsen lassen. Agathe musste die Gebüsche auseinanderbiegen, um hindurchzuschlüpfen. Sie wollte Abschied von dem Bänkchen nehmen, das unten, heimlich und traulich versteckt, am Rande des Weihers stand. Im vergangenen Herbst hatte sie viel dort gesessen und gelesen oder geträumt, auch in diesem Frühling schon, in warmen Mittagsstunden.
Am linken Ufer des stillen Sees, der weiter hinaus zu einem sumpfigen Rohrfeld verlief, lag die Mühle mit ihrem überhängenden Strohdach und dem großen Rade. In der Bucht am Pfarrgarten zeigten sich auf dem Wasser kleine Nymphäenblätter. Im Herbst war es hier ganz bedeckt gewesen von den grünen Tellern, und darüber flirrten die Libellen. Die schleimigen Stiele der Pflanzen drängten sich sogar durch die grauen Planken des zerfallenen Bootes, welches dort im Wasser faulte.
Anfangs hegte Agathe romantische Träume über den alten Kahn: dass er draußen in Sturm und Wellen gedient – dass er das Meer gesehen habe und an Felsenklippen gescheitert sei. Die kleinen Pastorsjungen hatten sie aber mit dieser Geschichte ausgelacht. Das Boot wäre immer schon auf dem Mühlteiche gewesen, doch bei den vielen Wasserpflanzen und den Rohrstängeln könne man ja gar nicht fahren; da sei es durchs Stilleliegen allmählich ein so elendes, nutzloses Wrack geworden. Nun konnte Agathe das Boot nicht mehr leiden. Es stimmte sie traurig. Ihre junge Mädchenphantasie wurde bewegt von unbestimmten Wünschen nach Größe und Erhabenheit. Sie dachte gern an die Ferne – die Weite – die grenzenlose Freiheit, während sie an dem kleinen Teich auf dem winzigen Bänkchen saß und sich ganz ruhig verhalten musste, damit sie nicht umschlug und damit die Bank nicht zerbrach, denn sie war auch schon recht morsch.
Plötzlich fiel Agathe die Beichte wieder ein, die sie hatte niederschreiben und ihrem Seelsorger übergeben müssen. Ihre Halbheit und Unaufrichtigkeit … und nun wurde es ihr zur Gewissheit, die Schuld des Unfriedens, der diesen heiligen Tag störte, lag in ihr selber. Schamvoll bekümmert starrte sie in das Wasser, das auf der Oberfläche so klar und mit fröhlichen, kleinen goldenen Sonnenblitzen geschmückt erschien und tief unten angefüllt war mit den faulenden Überresten der Vegetation vergangener Jahre.
II.
Die Freundschaft zwischen Agathe Heidling und Eugenie Wutrow bestand schon sehr lange – seitdem sie eines Morgens mit weißen Schürzchen und neuen Tafeln und Fibelbüchern zum ersten Mal in die Schule gebracht wurden und ihre Plätze nebeneinander angewiesen bekamen. Da hatten sie die Bonbons aus ihren Zuckertüten getauscht, und nun waren sie Freundinnen. Ihre beiden Mamas schickten sie in diese kleine vornehme Privatschule, denn in der staatlichen höheren Töchterschule kamen doch immerhin Kinder von allerlei Leuten zusammen, und sie konnten leicht ein hässliches Wort oder gewöhnliche Manieren mit nach Haus bringen. Entweder holte Agathe die kleine Wutrow zum Schulweg ab, oder Eugenie klingelte um dreiviertel auf acht Uhr bei Heidlings, wozu sie sich auf die Zehen stellen musste, bis Mama Heidling ein Strickchen an den gelben Messingring des Glockenzuges band. Auch in ihren Freistunden steckten die Mädelchen beständig zusammen. Am liebsten war Agathe bei Eugenie, dort blieben sie ungestörter mit ihren Puppen und Bildchen und Seidenflöckchen, mit ihren Geheimnissen und ihrem endlosen Gezwitscher und Gekicher.
Das große alte Kaufmannshaus, welches Eugenies Eltern gehörte, barg eine Unmenge von Ecken und Winkeln, köstlich zum Spielen und um sich zu verstecken. Dunkle Korridore gab es da, in denen auch bei Tage einsame Gasflammen brannten und dünnbeinige Kommis eilig an den kleinen Mädchen vorüberstrichen – hinter vergitterten, staubigen Fenstern das Comptoir, und darin saß Herr Wutrow, ein verschrumpftes, taubes, grobes Männchen, auf einem hohen Drehstuhl – ein Hof mit ungeheuren leeren Kisten und graue, schmutzige Hintergebäude, angefüllt mit einer Schar Arbeiter und Arbeiterinnen, die in kahlen Räumen Zigarren drehten. Die Fabrik – das Comptoir – die Korridore – alles roch nach Tabak. Der süßlich-scharfe Geruch drang sogar bis in die großen Wohnzimmer des Vorderhauses. Hier ließ Frau Wutrow beständig das Parkett bohnern und die Spiegelscheiben der Fenster putzen, deshalb war es immer kalt und zugig. Aber der Tabaksgeruch blieb trotzdem haften.
Auf Agathe übte das Haus, in dem alles ganz anders war als bei ihren Eltern, eine geheimnisvolle Anziehung aus. Sie fürchtete sich vor den Kommis und den Arbeiterinnen und noch mehr vor Herrn Wutrow selbst, sie hatte eine instinktive Abneigung gegen Frau Wutrow, und mit Eugenie zankte sie sich sehr oft, lief dann schluchzend nach Haus und hasste ihre Freundin. Aber Eugenie holte sie immer wieder, und alles blieb wie zuvor. Eugenie konnte niemals ordentlich spielen. Sie hatte ihre Puppen nicht wirklich lieb und glaubte nicht, dass es eine Puppensprache gäbe, in der Holdewina, die große mit dem Porzellankopf, und Kathchen, das Wickelkind, munter zu plaudern begannen, sobald ihre kleinen Mütter außer Hörweite waren.
Agathe verdankte ihrer Freundin verschiedene Strafpredigten, weil Eugenie sie verführte, mit ihr in allerlei Nebengassen der Stadt herumzubummeln, an den Klingeln zu reißen und dann fortzulaufen, alten Damen, die an Parterrefenstern hinter Blumentöpfen saßen, die Zunge herauszustecken und sich mit Schuljungen zu unterhalten.
Am liebsten hielt Eugenie sich in der Fabrik auf. Sie schlich sich an die Männer heran und streichelte die schmutzigen Röcke der Arbeiterinnen und steckte ihnen Kuchen und Äpfel zu, die sie heimlich aus ihrer Mutter Speisekammer holte, damit die Mädchen ihr dafür Geschichten erzählten. Beständig mussten die Aufseher sie fortjagen – im Umsehen war sie wieder da.
Ja – und Eugenie wusste auch, dass Walter eine Braut hätte, mit der er sich küsste, und wenn die Lehrer das hörten, käme er vor die Konferenz. Meta Hille aus der dritten Klasse wäre sein Schatz – na so eine! – Ja – ja – ja – ganz gewiss, wahrhaftig!!
Hatte Eugenie etwas Derartiges herausgespürt, so schüttelte sich ihr kleines, schlankes Körperchen vor Vergnügen, sie kniff ihre grauen Augen zusammen und blinzelte triumphierend über ihr hübsches Näschen hinweg.
Hei – das war fein!
Eines Sonntags nachmittags saßen die kleinen Freundinnen auf dem untersten Ast des niedrigen alten Taxusbaumes in Wutrows Garten. Sie hielten ihre Battiströckchen mit den Fingerspitzen und wehten damit hin und her, denn sie waren von einer bösen Fee in zwei Vögel verwandelt und schüttelten nun ihr weißes und rosenrotes Gefieder. Das Spiel hatte Agathe angegeben. Sie wollte immer so gerne fliegen lernen.
Und dann wussten sie nicht mehr, was sie anfangen sollten, um den Sonntagabend hinzubringen.
Arm in Arm gingen sie an den Beeten mit blühenden Aurikeln oder Stiefmütterchen, an ihren steifen Buchsbaum-Einfassungen entlang. Zwischen den Mauern der Hinterhäuser, die den altmodischen, zierlich gepflegten Stadtgarten einschlossen, wurde es schon grau und dämmerig, während hoch über den Kindern eine rosa Wolke am grünlichen Aprilhimmel langsam verblasste.
»Du«, flüsterte Agathe ganz leise, »es ist doch nicht wahr – das von den kleinen Kindern … Meine Mama …«
»Pfui – geklatscht! Du Petzliese!«
»Nein – ich habe ja bloß gefragt!«
»Ach, deine Mama … Mütter lügen einem immer was vor!«
»Meine Mutter lügt nicht!«, schrie Agathe gekränkt.
Aus dem Streit entspann sich ein heimliches Tuscheln und Flüstern zwischen den kleinen Freundinnen. Agathe rief ein paar Mal: »Pfui, Eugenie – ach nein, das glaube ich nicht …«
Hilfeschreie, die aus dem Abendschatten unter dem alten Taxusbaum, wo die kleinen Mädchen zusammenkauerten, hervorklangen, wie eine geängstete Vogelstimme, wenn die Katze zum Nest schleicht. Und vor Aufregung und Scham und Neugier frierend und glühend, horchte und horchte sie doch und fragte leise, sich dicht an Eugenie pressend und schließlich in ein maßloses Gekicher verfallend.
Das war zu komisch – zu komisch …
Aber Mama hatte doch gelogen, als sie ihr erzählte, ein Engel brächte die kleinen Babys.
Eugenie wusste alles viel besser.
Wie sie beide erschraken und in die Höhe fuhren, als Frau Wutrows scharfe Stimme sie hineinrief. Agathe klopfte das Herz entsetzlich – es war beinahe nicht auszuhalten. Sie getraute sich nicht in das Zimmer mit der hellen Lampe, holte eilig ihren Hut vom Flur und lief davon, ohne Adieu zu sagen.
Was Eugenie ihr sonst noch erzählt hatte – nein, das war ganz abscheulich. Pfui – pfui – ganz greulich. Nein, das konnte gar nicht wahr sein. Aber – wenn es doch wahr wäre?
Und ihre Mama und ihr Papa … Sie schämte sich tot.
Als Mama kam, ihr einen Gutenachtkuss zu geben, drehte sie hastig den Kopf nach der Wand und wühlte das heiße Gesicht in die Kissen. Nein – sie konnte ihre Mama niemals – niemals wieder nach so etwas fragen.
Am andern Morgen trödelte Agathe bis zum letzten Augenblick mit dem Schulgang. Nun war es schon viel zu spät, um Eugenie noch abzuholen. Als sie in der Klasse hörte, dass Eugenie sich erkältet habe und zu Haus bleiben müsse, wurde ihr leichter. Mit wahren Gewissensqualen musste sie sich fortwährend vorstellen: Eugenie könnte vielleicht sterben … Und dann würde kein Mensch auf der Welt erfahren, was sie gestern miteinander gesprochen hatten. Das wäre doch zu grässlich – ach – wenn doch Eugenie lieber stürbe!
»Frau Wutrow schickte schon zweimal, du möchtest herüberkommen«, sagte Frau Heidling zu ihrer Tochter. »Warum gehst du nicht hin? Habt ihr euch gezankt?«
»Ich kann Eugenie nicht mehr leiden.«
»O, wer wird seine Freundschaften so schnell wechseln«, sagte Frau Heidling tadelnd. »Was hat dir denn Eugenie getan?«
»Gar nichts.«
»Nun, dann ist es nicht hübsch von meinem kleinen Mädchen, ihre kranke Freundin zu vernachlässigen. Bringe Eugenie die Vergissmeinnicht, die ich auf dem Markt gekauft habe. Eugenie ist manchmal ein bisschen spöttisch, aber mein Agathchen ist auch sehr empfindlich. Du kannst viel von Eugenie lernen. Sie macht so hübsche Knickse und hat immer eine freundliche Antwort bereit, lässt nie das Mäulchen hängen, wie mein Träumerchen!«
Agathe sah ihre Mutter nicht an, mürrisch packte sie ihre Bücher aus. Es tat ihr schrecklich weh im Halse, als wäre ihr da alles wund. Sie hätte sich am liebsten auf die Erde geworfen und laut geschrien und geweint. Doch nahm sie gehorsam und ohne weiter etwas zu sagen den Strauß und ging. Unterwegs traf sie eine Bürgerschülerin, die sie kannte. Da warf sie die Blumen fort und schlenderte mit dem Mädchen.
Als sie auf ihren ziellosen Streifereien wieder am Hause ihrer Eltern vorüberkamen, sah Mama aus dem Fenster und rief sie zum Essen.
Agathe antwortete nicht und ging ruhig weiter. Sie hörte ihre Mutter hinter sich herrufen und ging immer weiter. Sie wollte überhaupt nicht wieder nach Hause zurück.
Auf einem freien Platz mit Blumenbeeten setzte sie sich auf eine der eisernen Ketten, die, zwischen Steinpfeilern herabhängend, die Anlagen schützen sollten, hielt sich mit beiden Händen fest und baumelte mit den Beinen. Das taten nur die allergemeinsten Kinder! Das Mädchen aus der Bürgerschule setzte sich auch auf eine von den Ketten. So unterhielten sie sich. Von Amerika. Wie weit es wäre, um dorthin zu kommen. Der Lehrer hatte ihnen erklärt, Amerika läge ganz genau auf der andern Seite von der Erde. Man brauchte nur ein Loch zu graben, furchtbar tief – immer tiefer –, dann käme man schließlich in Amerika an.
»Aber dazwischen kommt erst Wasser und dann Feuer«, sagte Agathe nachdenklich. Das hatte der Lehrer nicht gesagt. Aber Agathe glaubte es, ganz bestimmt. Eine entsetzliche Lust plagte sie, das mit dem Lochgraben einmal zu versuchen.
Da kam drüben auf dem Trottoir im hellen Sonnenschein Eugenie mit ihrer Mutter. Sie hatte ihren neuen lila Sammetpaletot an und das Barett mit dem Federbesatz. Wie sie sich zierte! Sie ging ganz sittsam zwischen ihrer Mutter und einem Offizier. Plötzlich bemerkte sie Agathe und stand erstaunt still, sie winkte und rief ihren Namen. Aber Agathe baumelte mit den Beinen und kam nicht. Frau Wutrow sagte etwas zu Eugenie, alle drei Personen sahen, wie es Agathe schien, empört zu ihr hin und spazierten dann weiter.
Agathe lachte verächtlich. Dann ging sie mit der Bürgerschülerin, die schon um zwölf Uhr zu Mittag gegessen hatte, trank mit ihr Kaffee und versuchte mit ihr im Hof das tiefe Loch zu graben, das nach Amerika führen sollte. Ach – wenn es wirklich wahr wäre!! Sie mühten sich ganz entsetzlich, nur erst den Kies und die Erde fortzubringen. Dann trafen sie zu ihrem grenzenlosen Erstaunen auf rote Ziegelsteine. Es wurde Agathe ganz seltsam zumut, so, als müsse jetzt ein Wunder geschehen – weiß Gott, was sie nun sehen würden. Mit aller Gewalt suchten sie die Ziegelsteine loszubrechen, schwitzten und stöhnten dabei. Und als der eine sich eben schon ein wenig bewegte – da kam jemand. Das andere Mädchen schrie laut auf vor Schrecken: »Hu – die schwarze Jule! Die schwarze Jule!«
Heidi jagte sie fort und Agathe hinterdrein. Während die Hauswirtin ins Leere über ihren verwüsteten Hof keifte, steckten beide kleine Mädchen im Holzstall und regten und rührten sich nicht vor Angst.
Aber das Nachhausekommen …! Sie musste doch einmal – es wurde schon dunkel – in der Nacht hätte sie sich auf der Straße totgefürchtet. Es gab auch Mörder da. Sie musste schon. »Ach Gott! Ach lieber Gott, lass doch Mama in Gesellschaft sein!«
Er war ja so gut – vielleicht tat er ihr den Gefallen.
Frau Heidling hatte inzwischen zu Wutrows geschickt, ob Agathe bei ihnen gewesen wäre.
Nein – sie hätte auf dem Kasernenplatze gesessen und mit den Beinen gebaumelt.
Agathe hatte jetzt alles vergessen, was sie am Morgen gequält. Sie empfand nur noch eine große Furcht vor ihrer Mutter, wie vor etwas schrecklich Erhabenem, vor dem sie nur ein kleines Würmchen war. Und dabei mischte sich auch eine unbestimmte Sehnsucht in die große Angst. Vielleicht dachte ihre Mutter, sie hätte bei Wutrows gespielt, und alles war gut.
Als sie zaghaft und ganz leise klingelte, riss Walter die Tür auf, lachte laut und rief: »Da ist sie ja, die Range!«
Ihre Mutter nahm sie bei der Hand und führte sie in die Logierstube. Dort ließ sie sie im Dunkeln stehen.
Mama würde doch nicht? Nein – sie war ja schon ein großes Mädchen, dachte Agathe und fror vor Angst – nein, das konnte Mama doch nicht. Sie ging doch schon in die Schule …
Frau Heidling kam mit einem Licht und mit der Rute wieder.
»Nein! Nein! Ach bitte, bitte nicht!«, schrie Agathe und schlug wie rasend um sich. Es war ein wilder Kampf zwischen Mutter und Tochter, Agathe riss Mama die Spitzen vom Kleide und trat nach ihr. Aber sie bekam doch ihre Schläge – wie ein ganz kleines Kind.
Als die schauerliche Strafe zu Ende war, wankte Frau Heidling erschöpft in ihr Schlafzimmer und sank keuchend und weinend auf ihr Bett nieder. Sie wusste, dass sie sich nicht aufregen sollte und dass sie furchtbare Nervenschmerzen auszustehen haben würde. Bis zuletzt, während der Sorge und Angst um Agathe hatte sie gekämpft, ob sie es tun müsse. Ja, es war ihre Pflicht. Das Kind durfte sich nicht so über alle Autorität hinwegsetzen. Als sie Agathe sah, hatte auch der Zorn sie übermannt.
Das Mädchen lag in der Logierstube auf den Dielen und schrie noch immer, schluckend und schluchzend, sie konnte die Töne nur noch heiser hervorstoßen, und ihr ganzer kleiner Leib zuckte krampfhaft dabei. Sie wollte sich totschreien. Mit einer solchen Schmach auf sich konnte sie doch nicht mehr leben …! Was würde Papa sagen? Ihm würde es wohl leidtun, wenn er sein kleines Mädchen nicht mehr hätte. Aber Mama – der war es ganz recht – ganz recht …
Endlich wurde sie so müde, dass alles um sie her und in ihr verschwamm. Mit wüstem Kopf stand sie auf und kroch taumelnd in ihr Bett.
Agathe hatte ihre Mutter nicht mehr lieb. Heimlich trug sie die Gewissensnot und den Schmerz darüber – eine zu schwere Bürde für ihre Kinderschultern. Ihre Haltung wurde schlaff, in ihrem Gesichtchen zeigte sich ein verdrießlicher, müder Zug. Aber der Arzt, den man befragte, meinte, das käme von dem gebückten Sitzen auf der Schulbank.
Einige Zeit später wurde Agathes Vater als Vertreter des Landrats in eine kleinere Stadt versetzt. Hier gab es keine höhere Töchterschule, und Agathe bekam eine Gouvernante.
Allmählich erholte sie sich und wurde wieder munter. Wahrscheinlich verhielt sich alles gar nicht so, wie Eugenie gesagt hatte, dachte sie nun. Weil es ihr zu unmöglich erschien, vergaß sie ihre verworrene Weisheit zuletzt so ziemlich. Nur hin und wieder durch ein Wort von Erwachsenen, eine Stelle in einem Buch, durch ein Bild geweckt, zuweilen ohne jede Veranlassung wachte die Erinnerung an die Stunden in Wutrows Garten und in den dunklen Korridoren in ihrem Gedächtnis auf und quälte sie wie ein schlechter Geruch, den man nicht loswird, oder wie die Mitwissenschaft eines trüben, verhängnisvollen Geheimnisses.
III.
Frau Heidling hegte das unbestimmte Ideal eines innigen Verhältnisses zwischen einer Mutter und ihrer einzigen Tochter. Doch wusste sie durchaus nicht, wie sie es beginnen sollte, ein solches zwischen sich und Agathe herzustellen. Sie sorgte mit peinlicher Pflichttreue für deren Anzug, für Zahnbürsten, Stiefel und Korsetts. Aber wenn Agathe mit einem Ausbruch ihres brennenden Interesses für alles und jedes in der Welt: für die Rätsel in Neros Charakter und für Bürgers Liebe zu Molly, für die Ringe des Saturn und die Auferstehung der Toten zu ihrer Mutter kam, sah sie immer nur dasselbe halb verlegene, halb beschwichtigende Lächeln auf dem blassen, kränklichen Gesicht. Und gerade dann wurde ihr meist das Wort abgeschnitten mit einer von den unaufhörlichen Ermahnungen: Halt dich gerade, Agathe – wo ist dein Zopfband wieder geblieben! Wirst du denn nie ein ordentliches Mädchen werden? Das reizte sie bis zu Tränen und ungezogenen Antworten.