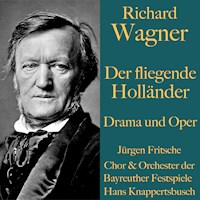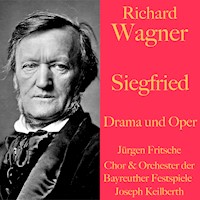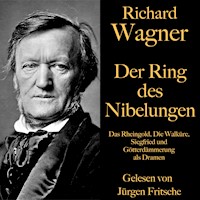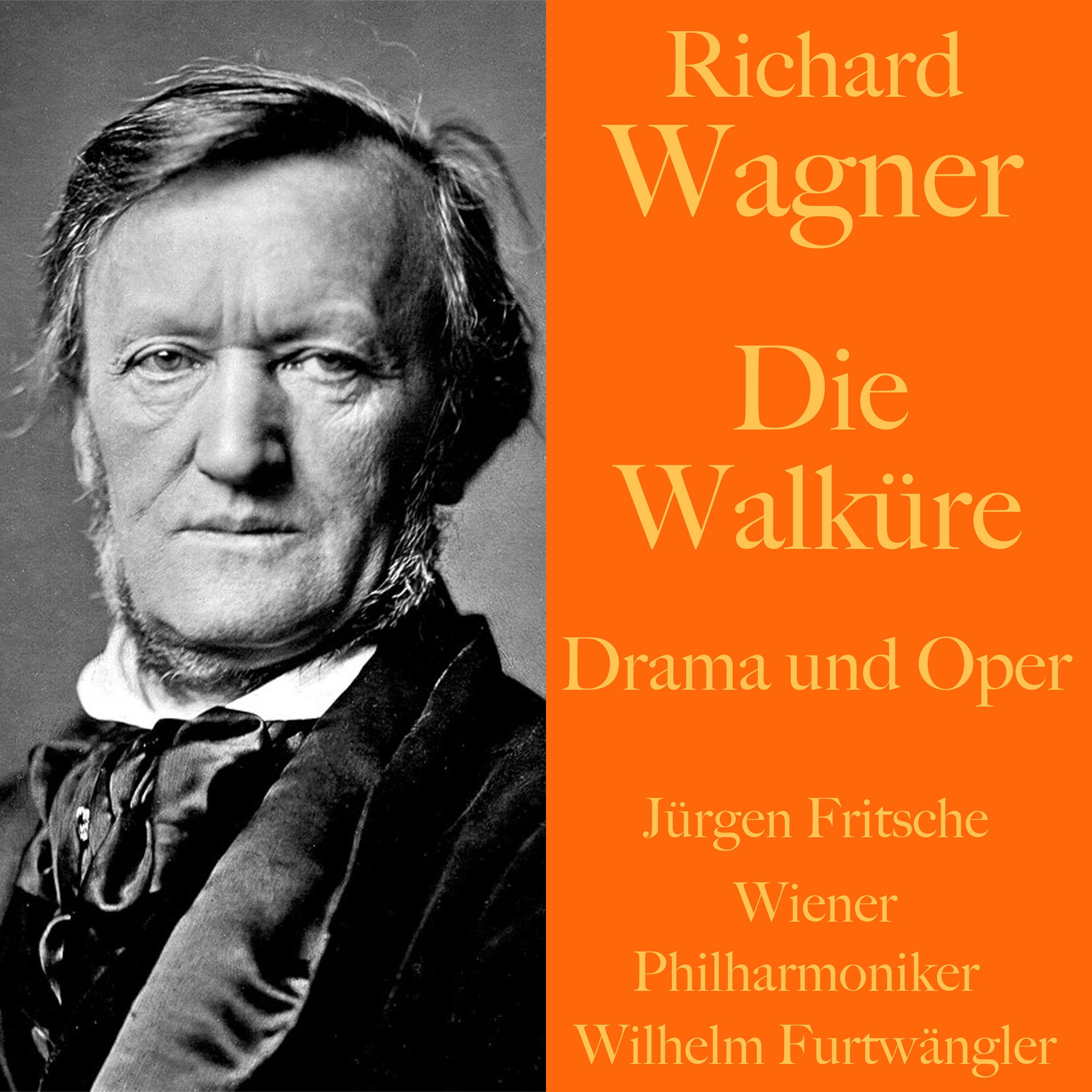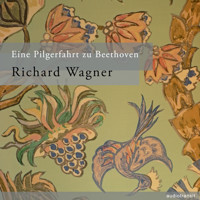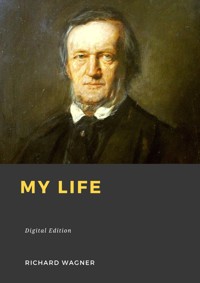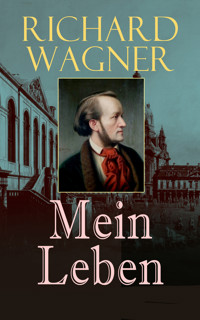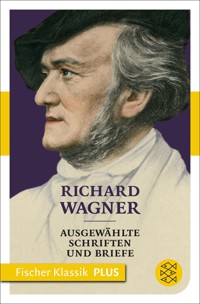
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Vor dem Komponieren stand für Richard Wagner die Arbeit mit und an dem Wort. Seine künstlerische Selbstsuche und Selbstüberzeugung lässt sich nirgends besser besichtigen als in seinen Schriften und Briefen. Denn große und bis heute faszinierende Ideen Wagners – seine Opernreform und die Bayreuther Festspiele – nehmen hier ihren Ausgangspunkt. Diese Auswahl ist eine Einladung, dem weltberühmten Komponisten beim Denken über die Schulter zu schauen. Mit Daten zu Leben und Werk. Mit einem Nachwort des Herausgebers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Richard Wagner
Ausgewählte Schriften und Briefe
Herausgegeben von Philipp Werner
Fischer e-books
Autobiographische Skizze
Ich heiße Wilhelm Richard Wagner, und bin den 22. Mai 1813 in Leipzig geboren. Mein Vater war Polizei-Aktuarius und starb ein halbes Jahr nach meiner Geburt. Mein Stiefvater, Ludwig Geyer, war Schauspieler und Maler; er hat auch einige Lustspiele geschrieben, worunter das Eine: »Der bethlehemitische Kindermord« Glück machte: mit ihm zog meine Familie nach Dresden. Er wollte, ich sollte Maler werden; ich war aber sehr ungeschickt im Zeichnen. Auch mein Stiefvater starb zeitig, – ich war erst sieben Jahr. Kurz vor seinem Tode hatte ich: »Üb’ immer Treu und Redlichkeit« und den damals ganz neuen »Jungfernkranz« auf dem Klavier spielen gelernt: einen Tag vor seinem Tode mußte ich ihm Beides im Nebenzimmer vorspielen; ich hörte ihn da mit schwacher Stimme zu meiner Mutter sagen: »Sollte er vielleicht Talent zur Musik haben?« Am frühen Morgen, als er gestorben war, trat die Mutter in die Kinderstube, sagte jedem der Kinder etwas, und mir sagte sie: »Aus Dir hat er etwas machen wollen«. Ich entsinne mich, daß ich mir lange Zeit eingebildet habe, es würde etwas aus mir werden. – Ich kam mit meinem neunten Jahre auf die Dresdner Kreuzschule: ich wollte studieren, an Musik wurde nicht gedacht; zwei meiner Schwestern lernten gut Klavier spielen, ich hörte ihnen zu, ohne selbst Klavierunterricht zu erhalten. Nichts gefiel mir so wie der »Freischütz«: ich sah Weber oft vor unserm Hause vorbeigehen, wenn er aus den Proben kam; stets betrachtete ich ihn mit heiliger Scheu. Ein Hauslehrer, der mir den Cornelius Nepos explizierte, mußte mir endlich auch Klavierstunden geben; kaum war ich über die ersten Fingerübungen hinaus, so studierte ich mir heimlich, zuerst ohne Noten, die Ouvertüre zum Freischütz ein; mein Lehrer hörte das einmal und sagte: aus mir würde nichts. Er hatte recht, ich habe in meinem Leben nicht Klavierspielen gelernt. Nun spielte ich nur noch für mich, nichts wie Ouvertüren, und mit dem gräulichsten Fingersatze. Es war mir unmöglich, eine Passage rein zu spielen, und ich bekam deshalb einen großen Abscheu vor allen Läufen. Von Mozart liebte ich nur die Ouvertüre zur »Zauberflöte«; »Don Juan« war mir zuwider, weil da italienischer Text darunter stand; er kam mir so läppisch vor. – Diese Beschäftigung mit Musik war aber nur große Nebensache: Griechisch, Lateinisch, Mythologie und alte Geschichte waren die Hauptsache. Ich machte auch Gedichte. Einmal starb einer unsrer Mitschüler, und von den Lehrern wurde an uns die Aufgabe gestellt, auf seinen Tod ein Gedicht zu machen; das beste sollte gedruckt werden: – das meine wurde gedruckt, jedoch erst, nachdem ich vielen Schwulst daraus entfernt hatte. Ich war damals elf Jahre alt. Nun wollte ich Dichter werden; ich entwarf Trauerspiele nach dem Vorbild der Griechen, wozu mich das Bekanntwerden mit Apels Tragödien: Polyidos, die Ätolier u.s.w antrieb; dabei galt ich in der Schule für einen guten Kopf in litteris: schon in Tertia hatte ich die ersten zwölf Bücher der Odyssee übersetzt. Einmal lernte ich auch Englisch, und zwar bloß um Shakespeare ganz genau kennen zu lernen: ich übersetzte Romeos Monolog metrisch. Das Englische ließ ich bald wieder liegen, Shakespeare aber blieb mein Vorbild; ich entwarf ein großes Trauerspiel, welches ungefähr aus Hamlet und Lear zusammengesetzt war; der Plan war äußerst großartig; zweiundvierzig Menschen starben im Verlaufe des Stückes, und ich sah mich bei der Ausführung genötigt, die Meisten als Geister wiederkommen zu lassen, weil mir sonst in den letzten Akten die Personen ausgegangen wären. Dieses Stück beschäftigte mich zwei Jahre lang. Ich verließ darüber Dresden und die Kreuzschule, und kam nach Leipzig. Auf der dortigen Nikolaischule setzte man mich nach Tertia, nachdem ich auf der Dresdner Kreuzschule schon in Sekunda gesessen; dieser Umstand erbitterte mich so sehr, daß ich von da an alle Liebe zu den philologischen Studien fahren ließ. Ich ward faul und lüderlich, bloß mein großes Trauerspiel lag mir noch am Herzen. Während ich dieses vollendete, lernte ich in den Leipziger Gewandhauskonzerten zuerst Beethoven’sche Musik kennen; ihr Eindruck auf mich war allgewaltig. Auch mit Mozart befreundete ich mich, zumal durch sein Requiem. Beethovens Musik zu »Egmont« begeisterte mich so, daß ich um Alles in der Welt mein fertig gewordenes Trauerspiel nicht anders vom Stapel laufen lassen wollte, als mit einer ähnlichen Musik versehen. Ich traute mir ohne alles Bedenken zu, diese so nötige Musik selbst schreiben zu können, hielt es aber doch für gut, mich zuvor über einige Hauptregeln des Generalbasses aufzuklären. Um dies im Fluge zu tun, lieh ich mir auf acht Tage Logiers Methode des Generalbasses und studierte mit Eifer darin. Das Studium trug aber nicht so schnelle Früchte, als ich glaubte; die Schwierigkeiten desselben reizten und fesselten mich; ich beschloß Musiker zu werden. – Während dem war mein großes Trauerspiel von meiner Familie entdeckt worden: sie geriet in große Betrübnis, weil am Tage lag, daß ich darüber meine Schulstudien auf das Gründlichste vernachlässigt hatte, und ich ward somit zu fleißiger Fortsetzung derselben streng angehalten. Das heimliche Erkenntnis meines Berufes zur Musik verschwieg ich unter solchen Umständen, komponierte nichtsdestoweniger aber in aller Stille eine Sonate, ein Quartett und eine Arie. Als ich mich in meinem musikalischen Privatstudium hinlänglich herangereift fühlte, trat ich endlich mit der Entdeckung desselben hervor. Natürlich hatte ich nun harte Kämpfe zu bestehen, da die Meinigen auch meine Neigung zur Musik nur für eine flüchtige Leidenschaft halten mußten, um so mehr, da sie durch keine Vorstudien, besonders durch etwa bereits erlangte Fertigkeit auf einem Instrument, gerechtfertigt war. Ich war damals in meinem sechzehnten Jahre, und zumal durch die Lektüre Hoffmanns zum tollsten Mystizismus aufgeregt: am Tage, im Halbschlafe hatte ich Visionen, in denen mir Grundton, Terz und Quinte leibhaft erschienen und mir ihre wichtige Bedeutung offenbarten: was ich aufschrieb, starrte von Unsinn. Endlich wurde mir der Unterricht eines tüchtigen Musikers zugeteilt; der arme Mann hatte große Not mit mir; er mußte mir erklären, daß, was ich für seltsame Gestalten und Gewalten hielt, Intervalle und Akkorde seien. Was konnte für die Meinigen betrübender sein, als zu erfahren, daß ich auch in diesem Studium mich nachlässig und unordentlich erwies? Mein Lehrer schüttelte den Kopf, und es kam so heraus, als ob auch hier nichts Gescheites aus mir werden würde. Meine Lust zum Studium erlahmte immer mehr, und ich zog vor, Ouvertüren für großes Orchester zu schreiben, von denen eine einmal im Leipziger Theater aufgeführt wurde. Diese Ouvertüre war der Kulminationspunkt meiner Unsinnigkeiten; ich hatte sie eigentlich, zum näheren Verständnis Desjenigen, der die Partitur etwa studieren wollte, mit drei verschiedenen Tinten schreiben wollen, die Streichinstrumente rot, die Holzblasinstrumente grün und die Blechinstrumente schwarz. Beethovens neunte Symphonie sollte eine Pleyel’sche Sonate gegen diese wunderbar kombinierte Ouvertüre sein. Bei der Aufführung schadete mir besonders ein durch die ganze Ouvertüre regelmäßig alle vier Takte wiederkehrender Paukenschlag im Fortissimo: das Publikum ging aus anfänglicher Verwunderung über die Hartnäckigkeit des Paukenschlägers in unverholenen Unwillen, dann aber in eine mich tief betrübende Heiterkeit über. Diese erste Aufführung eines von mir komponierten Stückes hinterließ auf mich einen großen Eindruck.
Nun kam aber die Julirevolution; mit einem Schlage wurde ich Revolutionär und gelangte zu der Überzeugung, jeder halbwegs strebsame Mensch dürfe sich ausschließlich nur mit Politik beschäftigen. Mir war nur noch im Umgang mit politischen Literaten wohl: ich begann auch eine Ouvertüre, die ein politisches Thema behandelte. So verließ ich die Schule und bezog die Universität, zwar nicht mehr um mich einem Fakultätsstudium zu widmen – denn zur Musik war ich nun dennoch bestimmt –, sondern um Philosophie und Ästhetik zu hören. Von dieser Gelegenheit, mich zu bilden, profitierte ich so gut als gar nicht; wohl aber überließ ich mich allen Studentenausschweifungen, und zwar mit so großem Leichtsinn und solcher Hingebung, daß sie mich bald anwiderten. Die Meinigen hatten um diese Zeit große Not mit mir: meine Musik hatte ich fast gänzlich liegen lassen. Bald kam ich aber zur Besinnung; ich fühlte die Notwendigkeit eines neu zu beginnenden, streng geregelten Studiums der Musik, und die Vorsehung ließ mich den rechten Mann finden, der mir neue Liebe zur Sache einflößen und sie durch den gründlichsten Unterricht läutern sollte. Dieser Mann war Theodor Weinlig, Kantor an der Thomasschule zu Leipzig. Nachdem ich mich wohl schon zuvor in der Fuge versucht hatte, begann ich jedoch erst bei ihm das gründliche Studium des Kontrapunktes, welches er die glückliche Eigenschaft besaß, den Schüler spielend erlernen zu lassen. In dieser Zeit lernte ich erst Mozart innig erkennen und lieben. Ich komponierte eine Sonate, in welcher ich mich von allem Schwulste losmachte und einem natürlichen, ungezwungenen Satze überließ. Diese höchst einfache und bescheidene Arbeit erschien im Druck bei Breitkopf und Härtel. Mein Studium bei Weinlig war in weniger als einem halben Jahre beendet, er selbst entließ mich aus der Lehre, nachdem er mich so weit gebracht, daß ich die schwierigsten Aufgaben des Kontrapunktes mit Leichtigkeit zu lösen im Stande war. »Das, was Sie sich durch dieses trockene Studium angeeignet haben, heißt: Selbstständigkeit«, sagte er mir. In demselben halben Jahre komponierte ich auch eine Ouvertüre nach dem jetzt etwas besser von mir verstandenen Vorbilde Beethovens, welche in einem der Leipziger Gewandhauskonzerte mit aufmunterndem Beifall gespielt wurde. Nach mehreren andern Arbeiten machte ich mich denn nun auch an eine Symphonie: an mein Hauptvorbild, Beethoven, schloß sich Mozart, zumal seine große C dur Symphonie. Klarheit und Kraft, bei manchen sonderbaren Abirrungen, war mein Bestreben. Mit der fertigen Symphonie machte ich mich im Sommer 1832 auf zu einer Reise nach Wien, aus keinem andern Zwecke, als um diese sonst so gepriesene Musikstadt flüchtig kennen zu lernen. Was ich dort hörte und sah, hat mich wenig erbaut; wohin ich kam, hörte ich »Zampa« und Strauß’sche Potpourris über »Zampa«. Beides – und besonders damals – für mich ein Gräuel. Auf meiner Rückreise verweilte ich einige Zeit in Prag, wo ich die Bekanntschaft Dionys Webers und Tomascheks machte; Ersterer ließ im Konservatorium mehrere meiner Kompositionen, unter diesen meine Symphonie, spielen. Auch dichtete ich dort einen Operntext tragischen Inhaltes: »Die Hochzeit«. Ich weiß nicht mehr, woher mir der mittelalterliche Stoff gekommen war; ein wahnsinnig Liebender ersteigt das Fenster zum Schlafgemach der Braut seines Freundes, worin diese der Ankunft des Bräutigams harrt; die Braut ringt mit dem Rasenden und stürzt ihn in den Hof hinab, wo er zerschmettert seinen Geist aufgibt. Bei der Totenfeier sinkt die Braut mit einem Schrei entseelt über die Leiche hin. Nach Leipzig zurückgekommen, komponierte ich sogleich die erste Nummer dieser Oper, welche ein großes Sextett enthielt, worüber Weinlig sehr erfreut war. Meiner Schwester gefiel das Buch nicht; ich vernichtete es spurlos. – Im Januar 1833 wurde meine Symphonie im Gewandhauskonzerte aufgeführt, und erhielt viel aufmunternden Beifall. Damals wurde ich mit Laube bekannt.
Um einen Bruder zu besuchen, reiste ich nach Würzburg und blieb das ganze Jahr 1833 dort; mein Bruder war mir als erfahrener Sänger von Wichtigkeit. Ich komponierte in diesem Jahre eine dreiaktige romantische Oper: »Die Feen«, zu der ich mir den Text nach Gozzis: »Die Frau als Schlange« selbst gemacht hatte. Beethoven und Weber waren meine Vorbilder: in den Ensembles war Vieles gelungen, besonders versprach das Finale des zweiten Aktes große Wirkung. In Konzerten gefiel, was ich aus dieser Oper in Würzburg zu hören gab. Mit meinen besten Hoffnungen auf meine fertige Arbeit, ging ich im Anfang des Jahres 1834 nach Leipzig zurück und bot sie dem Direktor des dortigen Theaters zur Aufführung an. Trotz seiner anfänglich erklärten Bereitwilligkeit, meinem Wunsche zu willfahren, mußte ich jedoch sehr bald dieselbe Erfahrung machen, die heut’ zu Tage jeder deutsche Opernkomponist zu gewinnen hat: wir sind durch die Erfolge der Franzosen und Italiener auf unserer heimatlichen Bühne außer Kredit gesetzt, und die Aufführung unserer Opern ist eine zu erbettelnde Gunst. Die Aufführung meiner »Feen« ward auf die lange Bank geschoben. Während dem hörte ich die Devrient in Bellinis Romeo und Julie singen: – ich war erstaunt, in einer so durchaus unbedeutenden Musik eine so außerordentliche Leistung ausgeführt zu sehen. Ich geriet in Zweifel über die Wahl der Mittel, die zu großen Erfolgen führen können: weit entfernt war ich, Bellini ein großes Verdienst zuzuerkennen; nichtsdestoweniger schien mir aber der Stoff, aus dem seine Musik gemacht war, glücklicher und geeigneter, warmes Leben zu verbreiten, als die ängstlich besorgte Gewissenhaftigkeit, mit der wir Deutsche meist nur eine erquälte Schein-Wahrheit zu Stande brachten. Die schlaffe Charakterlosigkeit unserer heutigen Italiener, sowie der frivole Leichtsinn der neuesten Franzosen schienen mir den ernsten, gewissenhaften Deutschen aufzufordern, sich der glücklicher gewählten und ausgebildeten Mittel seiner Nebenbuhler zu bemächtigen, um es ihnen dann in Hervorbringung wahrer Kunstwerke entschieden zuvor zu tun.
Damals war ich einundzwanzig Jahre alt, zu Lebensgenuß und freudiger Weltanschauung aufgelegt; »Ardinghello« und »das junge Europa« spukten mir durch alle Glieder: Deutschland schien mir nur ein sehr kleiner Teil der Welt. Aus dem abstrakten Mystizismus war ich herausgekommen, und ich lernte die Materie lieben. Schönheit des Stoffes, Witz und Geist waren mir herrliche Dinge: was meine Musik betraf, fand ich beides bei den Italienern und Franzosen. Ich gab mein Vorbild, Beethoven, auf; seine letzte Symphonie erschien mir als der Schlußstein einer großen Kunstepoche, über welchen hinaus Keiner zu dringen vermöge und innerhalb dessen Keiner zur Selbstständigkeit gelangen könne. Das schien mir auch Mendelssohn gefühlt zu haben, als er mit seinen kleinen Orchester-Kompositionen hervortrat, die große abgeschlossene Form der Beethoven’schen Symphonie unberührt lassend; es schien mir, er wolle, mit einer kleineren, gänzlich freigegebenen Form beginnend, sich eine größere selbst erschaffen. – Alles um mich herum kam mir wie in Gärung begriffen vor: der Gärung sich zu überlassen, dünkte mich das Natürlichste. Auf einer schönen Sommerreise in die böhmischen Bäder entwarf ich den Plan zu einer neuen Oper: »Das Liebesverbot«, wozu ich den Stoff aus Shakespeares: »Maß für Maß« entnahm, nur mit dem Unterschied, daß ich ihm den darin vorherrschenden Ernst benahm und ihn so recht im Sinne des jungen Europa modelte: die freie, offene Sinnlichkeit erhielt den Sieg rein durch sich selbst über puritanische Heuchelei. – Noch im Sommer desselben Jahres, 1834, nahm ich die Musikdirektorstelle am Magdeburger Theater an. Die praktische Anwendung meiner musikalischen Kenntnisse für die Funktion eines Dirigenten glückte mir sehr bald: der wunderliche Verkehr mit Sängern und Sängerinnen hinter den Kulissen und vor den Lampen entsprach ganz und gar meiner Neigung zu bunter Zerstreuung. Die Komposition meines »Liebesverbotes« wurde begonnen. In einem Konzert führte ich die Ouvertüre zu meinen »Feen« auf; sie gefiel sehr. Trotzdem verlor ich das Behagen an dieser Oper, und da ich zumal meine Angelegenheiten in Leipzig nicht mehr persönlich betreiben konnte, faßte ich bald den Entschluß, mich um diese Arbeit gar nicht mehr zu bekümmern, das hieß so viel, als sie aufgeben. Zu einem Festspiel für den Neujahrstag 1835 machte ich im Fluge eine Musik, welche allgemein ansprach. Dergleichen leichtgewonnene Erfolge bestärkten mich sehr in der Ansicht, daß, um zu gefallen, man die Mittel durchaus nicht zu skrupulös erwägen müsse. In diesem Sinne komponierte ich an meinem »Liebesverbot« fort; französische und italienische Anklänge zu vermeiden gab ich mir nicht die geringste Mühe. Auf einige Zeit darin unterbrochen, nahm ich die Komposition im Winter 1835 zu 1836 wieder auf und beendete sie kurz vor dem Auseinandergehen der Opernmitglieder des Magdeburger Theaters. Mir blieben nur noch zwölf Tage bis zum Abgange der ersten Sänger übrig; in dieser Zeit mußte also meine Oper studiert werden, wollte ich sie noch von ihnen aufführen lassen. Mit mehr Leichtsinn als Überlegung ließ ich nach zehntägigem Studium die Oper, welche sehr starke Partien hatte, in Scene gehen; ich vertraute dem Souffleur und meinem Dirigentenstabe. Trotzdem konnte ich aber doch nicht verhindern, daß die Sänger ihre Partien kaum halb auswendig wußten. Die Vorstellung war Allen wie ein Traum, kein Mensch konnte einen Begriff von der Sache bekommen; dennoch wurde, was halbweg gut ging, gehörig applaudiert. Eine zweite Vorstellung kam aus verschiedenen Gründen nicht zu Stande. – Während dem hatte sich denn auch der Ernst des Lebens bei mir gemeldet; meine schnell ergriffene äußere Selbstständigkeit hatte mich zu Torheiten aller Art verleitet, Geldnot und Schulden quälten mich auf allen Seiten. Es kam mir bei, irgend etwas Besonderes zu wagen, um nicht in das gewöhnliche Geleis der Not zu geraten. Ich ging ohne alle Aussichten nach Berlin, und bot dem Direktor des Königstädtischen Theaters mein »Liebesverbot« zur Aufführung an. Anfänglich mit den besten Versprechungen aufgenommen, mußte ich nach langem Hinhalten erfahren, daß keine von ihnen redlich gemeint war. In der schlimmsten Lage verließ ich Berlin, um mich in Königsberg in Preußen um die Musikdirektorstelle am dortigen Theater zu bewerben, die ich späterhin auch erhielt. Dort heiratete ich noch im Herbst 1836, und zwar unter den mißlichsten äußeren Verhältnissen. Das Jahr, welches ich in Königsberg zubrachte, ging durch die kleinlichsten Sorgen gänzlich für meine Kunst verloren. Eine einzige Ouvertüre schrieb ich: Rule Britannia.
Im Sommer 1837 besuchte ich Dresden auf eine kurze Zeit. Dort brachte mich die Lektüre des Bulwer’schen Romans »Rienzi« wieder auf eine bereits gehegte Lieblingsidee zurück, den letzten römischen Tribunen zum Helden einer großen tragischen Oper zu machen. Durch widerliche äußere Verhältnisse daran verhindert, beschäftigte ich mich aber nicht weiter mit Entwürfen. Im Herbste dieses Jahres ging ich nach Riga, um die Stelle des ersten Musikdirektors bei dem unter Holtei neu eröffneten Theater anzutreten. Ich fand da vortreffliche Mittel für die Oper versammelt, und mit vieler Liebe ging ich an die Verwendung derselben. Mehrere Einlagen in Opern sind für einzelne Sänger in dieser Zeit von mir komponiert worden. Auch machte ich den Text zu einer zweiaktigen komischen Oper: »Die glückliche Bärenfamilie«, wozu ich den Stoff aus einer Erzählung der tausend und einen Nacht entnahm. Schon hatte ich zwei Nummern daraus komponiert, als ich mit Ekel inne ward, daß ich wieder auf dem Wege sei, Musik à la Adam zu machen; mein Gemüt, mein tieferes Gefühl fanden sich trostlos verletzt bei dieser Entdeckung. Mit Abscheu ließ ich die Arbeit liegen. Das tägliche Einstudieren und Dirigieren Auber’scher, Adam’scher und Bellini’scher Musik tat denn endlich auch das Seinige, das leichtsinnige Gefallen daran mir bald gründlich zu verleiden. Die gänzliche Unmündigkeit des Theaterpublikums unserer Provinzstädte in Bezug auf ein zu fällendes erstes Urteil über eine neue, ihm vorkommende Kunsterscheinung, – da es eben nur gewöhnt ist, bereits auswärts beurteilte und akreditierte Werke sich vorgeführt zu sehen, – brachte mich zu dem Entschluß, um keinen Preis an kleineren Theatern eine größere Arbeit zur ersten Aufführung zu bringen. Als ich daher von Neuem das Bedürfnis fühlte, eine größere Arbeit zu unternehmen, verzichtete ich gänzlich auf eine schnell und in der Nähe zu bewirkende Aufführung derselben: ich nahm irgend ein bedeutendes Theater an, das sie einst aufführen sollte, und kümmerte mich nun wenig darum, wo und wann sich das Theater finden werde. So verfaßte ich den Entwurf zu einer großen tragischen Oper in fünf Akten: »Rienzi, der letzte der Tribunen«; ich legte ihn von vorn herein so bedeutend an, daß es unmöglich ward, diese Oper – wenigstens zum ersten Male – auf einem kleinen Theater zur Aufführung zu bringen. Außerdem ließ es auch der gewaltige Stoff gar nicht anders zu, und es herrschte bei meinem Verfahren weniger die Absicht, als die Notwendigkeit vor. Im Sommer 1838 führte ich das Sujet aus. In dieser Zeit studierte ich mit großer Liebe und Begeisterung unserm Opern-Personale Mehüls »Jakob und seine Söhne« ein. – Als ich im Herbst die Komposition meines »Rienzi« begann, band ich mich nun an nichts, als an die einzige Absicht, meinem Sujet zu entsprechen: ich stellte mir kein Vorbild, sondern überließ mich einzig dem Gefühle, das mich verzehrte, dem Gefühle, daß ich nun so weit sei, von der Entwickelung meiner künstlerischen Kräfte etwas Bedeutendes zu verlangen und etwas nicht Unbedeutendes zu erwarten. Der Gedanke, mit Bewußtsein – wenn auch nur in einem einzigen Takte – seicht oder trivial zu sein, war mir entsetzlich. Mit voller Begeisterung setzte ich im Winter die Komposition fort, so daß ich im Frühjahr 1839 die beiden großen ersten Akte fertig hatte. Um diese Zeit ging mein Kontrakt mit dem Theater-Direktor zu Ende, und besondere Umstände verleideten es mir, länger in Riga zu bleiben. Bereits seit zwei Jahren nährte ich den Plan, nach Paris zu gehen […].
(1842)
An Giacomo Meyerbeer, Paris
[Königsberg, 4. Februar 1837]
Verehrter Herr,
Möge es Sie nicht zu sehr befremden, wenn Sie aus einer so fernen Gegend u. von einem Ihnen gewiß so unbekannten Menschen, als ich, mit einem Briefe belästigt werden; indes ist dies nun einmal etwas, was mit der Berühmtheit, wie der Ihrigen, zusammenhängt, daß sie selbst in den ungekanntesten Gegenden Jedem nah ist, ein Jeder auf sie wie auf etwas ganz genau Bekanntes hinblickt, u. sich ihr selbst als etwas ganz unbekanntes naht. Ich muß dennoch vor Allem eilen, Sie mit mir u. meinem Interesse bekannt zu machen, u. will dies mit einem einfachen Signalement beginnen. Ich bin noch nicht 24 Jahre alt, in Leipzig geboren, u. habe mich, als ich bereits daselbst die Universität besuchte, vor ungefähr 6 Jahren für die Musik bestimmt; mich trieb eine leidenschaftliche Verehrung Beethovens dazu, wodurch auch meine erste Produktionskraft eine unendlich einseitige Richtung bekam; – seitdem, u. besonders seit ich in das eigentliche Leben u. die Praxis trat, haben sich meine Ansichten über den gegenwärtigen Standpunkt der Musik u. zumal der dramatischen, bedeutend geändert, u. soll ich es leugnen, daß gerade Ihre Werke es waren, die mir diese neue Richtung anzeigten? Es wäre hier jedenfalls sehr am unpassenden Orte, mich in ungeschickten Lobeserhebungen Ihres Genius aus zu lassen, nur so viel, daß ich in Ihnen die Aufgabe des Deutschen vollkommen gelöst seh, der sich die Vorzüge der italienischen u. französischen Schule zum Meister machte, um die Schöpfungen seines Genies universell zu machen. Dies hat mich denn ungefähr auf meine jetzige Bahn gebracht. Das unerhörte Daniederliegen unsrer jetztigen deutschen Binnen-Komponisten hat mich zunächst auf das aufmerksam gemacht, was jetzt zu ergreifen ist; daß unsre Deutschen nach Paris wandern müssen, um [von] da aus erst auf Deutschland wieder zu kommen, ist allerdings eine schlimme Erscheinung, aber sie ist begründet. Mir kam denn auch ein abenteuerlicher Gedanke, vielleicht sind Sie schon davon unterrichtet: – ich fand in einem neueren deutschen Romane ein vortreffliches Sujet für eine große Oper auf; es fiel mir jedoch gleich in die Augen, daß eine Verarbeitung desselben für die französische Oper von weit größerer Wirkung sein würde, als für die deutsche. Ich setzte demnach selbst einen Entwurf auf, der jetzt nur noch der Versifikation bedarf, um komponiert werden zu können, u. übersandte ihn schon im August vorigen Jahres an Hr. Scribe nach Paris. Ich ersuchte ihn, diesen Entwurf einer Durchsicht zu würdigen, u. falls er ihm gefiele u. er glaube, daß er daraus ein effektvolles Opernbuch machen könnte, sich ihn anzueignen, mir dann die Komposition desselben zu überlassen, u. seine Autorität dazu zu verwenden, daß eine Aufführung einer solchen Oper in Paris zu Stande käme. Bis jetzt erhielt ich noch keine Antwort, u. ich sah wohl ein, daß ich insofern unüberlegt gehandelt hatte, als ich nicht zugleich Hrn. Scribe von meiner Fähigkeit, eine gute u. effektvolle Komposition liefern zu können, zu überzeugt gesucht hatte. Ich habe demnach in diesen Tagen ihm die Partitur einer von mir komponierten großen komischen Oper Das Liebesverbot zugesandt, mit der Bitte, sie Ihnen zur Prüfung vorzulegen. Falle Ihr Urteil zu meinen Gunsten aus, so legte ich ihm meine frühere Bitte von neuem ans Herz. So wäre also eine schickliche Gelegenheit gefunden, Ihnen, verehrter Herr, mich nähern zu können. Wie unendlich viel für meine ganze Laufbahn, für mein ganzes Leben, demnach von Ihrem Urteil, falls Sie es der Mühe wert halten, eines über mein schwaches Werk zu fällen, abhängt, können Sie leicht ermessen, wenn ich Ihnen eröffne, daß mein glühendster Wunsch u. all meine Anstrengung dahin geht, nach Paris kommen zu können, denn ich spüre etwas in mir, was dort gute Früchte bringen müßte. Die Oper, die Ihnen vorgelegt werden soll, habe ich selbst nach einem shakespearischen Stücke, M[aß] f[ür] M[aß], bearbeitet; die etwas freien u. fast frivolen Anklänge, sowie das ganze Kolorit in derselben, überzeugte mich schon, während ich daran arbeitete, daß sie nicht so ganz für unsren deutschen Boden geschaffen sei; ich dachte schon dabei lebhaft an Frankreich, u. ließ sie deshalb noch nicht in Deutschland aufführen. Wäre es denn wohl möglich, dieses Sujet von einem geschickten Manne französisch bearbeiten zu lassen, u. sie so der OPÉRA COMIQUE zur Aufführung anzubieten? Wenn Ihnen diese Oper gefallen sollte, wäre es vielleicht grade Ihnen eher als irgend jemand anderen möglich, so etwas zu bewerkstelligen. Der Ruf bezeichnet Sie als einen so edlen, großmütigen Mann, daß ich fast die Unbescheidenheit soweit treiben möchte, Sie wirklich zu bitten, mir ein solches Interesse zu widmen; u. was bleibt einem Manne wie Ihnen auch noch Schöneres übrig? Künstlerruhm kann Ihnen fast nicht mehr zu Teil werden, denn Sie erreichten schon das Unerhörteste; überall, wo Menschen singen können, hört man Ihre Melodien; Sie sind ein kleiner Gott dieser Erde geworden; – wie herrlich ist es nun für den, der diesen Standpunkt erreicht hat, zurückzublicken, u. denen, die er soweit hinter sich ließ, die Hand zu reichen, um auch sie wenigstens in Ihre Nähe zu ziehen. Dies fühlen Sie gewiß schon Alles schöner u. klarer in sich, als es Ihnen ein so unbedeutender Mensch, als ich, sagen kann, u. ich bin überzeugt, es handelt sich hier nur darum, Ihre Gunst verdienen zu müssen. Nun wohlan, – würdigen Sie mein Werk einer Durchsicht, – ersehen Sie daraus, daß ich mich in mir selbst getäuscht habe, so werden Sie mir dies klarer als Jeder Andre machen können; halten Sie es aber für wert, unter Ihren Schutz genommen werden zu dürfen, dann versagen Sie mir ihn auch nicht. Mit einem solchen Glücke, wie Sie mir es bereiten können, hängt nicht nur Ehre u. äußerer Wohlstand zusammen, sondern es erregt, weckt u. bildet oft erst Kräfte in uns aus, die wir in unsrer schlimmen Lage im lieben Vaterlande oft versauern u. untergehen lassen müssen. Die bloße Notwendigkeit der Selbsterhaltung trieb mich hieher in das unwirtliche u. unbedeutende Ostpreußen; u. hält mich hier fest; was kann in einer solchen Lage aus einem werden? Es liegt vielleicht nur an einer Erklärung Ihrer Teilnahme, die Sie an meinem Talent, meinen Fähigkeiten nehmen, u. Sie stoßen wohl etwas aus mir, was sonst spurlos vergehen würde; werden Sie mir dies verweigern, wenn Sie mich ihrer wert halten?
Wie sehr werde ich aber wohl um Verzeihung zu bitten haben, daß ich mir eine solche Freiheit nahm, Sie durch meine etwas zudringliche Annäherung vielleicht um ein paar kostbare Minuten gebracht zu haben; können Sie sich aber in den Seelenzustand eines jungen Mannes versetzen, den es in allen Nerven u. Fasern nach Bewegung zur Entwickelung seiner Kräfte drängt, u. dem noch immer die Hand fehlt, die diesem Drange den Weg zeigt, so würden Sie mir gewiß Entschuldigung gewähren, Sie werden mir vielleicht gar diese Hand reichen. – Sollten Sie von Herrn Scribe meine Partitur noch nicht bereits erhalten haben, so hätten Sie wohl die Güte, ihn deshalb befragen zu lassen. Sind aber dann auch diese Antwort mir bekannt geworden, so darf ich wohl auf die kühne Hoffnung, von Ihnen selbst über mein Schicksal benachrichtigt zu werden, das ich hiermit ganz in Ihre Hand u. an Ihr Herz lege.
Monsieur Meierbeer,
compositeur et chevalier
de légion d’honneur
à Paris.
Autobiographische Skizze
[…] Natürlich hatte Scribe dies so gut wie unbeachtet gelassen. Nichtsdestoweniger gab ich meine Pläne nicht auf, ich ging vielmehr im Sommer 1839 mit Lebhaftigkeit wieder darauf ein, und vermochte kurz und gut meine Frau, sich mit mir an Bord eines Segelschiffes zu begeben, welches uns bis London bringen sollte. Diese Seefahrt wird mir ewig unvergeßlich bleiben; sie dauerte drei und eine halbe Woche und war reich an Unfällen. Dreimal litten wir von heftigstem Sturme, und einmal sah sich der Kapitän genötigt, in einem norwegischen Hafen einzulaufen. Die Durchfahrt durch die norwegischen Schären machte einen wunderbaren Eindruck auf meine Phantasie; die Sage vom fliegenden Holländer, wie ich sie aus dem Munde der Matrosen bestätigt erhielt, gewann in mir eine bestimmte, eigentümliche Farbe, die ihr nur die von mir erlebten Seeabenteuer verleihen konnten. Von der äußerst angreifenden Fahrt ausruhend, verweilten wir acht Tage in London; nichts interessierte mich so, als die Stadt selbst und die Parlamentshäuser, – von den Theatern besuchte ich keines. In Boulogne sur mer blieb ich vier Wochen: dort machte ich die erste Bekanntschaft Meyerbeers, ich ließ ihn die beiden fertigen Akte meines »Rienzi« kennen lernen; er sagte mir auf das Freundlichste seine Unterstützung in Paris zu. Mit sehr wenig Geld, aber den besten Hoffnungen betrat ich nun Paris. Gänzlich ohne alle Empfehlungen war ich einzig nur auf Meyerbeer angewiesen; mit der ausgezeichnetsten Sorgsamkeit schien dieser für mich einzuleiten, was irgend meinen Zwecken dienlich sein konnte, und gewiß dünkte es mich, bald zu einem erwünschten Ziele zu kommen, hätte ich es nicht so unglücklich getroffen, daß gerade während der ganzen Zeit meines Pariser Aufenthaltes Meyerbeer meistens und fast immer von Paris entfernt war. Auch aus der Entfernung wollte er mir zwar nützlich sein, nach seinen eigenen Voraussagungen konnten briefliche Bemühungen aber da von keinem Erfolge sein, wo höchstens das unausgesetzteste persönliche Eingreifen von Wirkung werden kann. Zunächst trat ich in Verbindungen mit dem Theater de la Renaissance, welches damals Schauspiele und Opern zugleich aufführte. Am geeignetsten für dieses Theater schien mir die Partitur meines »Liebesverbotes«; auch das etwas frivole Sujet wäre gut für die französische Bühne zu verarbeiten gewesen. Ich war dem Direktor des Theaters von Meyerbeer so dringend anempfohlen, daß er nicht anders konnte, als mir die besten Versprechungen zu machen. Demzufolge erbot sich mir einer der fruchtbarsten Pariser Theaterdichter, Dumersan, die Bearbeitung des Sujets zu übernehmen. Drei Stücke, die zu einer Audition bestimmt wurden, übersetzte Dumersan mit dem größten Glücke, so daß sich meine Musik zu dem neuen französischen Texte noch besser, als auf den ursprünglichen deutschen ausnahm; es war eben Musik, wie sie Franzosen am leichtesten begreifen, und Alles versprach mir den besten Erfolg, als sofort das Theater de la Renaissance Bankerott machte. Alle Mühe, alle Hoffnungen waren so vergebens gewesen. In demselben Winterhalbjahre, 1839 zu 1840, komponierte ich außer einer Ouvertüre zu Goethes »Faust«, I. Teil, mehrere französische Lieder, unter andern auch eine für mich gemachte französische Übersetzung der beiden Grenadiere von H. Heine. An eine möglich zu machende Aufführung meines »Rienzi« in Paris habe ich nie gedacht, weil ich mit Sicherheit voraussah, daß ich wenigstens fünf bis sechs Jahre hätte warten müssen, ehe selbst im glücklichsten Falle solch ein Plan ausführbar geworden wäre; auch würde die Übersetzung des Textes der bereits zur Hälfte fertig komponierten Oper unübersteigliche Hindernisse in den Weg gelegt haben. – So trat ich in den Sommer 1840 gänzlich ohne alle nächste Aussichten. Meine Bekanntschaften mit Habeneck, Halevy, Berlioz u.s.w führten durchaus zu keiner weitern Annäherung an diese: in Paris hat kein Künstler Zeit, sich mit einem andern zu befreunden, jeder ist in Hatz und Eile um seiner selbst willen. Halevy ist, wie alle Pariser Komponisten unserer Zeit, nur so lange von Enthusiasmus für seine Kunst entflammt gewesen, als es galt, einen großen Succeß zu gewinnen: sobald dieser davongetragen und er in die Reihe der privilegierten Komponisten-Lions eingetreten war, hatte er nichts weiter im Sinne, als Opern zu machen und Geld dafür einzunehmen. Das Renommée ist Alles in Paris, das Glück und der Verderb der Künstler. Berlioz zog mich trotz seiner abstoßenden Natur bei Weitem mehr an: er unterscheidet sich himmelweit von seinen Pariser Kollegen, denn er macht seine Musik nicht fürs Geld. Für die reine Kunst kann er aber auch nicht schreiben, ihm entgeht aller Schönheitssinn. Er steht in seiner Richtung völlig isoliert: an seiner Seite hat er nichts wie eine Schar Anbeter, die, flach und ohne das geringste Urteil, in ihm den Schöpfer eines nagelneuen Musik-Systems begrüßen und ihm den Kopf vollends verdreht machen; – alles Übrige weicht ihm aus wie einem Wahnsinnigen. – Den letzten Stoß gaben meinen früheren leichtfertigen Ansichten über die Mittel der Musik – die Italiener. Diese gepriesensten Helden des Gesanges, Rubini an der Spitze, haben mich vollends gegen ihre Musik degoutiert. Das Publikum, vor dem sie singen, trug das Seinige zu dieser Wirkung auf mich bei. Die große Pariser Oper ließ mich gänzlich unbefriedigt durch den Mangel alles Genies in ihren Leistungen: Alles fand ich gewöhnlich und mittelgut. Die mise en scène und die Dekorationen sind mir, offen gesagt, das liebste an der ganzen Académie Royale de musique. Viel eher wäre die Opéra comique mich zu befriedigen im Stande gewesen; sie besitzt die besten Talente, und ihre Vorstellungen geben ein Ganzes, Eigentümliches, welches wir in Deutschland nicht kennen. Das, was jetzt für dieses Theater geschrieben wird, gehört aber zu dem Schlechtesten, was je in Zeiten der Entartung der Kunst produziert worden ist; wohin ist die Grazie Mehüls, Isouards, Boyeldieus und des jungen Auber vor den niederträchtigen Quadrillen-Rhythmen geflohen, die heut’ zu Tage ausschließlich dies Theater durchrasseln? – Das Einzige, was Paris von Beachtungswertem für den Musiker enthält, sind die Orchester-Konzerte im Saale des Conservatoirs. Die Aufführungen der deutschen Instrumental-Kompositionen in diesen Konzerten haben auf mich einen tiefen Eindruck gemacht, und mich von Neuem in die wunderbaren Geheimnisse der echten Kunst eingeweiht. Wer die neunte Symphonie Beethovens vollkommen kennen lernen will, der muß sie vom Orchester des Conservatoirs in Paris aufführen hören. – Diese Konzerte stehen aber völlig allein da, nichts knüpft sich an sie an.
Ich ging fast gar nicht mit Musikern um: Gelehrte, Maler etc. bildeten meinen Umgang: ich habe viel schöne Erfahrungen von Freundschaft in Paris gemacht. – Als ich so gänzlich ohne alle nächsten Aussichten auf Paris war, ergriff ich wieder die Komposition meines »Rienzi«; ich bestimmte ihn nun für Dresden, einmal, weil ich an diesem Theater die besten Mittel vorhanden wußte, die Devrient, Tichatschek etc., zweitens, weil ich auf Bekanntschaften aus meiner frühesten Zeit mich stützend dort am ersten Eingang zu finden hoffen durfte. Mein »Liebesverbot« gab ich nun fast gänzlich auf; ich fühlte, daß ich mich als Komponisten desselben nicht mehr achten konnte. Desto unabhängiger folgte ich meinem wahren künstlerischen Glauben bei der Fortsetzung der Komposition meines Rienzi. Manigfacher Kummer und bittere Not bedrängten um diese Zeit mein Leben. Plötzlich erschien Meyerbeer wieder auf eine kurze Zeit in Paris. Mit der liebenswürdigsten Teilnahme erkundigte er sich nach dem Stande meiner Angelegenheiten, und wollte helfen. Nun setzte er mich auch in Verbindung mit dem Direktor der großen Oper, Leon Pillet: es war dabei auf eine zwei- oder dreiaktige Oper abgesehen, deren Komposition für dieses Theater mir anvertraut werden sollte. Ich hatte für diesen Fall mich bereits mit einem Sujet-Entwurfe vorgesehen. Der »fliegende Holländer«, dessen innige Bekanntschaft ich auf der See gemacht hatte, fesselte fortwährend meine Phantasie; dazu machte ich die Bekanntschaft von H. Heines eigentümlicher Anwendung dieser Sage in einem Teile seines »Salons«. Besonders die von Heine einem holländischen Theaterstücke gleichen Titels entnommene Behandlung der Erlösung dieses Ahasverus des Ozeans gab mir Alles an die Hand, diese Sage zu einem Opernsujet zu benutzen. Ich verständigte mich darüber mit Heine selbst, verfaßte den Entwurf und übergab ihn dem Herrn Leon Pillet mit dem Vorschlage, mir danach ein französisches Textbuch machen zu lassen. So weit war Alles eingeleitet, als Meyerbeer abermals von Paris fortging und die Erfüllung meiner Wünsche dem Schicksal überlassen mußte. Bald war ich erstaunt, von Pillet zu erfahren, der von mir überreichte Entwurf gefalle ihm so sehr, daß er wünschte, ich träte ihm denselben ab. Er sei nämlich genötigt, einem ältern Versprechen gemäß einem andern Komponisten baldigst ein Opernbuch zu übergeben: der von mir verfaßte Entwurf scheine ihm ganz zu solchem Zwecke geeignet, und ich würde wahrscheinlich kein Bedenken tragen, in die erbetene Abtretung einzuwilligen, wenn ich überlegte, daß ich vor dem Verlauf von vier Jahren mir unmöglich Hoffnung machen könnte, den unmittelbaren Auftrag zur Komposition einer Oper zu erhalten, da er erst noch Zusagen an mehrere Kandidaten der großen Oper zu erfüllen habe; bis dahin dürfte es mir natürlich doch auch zu lang werden, mich mit diesem Sujet herumzutragen; ich würde ein neues auffinden, und mich gewiß über das gebrachte Opfer trösten. Ich bekämpfte hartnäckig diese Zumutung, ohne jedoch etwas Anderes, als die vorläufige Vertagung der Frage ausrichten zu können. Ich rechnete auf eine baldige Wiederkunft Meyerbeers und schwieg. – – Während dieser Zeit wurde ich von Schlesinger veranlaßt, in dessen Gazette musicale zu schreiben: ich lieferte mehrere ausführliche Artikel »über deutsche Musik« u.s.w Vor Allem fand lebhaften Beifall eine kleine Novelle, betitelt: »Eine Pilgerfahrt zu Beethoven«. Diese Arbeiten haben mir nicht wenig geholfen, in Paris bekannt und beachtet zu werden. […]
(1842)
Eine Pilgerfahrt zu Beethoven
Not und Sorge, du Schutzgöttin des deutschen Musikers, falls er nicht etwa Kapellmeister eines Hoftheaters geworden ist, – Not und Sorge, deiner sei auch bei dieser Erinnerung aus meinem Leben sogleich die erste rühmendste Erwähnung getan! Laß dich besingen, du standhafte Gefährtin meines Lebens! Du hieltest treu zu mir und hast mich nie verlassen, lächelnde Glückswechsel hast du stets mit starker Hand von mir abgewehrt, hast mich stets gegen Fortunens lästige Sonnenblicke beschützt! Mit schwarzem Schatten hast du mir stets die eitlen Güter dieser Erde verhüllt: habe Dank für deine unermüdliche Anhänglichkeit! Aber kann es sein, so suche dir mit der Zeit einmal einen andern Schützling, denn bloß der Neugierde wegen möchte ich gern einmal erfahren, wie es sich auch ohne dich leben ließe. Zum wenigsten bitte ich dich, ganz besonders unsere politischen Schwärmer zu plagen, die Wahnsinnigen, die Deutschland mit aller Gewalt unter ein Zepter vereinigen wollen: – es würde ja dann nur ein einziges Hoftheater, somit nur eine einzige Kapellmeisterstelle geben! Was sollte dann aus meinen Aussichten, aus meinen einzigen Hoffnungen werden, die schon jetzt nur bleich und matt vor mir schweben, jetzt – wo es doch der deutschen Hoftheater so viele gibt? – Jedoch – ich sehe, ich werde frevelhaft. Verzeih’, o Schutzgöttin, den soeben ausgesprochenen, vermessenen Wunsch! Du kennst aber mein Herz, und weißt, wie ich dir ergeben bin, und ergeben bleiben werde, selbst wenn es in Deutschland tausend Hoftheater geben würde! Amen!
– Vor diesem meinem täglichen Gebete beginne ich nichts, also auch nicht die Aufzeichnung meiner Pilgerfahrt zu Beethoven.
Für den Fall, daß dieses wichtige Aktenstück nach meinem Tode veröffentlicht werden dürfte, halte ich es aber auch noch für nötig, zu sagen, wer ich bin, weil ohne dies vielleicht Vieles darin unverständlich bleiben könnte. Wisset daher, Welt und Testaments-Vollstrecker!
Eine mittelmäßige Stadt des mittleren Deutschlands ist meine Vaterstadt. Ich weiß nicht recht, wozu man mich eigentlich bestimmt hatte, nur entsinne ich mich, daß ich eines Abends zum ersten Male eine Beethoven’sche Symphonie aufführen hörte, daß ich darauf Fieber bekam, krank wurde, und als ich wieder genesen, Musiker geworden war. Aus diesem Umstande mag es wohl kommen, daß, wenn ich mit der Zeit wohl auch andere schöne Musik kennen lernte, ich doch Beethoven vor Allem liebte, verehrte und anbetete. Ich kannte keine Lust mehr, als mich so ganz in die Tiefe dieses Genius zu versenken, bis ich mir endlich einbildete, ein Teil desselben geworden zu sein, und als dieser kleinste Teil fing ich an, mich selbst zu achten, höhere Begriffe und Ansichten zu bekommen, kurz das zu werden, was die Gescheiten gewöhnlich einen Narren nennen. Mein Wahnsinn war aber sehr gutmütiger Art, und schadete Niemandem; das Brot, was ich in diesem Zustande aß, war sehr trocken, und der Trank, den ich trank, sehr wässerig, denn Stundengeben wirft bei uns nicht viel ab, verehrte Welt und Testaments-Vollstrecker!
So lebte ich einige Zeit in meinem Dachstübchen, als mir eines Tages einfiel, daß der Mann, dessen Schöpfungen ich über Alles verehrte, ja noch lebe. Es war mir unbegreiflich, bis dahin noch nicht daran gedacht zu haben. Mir war nicht eingefallen, daß Beethoven vorhanden sein, daß er Brot essen und Luft atmen könne, wie unser Eins; dieser Beethoven lebte ja aber in Wien, und war auch ein armer, deutscher Musiker!
Nun war es um meine Ruhe geschehen! Alle meine Gedanken wurden zu dem einen Wunsch: Beethoven zu sehen! Kein Muselmann verlangte gläubiger, nach dem Grabe seines Propheten zu wallfahrten, als ich nach dem Stübchen, in dem Beethoven wohnte.
Wie aber es anfangen, um mein Vorhaben ausführen zu können? Nach Wien war eine große Reise, und es bedurfte Geld dazu; ich Armer gewann aber kaum, um das Leben zu fristen! Da mußte ich denn außerordentliche Mittel ersinnen, um mir das nötige Reisegeld zu verschaffen. Einige Klavier-Sonaten, die ich nach dem Vorbilde des Meisters komponiert hatte, trug ich hin zum Verleger, der Mann machte mir mit wenigen Worten klar, daß ich ein Narr sei mit meinen Sonaten; er gab mir aber den Rat, daß, wollte ich mit der Zeit durch Kompositionen ein Paar Taler verdienen, ich anfangen sollte, durch Galopps und Potpourris mir ein kleines Renommée zu machen. – Ich schauderte; aber meine Sehnsucht, Beethoven zu sehen, siegte; ich komponierte Galopps und Potpourris, konnte aber in dieser Zeit aus Scham mich nie überwinden, einen Blick auf Beethoven zu werfen, denn ich fürchtete ihn zu entweihen.
Zu meinem Unglück bekam ich aber diese ersten Opfer meiner Unschuld noch gar nicht einmal bezahlt, denn mein Verleger erklärte mir, daß ich mir erst einen kleinen Namen machen müßte. Ich schauderte wiederum und fiel in Verzweiflung. Diese Verzweiflung brachte aber einige vortreffliche Galopps hervor. Wirklich erhielt ich Geld dafür, und endlich glaubte ich genug gesammelt zu haben, um damit mein Vorhaben auszuführen. Darüber waren aber zwei Jahre vergangen, während ich immer befürchtete, Beethoven könne sterben, ehe ich mir durch Galopps und Potpourris einen Namen gemacht habe. Gott sei Dank, er hatte den Glanz meines Namens erlebt! – Heiliger Beethoven, vergib mir dieses Renommée, es ward erworben, um dich sehen zu können!
Ha, welche Wonne! Mein Ziel war erreicht! Wer war seliger als ich! Ich konnte mein Bündel schnüren und zu Beethoven wandern. Ein heiliger Schauer erfaßte mich, als ich zum Tore hinausschritt und mich dem Süden zuwandte! Gern hätte ich mich wohl in eine Diligence gesetzt, nicht weil ich die Strapaze des Fußgehens scheute – (o, welche Mühseligkeiten hätte ich nicht freudig für dieses Ziel ertragen!) – sondern weil ich auf diese Art schneller zu Beethoven gelangt wäre. Um aber Fuhrlohn zahlen zu können, hatte ich noch zu wenig für meinen Ruf als Galoppkomponist getan. Somit ertrug ich alle Beschwerden und pries mich glücklich, so weit zu sein, daß sie mich ans Ziel führen konnten. O, was schwärmte ich, was träumte ich! Kein Liebender konnte seliger sein, der nach langer Trennung zur Geliebten seiner Jugend zurückkehrt. –
So zog ich in das schöne Böhmen ein, das Land der Harfenspieler und Straßensänger. In einem kleinen Städtchen traf ich auf eine Gesellschaft reisender Musikanten; sie bildeten ein kleines Orchester, zusammengesetzt aus einem Baß, zwei Violinen, zwei Hörnern, einer Klarinette und einer Flöte; außerdem gab es eine Harfnerin und zwei Sängerinnen mit schönen Stimmen. Sie spielten Tänze und sangen Lieder; man gab ihnen Geld und sie wanderten weiter. Auf einem schönen schattigen Plätzchen neben der Landstraße traf ich sie wieder an; sie hatten sich da gelagert und hielten ihre Mahlzeit. Ich gesellte mich zu ihnen, sagte, daß ich auch ein wandernder Musiker sei, und bald wurden wir Freunde. Da sie Tänze spielten, frug ich sie schüchtern, ob sie auch meine Galopps schon spielten? Die Herrlichen! Sie kannten meine Galopps nicht! O, wie mir das wohl tat!
Ich frug, ob sie nicht auch andere Musik als Tanzmusik machten? »Ei wohl«, antworteten sie, »aber nur für uns, und nicht vor den vornehmen Leuten.« – Sie packten ihre Musikalien aus – ich erblickte das große Septuor von Beethoven; staunend frug ich, ob sie auch dies spielten?
»Warum nicht?« – entgegnete der Älteste; – »Joseph hat eine böse Hand und kann jetzt nicht die zweite Violine spielen, sonst wollten wir uns gleich damit eine Freude machen.«
Außer mir, ergriff ich sogleich die Violine Josephs, versprach ihn nach Kräften zu ersetzen, und wir begannen das Septuor.
O, welches Entzücken! Hier, an einer böhmischen Landstraße, unter freiem Himmel das Beethoven’sche Septuor von Tanzmusikanten, mit einer Reinheit, einer Präzision und einem so tiefen Gefühle vorgetragen, wie selten von den meisterhaftesten Virtuosen! – Großer Beethoven, wir brachten dir ein würdiges Opfer!
Wir waren soeben im Finale, als – die Chaussee bog sich an dieser Stelle bergauf – ein eleganter Reisewagen langsam und geräuschlos herankam, und endlich dicht bei uns still hielt. Ein erstaunlich langer und erstaunlich blonder junger Mann lag im Wagen ausgestreckt, hörte unserer Musik mit ziemlicher Aufmerksamkeit zu, zog eine Brieftasche hervor und notierte einige Worte. Darauf ließ er ein Goldstück aus dem Wagen fallen, und weiter fortfahren, indem er zu seinem Bedienten wenige englische Worte sprach, woraus mir erhellte, daß dies ein Engländer sein müsse.
Dieser Vorfall verstimmte uns; zum Glück waren wir mit dem Vortrage des Septuors fertig. Ich umarmte meine Freunde und wollte sie begleiten, sie aber erklärten, daß sie von hier aus die Landstraße verlassen und einen Feldweg einschlagen würden, um für diesmal zu ihrem Heimatsdorfe zurückzukehren. Hätte nicht Beethoven selbst meiner gewartet, ich würde sie gewiß auch dahin begleitet haben. So aber trennten wir uns gerührt und schieden. Später fiel mir auf, daß Niemand das Goldstück des Engländers aufgehoben hatte. –
Im nächsten Gasthof, wo ich einkehrte, um meine Glieder zu stärken, saß der Engländer bei einem guten Mahle. Er betrachtete mich lange; endlich sprach er mich in einem passabeln Deutsch an.
»Wo sind Ihre Kollegen?« frug er.
»Nach ihrer Heimat«, sagte ich.
»Nehmen Sie Ihre Violine, und spielen Sie noch etwas« – fuhr er fort – »hier ist Geld!«
Das verdroß mich; ich erklärte, daß ich nicht für Geld spielte, außerdem auch keine Violine hätte, und setzte ihm kurz auseinander, wie ich mit jenen Musikanten zusammengetroffen war.
»Das waren gute Musikanten« – versetzte der Engländer – »und die Symphonie von Beethoven war auch sehr gut.«
Diese Äußerung frappierte mich; ich frug ihn, ob er Musik treibe?
»Yes« – antwortete er – »ich spiele zweimal in der Woche die Flöte, Donnerstags blase ich Waldhorn, und Sonntags komponiere ich.«
Das war viel; ich erstaunte. – In meinem Leben hatte ich nichts von reisenden englischen Musikern gehört; ich fand daher, daß sie sich sehr gut stehen müßten, wenn sie in so schönen Equipagen ihre Wanderungen ausführen könnten. – Ich frug, ob er Musiker von Profession sei?
Lange erhielt ich gar keine Antwort; endlich brachte er sehr langsam hervor, daß er viel Geld habe.
Mein Irrtum wurde mir einleuchtend, denn ich hatte ihn jedenfalls mit meiner Frage beleidigt. Verlegen schwieg ich, und verzehrte mein einfaches Mahl.
Der Engländer, der mich abermals lange betrachtet hatte, begann aber wieder. »Kennen Sie Beethoven?« – frug er mich.
Ich entgegnete, daß ich noch nie in Wien gewesen sei, und jetzt eben im Begriff stehe, dahin zu wandern, um die heißeste Sehnsucht zu befriedigen, die ich hege, den angebeteten Meister zu sehen.
»Woher kommen Sie?« frug er. – »Von L…« – »Das ist nicht weit! Ich komme von England, und will auch Beethoven kennen lernen. Wir werden Beide ihn kennen lernen; er ist ein sehr berühmter Komponist.« –
Welch wunderliches Zusammentreffen! – dachte ich bei mir. Hoher Meister, wie Verschiedene ziehst du nicht an! Zu Fuß und zu Wagen wandert man zu dir! – Mein Engländer interessierte mich; ich gestehe aber, daß ich ihn seiner Equipage wegen wenig beneidete. Es war mir, als wäre meine mühselige Pilgerfahrt zu Fuße heiliger und frömmer, und ihr Ziel müßte mich mehr beglücken, als Jenen, der in Stolz und Hoffahrt dahin zog.
Da blies der Postillon; der Engländer fuhr fort, nachdem er mir zugerufen, er würde Beethoven eher sehen als ich.
Ich war kaum einige Stunden zu Fuße gefolgt, als ich ihn unerwartet wieder antraf. Es war auf der Landstraße. Ein Rad seines Wagens war gebrochen; mit majestätischer Ruhe saß er aber noch darin, sein Bedienter hinten auf, trotzdem daß der Wagen ganz auf der Seite hing. Ich erfuhr, daß man den Postillon zurückerwartete, der nach einem ziemlich entfernten Dorf gelaufen sei, um einen Schmied herbeizuschaffen. Man hatte schon lange gewartet; da der Bediente nur englisch sprach, entschloß ich mich, selbst nach dem Dorfe zu gehen, um Postillon und Schmied anzutreiben. Wirklich traf ich den erstern in einer Schenke, wo er beim Branntwein sich nicht sonderlich um den Engländer kümmerte; doch brachte ich ihn mit dem Schmied bald zu dem zerbrochenen Wagen zurück. Der Schade war geheilt; der Engländer versprach mir, mich bei Beethoven anzumelden, und – fuhr davon.
Wie sehr war ich verwundert, als ich am folgenden Tage ihn wiederum auf der Landstraße antraf! Diesmal aber ohne zerbrochenem Rad, hielt er ganz ruhig mitten auf dem Wege, las in einem Buche, und schien zufrieden zu sein, als er mich meines Weges daher kommen sah.
»Ich habe hier schon sehr viele Stunden gewartet«, sagte er, »weil mir hier eingefallen ist, daß ich Unrecht getan habe, Sie nicht einzuladen, mit mir zu Beethoven zu fahren. Das Fahren ist viel besser als das Gehen. Kommen Sie in den Wagen.«
Ich war abermals erstaunt. Eine kurze Zeit schwankte ich wirklich, ob ich sein Anerbieten nicht annehmen sollte; bald aber erinnerte ich mich des Gelübdes, das ich gestern getan hatte, als ich den Engländer dahin rollen sah: ich hatte mir gelobt, unter allen Umständen meine Pilgerschaft zu Fuß zu wallen. Ich erklärte das laut. Jetzt erstaunte der Engländer; er konnte mich nicht begreifen. Er wiederholte sein Anerbieten, und daß er schon viele Stunden auf mich gewartet habe, obgleich er im Nachtquartier durch die gründliche Reparatur des zerbrochenen Rades sehr lange aufgehalten worden sei. Ich blieb fest, und er fuhr verwundert davon.
Eigentlich hatte ich eine geheime Abneigung gegen ihn, denn es drang sich mir wie eine düstere Ahnung auf, daß mir dieser Engländer großen Verdruß anrichten würde. Zudem kam mir seine Verehrung Beethovens, sowie sein Vorhaben, ihn kennen zu lernen, mehr wie die geckenhafte Grille eines reichen Gentlemans als das tiefe, innige Bedürfnis einer enthusiastischen Seele vor. Deshalb wollte ich ihn lieber fliehen, um durch eine Gemeinschaft mit ihm meine fromme Sehnsucht nicht zu entweihen.
Aber als ob mich mein Geschick darauf vorbereiten wollte, in welchen gefährlichen Zusammenhang ich mit diesem Gentleman noch geraten sollte, traf ich ihn am Abend desselben Tages abermals, vor einem Gasthofe haltend und, wie es schien, mich erwartend. Denn er saß rückwärts in seinem Wagen, und sah die Straße zurück mir entgegen.
»Sir«, – redete er mich an, – »ich habe wieder sehr viele Stunden auf Sie gewartet. Wollen Sie mit mir zu Beethoven fahren?«
Diesmal mischte sich zu meinem Erstaunen ein heimliches Grauen. Diese auffallende Beharrlichkeit, mir zu dienen, konnte ich mir unmöglich anders erklären, als daß der Engländer, meine wachsende Abneigung gegen sich gewahrend, mir zu meinem Verderben sich aufdrängen wollte. Mit unverhaltenem Verdrusse schlug ich abermals sein Anerbieten aus. Da rief er stolz:
»Goddam, Sie schätzen Beethoven wenig. Ich werde ihn bald sehen!« Eilig flog er davon. –
Diesmal war es wirklich das letzte Mal, daß ich auf dem noch langen Wege nach Wien mit diesem Inselsohne zusammentraf. Endlich betrat ich die Straßen Wiens; das Ende meiner Pilgerfahrt war erreicht. Mit welchen Gefühlen zog ich in dieses Mekka meines Glaubens ein! Alle Mühseligkeiten der langen und beschwerlichen Wanderschaft waren vergessen; ich war am Ziele, in den Mauern, die Beethoven umschlossen.
Ich war zu tief bewegt, um sogleich an die Ausführung meiner Absicht denken zu können. Zunächst erkundigte ich mich zwar nach der Wohnung Beethovens, jedoch nur um mich in dessen Nähe einzulogieren. Ziemlich gegenüber dem Hause, in welchem der Meister wohnte, befand sich ein nicht zu vornehmer Gasthof; ich mietete mir ein kleines Kämmerchen im fünften Stock desselben, und dort bereitete ich mich nun auf das größte Ereignis meines Lebens, auf einen Besuch bei Beethoven vor.
Nachdem ich zwei Tage ausgeruht, gefastet und gebetet, Wien aber noch mit keinem Blick näher betrachtet hatte, faßte ich denn Mut, verließ meinen Gasthof, und ging schräg gegenüber in das merkwürdige Haus. Man sagte mir, Herr Beethoven sei nicht zugegen. Das war mir gerade recht; denn ich gewann Zeit, um mich von Neuem zu sammeln. Da mir aber den Tag über noch viermal derselbe Bescheid, und zwar mit einem gewissen gesteigerten Tone gegeben ward, hielt ich diesen Tag für einen Unglückstag, und gab mißmutig meinen Besuch auf.
Als ich zu meinem Gasthof zurückwanderte, grüßte mir aus dem ersten Stocke desselben mein Engländer ziemlich leutselig entgegen.
»Haben Sie Beethoven gesehen?« rief er mir zu.
»Noch nicht: er war nicht anzutreffen«, entgegnete ich, verwundert über mein abermaliges Zusammentreffen mit ihm. Auf der Treppe begegnete er mir, und nötigte mich mit auffallender Freundlichkeit in sein Zimmer. »Mein Herr,« sagte er, »ich habe Sie heute schon fünf Mal in Beethovens Haus gehen sehen. Ich bin schon viele Tage hier, und habe in diesem garstigen Hotel Quartier genommen, um Beethoven nahe zu sein. Glauben Sie mir, es ist sehr schwer Beethoven zu sprechen; dieser Gentleman hat sehr viele Launen. Ich bin im Anfange sechs Mal zu ihm gegangen, und bin stets zurückgewiesen worden. Jetzt stehe ich sehr früh auf, und setze mich bis spät Abends an das Fenster, um zu sehen, wann Beethoven ausgeht. Der Gentleman scheint aber nie auszugehen.«
»So glauben Sie, Beethoven sei auch heute zu Hause gewesen, und habe mich abweisen lassen?« rief ich bestürzt.
»Versteht sich, Sie und ich, wir sind abgewiesen. Und das ist mir sehr unangenehm, denn ich bin nicht gekommen, Wien kennen zu lernen, sondern Beethoven.«
Das war für mich eine sehr trübe Nachricht. Nichtsdestoweniger versuchte ich am andern Tage wieder mein Heil, jedoch abermals vergebens, – die Pforten des Himmels waren mir verschlossen.
Mein Engländer, der meine fruchtlosen Versuche stets mit der gespanntesten Aufmerksamkeit vom Fenster aus beobachtete, hatte nun auch durch Erkundigungen Sicherheit erhalten, daß Beethoven nicht auf die Straße heraus wohne. Er war sehr verdrießlich, aber grenzenlos beharrlich. – Dafür war meine Geduld bald verloren, denn ich hatte dazu wohl mehr Grund als er; eine Woche war allmählich verstrichen, ohne daß ich meinen Zweck erreichte, und die Einkünfte meiner Galopps erlaubten mir durchaus keinen langen Aufenthalt in Wien. Nach und nach begann ich zu verzweifeln.
Ich teilte meine Leiden dem Wirte des Gasthofes mit. Dieser lächelte, und versprach mir den Grund meines Unglückes anzugeben, wenn ich gelobte, ihn nicht dem Engländer zu verraten. Meinen Unstern ahnend tat ich das verlangte Gelübde.
»Sehen Sie wohl«, – sagte nun der ehrliche Wirt – »es kommen hier sehr viel Engländer her, um Herrn von Beethoven zu sehen und kennen zu lernen. Dies verdrießt aber Herrn von Beethoven sehr, und er hat eine solche Wut gegen die Zudringlichkeit dieser Herren, daß er es jedem Fremden rein unmöglich macht, vor ihn zu gelangen. Er ist ein sonderlicher Herr, und man muß ihm dies verzeihen. Meinem Gasthofe ist dies aber recht zuträglich, denn er ist gewöhnlich stark von Engländern besetzt, die durch die Schwierigkeit, Herrn Beethoven zu sprechen, genötigt sind, länger, als es sonst der Fall sein würde, meine Gäste zu sein. Da Sie jedoch versprechen, mir diese Herren nicht zu verscheuchen, so hoffe ich ein Mittel ausfindig zu machen, wie Sie an Herrn Beethoven herankommen können.«
Das war sehr erbaulich; ich kam also nicht zum Ziele, weil ich armer Teufel als Engländer passierte! O, meine Ahnung war gerechtfertigt; der Engländer war mein Verderben! – Augenblicklich wollte ich aus dem Gasthofe ziehen, denn jedenfalls wurde in Beethovens Hause Jeder für einen Engländer gehalten, der hier logierte, und schon deshalb war ich also im Bann. Dennoch hielt mich aber das Versprechen des Wirtes, daß er mir eine Gelegenheit verschaffen wollte, Beethoven zu sehen und zu sprechen, zurück. Der Engländer, den ich nun im Innersten verabscheute, hatte während dem allerhand Intrigen und Bestechungen angefangen, jedoch immer ohne Resultat.
So verstrichen wiederum mehrere fruchtlose Tage, während welcher der Ertrag meiner Galopps sichtlich abnahm, als mir endlich der Wirt vertraute, daß ich Beethoven nicht verfehlen könnte, wenn ich mich in einen gewissen Biergarten begeben wollte, wo dieser sich fast täglich zu einer bestimmten Stunde einzufinden pflege. Zugleich erhielt ich von meinem Ratgeber unfehlbare Nachweisungen über die Persönlichkeit des großen Meisters, die es mir möglich machen sollten, ihn zu erkennen. Ich lebte auf und beschloß, mein Glück nicht auf morgen zu verschieben. Es war mir unmöglich, Beethoven beim Ausgehen anzutreffen, da er sein Haus stets durch eine Hintertür verließ; somit blieb mir nichts übrig, als der Biergarten. Leider suchte ich den Meister aber sowohl an diesem, als an den nächstfolgenden zwei Tagen dort vergebens auf. Endlich am vierten, als ich wiederum zur bestimmten Stunde meine Schritte dem verhängnisvollen Biergarten zuwandte, mußte ich zu meiner Verzweiflung gewahr werden, daß mich der Engländer vorsichtig und bedächtig von fern verfolgte. Der Unglückliche, fortwährend an sein Fenster postiert, hatte es sich nicht entgehen lassen, daß ich täglich zu einer gewissen Zeit nach derselben Richtung hin ausging; dies hatte ihn frappiert, und sogleich vermutend, daß ich eine Spur entdeckt habe, Beethoven aufzusuchen, hatte er beschlossen, aus dieser meiner vermutlichen Entdeckung Vorteil zu ziehen. Er erzählte mir alles dies mit der größten Unbefangenheit, und erklärte zugleich, daß er mir überall hin folgen wollte. Vergebens war mein Bemühen, ihn zu hintergehen und glauben zu machen, daß ich einzig vorhabe, zu meiner Erholung einen gemeinen Biergarten zu besuchen, der viel zu unfashionabel sei, um von Gentlemans seines Gleichen beachtet zu werden; er blieb unerschütterlich bei seinem Entschlusse, und ich hatte mein Geschick zu verfluchen. Endlich versuchte ich Unhöflichkeit, und suchte ihn durch Grobheit von mir zu entfernen; weit davon aber, sich dadurch aufbringen zu lassen, begnügte er sich mit einem sanften Lächeln. Seine fixe Idee war: Beethoven zu sehen, – alles Übrige kümmerte ihn nicht.