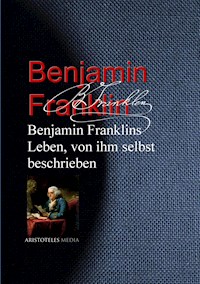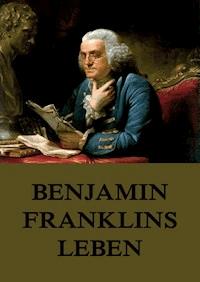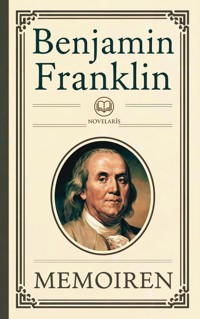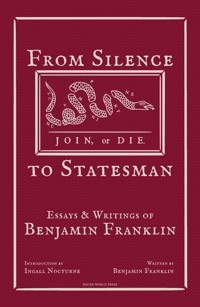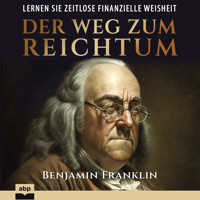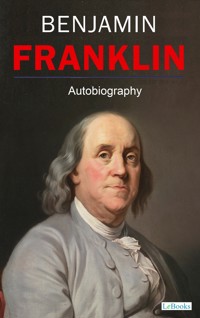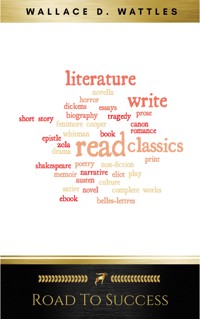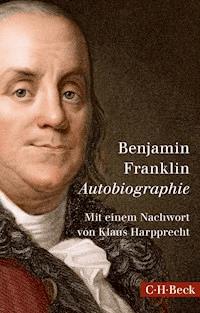
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die Lebensbeschreibung Benjamin Franklins (1706 - 1790), der einer der bedeutendsten Staatsmänner der jungen Vereinigten Staaten wurde, gilt als das erste "klassische" Werk der amerikanischen Literatur. Benjamin Franklin, der Sohn eines in die Neue Welt ausgewanderten Seifensieders und Kerzenmachers, berichtet in diesen Lebenserinnerungen von der Kindheit und den Lehrjahren im puritanischen Boston, der Flucht des lebenshungrigen Bücherwurms ins weltoffene Philadelphia und der erfolgreichen Tätigkeit dort, zuerst als Buchdrucker, dann auch als Wissenschaftler und Erfinder. Und er schildert seinen Aufstieg zum angesehenen Bürger und Politiker. Die Autobiographie "dieses weltzugewandten nüchternen Aufklärers und Repräsentanten der jungen amerikanischen Republik, dieses auf den verschiedenartigsten Gebieten unermüdlich tätigen Bürgers", gehöre, schreibt Hans J. Schütz, "gewiss zu den bedeutendsten autobiographischen Zeugnissen eines emanzipierten Bürgertums".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Benjamin Franklin
Autobiographie
Mit einem Nachwortvon Klaus Harpprecht
Verlag C.H.Beck
Zum Buch
Die Lebensbeschreibung Benjamin Franklins (1706–1790), der einer der bedeutendsten Staatsmänner der jungen Vereinigten Staaten wurde, gilt als das erste „klassische“ Werk der amerikanischen Literatur. Benjamin Franklin, der Sohn eines in die Neue Welt ausgewanderten Seifensieders und Kerzenmachers, berichtet in diesen Lebenserinnerungen von der Kindheit und den Lehrjahren im puritanischen Boston, der Flucht des lebenshungrigen Bücherwurms ins weltoffene Philadelphia und der erfolgreichen Tätigkeit dort, zuerst als Buchdrucker, dann auch als Wissenschaftler und Erfinder. Und er schildert seinen Aufstieg zum angesehenen Bürger und Politiker. Die Autobiographie „dieses weltzugewandten nüchternen Aufklärers und Repräsentanten der jungen amerikanischen Republik, dieses auf den verschiedenartigsten Gebieten unermüdlich tätigen Bürgers“, gehöre, schreibt Hans J. Schütz, „gewiss zu den bedeutendsten autobiographischen Zeugnissen eines emanzipierten Bürgertums“.
Über den Autor
Benjamin Franklin (1706–1790), vor allem bekannt als einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika, beteiligte sich nicht nur an staatlichen Angelegenheiten wie dem Entwurf der Unabhängigkeitserklärung, sondern verfolgte vielschichtige Interessen. So war der Staatsmann unter anderem auch als Drucker, Naturwissenschaftler, Erfinder und Schriftsteller tätig.
INHALT
1706–1730
1730–1731
1731–1757
Franklins Konzept
Nachwort
Anmerkungen
1706–1730
Twyford, beim Bischof von St. Asaph, 1771
Mein lieber Sohn!
Ich habe mir stets ein Vergnügen daraus gemacht, irgendwelche kleinen Anekdoten über meine Vorfahren zu sammeln. Du wirst dich noch der Erkundigungen erinnern, die ich unter meinen noch lebenden Verwandten anstellte, als du mit mir in England warst, und der Reise, die ich zu diesem Zweck unternahm. Da ich mir einbilde, es dürfte für dich in gleicher Weise angenehm sein, meine Lebensumstände kennenzulernen, von denen dir manche noch unbekannt sind, und da ich den Genuß der ununterbrochenen Muße einer Woche in meiner gegenwärtigen ländlichen Zurückgezogenheit erwarte, so setze ich mich nieder, um sie für dich aufzuzeichnen. Hierzu veranlassen mich noch einige andere Beweggründe. Da ich aus der Armut und Dunkelheit, worin ich geboren und aufgewachsen bin, zu Wohlhabenheit und einigem Ruf in der Welt mich aufgeschwungen und meinen bisherigen Lebensweg mit einem nicht unbedeutenden Erfolg zurückgelegt habe, so werden meine Nachkommen vielleicht begierig sein, die von mir angewandten Mittel kennenzulernen, welche mir, unter Gottes Segen, soviel Gedeihen brachten, zumal sie einige derselben für ihre eigene Lage passend und darum der Nachahmung würdig erachten dürften.
Jenes Glück hat mich, wenn ich darüber nachdachte, schon manchmal zu der Äußerung veranlaßt, daß, wenn es in meine Wahl gegeben wäre, ich gar keinen Anstand nähme, dasselbe Leben noch einmal von vorn anzufangen, wobei ich nur das Vorrecht beanspruchen würde, das Schriftstellern bei einer zweiten Auflage zusteht: nämlich einige Druckfehler der ersten zu verbessern. Auch möchte ich, neben Berichtigung der Fehler, noch einige schlimme Zufälle und Begebenheiten mit anderen, günstigeren vertauschen. Allein selbst wenn mir dies verwehrt wäre, würde ich noch immer das Anerbieten annehmen. Weil nun aber eine solche Wiederholung nicht zu erwarten ist, so scheint wohl nichts dem abermaligen Durchleben unseres Daseins so nahe zu kommen wie die Erinnerung an dieses Leben selbst und die schriftliche Aufzeichnung desselben, um diese Erinnerung so dauerhaft wie möglich zu machen.
Damit werde ich mich überdies dem bei alten Männern so natürlichen Hang hingeben, von sich und ihren früheren Taten zu reden, und meiner Neigung ganz unbeschränkt folgen können, ohne deshalb denen langweilig zu werden, die sich aus Achtung vor meinem Alter verpflichtet fühlen, mir zuzuhören, da es ja jedem freistehen wird, mich je nach Belieben zu lesen oder nicht. Endlich aber – ich will es nur lieber gleich gestehen, da mir doch niemand das Gegenteil glauben würde – werde ich bei dieser Arbeit vielleicht meine Eitelkeit zum guten Teil befriedigen. Ich habe nämlich kaum je die einleitende Redensart gehört oder gelesen: Ich darf wohl ohne Eitelkeit behaupten usw., ohne daß nicht sogleich irgendein charakteristisches Zeichen von Eitelkeit gefolgt wäre. Die meisten Menschen hassen die Eitelkeit an anderen, sosehr sie auch selbst damit behaftet sein mögen; allein ich heiße sie willkommen, wo immer ich ihr begegne, in der Überzeugung, daß sie oft für ihren Besitzer und auch für andere im Bereich seines Wirkungskreises Gutes erzielt. Es wäre daher in vielen Fällen gar nicht so absurd, wenn ein Mensch Gott für seine Eitelkeit ebensosehr danken würde wie für die übrigen Annehmlichkeiten des Lebens.
Da ich nun gerade von Dank gegen Gott spreche, so will ich auch in aller Demut anerkennen, daß ich das erwähnte Glück meines vergangenen Lebens seiner gütigen Vorsehung verdanke, die mir die Mittel in die Hand gab, deren ich mich dann bediente und die ihnen Erfolg verlieh. Mein Glaube in diesem Punkt veranlaßt mich zu hoffen – wenn ich mich auch nicht darauf verlassen darf –, daß sich dieselbe Güte auch noch ferner an mir bewähren werde, indem sie entweder die Dauer meines Glücks verlängert oder mich mit Kraft erfüllt, eine verhängnisvolle Schicksalswende zu tragen, die auch ich, so gut wie andere, erfahren kann. Die Gestaltung meines künftigen Schicksals ist nur dem bekannt, in dessen Macht es steht, selbst unsere Leiden zu unserem Heil zu lenken.
Die Aufzeichnungen eines meiner Oheime, der wie ich gern Nachrichten über unsere Familie sammelte, sind mir zu Händen gekommen und haben mir mehrere Einzelheiten über unsere Vorfahren geliefert. Aus diesen Notizen erfuhr ich, daß während einer Zeit von mindestens dreihundert Jahren die Familie in demselben Dorf (Ecton in Northamptonshire) auf einem Freigut von ungefähr dreißig Acres lebte. Wie lange sie schon vor jener Zeit dort gewohnt hatten, wußte er nicht; wahrscheinlich aber noch vor dem Aufkommen der Zunamen, wo sie den Namen Franklin annahmen, womit früher eine besondere Standesklasse belegt wurde. Dieser kleine Grundbesitz würde für ihren Lebensunterhalt nicht ausgereicht haben, wenn sie nicht nebenher das Gewerbe eines Grobschmieds betrieben hätten, das bis zu meines Oheims Zeit in der Familie blieb, indem immer der älteste Sohn für dieses Gewerbe erzogen wurde, ein Brauch, den auch sowohl er wie mein Vater für ihre ältesten Söhne beibehielten. Bei meinen Nachforschungen in den Kirchenbüchern zu Ecton fand ich eine Nachricht über ihre Geburten, Heiraten und Todesfälle erst vom Jahre 1555 an, da in jenem Sprengel vor diesem Zeitpunkt keine Kirchenbücher geführt worden waren. Aus diesen Kirchenbüchern erfuhr ich, daß ich der jüngste Sohn des jüngsten Sohnes seit fünf Generationen rückwärts war. Mein Großvater Thomas, im Jahre 1598 geboren, lebte in Ecton, bis er zur weiteren Ausübung seines Handwerks zu alt war, und zog dann nach Banbury in Oxfordshire, wo sein Sohn John, bei dem mein Vater seine Lehrzeit durchmachte, als Färber wohnte. Dort starb mein Großvater, und hier liegt er begraben; im Jahre 1758 haben wir sein Grabmal gesehen. Sein ältester Sohn Thomas wohnte in dem Stammhaus zu Ecton und vererbte es mit dem dazugehörigen Land seiner einzigen Tochter, die es unter Zustimmung ihres Gatten, eines gewissen Mr. Fisher aus Wellingborough später an Mr. Isted, den gegenwärtigen Eigentümer, verkaufte. Mein Großvater hatte vier Söhne, die das Mannesalter erreichten, nämlich: Thomas, John, Benjamin und Josiah. Ich will dir über sie Auskunft geben, so gut ich es bei dieser Entfernung von meinen Papieren kann, in denen du noch viele Einzelheiten finden wirst, falls sie nicht während meiner Abwesenheit verlorengegangen sind.
Thomas erlernte bei seinem Vater das Handwerk eines Grobschmieds; da er aber, wie alle meine Brüder, einen recht gesunden, natürlichen Verstand hatte, sorgte für seine geistige Ausbildung ein Herr namens Palmer, der zu jener Zeit der vornehmste Bewohner des Dorfes war. Auf diese Weise erwarb Thomas sich Tüchtigkeit für die Geschäfte eines Notars, wurde bald eine wichtige Person in Dorfangelegenheiten und gehörte zu den Förderern jedes öffentlichen Unternehmens, sowohl in bezug auf die Grafschaft wie auf das Städtchen Northampton, ebenso auf sein Dorf, wovon viele Beispiele überliefert sind; und er fand viel Beachtung und Gunst bei dem damaligen Lord Halifax. Er starb am 6. Januar 1702 nach dem alten Kalender – genau vier Jahre vor meiner Geburt. Die Schilderung seines Lebens und Charakters, die mehrere bejahrte Einwohner des Dorfes uns entwarfen, überraschte dich, wie ich mich entsinne, wegen ihrer Übereinstimmung mit dem, was du über mich selbst wußtest, so daß du sagtest: »Wäre er gerade an demselben Tage gestorben, als du geboren wurdest, so könnte man an eine Seelenwanderung glauben.«
John erlernte, soviel ich weiß, das Geschäft eines Wollfärbers. Benjamin erlernte in London die Seidenfärberei. Er war ein begabter Mann, dessen ich mich noch wohl entsinne; denn während meiner Kindheit kam er zu meinem Vater nach Boston und lebte mehrere Jahre in unserem Hause. Er erreichte ein hohes Alter. Sein Enkel, Samuel Franklin, lebt noch jetzt in Boston. In seinem Nachlaß fanden sich zwei Quartbände Gedichte im Manuskript, kleine, an seine Freunde gerichtete Gelegenheitsstücke. Er hatte eine Kurzschrift erfunden, die er mich lehrte; da ich aber nie Gebrauch davon machte, habe ich sie wieder vergessen. Ich wurde nach diesem Oheim getauft; zwischen ihm und meinem Vater bestand ein besonders inniges Verhältnis. Er war sehr fromm, ein eifriger Zuhörer der besten Prediger, deren Vorträge er nach seiner Methode niederschrieb und auf diese Weise in verschiedenen Bänden sammelte. Auch mit Politik beschäftigte er sich sehr gern – vielleicht zuviel für seine Verhältnisse. Erst unlängst fand ich in London eine von ihm angelegte Sammlung der wichtigsten über die Staatsereignisse von 1647 bis 1717 erschienenen Flugschriften. Wie sich aus der Zahlenfolge ergibt, fehlen mehrere Bände, aber es sind doch noch acht Folianten und vierundzwanzig Quart- und Oktavbände vorhanden. Die Sammlung war in die Hände eines Antiquars gekommen, der mich kannte, weil er mir mehrere Bücher verkauft hatte, und der sie mir brachte. Wahrscheinlich hatte sie mein Oheim vor seiner Abreise nach Amerika, vor ungefähr fünfzig Jahren, zurückgelassen. Am Rande finden sich viele Bemerkungen von seiner Hand.
Unsere schlichte Familie bekannte sich früh zur reformierten Lehre und beharrte während der Regierung der Königin Mary treu dabei, obwohl sie manchmal wegen ihres Eifers gegen das Papsttum gefährdet war. Sie besaßen eine englische Bibel, und um diese desto sicherer zu verbergen, wurde sie offen, mit über die Blätter gespannten Bindfäden unter dem Deckel eines Klappstuhls befestigt. Wollte nun mein Urgroßvater seiner Familie vorlesen, so legte er den Deckel des Klappstuhles verkehrt auf seine Knie und wendete so die Blätter um, die auf beiden Seiten von den Bindfäden niedergehalten wurden. Eins der Kinder wurde an die Tür gestellt, um sogleich Nachricht zu geben, wenn es den Apparitor (einen Beamten des geistlichen Gerichtes) kommen sah; dann wurde der Stuhl mit der wie zuvor darunter versteckten Bibel wieder auf die Füße gestellt. Ich erfuhr diese Anekdote von Oheim Benjamin. Die ganze Familie bewahrte ihre Anhänglichkeit an die anglikanische Kirche bis etwa gegen Ende der Regierung Karls II., wo gewisse als Nonkonformisten abgesetzte Geistliche Konventikel in Northamptonshire abhielten, denen Onkel Benjamin und mein Vater Josiah sich anschlossen und denen sie ihr Leben lang zugetan blieben. Die übrige Familie blieb in der Bischöflichen Kirche.
Mein Vater hatte jung geheiratet und ungefähr ums Jahr 1682 seine Frau und drei Kinder mit sich nach Neuengland gebracht. Da die Konventikel zu jener Zeit verboten waren und häufig gestört wurden, so waren mehrere angesehene Männer seiner Bekanntschaft veranlaßt worden, nach Neuengland zu übersiedeln, und hatten ihn bewogen, sie dorthin zu begleiten, wo sie hofften, sich ihrer Religionsausübung unbeanstandet hingeben zu dürfen. Mein Vater hatte von derselben Frau noch vier Kinder, die dort geboren wurden, und weitere zehn von einer zweiten Frau, zusammen also siebzehn Kinder. Ich weiß noch recht gut, daß wir unser dreizehn zusammen bei Tische saßen, die alle zu Männern und Frauen heranwuchsen und heirateten. Ich war der jüngste Sohn und das vorletzte Kind und wurde zu Boston in Neuengland geboren. Meine Mutter, die zweite Frau, war Abiah Folger, Tochter des Peter Folger, eines der ersten Ansiedler in Neuengland, dessen Cotton Mather in seiner Kirchengeschichte jener Provinz, mit dem Titel ›Magnalia Christi Americana‹, als eines frommen wohlunterrichteten Engländers ehrend gedenkt, wenn ich mich der Worte recht entsinne. Wie mir erzählt wurde, schrieb er eine Menge kleiner Aufsätze, doch scheint nur einer gedruckt worden zu sein, der mir vor vielen Jahren zu Gesicht kam. Er wurde im Jahre 1675 geschrieben, in den kunstlosen Reimen jener Zeiten und Menschen. Er war an die damals am Staatsruder stehenden Männer gerichtet und verwandte sich zugunsten der Gewissensfreiheit, der Baptisten, Quäker und anderer Sektierer, die Verfolgungen erduldeten. Diesen Verfolgungen schreibt er die Kriege mit den Indianern und andere Drangsale zu, die das Land drückten, indem er sie als die vielfältigen Gerichte Gottes zur Züchtung für so böse Taten ansieht und die Regierung zum Widerruf solcher hartherzigen Gesetze ermahnt. Das Gedicht erschien mir mit männlicher Freimütigkeit und ehrlicher Schlichtheit geschrieben. Ich entsinne mich noch der sechs letzten Zeilen, habe aber die Wortfolge der beiden ersten von ihnen vergessen. Der Sinn war, daß sein Tadel aus guter Absicht entspringe und daß er deshalb als der Verfasser bekannt zu sein wünsche.
Weil ich’s von ganzem Herzen hasse,ein übler Schmähskribent zu sein,setz ich hier meinen Namen hin:zu Sherburne wohn ich jetzt und bineuch wahrer Freund, von Ränken frei,wißt, daß ich Peter Folger sei.
Meine älteren Brüder kamen alle zu verschiedenen Handwerkern in die Lehre. Ich selbst wurde mit acht Jahren in eine Lateinschule geschickt, da mein Vater mich als einen Zehnten von seinen Söhnen für den Dienst der Kirche bestimmte. Die Schnelligkeit, mit der ich lesen lernte (was sehr früh gewesen sein muß, da ich mich gar nicht mehr der Zeit erinnere, wo ich nicht lesen konnte), und die Ansicht seiner Freunde, daß ich sicher eines Tages ein sehr gelehrter Mann werden würde, bestärkten ihn in seinem Plan. Auch Oheim Benjamin gab seinen Beifall zu dieser Absicht und versprach mir alle seine Bände mit nachgeschriebenen Predigten, vermutlich als eine Art Grundstock, wenn ich mich bemühen wollte, seine Kurzschrift zu lernen. Ich blieb indessen kaum ein Jahr in der Lateinschule, obschon ich in dieser Zeit allmählich aus der Mitte meiner Jahresklasse an die Spitze derselben mich aufgeschwungen hatte und dann in die nächstobere vorrückte, um mit dieser am Ende des Jahres in die dritte zu treten. Allein mein Vater änderte inzwischen, wegen der großen Kosten einer gelehrten Erziehung, die er bei seiner zahlreichen Familie kaum erschwingen konnte, und bei dem ärmlichen Lebensunterhalt, den manche Männer von gelehrter Erziehung später fanden – Gründe, die er in meinem Beisein öfters gegen seine Freunde äußerte –, seinen ursprünglichen Plan, nahm mich aus der Lateinschule fort und schickte mich in eine Schreib- und Rechenschule, die ein damals bekannter Mann, Mr. George Brownell, hielt, ein geschickter Lehrer, der seinem Beruf mit Erfolg vorstand, weil er sich einer milden und ermutigenden Methode bediente. Unter ihm lernte ich bald eine vortreffliche Hand schreiben; im Rechnen aber wollte es mir durchaus nicht gelingen, und ich machte keine Fortschritte darin. In einem Alter von zehn Jahren wurde ich von meinem Vater wieder nach Hause genommen, um ihm in seinem Geschäft, nämlich beim Seifensieden und Lichterziehen, zur Hand zu gehen. Dieses Gewerbe hatte er zwar nicht eigentlich gelernt, aber bei seiner Ankunft in Neuengland ergriffen, weil er erkannte, daß er mit seinem eigentlichen, der Färberei, seine Familie nicht ernähren könne, da es nicht sehr gefragt war. Demgemäß wurde ich zum Schneiden der Dochte, Füllen der Gußformen, zur Bedienung des Ladens, zu Geschäftsausgängen usw. verwendet.
Diese Beschäftigung gefiel mir nicht, wogegen ich eine starke Vorliebe für die See hegte; mein Vater wollte aber hiervon nichts wissen. Die Nähe des Wassers gab mir indes häufige Gelegenheit, mich oft darauf und hinein zu wagen, und bald verstand ich zu schwimmen und ein Boot zu führen. Wenn ich mit anderen Knaben fuhr, so wurde gewöhnlich mir das Steuerruder anvertraut, namentlich in schwierigen Fällen, wie ich denn auch bei allen übrigen Unternehmungen fast immer der Anführer der Schar war, die ich nicht selten in Verlegenheit brachte. Ich will hiervon ein Beispiel mitteilen, das einen frühentwickelten Hang zu öffentlichen Unternehmungen zeigt, obschon derselbe damals nicht richtig geleitet war.
Der Mühlteich wurde an der einen Seite durch einen Salzsumpf begrenzt, an dessen Rand wir uns bei hohem Wasser aufstellten, um Elritzen zu fangen. Durch vieles Getrampel hatten wir es zu einer Kotlache gemacht. Mein Vorschlag ging deshalb dahin, hier einen Damm zu bauen, auf dem wir stehen konnten, wobei ich meinen Gefährten einen großen Haufen Steine zeigte, die zum Bau eines Hauses in der Nähe des Sumpfes bestimmt waren und vortrefflich für unseren Zweck paßten. Demgemäß versammelte ich, nachdem sich die Werkleute am Abend entfernt hatten, eine Anzahl meiner Spielgenossen. Da wir fleißig wie die Ameisen waren, indem oft mehrere von uns mit vereinten Kräften einen Stein wegschleppten; so trugen wir sie denn alle fort und bauten unseren kleinen Damm. Die Arbeiter staunten, als sie am Morgen ihre Steine nicht fanden, die wir für unseren Damm verbraucht hatten. Man forschte nach den Erbauern dieses Werkes; wir wurden entdeckt, man beklagte sich, und gar mancher von uns wurde von seinem Vater hart gestraft. Obschon ich hartnäckig die Nützlichkeit des Baus verteidigte, so überzeugte mich mein Vater doch endlich, daß nichts nützlich sein könne, was nicht rechtmäßig sei.
Du wirst vielleicht begierig sein, auch einiges über die Person und den Charakter meines Vaters zu erfahren. Er besaß eine vortreffliche Leibesbeschaffenheit, war von mittlerer Gestalt, aber wohl und kräftig gebaut; er war sehr begabt, konnte hübsch zeichnen, verstand ein wenig von Musik und hatte eine helle, angenehme Stimme, so daß es viel Vergnügen gewährte, ihm zuzuhören, wenn er zu seiner Violine einen Psalm oder ein Lied sang, wie er wohl öfter abends nach beendigtem Tagewerk zu tun pflegte. Auch besaß er ein mechanisches Talent und verstand bei Gelegenheit, die Werkzeuge einer Menge von Handwerkern zu führen. Aber vor allem zeichnete er sich durch gesunde Auffassungen und gediegenes Urteil in Verstandessachen sowohl im öffentlichen, wie im Privatleben aus. Zwar gab er sich mit ersterem nicht eigentlich ab, weil seine zahlreiche Familie und sein geringes Vermögen ihn streng an sein Gewerbe fesselten; aber ich entsinne mich recht wohl, wie die Angesehenen des Ortes häufig zu ihm kamen und seine Meinung über Angelegenheiten der Stadt oder Kirche, zu der er sich bekannte, einholten und auf seinen Rat und sein Urteil großen Wert legten. Ebenso pflegten einzelne ihn über ihre Privatangelegenheiten zu Rate zu ziehen, wenn es irgendeine Schwierigkeit gab, und oft wurde er zum Schiedsrichter zwischen streitenden Parteien erwählt. Bei Tische sah er gern so häufig als möglich einige gebildete Freunde oder Nachbarn bei sich, mit denen eine vernünftige Unterhaltung möglich war, und war immer bemüht, nützliche oder interessante Dinge zur Sprache zu bringen, woran der Geist seiner Kinder sich bereichern könnte. Auf diese Weise lenkte er schon früh unsere Aufmerksamkeit auf alles, was im Leben der Menschen gerecht, verständig und heilbringend ist. Kaum jemals sprach er von den Gerichten auf dem Tisch, ob sie gut oder schlecht bereitet, von angenehmem oder schlechtem Geschmack, stark gewürzt oder nicht, dieser oder jener Speise ähnlicher Art vorzuziehen oder nachzusetzen seien. Auf diese Weise wurde ich seit meiner frühesten Kindheit an eine gänzliche Unaufmerksamkeit gegen solche Dinge gewöhnt und kümmerte mich nie im geringsten darum, was für Essen vor mir stand, und selbst jetzt noch wende ich diesem Punkt so wenig Beachtung zu, daß es mir schwer werden dürfte, wenige Stunden nach dem Essen anzugeben, woraus mein Mittagbrot bestanden habe. Dies kam mir auf Reisen sehr zustatten, wo meine Gefährten bisweilen über die mangelhafte Befriedigung ihres zarten, weit besser gepflegten Gaumens und Geschmacks sehr unglücklich waren.
Meine Mutter hatte gleicherweise eine vortreffliche Leibesbeschaffenheit. Sie stillte alle ihre zehn Kinder selbst, und ich hörte weder meinen Vater noch sie je über eine andere Krankheit als die klagen, an welcher sie, mein Vater mit 89, meine Mutter mit 85 Jahren, starben. Beide liegen in Boston begraben, wo ich vor einigen Jahren über ihrem Grabe einen marmornen Denkstein mit folgender Inschrift errichten ließ:
Hier ruhen
Josiah FranklinundAbiah, seine Gattin.
Sie lebten innig und einträchtiglich zusammenneunundfünfzig Jahreund ernährtenohne Vermögen, ohne gewinnbringendes Gewerbe durchunermüdliche Arbeit und ehrlichen Fleiß anständigeine zahlreiche Familieund erzogen mit Gottes Segendreizehn Kinder und sieben Enkel.
Laß, Leser, dieses Beispiel dich ermutigen,den Pflichten deines Berufes fleißig nachzukommenund der Vorsehung zu vertrauen.Er war ein frommer und weiser Mann,sie ein kluges und tugendsames Weib.Im Gefühl kindlicher Pflichtschuldigkeitweiht diesen Stein ihrem Gedächtnisseihr jüngster Sohn.
J. F. geb. 1655, gest. 1744, Aetat. 89
A. F. geb. 1667, gest. 1752, Aetat. 85
An meinen Abschweifungen bald hier-, bald dorthin bemerke ich übrigens, daß ich selbst alt werde. Ich pflegte sonst methodischer zu schreiben; aber für den häuslichen Kreis kleidet man sich ja nicht so sorgfältig wie für einen öffentlichen Ball; daher vielleicht meine Nachlässigkeit.
Jedoch zur Sache: Ich blieb auf diese Weise in meines Vaters Geschäft zwei Jahre, das heißt bis ich zwölf Jahre alt war. Da mein Bruder John, der die Seifensiederei erlernt, meinen Vater verlassen, sich verheiratet und in Rhode Island ein eigenes Geschäft begründet hatte, so war ich allem Anschein nach dazu bestimmt, seine Stelle einzunehmen und ein Kerzenmacher zu werden. Weil aber mein Widerwille gegen dies Geschäft fortdauerte, so fürchtete mein Vater, daß, wenn er nicht ein mir angenehmeres fände, ich eines Tages auf und davon und zur See gehen könnte, wie es zu seinem größten Kummer mein Bruder Josiah getan hatte. Deshalb nahm er mich öfter mit, um Maurern, Böttchern, Kupferschmieden, Tischlern und anderen Handwerkern bei der Arbeit zuzusehen, um meine Neigungen zu beobachten und sie an eine Beschäftigung zu fesseln, die mich an Land zurückhielte. Es hat mir seither auch immer großes Vergnügen bereitet, geschickte Werkleute ihr Gerät handhaben zu sehen. Auch habe ich manchen Nutzen daraus gezogen und wenigstens dabei so viel gelernt, daß ich in meinem Haus allerlei kleine Arbeiten selbst zu verrichten vermochte, wenn ich gerade keinen Handwerker bekommen konnte, und daß ich die kleinen Apparate für meine Versuche bauen konnte, während die Absicht zur Anstellung des Experiments in meinem Geist noch frisch und warm war. Mein Vater entschied sich endlich, daß ich Messerschmied werden sollte. Ich wurde einige Tage auf Probe zu meinem Vetter Samuel gegeben, dem Sohn meines Oheims Benjamin, der dies Gewerbe in London erlernt und sich in Boston niedergelassen hatte. Aber das Lehrgeld, das er für mich von meinem Vater verlangte, stand diesem nicht an, weshalb ich wieder ins Haus genommen wurde.
Von frühester Zeit hatte ich leidenschaftlich gern gelesen und all das wenige Geld, das ich erhielt, in Büchern angelegt. Da mir ›Des Pilgers Erdenwallen‹ besonders gefiel, so bestand meine erste Büchersammlung aus Bunyans Werken in einzelnen kleinen Bänden. Diese verkaufte ich später wieder, um R. Burtons ›Geschichtliche Sammlungen‹ kaufen zu können, die aus kleinen billigen Bändchen, etwa vierzig bis fünfzig an der Zahl, bestanden. Meines Vaters kleine Bibliothek enthielt vorzugsweise Bücher über praktische und polemische Theologie. Den größten Teil hatte ich durchgelesen. Ich habe es seitdem oft bedauert, daß in der Zeit, wo ich einen so heftigen Durst nach Kenntnissen empfand, mir nicht ausgewähltere Bücher in die Hände fielen, da es schon beschlossen war, daß ich nicht Geistlicher werden sollte. Unter meines Vaters Büchern befanden sich auch Plutarchs ›Lebensbeschreibungen‹, in denen ich fortwährend las, und noch immer halte ich die Zeit für gut angewandt, die ich damit zubrachte. Auch fand ich ein Werk von Defoe ›Essay über Projekte‹ und ein anderes von Dr. Mather unter dem Titel ›Essays über rechtliches Handeln‹, die mir vielleicht einen Hang zum Nachdenken gaben, der einen Einfluß auf einige der Hauptereignisse meines späteren Lebens hatte.
Meine Vorliebe für Bücher bestimmte meinen Vater endlich, einen Buchdrucker aus mir zu machen, obgleich er schon einen seiner Söhne (James) in diesem Geschäft hatte. Mein Bruder war im Jahre 1717 mit einer Presse und Typen aus England zurückgekehrt, um in Boston eine Druckerei zu errichten. Dies Gewerbe gefiel mir bei weitem besser als das meines Vaters, obschon ich noch immer eine Vorliebe für die See hegte. Um den möglichen Folgen dieser Neigung vorzubeugen, konnte mein Vater es gar nicht abwarten, mich bei meinem Bruder untergebracht zu sehen. Einige Zeit weigerte ich mich, endlich aber ließ ich mich überreden und Unterzeichnete den Lehrbrief, als ich erst zwölf Jahre alt war. Es wurde ausgemacht, daß ich bis zum einundzwanzigsten Jahr in die Lehre gehen und nur im letzten Jahr den Lohn eines Gesellen erhalten sollte. In kurzer Zeit machte ich große Fortschritte in diesem Gewerbe und wurde sehr brauchbar für meinen Bruder. Jetzt hatte ich Zutritt zu besseren Büchern. Eine Bekanntschaft mit Buchhändlerlehrlingen machte es mir möglich, dann und wann einen Band zu borgen, den ich gewissenhaft bald und rein zurückgab. Oft verbrachte ich den größeren Teil der Nacht lesend in meinem Zimmer, wenn mir ein Buch am Abend geliehen worden war, das am anderen Morgen zurückgegeben werden sollte, damit es nicht vermißt oder gesucht würde. Nach einiger Zeit erregte ich die Aufmerksamkeit des Mr. Mathew Adams, eines hochbegabten Handelsmanns, der eine schöne Büchersammlung besaß und oft in die Druckerei kam. Er lud mich ein, seine Bücher anzusehen und war so gütig, mir einige, die ich gern lesen wollte, zu leihen. Damals ergriff mich eine seltsame Leidenschaft für die Dichtkunst, und ich verfaßte mehrere kleinere Stücke. Mein Bruder glaubte, dabei auch auf seine Rechnung kommen zu können und ermunterte und veranlaßte mich, zwei Gelegenheitsballaden zu schreiben. Die eine schilderte unter dem Titel ›Die Leuchtturmtragödie‹ den Wellentod des Kapitän Worthilake und seiner beiden Töchter, die andere war ein Seemannslied auf die Gefangennehmung des bekannten Piraten Teach oder Blackbeard (Schwarzbart). Es waren, was den Stil anlangt, jämmerliche Verse, wahrhafte Gassenhauer; als sie aber gedruckt waren, sandte mich mein Bruder in der Stadt herum, sie zu verkaufen. Die erste hatte ungeheuren Absatz, weil der Vorfall noch neu war und viel Aufsehen erregte. Dies schmeichelte meiner Eitelkeit; aber mein Vater wußte meinen Jubel durch Verspottung meiner Erzeugnisse und die Bemerkung zu dämpfen, daß Versemacher meist Bettler seien. Auf diese Weise entging ich dem Schicksal, ein Dichter – und höchstwahrscheinlich ein sehr schlechter – zu werden. Da aber meine Gabe, in Prosa zu schreiben, im Laufe meines Lebens mir so sehr zustatten gekommen ist und vorzüglich mein Emporkommen förderte, so will ich berichten, durch welche Mittel ich in meiner Lage die schwache Fertigkeit erwarb, die ich vielleicht hierin besitze.
Franklin mit Mitarbeitern seiner Druckerei
Es gab in der Stadt noch einen jungen Bücherwurm, einen gewissen John Collins, mit dem ich vertrauten Umgang hatte. Wir disputierten häufig miteinander und waren auch so versessen, uns gegenseitig etwas zu beweisen, daß uns nichts lieber war als ein Wortkampf. Diese Neigung zum Streit hat aber, wie ich nur im Vorbeigehen bemerken will, das Gefährliche, in eine schlimme Gewohnheit auszuarten, und macht oft die Gesellschaft eines Mannes unerträglich, weil sie den Widerspruchsgeist notwendig zur anderen Natur macht. Abgesehen von der Bitterkeit und dem Hader, die sie in das Gespräch bringt, erzeugt sie auch oft Abneigung, ja Haß unter Personen, zwischen denen Freundschaft durchaus angebracht ist. Ich hatte sie in meines Vaters Hause durch das Lesen religiöser Streitschriften angenommen. Seitdem habe ich bemerkt, daß Männer von Verstand selten auf diesen Abweg geraten – Rechtsgelehrte, Studenten und Leute jeden Standes, die in Edinburgh erzogen wurden, ausgenommen.
Collins und ich gerieten eines Tages in einen Streit über die Zweckmäßigkeit der Erziehung des weiblichen Geschlechts in den Wissenschaften und über dessen Befähigung für das Studium. Collins war der Ansicht, die höhere Bildung passe nicht für das weibliche Geschlecht und dieses sei ihm auch von Natur aus nicht gewachsen. Ich ergriff die Gegenpartei, vielleicht nur aus Lust am Streit. Die Natur hatte ihm größere Rednergabe verliehen; die Worte strömten in Massen von seinen Lippen, und er bezwang mich mehr durch seine Zungenfertigkeit als durch die Kraft seiner Beweise. Als wir voneinander schieden, ohne uns in der Sache geeinigt zu haben, und da wir uns eine Zeitlang nicht sprechen konnten, brachte ich meine Gedanken zu Papier, fertigte eine saubere Abschrift an und schickte sie ihm. Er antwortete, und ich erwiderte nochmals. Wir hatten jeder drei oder vier Briefe geschrieben, als meinem Vater zufällig meine Papiere zu Gesicht kamen und er sie las. Ohne sich auf den Streit selbst einzulassen, nahm er die Gelegenheit wahr, über meine Schreibweise mit mir zu reden. Er bemerkte, daß ich zwar in Rechtschreibung und richtiger Interpunktion, die ich meinem Beruf verdankte, meinem Gegner überlegen sei, aber ihm in der Gewandtheit des Ausdrucks, in der Methode und Klarheit weit nachstehe. Er überzeugte mich davon durch mehrere Beispiele. Ich erkannte die Wahrheit seiner Bemerkungen, verwandte von da an mehr Sorgfalt auf die Sprache und entschloß mich zu größter Anstrengung, um meinen Stil zu verbessern.
Etwa um diese Zeit fiel mir ein einzelner Band des ›Spectator‹ in die Hände. Es war der dritte. Ich hatte dies Werk noch nie gesehen, kaufte den Band, las ihn mehrmals und war ganz entzückt davon. Ich hielt den Stil für ausgezeichnet und wünschte mir nur die Fähigkeit, ihn nachahmen zu können. In dieser Absicht wählte ich einige Aufsätze aus, brachte den Sinn jeder Periode in einen kurzen Auszug, legte das Ganze einige Tage beiseite, versuchte dann, ohne einen Blick in das Buch zu werfen, die Aufsätze in ihrer ursprünglichen Abfassung wieder herzustellen, kurz, jeden Gedanken, wie er sich im Original befand, wiederzugeben, indem ich die geeignetsten Worte gebrauchte, die mir einfielen. Nachher verglich ich meinen ›Spectator‹ mit dem wirklichen, fand einige Fehler, die ich verbesserte, erkannte aber auch, daß es mir an einem Vorrat von Wörtern sowie an der Fertigkeit, mich ihrer zu entsinnen und sie zu gebrauchen, mangelte, in deren Besitz ich nach meiner Ansicht damals längst gewesen wäre, wenn ich fortgefahren hätte, Verse zu machen. Der fortwährende Bedarf an Wörtern derselben Bedeutung indessen, wegen des Versmaßes von verschiedener Länge oder wegen des Reimes von verschiedenem Klang, hätte mich gezwungen, eine Menge Synonyma zu suchen und ihrer Herr zu werden. In diesem Glauben wählte ich einige Erzählungen aus dem ›Spectator‹, schrieb sie in Verse um, und nach Verlauf einiger Zeit übertrug ich sie, wenn sie meinem Gedächtnis genugsam entschwunden waren, wieder in Prosa.
Bisweilen warf ich auch wohl alle meine Auszüge durcheinander und versuchte dann einige Wochen später, sie wieder in die gehörige Ordnung zu bringen, ehe ich an die Bildung der vollen Sätze und die Abfassung der Aufsätze ging. Dies sollte mich Methode in der Anordnung meiner Gedanken lehren. Verglich ich später meine Arbeit mit dem Original, so entdeckte und verbesserte ich manche Fehler; aber bisweilen genoß ich auch die Befriedigung, mir einzubilden, ich sei in gewissen untergeordneten Einzelheiten so glücklich gewesen, Methode oder Ausdruck zu verbessern, und dies ermutigte mich zu der Hoffnung, daß ich es mit der Zeit noch zu einem guten Stil im Englischen bringen würde, der das Hauptziel meines Ehrgeizes war. Die Zeit, die ich diesen Übungen und dem Lesen zuwandte, waren der Abend nach beendetem Tagewerk, der Morgen, ehe dieses begann, und der Sonntag, wenn ich in der Druckerei allein sein konnte. Ich wich nämlich dem gewöhnlichen Besuch des öffentlichen Gottesdienstes soviel wie möglich aus, den mein Vater von mir verlangte, solange ich noch unter seiner Obhut war, und den ich in Wirklichkeit noch immer für eine Pflicht hielt, obschon ich, wie es mir scheinen wollte, nicht die Zeit zu seiner Ausübung erübrigen konnte.
Als ich ungefähr sechzehn Jahre alt war, fiel mir ein Werk von einem gewissen Tryon in die Hände, in dem er die Pflanzennahrung empfiehlt. Ich beschloß, mich derselben ebenfalls zu bedienen. Mein Bruder war unverheiratet, hatte noch keinen eigenen Haushalt, sondern speiste mit seinen Lehrlingen bei einer nahebei wohnenden Familie. Meine Weigerung, Fleischspeisen zu essen, wurde unpassend gefunden und ich oft wegen meiner Sonderbarkeit ausgescholten. Ich merkte mir die Art und Weise, wie Tryon einige seiner Gerichte bereitete, namentlich wie Kartoffeln und Reis gekocht und Schnellpudding gebacken würden. Dann erklärte ich meinem Bruder, wenn er das halbe Wochengeld, welches er für meine Beköstigung zahle, mir geben wollte, so würde ich mich selbst beköstigen. Er nahm mein Anerbieten sofort an, und ich erkannte bald, daß ich von dem, was er mir gab, noch die Hälfte zurücklegen konnte. Dadurch erlangte ich einen Grundstock zum Ankauf von Büchern, abgesehen von einem anderen Vorteil, der mir aus diesem Verfahren erwuchs. Wenn mein Bruder und die Arbeiter die Druckerei verließen, um zu Tisch zu gehen, so blieb ich zu Hause. Nachdem ich mein einfaches Mahl verzehrt hatte, das häufig nur aus einem Zwieback oder einer Brotschnitte und einer Handvoll Rosinen oder einem Obstkuchen vom Pastetenbäcker und einem Glas Wasser bestand, konnte ich die übrige Zeit bis zu ihrer Rückkehr auf meine geistige Ausbildung verwenden, worin ich um so größere Fortschritte machte, als mein klarerer Kopf und meine raschere Auffassung eine gewöhnliche und natürliche Folge der Mäßigkeit im Essen und Trinken waren.
Damals mußte ich mich eines Tages wegen meiner Unwissenheit im Rechnen schämen, dessen Erlernung ich bei zweifacher Gelegenheit während meiner Schuljahre versäumt hatte; ich nahm daher Cockers Rechenbuch vor und arbeitete es mit der größten Leichtigkeit durch. Auch las ich ein Buch über Schifffahrtskunde von Seiler und Shermy und machte mich noch mit den Anfangslehren der Geometrie vertraut, die dieses enthält, brachte es aber nie weit in dieser Wissenschaft. Ungefähr um dieselbe Zeit las ich Lockes ›Vom menschlichen Verstande‹ und ›Die Kunst zu denken‹ von den Patres von Port-Royal.
Während ich auf die Verbesserung meines Stils hinarbeitete, fiel mir eine englische Grammatik in die Hände, wenn ich nicht irre von Greenwood, der zwei kurze Aufsätze über Rhetorik und Logik angehängt waren. In dem letzteren fand ich das Muster einer Disputation in der sokratischen Weise. Bald darauf verschaffte ich mir Xenophons Werk Denkwürdigkeiten von Sokrates‹, worin viele Beispiele dieser Methode zu finden sind. Diese Weise des Disputierens entzückte mich bis zur Begeisterung: Ich eignete sie mir an, gab mein System des reinen Widerspruches und der direkten und positiven Beweisführung auf und versetzte mich statt dessen in die Stellung eines schlichten Fragers. Da ich dann durch die Lektüre von Shaftesbury und Collins zu einem echten Zweifler in vielen Fragen unserer religiösen Lehre geworden war, hielt ich die Methode des Sokrates nicht allein für die passendste für mich, sondern auch für die verwirrendste für diejenigen, gegen welche ich sie in Anwendung brachte. Ich empfand dabei bald außerordentliches Vergnügen; unausgesetzt übte ich mich darin und wußte sehr gewandt selbst mir weit an Verstand überlegene Personen zu Zugeständnissen zu bringen, deren Folgen sie nicht voraussahen. So führte ich sie in Verlegenheiten, aus denen sie sich nicht herauswinden konnten, und oft gewann ich einen Sieg, den weder mein Streitobjekt noch meine Gründe verdienten. Dieses Verfahren setzte ich mehrere Jahre fort, gab es aber später allmählich auf und behielt nur die Gewohnheit bei, mich mit bescheidener Zurückhaltung auszudrücken und nie, wenn ich eine Behauptung aufstellte, die bestritten werden konnte, die Wörtchen ›bestimmt‹, ›unzweifelhaft‹ oder ähnliche zu gebrauchen, die den Verdacht erregen konnten, ich hinge meiner Ansicht hartnäckig an. Lieber sagte ich: ›ich stelle mir vor, ich vermuteoder es will mir scheinen, daß sich diese oder jene Sache aus dem und dem Grunde so und so verhält‹, oder ›wenn ich mich nicht irre, ist der Tatbestand so‹. Ich bin der Ansicht, daß mir diese Gewohnheit von außerordentlichem Nutzen war, wenn ich gelegentlich andere von meiner Ansicht überzeugen und zur Ergreifung von Maßnahmen überreden wollte, die ich empfohlen hatte. Da es doch der Hauptzweck jeder Unterhaltung ist, zu belehren oder belehrt zu werden, zu überzeugen oder zu überreden, so möchte ich wohl, daß verständige und wohlmeinende Männer ihre Mittel, sich nützlich zu machen, dadurch nicht selber schwächten, daß sie sich in so bestimmter und dogmatischer Weise ausdrücken, wodurch sie fast allemal das Mißfallen der Zuhörer erregen, einzig und allein den Widerspruch wecken und jede Absicht vereiteln, für welche die Gabe der Rede einem Menschen verliehen wurde: zum geistvollen Austausch, zum Geben und Empfangen von Informationen, zum Vergnügen. Mit einem Worte: willst du belehren und trägst deine Ansicht entschieden und rechthaberisch vor, so weckst du nur Widerspruch und vereitelst jedes aufmerksame Zuhören. Suchst du andererseits Belehrung und Vorteil aus den Kenntnissen anderer und drückst du dich so aus, als seiest du deiner Ansicht starr zugetan, so werden friedliche und kluge Leute, die keine Freunde vom Disputieren sind, dich ruhig bei deinen Irrtümern belassen. Wenn du einen solchen Weg einschlägst, hast du selten Hoffnung, deinen Zuhörern zu gefallen, ihr Vertrauen zu erwerben oder diejenigen zu überzeugen, die du gern zu deiner Ansicht hinüberziehen möchtest. Pope sagt ganz richtig: ›Man muß die Menschen so belehren, als ob man sie nicht belehrte, und unbekannte Dinge ihnen vortragen, als seien sie nur vergessen,‹ Und in demselben Gedicht rät er, ›… wenngleich bestimmt, doch mit scheinbarem Bedenken uns auszudrücken‹. Und diesen Zeilen hätte er noch eine beifügen können, die er an einer anderen Stelle, nach meiner Ansicht minder passend, mit einer anderen verband: ›Denn unbescheiden heißt auch unverständig sein.‹ Willst du wissen, warum ich sage minder passend, so muß ich die beiden Verse zusammen zitieren: ›Das unbescheidene Wort läßt sich durch nichts verzeihn: denn unbescheiden heißt auch unverständig sein.‹ Ist es denn nun aber Mangel an Verstand, sobald ein Mensch das Unglück hat, davon betroffen zu sein, und nicht vielmehr eine Art Entschuldigung seiner Anmaßung? Und lauteten nicht die Verse richtiger, wenn sie sagten: ›Das unbescheidene Wort mag nur der Satz verzeihn: nicht recht bescheiden heißt auch nicht verständig sein.‹
Ich überlasse aber die Entscheidung dieses Punktes besseren Richtern, als ich bin.
Im Jahre 1720 oder 1721 begann mein Bruder den Druck einer neuen Zeitung. Sie war die zweite, die in Amerika erschien, und zwar unter dem Namen ›New England Courant‹. Die einzige vor ihr schon vorhandene war der ›Boston News Letter‹. Einige seiner Freunde wollten, wie ich mich noch entsinne, ihm das Unternehmen ausreden, das doch wohl keinen günstigen Erfolg haben würde, indem nach ihrer Ansicht eine Zeitung für ganz Amerika genug sei. In diesem Augenblick aber, 1771, erscheinen ihrer nicht weniger als fünfundzwanzig. Er brachte aber doch sein Vorhaben zur Ausführung, und ich mußte jede Nummer erst setzen und drucken helfen, dann aber die Exemplare an die Kunden austragen. Er hatte einige begabte Männer unter seinen Freunden, die zu ihrem Vergnügen kleine Aufsätze für sein Blatt schrieben und dadurch demselben Ruf und einen vermehrten Absatz verschafften. Diese Herren kamen oft in unser Haus. Da ich der Unterhaltung und den Schilderungen von der günstigen Aufnahme ihrer Aufsätze oft zuhörte, so verspürte ich ebenfalls die Versuchung, ihrem Beispiel zu folgen. Ich war aber noch ein Knabe und fürchtete, mein Bruder werde in seinem Blatt keine Arbeit abdrucken wollen, als deren Verfasser er mich kenne; daher bemühte ich mich erfolgreich, mit verstellter Handschrift einen anonymen Aufsatz zu schreiben, und schob ihn nachts unter der Tür der Druckerei hindurch, wo er am anderen Morgen gefunden wurde. Mein Bruder teilte ihn seinen Freunden bei ihrem gewöhnlichen Besuch mit; sie lasen ihn, machten in meiner Gegenwart ihre Bemerkungen darüber, und ich hatte dann die große Freude zu sehen, daß er ihren Beifall erhielt und daß sie bei ihren verschiedenen Vermutungen, welche sie über den Verfasser anstellten, Namen nannten, die ihres Talentes und Geistes wegen einen bedeutenden Ruf im Lande genossen. Ich glaube heutzutage, daß ich damals besonderes Glück mit meinen Richtern hatte und daß sie vielleicht eigentlich keine so guten Kritiker waren, wie sie mir damals erschienen.