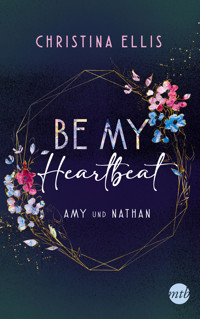
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ambrose Brothers
- Sprache: Deutsch
Solange mein Herz für dich schlägt ...
Amy ist krank. Todkrank. Doch sie ist festentschlossen, sich von ihrer Krankheit nicht aufhalten zu lassen und das Leben zu genießen. Bei einer Sitzung im Tattoo Studio trifft sie prompt auf den attraktiven Nathan. Amy fallen tausend Gründe ein, wieso sie sich von ihm fernhalten sollte. Aber so sehr sie ihn auch zu vergessen versucht, es will ihr einfach nicht gelingen. Nathan lädt sie zu einer Studentenparty ein, nimmt sie mit zum Surfen und verwandelt ihr Krankenhauszimmer in eine Strandbar. Noch nie hat Amy sich so lebendig gefühlt. Und sie ist bereit, für Nathan um ihr Leben zu kämpfen und damit alles zu riskieren …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Originalausgabe © 2023 by MIRA Taschenbuch in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Covergestaltung von zero-media.net, München Coverabbildung von FinePic®, München E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783745703665
www.harpercollins.de
Vorwort
Liebe Leser: innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr am Romanende eine Themenübersicht,
die demzufolge Spoiler enthalten kann.
Wir wünschen euch das bestmögliche Erlebnis
beim Lesen dieser Geschichte.
Euer Team von Mira
KAPITEL 1
KAPITEL 1
Amy
Ich war von zu Hause abgehauen und irrte durch die Straßen von Santa Barbara, kämpfte dabei mit meinem schlechten Gewissen und meinem Körper.
Verdammte Übelkeit.
Verdammte Müdigkeit.
Die Hitze des Tages tat ihr Übriges. Sie flimmerte auf dem Asphalt und ließ meinen Blick verschwimmen. Ich sehnte mich nach meinem Bett, doch ich hatte eine Mission und sah gar nicht ein, jetzt aufzugeben.
Endlich fand ich, wonach ich suchte: das kleine Tattoo-Studio, das ich im Internet entdeckt hatte. Es hatte gute Bewertungen, warb mit kurzen Wartezeiten und befand sich in einer ruhigen Seitengasse am Rand von Santa Barbara, etwa eine Meile von meinem Elternhaus entfernt. Eine Strecke, die ich in meinem Zustand gerade so noch hatte gehen können.
Ich war ein wenig enttäuscht vom Äußeren des Studios, das trostlos zwischen zwei Flachdach-Häusern stand. Da war kein riesiges Werbeschild über der Haustür. Nicht einmal Bilder hingen im Schaufenster. Lediglich ein Schriftzug klebte in schlichten Blockbuchstaben auf der Fensterscheibe: Dan’s Studio. Auch der Name zeugte von wenig Kreativität. Doch ich wusste, dass der Schein durchaus trügen konnte. Außerdem war es für einen Rückzieher jetzt ohnehin zu spät. Ich war zu müde und musste mich dringend setzen.
Tief durchatmen, befahl ich mir und kämpfte gegen den Schwindel und die Magenkrämpfe an. Nicht kotzen. Nicht zusammenbrechen. Weiter!
Bevor ich es mir anders überlegen konnte, riss ich etwas zu schnell die Tür des Ladens auf, kam ins Straucheln und wäre beinahe vornüber auf die Nase gefallen. Die Eingangsglocke untermalte meinen dramatischen Auftritt mit einem fröhlichen Klingeling! Ich fing mich in letzter Sekunde und stolperte zum Tresen. Er war aus Metall und wackelte bei meiner Berührung, genauso wie die blöde Perücke auf meinem Kopf.
Wenn ich die nächste Woche überlebe, besorge ich mir eine bessere, schwor ich mir. Das verdammte Ding war mir viel zu groß. Es hatte meinem Bruder gehört, ihm allerdings genauso wenig gepasst wie mir. Irgendwann war man jedoch an einem Punkt, wo so was einen nicht mehr störte.
»Komme gleich!«, rief mir eine dunkle Männerstimme zu. Ich sah mich suchend um, fand aber nur einen riesigen Paravent mit aufgedruckten Kranichen, der den Eingangsbereich vom Rest des Studios abtrennte. Der Sichtschutz hielt neugierige Blicke von den Kunden fern, verdeckte aber nicht das Summen der elektrischen Tätowiermaschine.
Ein Kribbeln jagte über meine Haut und durch meinen Körper. Eine Mischung aus Angst und Vorfreude. Tätowieren konnte gewiss nicht schlimmer sein als eine Chemotherapie. Ein Spaziergang im Vergleich. Hoffentlich.
Das Brummen setzte aus. »Kannste kurz warten? Ich guck mal, wer da ist. Hab wohl vergessen abzuschließen. Sorry.« Ich wartete mit klopfendem Herzen und sinkendem Mut. Eigentlich hatte ich im Studio anrufen wollen, dann aber Angst bekommen. Einfach einen Termin auszumachen, war nicht genug. Da war das Risiko zu hoch, dass ich doch noch kniff. Nein. Ich musste persönlich hierherkommen und es einfach hinter mich bringen.
Ein bärtiger Typ tauchte hinter dem Sichtschutz auf. Er war die klischeehafte Verkörperung eines Tätowierers: über und über mit kunstvollen Bildern verziert, die Lippen und Augenbrauen gepierct, schwarze Hose, weißes Muscle-Shirt. Insgesamt sah er sehr gepflegt aus. Selbst seine Glatze wirkte wie herausgeputzt. Poliert.
»Kann ich dir helfen?«, begrüßte er mich, nachdem er mich in etwa so intensiv gemustert hatte wie ich ihn. Dabei war er eindeutig zu dem Schluss gekommen, dass ich hier nichts verloren hatte.
»Ich hätte gerne ein Tattoo«, platzte ich heraus und ärgerte mich prompt über mich selbst. Warum sonst sollte ich wohl hier sein? »So schnell wie möglich. Wäre heute machbar?«, setzte ich noch hinzu und knetet nervös meine Hände.
»Wir sind ausgebucht.« Er zog eine Augenbraue hoch.
Das hatte ich befürchtet, aber so schnell gab ich kurz vorm Ziel nicht auf. »Das stand im Internet aber anders«, entgegnete ich. »Da werben Sie mit kurzen Wartezeiten.« Obwohl ich aufgeregt war, hörte und sah man es mir nicht an. Das hatte ich mittlerweile perfektioniert: Angesichts von finster dreinblickenden Ärzten hatte ich mir ein Pokerface zugelegt, bei dem jeder Profispieler vor Neid erblassen würde.
»Mir egal, was im Internet steht. Ich hab keine Termine mehr bis Januar. Kannste so lange warten?«
Puh. Jetzt war Anfang September. Da brauchte ich kein Rechengenie zu sein. »Ne. Bis dahin bin ich vermutlich schon tot.«
Der Typ starrte mich an und versuchte zu ergründen, ob ich scherzte. Aber es war mir todernst. Buchstäblich.
»Sehr witzig«, brummte er verstimmt und deutete auf die Tür. »Über so was macht man sich nicht lustig. Und jetzt raus.«
Ich hatte nun zwei Möglichkeiten: Entweder ich trollte mich oder ich ging zum Gegenangriff über. Da aufgeben nicht zu meinem Naturell passte, tat ich Letzteres, zog mit viel Schwung meine Perücke vom Kopf und deutete auf die darunter sichtbare Glatze. »Die hab ich einer Chemo zu verdanken, damit ich eine akute myeloische Leukämie überlebe. Das ist jetzt zwei Jahre her.« Warum meine Haare bisher nicht nachgewachsen waren, hatte mir niemand erklären können. »Ich habe mir jedenfalls damals geschworen, dass ich mir ein Tattoo stechen lassen würde, sobald ich den Krebs besiegt habe.« Ich machte eine Pause. »Ich habe ihn besiegt, also hätte ich gerne ein Tattoo.« Ich überlegte. »Bitte.« Konnte ja nicht schaden.
»Hast du nicht gerade gesagt, dass du bis Januar tot bist? Das klingt aber nicht danach, als hättest du den Krebs besiegt.«
Mist. Mein verdammtes Plappermaul war mal wieder zu schnell gewesen – und der Tätowierer zu aufmerksam. Sollte ich ihm jetzt wirklich meine gesamte Leidensgeschichte erzählen? Dass ich den letzten Krebs durchaus besiegt hatte, worauf zumindest meine guten Werte hatten schließen lassen? »Sagen wir so: Meine Blutwerte könnten momentan besser sein. Aber noch ist nicht raus, ob die Leukämie zurück ist,« sagte ich stattdessen. Dass ich selbst vom Schlimmsten ausging, ließ ich lieber unerwähnt. Denn obwohl AML normalerweise gut behandelbar war, hatte ich anscheinend weniger Glück. »Wichtig ist trotzdem, dass ich schnell ein Tattoo brauche.« Ich probierte es mal mit einem strahlenden Lächeln. Man wusste ja nie.
Der bärtige Typ, Marke Wikinger, starrte meine Glatze an, als wäre sie das Symbol des Todes. Angesichts der Tatsache, dass er selbst eine hatte, war das natürlich lächerlich. Doch gerade diese Gemeinsamkeit trennte uns mehr voneinander als jede Gegensätzlichkeit. Er, ein Typ schätzungsweise Mitte vierzig, der sich wohl aus kosmetischen Gründen einen Kahlkopf hatte rasieren lassen. Ich, eine junge Frau mit einundzwanzig Jahren, die sich das Ganze nicht ausgesucht hatte.
»Ich … also … äh«, begann der Tätowierer.
»Ich schätze, an dieser Stelle übernehme dann wohl ich. Bevor du dich noch mehr zum Narren machst.« Ein junger Mann trat hinter dem Sichtschutz hervor und klopfte dem Tätowierer freundschaftlich auf den Rücken.
Als Erstes bemerkte ich seine warmen braunen Augen, aus denen heraus er mich wach ansah. Als Nächstes seinen nackten Oberkörper, seine durchaus gut definierten Brustmuskeln und die breiten Schultern. Einen Moment konnte ich ihn einfach nur anstarren.
Wenn er wenigstens hässlich gewesen wäre! Dann hätte ich mich wieder auf das Gespräch konzentrieren können. So aber war mein Gehirn nicht länger auf Streitgespräch, sondern auf Gaffen gepolt. Der Typ hatte perfekt geschwungene Augenbrauen. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Dazu ausgeprägte Wangenknochen, ein markantes Kinn und ein echt hübsches, spitzbübisches Grinsen.
»Ich bin Nathan«, sagte er und hielt mir seine Hand hin. Ich nahm sie eher mechanisch und schüttelte sie.
»Amy«, brachte ich hervor. »Freut mich.«
»Mich auch. Dieser um Worte ringende Wikinger hier ist Dan. Ihm gehört das Studio.«
»Ich kann selbst reden«, knurrte Dan. »Das ist immer noch mein Laden, und du bist nur ein Kunde.«
»Ganz genau, Dan. Doch wie es scheint, wolltest du gerade einer Schwerkranken nicht sehr taktvoll die Tür vor der Nase zuknallen. Bevor du das tust, solltest du noch mal über das Image des Ladens nachdenken.«
»Ich bin der beste Tätowierer in ganz Santa Barbara«, konterte er. »Da brauch ich kein gutes Image. Mädchen, das mit deiner potenziell zurückgekommenen Leukämie tut mir echt leid, aber ich bin ausgebucht.«
»Wie wäre es denn jetzt?«, fragte ich zaghaft.
»Da hab ich diesen Knilch hier an der Backe. Bis sein Tattoo fertig ist, dauert es.«
»Ich hab Zeit mitgebracht und kann warten.«
»Vergiss es. Wenn ich mit Nathan fertig bin, hab ich frei. Außerdem werde ich den Teufel tun und einer Krebskranken Tinte unter die Haut stechen. Ob potenziell erneut krank oder nicht ist mir dabei völlig egal.«
Ich zog eine Augenbraue hoch. »Bevor die Tinte mich umbringen könnte, hat mich der Krebs wahrscheinlich ohnehin besiegt. Da machen Sie sich mal keine Sorgen.«
Der Wikinger starrte mich zwei Sekunden an, dann wandte er sich Nathan zu. »Ich kann mit ihrem Humor nix anfangen«, brummte er. »Meint sie das jetzt ernst?«
»Sie will dich nur aus der Reserve locken.« Nathan klopfte Dan erneut auf den Rücken, als müsse er ihn wie ein Pferd beruhigen.
Ich nutzte derweil den Moment, um meinen Blick neugierig über seinen nackten Oberkörper wandern zu lassen. Er hatte ein Tattoo direkt über dem Herzen: Ein Rabe im Angriffsflug. Es sah jedoch alt aus. Dann entdeckte ich den Beginn eines neuen Tattoos am Oberarm.
»Was lässt du dir stechen?«, fragte ich ihn.
»Die Eulersche Identität.«
»Die was?«
»Die Eulersche Identität. Die schönste Matheformel aller Zeiten. Sie enthält die fünf wichtigsten Zahlen der Mathematik. Cooler geht nicht. Im Moment sieht es aber eher nach einem Fleischklops aus.« Nathan verdrehte den Kopf, um die Farbkleckse an seiner Schulter betrachten zu können. »Vielleicht eher wie eine Frikadelle«, stellte er fest.
Ich lachte leise, selbst wenn ich mich an die Eulersche Identität wirklich nur ganz blass erinnerte. Dass sich jemand eine Matheformel als Tattoo stechen ließ, lag zudem jenseits meiner Vorstellungskraft. »Sobald es fertig ist, sieht es bestimmt grandios aus«, versuchte ich dem Tätowierer zu schmeicheln, doch der starrte mich weiter finster an.
»Mir reicht was winzig Kleines«, versuchte ich es erneut. »Ein Schriftzug zum Beispiel. Mit dem Namen meines verstorbenen Bruders. Es ist auch nur ein kurzer Name. Ben.«
Dan wurde noch blasser. »Die Frau macht mich fertig«, sagte er zu Nathan und dann an mich gewandt: »Ob toter Bruder oder nicht. Ich hab keine Zeit. Und solche Tattoos steche ich nicht. Namen zu tätowieren … Das ist keine Kunst, sondern eine Beleidigung. Damit kannste mal schön zu den Touristenfallen am Strand gehen. Da bekommste so komische Unendlichkeitszeichen, hässliche chinesische Symbole, die in Wirklichkeit was anderes bedeuten als behauptet und Kätzchen mit Wollknäueln. Ich bin Künstler und hab einen Ruf zu verlieren. Und eins kannste mir glauben: Ich werde auf keinen Fall kleine Mädchen mit Krebs tätowieren. Schon mal was von Immunreaktion gehört? Wenn du mich also entschuldigst … Nathan? Kommst du?«
Damit floh der Hüne rasch hinter den Paravent. Ja, er floh.
Nathan sah ihm hinterher, rührte sich jedoch nicht. Stattdessen musterte er mich eingehend. »Du ziehst hier gerade alle Register, nicht wahr?«, fragte er.
»Ja. Mir bleibt nicht viel Zeit. Ich habe mir und meinem Bruder geschworen, dieses verdammte Tattoo stechen zu lassen. Als Zeichen für unseren gemeinsamen Kampf und dafür, dass ich mich nicht unterkriegen lasse. Nie. Schon gar nicht vom Krebs.« Ben hatte es nicht geschafft – er war vom Krebs besiegt worden. Als ich Nathan das sagte, schaute er erst mitleidig, dann besorgt und dann zweifelnd. »Jetzt guck nicht so. Ich weiß, dass sich ein Tattoo und Chemo nicht besonders vertragen. Aber gerade wegen der potenziellen Risiken habe ich zwei Jahre mit dem Tattoo gewartet. Dass meine Werte plötzlich nicht mehr ganz so perfekt sind, kam recht unerwartet. Daher muss ich mich beeilen, solange ich noch als gesund gelte.«
»Vielleicht hörst du in diesem Fall besser auf Dan. Verzichte auf das Tattoo und warte die genaue Diagnose der Ärzte ab.« Nathans Stimme war sanft.
Ich hob den Kopf und starrte ihm in die Augen. In diese warmen, braunen, verständnisvollen Augen. »Dieses Tattoo ist mein Zeichen dafür, dass ich den Krebs besiegen konnte. Ich brauche dieses Tattoo für mich. Als Symbol, dass ich das auch noch mal packen kann.«
Nathan erwiderte meinen Blick. Eine Sekunde. Zwei. Er musterte mich so intensiv, dass ich es als Kribbeln am ganzen Körper spürte. Zu meiner Überraschung nickte er schließlich. »Kann ich verstehen«, sagte er schlicht.
Dieser eine Satz bedeutete mir die Welt. Meine Freunde von der Selbsthilfegruppe hatten mich für verrückt erklärt. Sogar der Tätowierer hielt mich für irre. Dass Nathan, ein Fremder, es verstand, half mir mehr, als ich sagen konnte. Unverzüglich kramte ich in meiner Manteltasche herum und zog eine Fünf-Dollar-Note und eine verschlissene Einkaufsmarke hervor. »Was meinst du? Sticht er mir für das Geld zumindest das B?«
Mit Nathans Reaktion hatte ich nicht gerechnet. Ich war es mittlerweile gewohnt, dass die Leute bei der Erwähnung meines toten Bruders peinlich berührt schwiegen und allerlei Unsinn von sich gaben, um die Stille zu füllen. Nathan hingegen lachte über meinen eigentlich gar nicht als Scherz gemeinten Satz. Er lachte so sehr, dass er den Kopf in den Nacken warf und der Laut seiner Stimme in meinen Ohren vibrierte.
»Aus welchem Jahrhundert kommst du denn?«, fragte er. »Dafür bekommst du nicht mal sein Portfolio gezeigt.« Kopfschüttelnd hob er die Hand, hielt sie mir hin. Ich verstand zunächst nicht, sondern starrte sie lediglich verwirrt an.
»Komm mit«, sagte er zur Erklärung. »Wir überzeugen den Sturkopf, dir deinen Mutmacher zu stechen. Ich vermache dir meinen Termin und gebe dir einen Vorschuss auf dein erstes Tattoo. Alternativ bieten wir Dan an, das Geld abzuarbeiten. Du wärst bestimmt ein prima Kundenschreck für ungewolltes Publikum.«
Ich sah ihn zunächst verdutzt an, dann musste ich lachen. Normalerweise war ich es, die meine Krankheit als Waffe nutzte, um Leuten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dass das jemand anderes machte, war ungewohnt und auf seltsame Weise cool.
So wie der gesamte Kerl, der da noch immer mit seiner nackten Brust vor mir stand. Nathan strahlte eine Lässigkeit aus, die mich beeindruckte. Als könnte er die Welt mit nur einem Lächeln erobern.
Ich war dankbar für sein Angebot. Durch ihn war ich dem Ziel zum Greifen nahe, also durfte ich nicht zögern. Entschlossen nahm ich seine Hand. Sie war warm, rau und seltsam vertraut. Ein erstaunliches Gefühl. Vor allem, weil mich sein Griff kurioserweise erdete. Als strahlte seine Ruhe auf mich über.
Plötzlich zog er mich näher, um mir etwas ins Ohr zu flüstern. Als sein Atem meine Wange streifte, bekam ich peinlicherweise eine Gänsehaut. Nur eine ganz leichte, aber sie war da.
Seine Nähe. Seine Berührung. Sein Geruch. Das brachte meinen gesamten Körper durcheinander – und meine Gedanken. Seit mein Leben komplett aus den Fugen geraten war, hatte ich keinen Körperkontakt mehr zu anderen Leuten gehabt. Mal abgesehen von Krankenschwestern, Ärzten oder meinen Eltern. Kein Wunder, dass ich jetzt kurz durchdrehte.
»Wenn du bei Dan punkten willst, dann suchst du dir ein Eulentattoo raus. Frag mich nicht, aber der große Kerl steht voll auf die Tierchen«, flüsterte Nathan. »Nimm ja keine Katzen. Die findet er zu ausgelutscht. Wähl noch einen kreativen Schriftzug, und Dan ist Wachs in deinen Händen. Aber hör auf über Tod und Leukämie zu reden. Da fühlt er sich unwohl.«
Nathan lief los, ins Innere des Tattooladens hinein. Da er meine Hand noch immer festhielt, blieb mir nichts anderes übrig, als hinter ihm her zu stolpern. Jetzt bloß nicht der Länge nach hinfallen.
»Eulen?«, fragte ich zweifelnd, sobald ich wieder Luft gefunden hatte. Doch weiter nachhaken konnte ich nicht, da wir bereits vor Dan standen. Der hockte auf seinem Drehstuhl und hielt die Tätowiermaschine wie eine Waffe vor sich. Als er uns sah, verfinsterte sich seine Miene.
»Ich hab ihr meinen Termin gegeben«, sagte Nathan, bevor Dan irgendetwas von sich geben konnte. »Amy, setz dich!«
Ich hüpfte hastig auf den Stuhl. Um mich hier wieder wegzubekommen, würde Dan mich schon mit Gewalt runterziehen müssen.
»Mensch, Nathan. Das hast du nicht zu entscheiden.« Dan wurde langsam ärgerlich. »Ich müsste hier erst mal alles desinfizieren, bevor ich mit einem neuen Kunden starten könnte. Und überhaupt … Ich tätowiere keine Namen. Punkt. Außerdem lass ich dich bestimmt nicht mit deiner Bulette auf dem Arm aus meinem Studio latschen. Das können wir so nicht lassen!«
Wir sahen wie auf Kommando allesamt auf das seltsame Gebilde auf Nathans Arm. »Ich mag Buletten. Und wenn mich einer fragt, sag ich halt, ich hätte dich zu dem Bild gezwungen. Jetzt hör auf, so eine Diva zu sein und hilf der Krebskranken.«
Autsch. Dan und ich zuckten gemeinsam zusammen. Ein Blick in Nathans funkelnde Augen genügte mir aber, um seinen letzten Satz einordnen zu können. Er hatte Dan aus der Reserve locken wollen. Sein Plan ging auf. Dans Blick wurde tatsächlich mit einem Schlag etwas weicher.
»Okay, Mädchen. Wir machen das so: Ich mal dir ein Tattoo. Mit Henna. Lach nicht, Nathan, das kann ich tatsächlich. Bin ich sogar richtig gut drin. Aber bei aller Liebe: Wenn du schon eine Chemo hattest und womöglich die nächste ansteht, ist dein Immunsystem im Arsch. Und zwar komplett. Ich will dich nicht umbringen, selbst wenn du mir echt auf den Zeiger gehst. Die Nummer ist mir zu heiß. Solltest du überleben, dann stech ich dir so viele Namen von toten Brüdern, wie du willst. Umsonst. Deal?«
Er hielt mir die Hand hin, und ich zögerte keine Sekunde. Ich schlug ein. Dan legte seine Tätowiermaschine zur Seite und kam mit einer kleinen Tube zurück. »Ich nehme die braune, naturbelassene Paste. Erscheint mir sicherer«, sagte er zu mir. Er setzte sich und bedeutete mir, meinen Arm nach vorne zu strecken. Aufgeregt tat ich wie geheißen und fragte mich gleichzeitig, was er vorhatte.
»An dem Arm will ich das Tattoo aber gar nicht haben«, merkte ich an.
»Das macht nichts.« In Sekundenschnelle malte Dan frei Hand mit einem winzigen Pinsel ein wunderschönes filigranes Gänseblümchen auf meinen Unterarm. Es war nicht größer als mein Daumennagel. »Ich mach erst mal einen Allergietest. Wenn das kleine Ding hier nichts auslöst, dann können wir den Schriftzug in Angriff nehmen.«
Ich starrte die Blume einen Moment an. »Das Gänseblümchen steht symbolisch für Leid«, sagte ich traurig.
»Und für Kraft und Unerschütterlichkeit.«
»Gibt es das Wort überhaupt?«
»Wenn du mich fragst, dann verkörperst du es. Komm in zwei Stunden wieder oder setz dich hinten in den Wartebereich. Sollte deine Haut sich nicht gerötet haben, können wir loslegen.«
Ich war entsetzt. »Zwei Stunden? So lange kann ich nicht warten! Ich muss zurück.«
Dan wechselte einen kurzen Blick mit Nathan, dann zog er die Schultern hoch. »Tut mir leid. Da lass ich nicht mit mir reden.«
Ich spürte, wie mich meine Kampfeslust abrupt verließ. Das war es also mit meinem Freiheitsplan. Meinem Versuch, etwas Verrücktes zu tun. Ich hatte gewagt, aus meinem Alltag auszubrechen. Mich etwas zu trauen. Einen lange gehegten, für mich immens wichtigen Traum zu verwirklichen. Doch selbst das gelang mir nicht. Wegen dem, was mein Körper mir antat.
In Dans Augen sah ich bereits, dass ich verloren hatte. Er würde keinen Schritt weiter auf mich zugehen. »Dann eben nicht«, sagte ich müde und schob mich von der Liege. Mir war etwas schwindelig, aber damit kam ich klar. Mein Kreislauf war seit Tagen das Allerletzte. Normalerweise folgten auf schlechte Zeiten auch immer wieder gute Momente. Dann ging es mir wieder relativ okay. Leider ließen die guten Tage schon etwas länger auf sich warten.
»Viel Erfolg mit deiner Bulette.« Ich nickte Nathan zu und strebte gen Ausgang. Auf keinen Fall würde ich hier in dem Studio darauf warten, ob sich auf meiner Haut was tat. Das verkrafteten meine Nerven nicht. Außerdem war es mir hier drin zu stickig. Luft. Ich brauchte Luft. Aber zwei Stunden durch die Gegend streunen? Das war unmöglich.
Natürlich war mir eigentlich klar, dass Dan richtig handelte. Kein normaler Tätowierer hätte einer jungen Frau in meinem Zustand ein Tattoo gestochen. Echt nicht. Tief in mir drin wusste ich das, aber es tat trotzdem weh, es einzusehen. Diese Schlacht war definitiv verloren.
Die Türklingel verabschiedete mich mit einem sanften Klingeling! Abermals stolperte ich über die verflixte Eingangsstufe, fing mich aber noch. Nach Atem ringend blieb ich stehen und blinzelte gegen die Sonne an. Mittagszeit. Auch das noch. Im September kletterten die Temperaturen auch mal gerne auf bis zu dreißig Grad. Mir brach der Schweiß aus, und meine Beine begannen zu zittern.
Und was nun?
Ich konnte natürlich weiter meinem Plan folgen und einem Tattoo hinterherjagen. Unten am Strand könnte ich einen Tätowierer finden, der sich nur für mein Geld interessierte und sich nicht um Verantwortung gegenüber seinen Kunden scherte. Doch ich musste realistisch sein: Bis zum Strand war es zu weit, und ich war müde. Zu müde.
In dieser Sekunde wurde mir klar, dass ich ein ernstes Problem hatte. Ich hatte mir zu viel vorgenommen, hatte zu viel gewagt. Der Preis dafür würde hoch sein. Sehr hoch.
Ach, Amy dachte ich bitter. Gib das Kämpfen einfach auf und füg dich deinem Schicksal. Du kannst ihm eh nicht entkommen.
KAPITEL 2
KAPITEL 2
Nathan
Ich starrte Dan beunruhigt an. »Wir können sie doch nicht einfach gehen lassen«, sagte ich zu ihm.
Dan zuckte mit den Schultern. »Reisende soll man nicht aufhalten.«
»Aber sie war leichenblass.«
»Sie ist ja sofort rausgestürmt. Was hätte ich denn tun sollen? Sie kam freiwillig und ist freiwillig wieder gegangen. Ist besser so. Glaub mir.«
Vermutlich hatte er recht. Amy ging mich nichts an. Ich hatte ihr meinen Termin überlassen. Mehr nicht. Alles andere war jetzt ihr Problem. Zumindest theoretisch. Aber mal ehrlich: Sie in diesem Zustand gehen zu lassen, war unverantwortlich.
Dan packte bereits die Hennafarbe zusammen und sprühte Desinfektionsspray auf den Stuhl. Für ihn war die Sache erledigt. Aus den Augen, aus dem Sinn.
Mir hingegen krampfte sich der Magen zusammen. Das war nicht richtig. Amy brauchte Hilfe. Sie hatte es nicht gesagt, doch das war offensichtlich gewesen. Die Blässe ihrer Haut hatte mir nicht gefallen, genauso wenig wie der Blick in ihren Augen. Als sie hier reingekommen war, hatte sie so kämpferisch gewirkt. So voller Energie. Gegangen war sie als völlig erschöpfte Kranke.
Dabei hatte sie das Tattoo doch aufbauen sollen.
Nein. Das ging so gar nicht. Was für Menschen wären wir, wenn wir sie in diesem Zustand allein ließen?
»Ich gehe ihr nach«, sagte ich entschlossen und schnappte mir bereits mein Hemd. Dabei fiel mein Blick auf eine einsam zurückgelassene Perücke auf dem Stuhl. Amy hatte sie vergessen. Gut, dann hatte ich wenigstens eine Ausrede, um ihr hinterherzurennen. So, wie ich sie einschätzte, wurde sie nicht gerne bemuttert.
»Amy, warte!«, rief ich, als ich aus der Tür stürmte. Ich würde später noch einmal zu Dan zurückkehren, damit er das angefangene Tattoo desinfizierte und abklebte.
Sie war noch nicht weit gekommen. Gerade mal drei Schritte. Schwankte sie? »Du hast deine Perücke vergessen!«
Amy blieb stehen und drehte sich zu mir um. An der Art, wie sie den Kopf hielt, erkannte ich bereits alarmierende Anzeichen: kaum zu ertragende Kopfschmerzen. Sie nahm mir die Kurzhaarperücke eher mechanisch ab und zog sie sich auf den Kopf.
Das Teil stand ihr wirklich gar nicht und wirkte eher wie der hässlichste Sonnenhut der Welt. Außerdem sah sie damit aus wie ein Junge.
»Danke«, murmelte sie und wandte sich bergauf. Die Schultern verkrampft hochgezogen, den Kopf gesenkt. Das sah nicht gut aus.
Sag was, dachte ich. Lass sie jetzt nicht einfach gehen. Du musst sie nach Hause bringen. »Ich hab Dan runtergehandelt«, sagte ich spontan. Das war zwar eine Lüge, aber das musste sie in diesem Moment nicht wissen. Ein Problem nach dem anderen. Erst mal ging es mir nur darum, dass sie nicht alleine durch die Gegend lief. »In einer Stunde können wir wiederkommen. Dann macht er dir dein Tattoo.«
»Wir? Was meinst du mit wir?«
»Ich vertreibe dir die Wartezeit mit meiner charmanten Anwesenheit. Worauf hast du Lust? Ein Eis?«
Amy blieb stehen und warf mir den finstersten Blick aller Zeiten zu. Offenbar hatte ich es übertrieben. Mein Vorschlag mit dem Eis war wohl zu offensichtlich aus der Luft gegriffen gewesen. »Ich brauch kein Kindermädchen.«
»Aber Hilfe.«
»Ich komm klar.«
»Erzähl das deiner Großmutter. Dir geht’s scheiße.« Okay. Das hatte ich zu heftig gesagt, aber verdammt! Ich hasste es, wenn sich Leute partout nicht helfen lassen wollten. Mit gleich zwei Exemplaren dieser Sorte war ich aufgewachsen. Meine Brüder hatten grundsätzlich den Hang dazu, alles mit sich selbst ausmachen zu wollen. »Wie wäre es, wenn ich dich einfach ein Stück begleite?«, schlug ich etwas ruhiger vor. »Sobald es dir besser geht, bist du mich wieder los. Versprochen.«
Das zog tatsächlich. Amy entspannte sich und nickte sogar. »In Ordnung. Aber nur, wenn du dir endlich das verdammte Hemd überziehst. Neben dir komme ich mir noch hässlicher vor, als ich mich ohnehin schon fühle, und solange ich deine Brustmuskeln anstarren muss, kann ich nicht denken.«
Ich blinzelte überrascht. Okay … Mit der Wendung des Gesprächs hatte ich wahrhaftig nicht gerechnet. Aber wenigstens redete sie mit mir und wollte mich nicht länger verjagen. Das war doch schon ein Fortschritt. »Ich wollte keineswegs Showlaufen, sondern meinen Rücken schonen, weil ich da einen riesigen Sonnenbrand hab. Es brennt wie die Hölle, sobald der Stoff drüber schabt.« Ich drehte mich um, sodass sie einen geradezu obszön roten Rücken anstarren konnte. Die Haut pellte sich an verschiedensten Stellen, wie ich heute Morgen im Spiegel festgestellt hatte. Mir war der Sonnenbrand peinlich, aber wenigstens hatte ich ein Gesprächsthema.
»Autsch«, brachte Amy schwach hervor. »Schon mal was von Sonnencreme gehört? Soll gegen Hautkrebs helfen. Denn Krebs, das kannst du mir glauben, ist scheiße.«
Ich wandte mich ihr umgehend wieder zu und zog eine Augenbraue hoch. »Du bist echt die Königin darin, unangenehme Dinge von dir zu geben.«
»Das nennt man Sarkasmus. Oder Galgenhumor. Wo hast du dir denn diese brutale Verbrennung zugezogen?«
»Beim Surfen. Ich trag da normalerweise meinen Neoprenanzug, hab den aber am Strand zu lange runtergezogen getragen. Zack. Schon war’s passiert.«
Sie starrte mich an. Dann entließ sie zischend die offensichtlich angehaltene Luft. »Du gehst surfen?«, fragte sie kopfschüttelnd und lief urplötzlich wieder los.
Ich folgte ihr hastig und einigermaßen irritiert. »Was hab ich denn jetzt Falsches gesagt?«, fragte ich.
»Nichts. Alles gut.« Sie blieb wieder stehen, und es war klar, dass nichts wirklich gut an dieser Situation war. Immerhin sah sie mich zum ersten Mal, seit wir das Studio verlassen hatten, richtig an.
Aus diesen riesigen blauen Augen. Müde Augen. Erschöpfte Augen. Und trotzdem sah ich die Kämpferin darin aufblitzen, die ich im Laden gesehen hatte.
Leider schwankte sie in dieser Sekunde. Nur ganz leicht, aber ich hatte es trotzdem gesehen. »Wirst du etwa ohnmächtig?«, fragte ich mit einem Anflug von Panik in der Stimme.
»Mir ist kotzübel, und ich kämpfe mit meinem Mageninhalt. Außerdem dreht sich alles. Ich … müsste mich nur mal kurz hinsetzen. War wohl doch etwas viel.«
»Aber nicht da. Da liegen zwei Hundehaufen. Warte kurz.« Ich warf mein Hemd auf den Boden etwa fünf Schritte von uns entfernt. Dann berührte ich sanft ihre Oberarme und dirigierte sie zu der Stelle. Sie ließ es willenlos zu, was mir gar nicht gefiel.
Ich sorgte dafür, dass sie sich hinsetzen und sich gegen eine Häuserwand lehnen konnte. Schnell bekam sie wieder etwas Farbe im Gesicht. Sie atmete tief durch. Dass sie die Augen schloss, fand ich dennoch beunruhigend.
»Soll ich einen Krankenwagen rufen?«, fragte ich nach etwa zwanzig Sekunden vollkommener Stille zwischen uns.
»Soll ich dich schlagen?« fragte sie zurück. »Natürlich nicht! Mein Magen beruhigt sich bereits. Jetzt muss nur die Welt aufhören zu kreisen.«
»Okay … dann … Also wir könnten zurück zu Dan gehen. Der dreht zwar durch, würde aber helfen. Du könntest dich auf die Liege im Studio legen.«
Sie lachte humorlos auf. »Das können wir Dan nicht antun. Wirklich nicht. Es gibt Leute, die können mit kranken Menschen nichts anfangen. Und er scheint einer davon zu sein.« Langsam öffnete sie ihre Augen einen winzigen Spalt und blinzelte mich an. »Du kommst damit erstaunlich gut zurecht«, merkte sie an.
»Ich hab mich lange Jahre um meine kranke Katze gekümmert. Die hatte Epilepsie.«
»Du vergleichst ein sterbenskrankes Mädchen ernsthaft mit deiner unter Epilepsie leidenden Katze?«, fragte sie ungläubig.
»Durchaus. Sie hieß Luna. Ein wenig erinnerst du mich an sie. Sie mochte es ebenfalls nicht, wenn sie bei ihren Anfällen Zuschauer hatte. Sie wollte lieber allein leiden. Allerdings war sie weniger kratzbürstig als du.«
Wir tauschten einen Blick aus. Ein Blick, der mir durch und durch ging. Da war etwas an ihr, das mich zutiefst berührte. Mit Mitleid hatte das nichts zu tun. Im Gegenteil.
Amy gefiel mir.
Obwohl es ihr gerade echt dreckig ging, blitzte immer wieder ein feiner, andersartiger Humor auf, der mich faszinierte. Wie interessant mussten Gespräche mit ihr sein, wenn sie nicht gerade gegen eine Ohnmacht ankämpfen musste?
Außerdem war sie clever. Das sah ich an dem Funkeln in ihren Augen. Sie hatte meinen bissigen Kommentar als das erkannt, was er war: Der Versuch, sie abzulenken.
»Danke«, sagte sie unvermittelt.
»Wofür?«
»Dass du nicht in Panik gerätst. Das hab ich schon anders erlebt. Ich rechne es dir hoch an, dass du nicht sofort die Führung übernimmst und mich gegen meinen Willen ins nächste Krankenhaus verfrachtest. Erst mal abzuwarten erfordert viel Mut und Selbstvertrauen. Einen Krankenwagen zu rufen und die Verantwortung abzugeben ist viel einfacher, als die Situation auszuhalten.«
Ich registrierte durchaus den leicht düsteren Unterton in ihren Worten. Offenbar hatte man oft genug ihre Meinung ignoriert und Entscheidungen getroffen, die ihr nicht gefallen hatten.
»Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn einem die Kontrolle entgleitet und die eigene Meinung nicht mehr zählt«, sagte ich ruhig und wechselte mit ihr einen Blick, der alles sagte.
Ein seltsames Gefühl setzte in meinem Magen ein. Eine Mischung aus Nervosität und … keine Ahnung. So was hatte ich noch nie gespürt. Als wäre etwas Bedeutsames geschehen, das ich noch nicht ganz erfassen konnte.
Es war Amy, die den Blickkontakt löste und sich räusperte. Hatte auch sie das gespürt? Diesen kurzen seltsamen Moment? Die Verbundenheit, woher auch immer sie gekommen war?
Ich musterte sie noch einmal gründlich, dann lehnte ich mich neben sie an die Wand. Es roch unangenehm nach der Hundescheiße nicht weit von uns, aber das war jetzt egal.
Wir saßen im Schatten einer Hauswand. Sie atmete. Sie schien sich langsam zu beruhigen.
Hoffentlich.
»Ich studiere an der UCSB. Eigentlich komme ich aus LA, hab aber ein Stipendium ergattert und darf sogar auf dem Campus wohnen. Es ist ein privatwirtschaftliches Stipendium von Highgrove Industries, ein Wirtschaftsriese der Extraklasse. Die beraten Firmen, optimieren Prozesse für sie, machen Marktanalysen und sind eigentlich die Ansprechpartner, um kleinere Unternehmen ganz nach oben zu bringen. Ich bin vermutlich ihr Quoten-Underdog, aber Hauptsache, die zahlen mir das Studium. Aber ein falscher Schritt – schon fliege ich. Die verlangen Bestnoten und einen Vorzeigestudierenden. Liefere ich das ab, ist mir ein Job bei denen garantiert«, sprudelte es aus mir hervor, um die seltsame Stille zwischen uns zu füllen und ihr Zeit zu verschaffen, sich weiter zu beruhigen. Ablenkung half uns beiden gerade definitiv.
Zu meiner Erleichterung ging Amy auf das Gespräch ein. Sie stöhnte abschätzig. »Ein Stipendium? Lass mich raten: Es ist ein Sportstipendium. Baseball? Rugby? Das würde zum Surfen passen. Willkommen bei den Gauchos.«
»Mathe«, korrigierte ich sie.
Sie riss die Augen auf. »Nicht dein Ernst!«
»Wieso? Dürfen Mathematiker nicht gut aussehen?« Ich winkelte betont cool die Arme an, damit mein Bizeps heraustrat. Es wirkte.
»Angeber«, lachte Amy. Sie wollte noch was hinzufügen und schloss stattdessen abrupt die Augen. Obwohl sie saß, streckte sie instinktiv ihre Hand aus, als wolle sie sich irgendwo festhalten. Dabei erwischte sie meinen Bizeps, strich darüber.
»Hey, nicht anfassen. Nur angucken«, flachste ich spontan, bemerkte aber sofort, dass das hier fehl am Platze war. Amy war gerade definitiv nicht nach Blödeln. »Du bist weiß wie die Wand. Willst du echt keinen Krankenwagen?«
Amy schüttelte den Kopf. »Lass uns einfach noch hier sitzen bleiben, okay? Geht gleich wieder. Bestimmt.«
Ich bezweifelte das, doch für den Moment war ich gewillt, ihren Wunsch zu akzeptieren.
Fünf unendlich lange Minuten saßen wir nebeneinander und warteten darauf, dass sich Amy berappelte. Diesmal schwieg ich. Vielleicht brauchte sie wirklich gerade keine Ablenkung, sondern Ruhe.
Das gab mir Zeit, unsere Möglichkeiten zu überdenken. Wir konnten schlecht in dieser Ecke hocken bleiben. Kein Krankenwagen. Da blieben nicht viele Optionen. »Wie weit ist es bis zu dir nach Hause?«, fragte ich schließlich.
»Etwa drei Blocks. Klingt nicht viel, ist für mich aber ein Gewaltmarsch. Du hast nicht zufällig ein Auto hier?«
»Selbst auf die Gefahr hin, dass du mich wieder schief ansiehst: Ich stehe eher auf zwei Räder als auf vier.«
Ich hatte recht: Sie öffnete tatsächlich endlich ihre Augen und sah mich schräg an. »Du fährst Mofa?«
»Du enttäuschst mich mit dieser Frage. Natürlich Motorrad. Eine Dukati Monster. Mein ganzer Stolz. Ich schätze, in deinem Zustand ist eine Fahrt darauf eher eine doofe Idee.«
»Eine Fahrt darauf ist in jedem Zustand eine doofe Idee.« Sie seufzte. »Gibt es hier einen Laden, wo wir mir was zu essen und zu trinken besorgen können? Mein Kreislauf muss erst in Schwung kommen. Danach schaffe ich den Weg zu mir. Allein. Du musst nicht auf mich aufpassen.«
»Wie kommst du denn auf diese Idee? Ich baggere wie wild an dir rum. Wenn du das nicht merkst, muss ich dringend an meiner Flirttechnik feilen. Aber ja. Direkt um die Ecke gibt es einen Kiosk.«
Ich war von Flirten wirklich Meilen entfernt, aber Humor half uns beiden. Was das anging, waren wir auf der gleichen Wellenlänge. Sie fand mich lustig und ich sie. Das war doch schon mal eine gute Basis, um diese Situation zu entschärfen. Möglichst heil und ohne Krankenwagen.
Ich zuckte zusammen, als sich Amy plötzlich bewegte. Sie stemmte sich ächzend hoch, konnte sich aber nicht aufrichten und begann zu fluchen.
Ich hörte ihr eine Weile zu, dann stand ich selbst auf und hielt ihr eine Hand hin. »Dein Wortschatz ist wirklich beeindruckend«, sagte ich anerkennend. Wie nicht anders zu erwarten, ignorierte Amy zunächst meine Hand. Schließlich gab sie aber auf, nahm grummelnd meine Hilfe an und ließ sich von mir in die Höhe ziehen.
Ich tat so, als strenge mich das an. In Wirklichkeit bemerkte ich es kaum. Amy war bis auf die Knochen abgemagert.
Sie ließ meine Hand so früh wie möglich los, als hätte sie sich verbrannt. Ich fand das erstaunlich schade. Irgendwie hatte es mich beruhigt, sie berühren zu dürfen. Als könnte ich ihr dadurch besser helfen.
»Geht es?«, fragte ich, um irgendwas zu sagen.
Sie nickte und lief los, wenn auch nur langsam. »Du bist also ein Mathegenie?«, fragte sie mich. Ich durchschaute ihr Ablenkungsmanöver sofort.
Ich war etwas zurückgefallen, um mein Hemd aufzuheben, holte aber schnell wieder auf. »Ja. Zahlen, binomische Formeln, Primzahlen, Wurzeln, Quadratur … Das macht mir richtig Spaß. Ich bin ein Meister im Kopfrechnen, aber tu mir einen Gefallen und versuch nicht, mich zu testen. Das tun ALLE. Glaube mir. Ich bin besser als jeder Taschenrechner.«
»Und viel bescheidener«, bekräftigte sie ironisch. Aha. Da war er wieder. Der alte beißende Spott. »Das heißt, du hast ein richtig gutes Stipendium?«
»Ja, sonst könnte ich die Uni gar nicht bezahlen. Meine Familie ist nicht gerade als wohlhabend zu bezeichnen. Die Dukati ist vom Schrottplatz, sonst hätte ich sie mir nie leisten können.« Ich machte eine kurze Pause. »Mein Highschool-Lehrer hat mich unter seine Fittiche genommen und dafür gesorgt, dass ich das Stipendium bekommen konnte. Eine große Ehre, immerhin bin ich der Erste in meiner gesamten Familie, der studieren gehen kann. Sie erwarten, dass ich mich finanziell um meine Geschwister werde kümmern können.« Ich bemühte mich, bei diesen Worten möglichst wenig zu fühlen. Der Druck durch meine Familie war enorm. So enorm, dass ich an manchen Tagen kaum Schlaf fand. Aber das musste Amy nicht wissen. Jeder hatte seine Geheimnisse. Mich eingeschlossen.
Wir waren am Kiosk angekommen, und ich hielt ihr die Tür auf. Gott sei Dank gab es zwei Stehtische mit Barhockern daran und eine Klimaanlage. Müde zog Amy ihren zerknautschten Dollarschein hervor und hielt ihn mir hin. »Kannst du uns was zu trinken besorgen? Ich setz mich schon mal.«
Ich ignorierte ihr Geld und bestellte bereits. »Eine Cola, ein Wasser, ein Kaffee, die Laugenbrezel da und das matschige Schinkensandwich dazu. Plus noch die Schokoriegel, die sauren Fruchtgummis und die Chips. Das wärs. Danke.«
Amy schob sich auf den Barhocker und bemühte sich, gerade zu sitzen. Besorgt musterte ich ihre Gestalt und zog dabei mein Hemd über. Der Kassierer hatte meinen nackten Oberkörper bereits mit missbilligendem Blick gemustert. Vollbepackt kehrte ich zum Tisch zurück und rieb mir in kindlicher Vorfreude die Hände. »Ich wusste nicht, was du lieber magst. Sauer, süß, salzig, deftig, mit und ohne Koffein. Fehlt noch was?«
Amy schob mir vehement die fünf Dollar zu. »Die Bezahlung fehlt. Nimm!«
»Nie im Leben. Sieh es als erstes Date an. Da bezahlt immer der Gentleman«, flachste ich.
»Ich hoffe doch, dass du mich bei unserem ersten Date in ein vernünftiges Restaurant einlädst. Mit Kellnern, Servietten, Tischdecke und drei verschiedenen Gläsern und Messern auf dem bereits gedeckten Tisch. Ein Streichquartett wäre auch ganz nett. Und Kerzenschein.«
Ich musste schmunzeln. Gleichzeitig hoffte ich, dass sie meine Signale nicht falsch gedeutet hatte. Gefährliches Terrain. Ich wollte ihr helfen und sie nicht wirklich zu einem Date ausführen. Dafür hatte ich keine Zeit und im Übrigen selbst viel zu große Probleme. Damit ich die Stimmung aber nicht ganz ruinierte, spielte ich mit. »Gefällt dir unser Date etwa nicht? Ich habe dir ein Vier-Gänge-Menü gezaubert, und die Kaffeeflecken auf dem Tisch sind doch eine hübsche Deko. Chips gefällig?« Ich riss die Tüte auf und hielt sie ihr hin.
Amy griff tatsächlich zu und schob sich ein paar Chips in den Mund. Danach kaute sie eine gefühlte Ewigkeit hohl darauf herum. Als sei ihr Mund zu trocken zum Schlucken.
Ich blieb hartnäckig und schob ihr immer wieder kleine Stückchen Schokolade rüber. So brachte ich sie dazu, noch zusätzlich etwas Wasser, Cola und eine halbe Brezel runterzukriegen. Allmählich wagte ich es, mich zu entspannen. Wir hatten die Situation wieder unter Kontrolle. Wir würden es zu ihr nach Hause schaffen, und dann konnten wir wieder in unsere normalen Leben zurückkehren.
Sie in ihre Welt voller Krankheit und ich in meine Welt voller familiärer Verpflichtungen.
KAPITEL 3
KAPITEL 3
Amy
Dieser Tag ging in die Top Ten der schlimmsten Tage meines Lebens ein. Da traf ich mal einen wirklich heißen Typen, und dann kotzte ich ihm beinahe auf die Füße. Zum Glück hatte ich meinen Magen im letzten Moment unter Kontrolle gebracht. Nicht auszudenken! Das hier war schon peinlich genug.
Sag was Unverfängliches, dachte ich verzweifelt. Fang ein ganz normales Gespräch an, damit die Situation nicht noch unangenehmer wird, als sie es ohnehin schon ist. »Wie gefällt es dir denn in Santa Barbara?«, fragte ich spontan.
Nathan ging nur zu gerne auf die Frage ein. »Ich lebe mich noch ein und mag es, mein eigener Herr zu sein. Niemand fragt, wann ich wieder da bin und auf meine Geschwister aufpasse. Niemand regt sich über meine Alkoholfahne auf, und niemand erkundigt sich bei meinen Lehrern, ob ich mich benehme. Das ist alles sehr aufregend für mich, aber natürlich auch recht verführerisch.«
»Inwiefern?«
»Momentan laufen erst die Vorkurse, aber ich weiß schon jetzt, was auf mich zukommt: jede Menge harte Arbeit. Gleichzeitig könnte ich, wenn ich wollte, von einer Party zur nächsten springen. Ich wohne in einem Zimmer mit einem Typen, der dauerblau ist. Und wenn er nicht gerade besoffen ist, dann vernascht er eine nach der anderen. Wohlgemerkt, während ich im Bett daneben liege und versuche zu schlafen.«
»Klingt nach einem wilden Partyleben.«
»Klingt eher danach, als könnte das für mich schnell schiefgehen. Da ist niemand, der mich kontrolliert. Im Moment halte ich Kurs und lerne brav. Die Frage ist nur, wann ich einbreche.«
Ich seufzte tief. »Ich darf nicht mal aufs Klo, ohne das vorher anzukündigen. Ich könnte womöglich dabei draufgehen. Was das angeht, ist meine Mum echt krass.«
Als Nathan mich eingehend musterte, ging mir sein Blick geradewegs bis in die Seele. Er legte den Kopf schief. Ich konnte zusehen, wie sich seine Miene verschloss. Hatte ich ihn verärgert? Seine braunen Augen wurden eine Nuance dunkler. Langsam schüttelte er den Kopf. »Sei froh, wenn sich deine Mum kümmert. Sie tut es, weil sie sich Sorgen um dich macht.«
»Deine etwa nicht?«
»Meine ist nicht so der mütterliche Typ«, druckste er und lenkte rasch vom Thema ab. »Dann lass uns mal überlegen, wie wir dich nach Hause schaffen. Taxi? Bus?«
»Ich habe nur diese fünf Dollar dabei. Taxi wird also schwierig. Fährt denn von hier aus ein Bus? Ich wohne in der Willow Lane.«
Nathan zog sein Handy hervor, das mehr als ramponiert aussah. Es hatte die Spider-App: ein Netz aus zersplittertem Glas über das halbe Display hinweg. An den Seiten blätterte der Lack ab. Ich selbst hatte mein Handy zu Hause liegenlassen. Absichtlich.
Er suchte eine Weile im Internet und deutete dann auf die andere Straßenseite. »Wenn wir uns beeilen, erwischen wir ihn noch.«
Ich nahm einen winzigen Schluck von meinem Wasser und nickte. »Dann los.«
Hastig räumte Nathan unseren Stehtisch ab und steckte sich die Schokoriegel in die Hosentasche. Wir verabschiedeten uns mit einem Nicken von dem mies gelaunten Kioskbesitzer und waren Sekunden später auf der Straße.
Von der Hitze des Tages wurde mir flau im Magen, doch ich kämpfte die Übelkeit nieder. Einmal sterbender Schwan auf offener Straße reichte für ein ganzes Leben.
Wir wollten gerade über die Straße hasten, als ein schwarzer SUV mit quietschenden Reifen an der nächsten Kreuzung stoppte. Der Motor röhrte auf, dann wendete der Wagen und kam in unsere Richtung geschossen. Ich hatte ihn längst erkannt und blieb stehen, um mich für das zu wappnen, was nun kam.
Leider hatte ich nicht einmal mehr die Gelegenheit, Nathan zu warnen, da hielt der Wagen auch schon neben mir. Die getönte Scheibe glitt lautlos nach unten und offenbarte das vor Stress gerötete Gesicht meiner Mutter. »Amy Elisabeth Darren, steig sofort ins Auto ein!«, schrie sie mich an. Sie saß auf dem Beifahrersitz, sodass sie sich quasi direkt neben mir befand.
Anhand der hohen Tonlage erkannte ich, wie aufgebracht meine Mutter war. Sie war kurz davor zu hyperventilieren.
»Hey, Mum«, brachte ich hervor. Es war immer besser, bei meiner Mutter ruhig zu bleiben, sonst wurde sie nur noch aggressiver. Momentan war sie wütend genug. Nathan stand dicht neben mir, als wolle er mich beschützen. Seine Hand berührte ganz kurz meinen Arm. Zufällig? Oder mit Absicht? »Was tust du denn hier?«
»Das Gleiche könnte ich dich fragen. Ich suche dich! Wir sind außer uns vor Sorge und haben schon sämtliche Krankenhäuser abtelefoniert. Ich war kurz davor, die Polizei einzuschalten. Wie kannst du nur einfach abhauen?«
»Mum, ich bin einundzwanzig! Findest du nicht, du reagierst ein wenig über? Ich hab dir doch einen Zettel dagelassen …«
»Dass du zum Strand gehst. Genau. Bist du wahnsinnig? Deine Thrombozytenwerte sind völlig im Keller. Ein zufälliger Stoß von jemandem, und es könnte dich umbringen. Willst du das etwa?«
Ich spürte, wie sich mein Magen verkrampfte. »Mum, du übertreibst maßlos«, zischte ich ihr zwischen zusammengebissenen Zähnen zu.
Der Tag konnte also wirklich noch schlimmer werden. Meine Mum schrie mich an. Die Passanten starrten argwöhnisch zu uns herüber. Und Nathan schien erst jetzt zu begreifen, wie gefährlich mein Spaziergang war.
Da ich mich nicht rührte, wurde Mum aktiv. Sie stieg aus dem Auto und baute sich vor uns auf. Amanda Darren war mit ihren einundfünfzig Jahren eine wirklich beeindruckende Frau. Sie war groß, extrem schlank und trug zu ihren raspelkurzen dunkelroten Haaren stets runde Ohrringe, die bis zu ihren grazilen Schultern reichten. In ihrem Schrank gab es grundsätzlich nur Kostüme. Auch im Moment trug sie einen dunkelroten Rock, der perfekt zum Blazer passte. Nur meine Mum brachte es fertig, bei einer Suchaktion wie eine Businessfrau auszusehen.
Sie warf mir einen giftigen Blick zu und riss die Hintertür des Wagens auf. »Steig ein«, forderte sie. Dann erst registrierte sie Nathan, der noch immer viel zu dicht bei mir stand. Da war sie wieder. Die Hand, die mich ganz kurz am Ellbogen berührte. Ich spürte seine Finger federleicht über meine Haut fahren. Diesmal war es definitiv keine Einbildung. »Und wer bist du?«, fragte Mum aufgebracht.
»Und wer sind Sie«, korrigierte Nathan, ohne mit der Wimper zu zucken. Aus dem Sonnyboy war plötzlich eine finstere Gestalt geworden. Er wirkte dadurch größer und älter. Betont lässig hob er die Hand und hielt sie meiner Mum hin. »Nathan Ambrose. Ich bin ein Freund Ihrer Tochter.«
Das Wort ging mir durch und durch. Ein Freund. Um ehrlich zu sein, hatte ich den kleinsten Freundeskreis der Welt. Ich unterhielt ein paar sehr nette Brieffreundschaften und chattete seit Jahren mit den gleichen Leuten aus einer Selbsthilfegruppe für schwerkranke Jugendliche. Mittlerweile waren wir längst dem Jugendalter entwachsen, aber den Kontakt hatten wir gehalten. Manchmal textete ich noch mit meiner ehemaligen Zimmergenossin aus dem Krankenhaus. Das war es auch schon. Freundschaften überdauerten vielleicht eine schwere Krankheit, wenn sie sich nicht über Jahre hinzog. Ich hingegen war seit meinem zwölften Geburtstag ständig krank. Das konnte man niemandem mehr zumuten. Zumindest nicht in meinem Alter.
»Was sind Sie denn für ein Freund, wenn Sie Amy bei diesem Wahnsinn unterstützen? Amy, steig ein.«
»Danke, nein. Ich nehme den Bus«, entfuhr es mir. Es kam selten vor, dass ich meiner Mutter die Stirn bot. Dafür hatten wir zu viel gemeinsam durchgemacht. Ich wusste, dass sie Angst um mich hatte und daher oft überreagierte. Sie hatte erst vor drei Jahren ihren Sohn an die schreckliche Krankheit verloren, und ihrer Tochter drohte ein ähnliches Schicksal. Da war es nicht verwunderlich, dass sie jetzt durchdrehte.
Doch auch ich hatte Gefühle, und ich war nicht weniger impulsiv. Immerhin war ich erwachsen! Sie behandelte mich wie eine Fünfzehnjährige. Wir waren deswegen schon häufiger aneinandergeraten. Ärgerlicherweise hatte ich meist den Kürzeren gezogen. Der Klügere gibt ja bekanntlich nach. Dieses Mal war ich jedoch nicht gewillt, ihr unmögliches Verhalten hinzunehmen. Ich hatte die Nase voll!
Als hätte sie in meinem Gesicht gelesen, was ich dachte, trat sie einen Schritt zurück. Wir maßen uns mit Blicken. Vielleicht wäre jetzt Ruhe eingekehrt. Vielleicht hätten wir uns ganz normal unterhalten. Wie zwei Erwachsene.
Leider hatte ich die Rechnung ohne meinen Vater gemacht. Der stieg in dieser Sekunde aus der Fahrertür, nahm seine dunkle Designersonnenbrille ab und warf mir seinen besten Staranwalt-Blick zu. Mit diesem Ausdruck in den Augen machte er sogar Richter nervös. Behauptete zumindest er. »Einsteigen«, sagte er in einem Tonfall, der keinen Protest zuließ.
Erst jetzt registrierte ich, dass Dad wirklich der Fahrer war. Er stand vor mir! Dann war es wirklich ernst. Mein Vater glänzte eigentlich grundsätzlich durch Abwesenheit. Er hatte sogar den letzten Atemzug seines Sohnes verpasst, weil er auf irgendeinem ultrawichtigen Meeting auf einem anderen Kontinent einen selbstverständlich total wichtigen Klienten betreuen musste. Ein Umstand, der zu einem kaum zu kittenden Bruch zwischen meinen Eltern geführt hatte. Allerdings hatte Dad nicht ahnen können, dass es so schnell bergab gehen würde mit Ben. Innerhalb von zwei Tagen hatte sich sein Zustand rapide verschlechtert. Selbst die Ärzte hatten das nicht kommen sehen.
Dennoch. Mein Dad hatte uns im schrecklichsten Moment allein gelassen. Dass er hier war, sagte zwei Dinge: Er wollte seine Fehler wiedergutmachen, und ich war zu weit gegangen.
Für mich gab es nun ebenfalls zwei Möglichkeiten. Ich konnte die Szene hier austragen oder mich für den Moment fügen und mich später zu Hause mit ihnen auseinandersetzen. Denn eines war klar: Ich konnte und wollte das Verhalten meiner Eltern nicht unkommentiert stehen lassen.
Schweigend löste ich mich von Nathans Nähe und stieg in den SUV. Meine Mutter wollte schon die Tür vor meiner Nase zuknallen, da entschied ich mich anders. Einen kleinen Denkzettel musste ich den beiden dann doch verpassen.
Ich drückte gegen die Tür, sodass sie nicht zugehen konnte, und lehnte mich an meiner Mutter vorbei zu Nathan.
»Nathan, du wolltest mir noch deine Nummer geben«, sagte ich zu ihm. Weil er mich nur verdutzt ansah, angelte ich mir hastig einen Kugelschreiber aus der Mittelkonsole, stieg aus dem Auto und zog Nathans Arm zu mir. In dieser Sekunde kam ich mir äußerst cool vor. Das hatte ich schon immer mal machen wollen! Mit viel Schwung kritzelte ich meine Handynummer auf seinen kräftigen Unterarm, dazu noch meinen Vornamen, und weil das nicht reichte, auch gleich noch ein deutlich sichtbares Herzchen. Letzteres war eigentlich nur eine Kampfansage an meine Mutter. Hoffentlich verstand Nathan die Botschaft.
Ich sah ihn ernst an und klimperte mit den Wimpern. »Ruf mich an«, hauchte ich lasziv und spürte leider, dass mir die Röte in die Wangen stieg.
»Klar«, sagte er schwach.
Meine Eltern beäugten die Szene misstrauisch. Wenigstens warteten sie, bis wir fertig waren. »Das reicht jetzt«, sagte Dad, wirkte dabei aber fast ein wenig zerknirscht.
Nathan schien endlich kapiert zu haben und nickte mir verschwörerisch zu. »Ich klingel gleich bei dir durch, damit du meine Nummer auch hast.« Ich war mir nicht ganz sicher, ob er das ernst meinte. Hatte er mich doch falsch verstanden? Dachte er, ich wolle wirklich was von ihm?
Ich hatte keine Zeit mehr, um nachzufragen, denn Mum wurde unruhig. Ich gab nach, ließ mich ins Auto fallen, und Nathan trat zurück, sodass Mum die Tür zuschlagen konnte.
Sekunden später fuhr Dad auch schon los. Ich gab ihnen zehn Sekunden, bevor ich explodierte. »Das war die peinlichste Aktion, die ihr je gebracht habt!«, rief ich. »Aus welchem Actionfilm habt ihr das denn? Eure Tochter auf der Straße kidnappen …«
Meine Mutter zog den Kopf ein. Von meiner Position konnte ich ihr Gesicht leider nicht sehen, wohl aber das von Dad. Er warf mir im Rückspiegel einen entschuldigenden Blick zu.
»Vielleicht haben wir etwas übertrieben«, räumte er ein. »Aber mal ehrlich: Was war das für ein Typ? Und was willst du von ihm?«
»Dad! Das geht dich absolut nichts an. Und nach dem, was ihr hier gerade abgeliefert habt, hält er uns wahrscheinlich allesamt für verrückt.«
Sofort hellte sich Dads Gesicht auf. »Das tut mir leid«, log er ungeniert.
»Klar«, erwiderte ich ironisch. Frustriert blickte ich aus dem Fenster und versuchte meine Gedanken zu sortieren. Nathan hatte meine Nummer. Ob er mich womöglich doch angerufen hatte? Selten zuvor hatte ich mich so nach meinem Handy gesehnt.
»Willst du mit diesem Nathan wirklich in Kontakt bleiben? Er war sehr unhöflich zu mir«, wandte Mum ein. Ich kannte sie gut genug, um zu wissen, dass sie vor Neugierde platzte.
»Er war nur unhöflich, weil ihr euch unmöglich benommen habt.« Zum Glück bogen wir gerade in die Einfahrt ein, sodass ich meine Antwort nicht vertiefen musste.
Dad parkte den Wagen vor dem Haus, und ich schnallte mich so schnell es ging ab, um aus dem Wagen zu steigen, denn in der Nähe meiner Eltern hielt ich es keine Sekunde länger aus. Das half mir sogar über meine Schwäche hinweg. Dank der Autofahrt hatte sich auch endlich mein Magen beruhigt, genau wie der Schwindel. Es ging mir etwas besser. Den Ruf meiner Eltern ignorierte ich.
Mein Ziel war klar: Ich wollte mein Handy holen und nachschauen, ob Nathan womöglich doch angerufen hatte. Dass dieser Wunsch absolut lächerlich war, ignorierte ich einfach mal.
Ich holte meinen Haustürschlüssel aus der Tasche, stolperte in den Hausflur und nahm den ersten Stock in Angriff. Für meine Verhältnisse war ich blitzschnell die Treppe raufgelaufen, auch wenn ich zwei kleine Pausen einlegen musste. In meinem Zimmer entdeckte ich mein Handy auf dem Nachttischchen. Seltsam, heute Morgen hatte ich es auf meinem Bett zurückgelassen. Mum oder Dad mussten es in der Hand gehabt haben.
Über den Eingriff in meine Privatsphäre würden wir uns später unterhalten. Jetzt war etwas anderes wichtig.
Mit zitternden Fingern nahm ich mein Handy und schloss kurz die Augen. Bitte, hab angerufen, dachte ich und stählte mich gleichzeitig davor, dass er es mit ziemlicher Sicherheit nicht getan haben würde.
Doch ich irrte.
Da war tatsächlich ein Anruf in Abwesenheit.
Und jetzt?
Ich hatte keine Ahnung. Wirklich nicht. Nathan stand mitten im Leben, freute sich auf Studierendenpartys und das Studium. Ich hingegen ging nächste Woche ins Krankenhaus. Und wenn ich nur ein wenig mit ihm schrieb? Ganz locker und ohne Hintergedanken.
Ich hatte auch wirklich vorgehabt, ihm eine nette, kurze Nachricht zu schreiben und mich zu bedanken. Stattdessen rief ich ihn an. Das Freizeichen ertönte, und er ging ran.
»Hallo, Sonnenschein«, begrüßte er mich.
»Ich … also … Hey, hier ist Amy.«
»Ja, ich weiß. Seh ich an der Nummer. Ich bin froh, dass du anrufst. Dein Auftritt war echt filmreif. Es kommt nicht alle Tage vor, dass mir eine Frau ihre Nummer so dramatisch auf den Unterarm malt. Um ehrlich zu sein, hätte ich auch nicht wirklich mit einem Rückruf gerechnet. Schon gar nicht so schnell.«
Ich blinzelte irritiert. »So schnell?« Hatte ich was falsch gemacht?
»Naja, die meisten Frauen warten ein paar Tage, bevor sie Kontakt aufnehmen. Damit sie nicht so verzweifelt wirken.«
Ups. »Dann muss ich ja schrecklich verzweifelt wirken.«
»Überhaupt nicht. Eher sehr selbstbewusst. Ich hasse es, auf solche Anrufe zu warten.«
»Klingt, als würdest du das ständig machen.« Der Gedanke bestätigte mich in meinem Verdacht. Nathan war ein Frauenheld. Sofort bereute ich meinen blinden Aktionismus. Drängte ich mich ihm gerade auf?
Er erkannte wohl, was er da zugegeben hatte, und ruderte zurück. »Ständig? Wo denkst du hin? Das ist eher die Ausnahme als die Regel. Aber egal.« Er machte eine kurze Pause. »Und? Wurdest du eingekerkert?«
Ich lachte, obwohl es nicht wirklich lustig war. Meine Eltern hatten Ben tatsächlich mal eingesperrt, um ihn vor Dummheiten zu bewahren. »Ich habe vermutlich erst einmal Hausarrest.«
Erneut entstand eine kurze Pause. Dann fragte Nathan eher zaghaft: »Sagtest du nicht, du seist einundzwanzig?«
»Jap. Allerdings beuge ich mich meistens der elterlichen Gewalt, da sie zumindest momentan recht haben. Ich bin gerade nicht ganz auf meiner körperlichen Höhe. Der Hausarrest wäre also eher symbolischer Natur.«
»Okay …« Nathan klang nicht überzeugt. Mist. Jetzt dachte er bestimmt, ich hinge an Mums Rockzipfel. »Ich bin jedenfalls froh, dass du sicher zu Hause angekommen bist.« Jemand sprach ihn von hinten an. »Entschuldige. Ich muss Schluss machen. Mein Mitbewohner Ian will irgendwas wahnsinnig Wichtiges von mir. Ich …«
»Schon gut. Kein Problem. Dann … Danke für deine Hilfe.«
»Klar. Immer wieder gerne. Mach´s gut.«
»Du auch. Bye.« Damit legte ich hektisch auf. Verabschiedungen waren mir generell ein Graus, aber diese hier fühlte sich noch viel unangenehmer an. Verdammt. Warum nur hatte ich das Gefühl, eine Chance vertan zu haben? Und warum hatte ich plötzlich so einen dicken Kloß im Hals?
Um mich abzulenken, setzte ich mir meine Kopfhörer auf und suchte mir das blutigste Hörbuch heraus, das ich finden konnte. Massaker war ein Thriller mit Horrorelementen und Krimianteilen. Das versprach eine so seltsame Mischung, dass es mich garantiert auf andere Gedanken brachte.
Seit mir die Augen vom Lesen ständig weh taten, war ich auf Hörbücher und Hörspiele umgestiegen. Als Stubenhocker waren Bücher meine liebste Beschäftigung gewesen, und es hatte mich hart getroffen, als die Buchstaben ständig vor meinen Augen verschwammen. Zum Glück hatte ich schnell Ersatz gefunden.
In diesem Fall fesselte mich die Geschichte allerdings nicht gut genug, sodass ich parallel am Handy war.
Das mit dem Tattoo hat nicht geklappt, schrieb ich meinem Chatfreund aus der Selbsthilfegruppe. Deadlybird





























