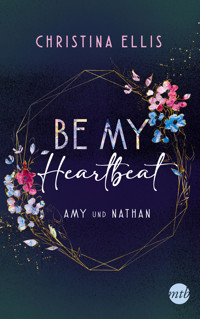9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MIRA Taschenbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ambrose Brothers
- Sprache: Deutsch
So lange du an mich glaubst ...
Der unnahbare Kane mit seinen Tattoos und seiner selbstbewussten Art ist so ganz anders als die aufmerksame Valerie. Im Gegensatz zu ihm hat sie ihr Leben im Griff – zahlt dafür allerdings den Preis, den es mit sich bringt, in einem goldenen Käfig zu leben. Die beiden sind als Nachbarskinder aufgewachsen, haben jedoch kaum ein Wort miteinander gewechselt. Als Valerie Kane schwerverletzt im Poolhaus ihrer Eltern findet, hilft sie ihm und es kommt zum Kuss. Doch sein düsteres Familiengeheimnis droht sie in den Abgrund zu ziehen. Und auch ihr Vater stellt sich den beiden in den Weg …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Originalausgabe
© 2024 by MIRA Taschenbuch in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Covergestaltung von zero-media.net, München
Coverabbildung von FinePic®, München
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783745704068
www.harpercollins.de
Vorwort
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr am Romanende eine Themenübersicht, die demzufolge Spoiler enthalten kann.
Wir wünschen euch das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser Geschichte.
Euer Team von Mira
ZWEI JAHRE ZUVOR
ZWEI JAHRE ZUVOR
KAPITEL 1
KAPITEL 1
Val
In unserem Poolhaus war ein Einbrecher. Mittlerweile war ich mir sicher und duckte mich nervös hinter der Wohnzimmerscheibe. Wenn ich den Eindringling sehen konnte, galt das womöglich auch umgekehrt. Wobei ich im Gegensatz zu ihm kein Licht angemacht hatte. Ich sah den schwachen Schein eines Handy-Displays quer durch die Gartenhütte hüpfen. Von rechts nach links und wieder zurück. Nur die Terrasse mit dem Schwimmbereich trennte uns voneinander. Zehn Meter entfernt. Mehr nicht.
Je länger ich das Licht beobachtete, desto nervöser wurde ich. Was sollte ich jetzt machen? Am liebsten hätte ich das Problem ignoriert. Schließlich war im Poolhaus kaum was zu holen. Nur altes Zeug, ein paar Terrassenmöbel und Papas Billardtisch. Ich bezweifelte, dass er den wegschleppen konnte.
Es rumpelte leise. Vermutlich war der Eindringling gegen die Liege gestoßen, die ich wie immer achtlos ins Häuschen geworfen hatte. Zum einen, weil ich zu faul war, sie jedes Mal ordentlich zurückzulegen. Zum anderen, weil Mom das zur Weißglut trieb.
Ich verdrängte den Gedanken an den schwelenden Streit mit meinen Eltern. Erst musste ich mich um den Einbrecher kümmern. Natürlich könnte ich einfach die Polizei rufen, aber das hätte die gesamte Nachbarschaft aufgeschreckt und meine Eltern darin bestärkt, mich niemals wieder allein zu Hause zu lassen. Immerhin dachten sie auch so schon, dass ich mit zwanzig Jahren noch einen Babysitter brauchte. Wann immer ich auch nur kurz zu Besuch war, taten sie so, als wäre ich zwölf.
Nein. Polizei kam nicht infrage. Ich musste mich schon persönlich um das Problem kümmern. Beherzt schnappte ich mir den Baseballschläger, der seit Dads Highschool-Zeit einsam und allein neben der Terrassentür in einem Schirmständer lehnte. Das glatte Holz und das Gewicht meiner Waffe gaben mir Mut.
War mein Vorhaben dämlich? Vielleicht. Hatte ich eine andere Wahl? Nein! Ich musste mich um den Typen kümmern, bevor meine Eltern zurückkamen. Sonst dachten sie wieder über einen Auszug in eine noch stärker gesicherte Umgebung mit eigenen Wachposten und Umzäunung nach. Nicht auszudenken. Auch so fühlte ich mich schon überwacht genug, denn meine Eltern fragten mich über jeden kleinen Termin aus, den ich mir vornahm. Kein Wunder, dass ich so selten wie möglich hierherkam.
Leise öffnete ich die Terrassentür und huschte am beleuchteten Pool vorbei. Das Wasser glitzerte blau-gelb im Schein der schwachen Außenlampen, ein krasser Kontrast zur Finsternis um mich herum. Meine nackten Füße machten auf den Marmorfliesen kaum Geräusche. Auf Zehenspitzen schlich ich zum schneeweiß gestrichenen Häuschen an der Stirnseite des Beckens. Das Haus hatte breite Flügeltüren aus Glas, sodass ich problemlos hineinsehen konnte. Der Fremde ging weiter ins Innere hinein und sah sich um. Er suchte was. Tja, Pech für ihn. Meine Eltern bewahrten dort weder Geld noch Alkohol oder Sonstiges von Wert auf. Da gab es nichts zu holen.
Ich hielt die Luft an, als ich meine Hand auf die Klinke der Flügeltür legte. Ein warnendes Stimmchen in meinem Kopf wurde immer lauter. War es wirklich klug, was ich hier tat? Nein, mit Sicherheit nicht. Aber verdammt noch mal: Ich würde diesen Einbrecher verjagen und niemals ein Wort darüber verlieren. Sonst würden meine Eltern noch hysterischer werden als ohnehin schon. Also los!
Erstaunt stellte ich fest, dass die Tür nur angelehnt war. Ich musste sie lediglich aufdrücken. Zum Glück gab es kein gruseliges Knarzen. Mein Vater war ein Perfektionist, somit existierten knarrende Scharniere in seinem Universum nicht. Das galt normalerweise allerdings ebenfalls für gefährliche Diebe – und dennoch war einer hier.
Möglichst lautlos schob ich mich in den Raum und orientierte mich kurz. Sofort entdeckte ich das schwache Leuchten, das mich alarmiert hatte. Eine Gestalt hockte am Boden, mit dem Rücken zu mir. Jetzt hörte ich ein leises Rumoren. Der Einbrecher durchsuchte den hinteren Schrank der Poolbar. Auf Knien wühlte er wild in der untersten Schublade herum. Also doch. Da suchte jemand nach Alkohol oder Schmuck. Ein großer Mensch. Vermutlich ein Mann. Mit schwarzer Jacke. Leder? Ein Fluch unterbrach die Stille. Ja, ein Mann. Jünger. Die Stimme kam mir bekannt vor. Aber woher?
Bevor ich mich erinnern konnte, zuckte der Fremde vor mir zusammen, drehte sich zu mir um. Er hatte mich bemerkt. Mist! Mein Überraschungsmoment war damit dahin. Um dennoch die Oberhand zu behalten, griff ich an. Ich schrie, so laut ich konnte, und schwang den Baseballschläger. Jeder Kompanieoberfeldwebel wäre stolz auf mich gewesen. Mein Schlachtruf klang wild, gefährlich und aggressiv. Dabei schlug mir mein Herz bis in die Kehle, und vor lauter Angstschweiß konnte ich den Schläger kaum halten. Doch das durfte er nicht bemerken. Also holte ich aus, mein Ziel genau im Blick. Der Eindringling war mittlerweile auf die Beine gekommen, hob abwehrend die Arme vor den Kopf und rief immer wieder dieselben Worte.
»Stopp«, hörte ich noch, allerdings konnte ich da den Schlag nicht mehr verhindern. Ich hatte zu kräftig ausgeholt und traf bereits den Oberarm des Einbrechers, sodass sein Handy klirrend zu Boden fiel und das schwache Leuchten des Displays erlosch. Der Schlag erschütterte meine Handgelenke, doch noch gab ich nicht auf und holte erneut aus. Es war wichtig, den Gegner möglichst schnell kampfunfähig zu machen. Zumindest hatten mir das stets meine besten Freundinnen Mara und Cassy eingeschärft, die von ihren Eltern zu sämtlichen Selbstverteidigungskursen dieser Welt gescheucht worden waren.
Bevor ich jedoch erneut zuschlagen konnte, erholte sich mein Gegenüber von seinem Schrecken. Er machte einen Satz in meine Richtung. Gleichzeitig schnellte seine große Hand auf mich zu. Ich quiekte, versuchte auszuweichen, mich zu ducken. Vergeblich. Der Einbrecher hatte meinen Baseballschläger zu fassen bekommen und riss ihn mir mit einem harten Ruck aus den Händen.
Ich stolperte nach vorne und kam ihm viel zu nahe.
Verdammte Dunkelheit! Die Poolleuchten halfen auch nicht weiter. Es handelte sich dabei nur um winzige Funzeln, die hübsch aussahen, aber kaum Licht spendeten. Sie waren nicht hell genug, um bis zum Häuschen zu reichen.
Weil ich sonst keine Wahl hatte, fing ich an zu schreien. »Feuer!«, brüllte ich, so laut ich konnte. Im Kindergarten hatte man mir beigebracht, statt »Hilfe« lieber »Feuer« zu rufen. Wie immer fielen mir solche merkwürdigen Sachen in Notsituationen wieder ein.
»Val, jetzt krieg dich ein«, hörte ich über mein Gebrüll hinweg. Endlich verstummte ich, starrte die Schattengestalt vor mir an.
Braune Augen. Wie Mahagoni. Fast schwarz. Das war so ziemlich das Einzige, das ich erkennen konnte. Gebräunte Haut. Lederne Jacke. Moooooment mal! Die kleinen Puzzlestücke rasteten langsam ineinander, setzten sich zu einem Bild zusammen.
Und allmählich verstand ich.
Da stand unser Nachbarsjunge vor mir! Der Typ, der mir seit Kindesbeinen eine Heidenangst einjagte. Allerdings verdiente er die Bezeichnung Junge nicht mehr, das war amtlich. Er war ein Mann. Ein richtig großer, einschüchternder Mann. Obwohl ich schon mein ganzes Leben neben ihm wohnte, hatten wir noch nie ein Wort gewechselt. Wir nickten einander zu, und das auch nur, wenn wir wirklich unbeobachtet waren. An dieser Stelle endete unsere Kommunikation auch schon.
»Kane?«, fragte ich fassungslos. »Was machst du hier?«
Wir starrten uns an. Er wütend. Ich erstaunt. Unsere Familien hatten seit jeher ein stilles Abkommen getroffen: Wir kümmerten uns nicht umeinander und stritten dadurch nicht miteinander. Denn Kanes Familie war das komplette Gegenteil von meiner. Meine Eltern waren reich, seine nicht. Meine Eltern lebten und liebten den Luxus, seine hassten uns dafür.
Ehrlich gesagt hatte ich den eindrucksvollen Jungen beziehungsweise mittlerweile Mann von nebenan schon immer gern beobachtet. Kane bewegte sich auf eine Art und Weise, die ich interessant fand. Wenn er über die Straße ging, sah es aus, als wisse er stets, wo er hinwollte. Jeder Schritt strotzte vor Selbstbewusstsein, als könnte sich ihm nichts und niemand in den Weg stellen. Dabei schwangen seine Arme nur leicht mit, aber das reichte schon, damit sich das T-Shirt an den richtigen Bereichen spannte. Ich mochte seinen Bizeps. Nicht zu viel und nicht zu wenig.
In dieser Sekunde wurde mir erst klar, wie oft ich ihn beobachtet hatte. Ich kannte sogar die Art, wie er sich bewegte. Und das, obwohl wir uns seit gut einem Jahr nicht mehr gesehen hatten. Wie peinlich!
Doch die aktuelle Quizfrage war, was er in unserem Poolhaus zu suchen hatte.
Kane ließ den Baseballschläger fallen, als sei er heiß geworden. Danach bückte er sich und hob sein Handy auf. Schweigend. Das Einzige, das ich hörte, war sein lautes Atmen. Als würde ihn jede einzelne Bewegung anstrengen.
»Bin schon weg«, murmelte er defensiv, was überhaupt nicht zu ihm passte. Er wollte ernsthaft an mir vorbei stapfen, doch das verhinderte ich, indem ich ihm in den Weg trat. Das war mutig von mir. Vermutlich das Mutigste, das ich seit mehr als einem Jahr getan hatte. Aber ein seltsamer Nachbar, der nach zwei Jahrzehnten unvermittelt die Grenze zwischen unseren Grundstücken überschritt, ließ mich meine Vorsicht vergessen. Ich wollte wissen, was los war. Sofort.
»Kane Ambrose. Was zur Hölle machst du hier?«, fragte ich mit möglichst fester Stimme. Leider hörte ich nur allzu deutlich, dass sie vor Angst und Nervosität vibrierte. Wie immer in der letzten Zeit kiekste sie bei Aufregung unangenehm in den hohen Tönen, als hätte ich umgekehrten Schluckauf.
Kane starrte mich an, reagierte aber sonst nicht auf meine Worte. Ich hätte mein letztes Hemd verpfändet, um seinen Gesichtsausdruck sehen zu können, doch dazu war es zu dunkel. Jedenfalls war er eindeutig unbeeindruckt von mir, denn er machte Anstalten, mich zur Seite zu schieben. Seine Hand lag bereits auf meiner Schulter, und ich spürte seinen Atem in meinem Gesicht, die Hitze, die er ausstrahlte. Es war das erste Mal, dass wir uns berührten. Ein seltsames Gefühl. Seine Haut auf meiner. Warm und fest. Riesig. Er hatte wirklich Pranken wie ein Bär. Dazu stieg mir der Geruch seiner Lederjacke in die Nase, gepaart mit etwas Metallischem, das ich zunächst nicht einordnen konnte.
In der gleichen Sekunde gab er einen undefinierbaren Laut von sich. Es war eine Mischung aus Stöhnen und Fluchen. Bevor ich reagieren konnte, ging er in die Knie. Blitzschnell. Als hätte ihm jemand die Beine unter dem Körper weggezogen, hörte ich deutlich, wie er mit den Knien hart auf dem Boden aufschlug.
Das reichte. Ich machte einen Satz von ihm fort, rüber zum Lichtschalter und legte den Schalter um. Sofort flutete grelles Licht das gesamte Zimmer. Meine Mutter mochte es hell und weiß. Je steriler ein Raum aussah, desto wohler fühlte sie sich. Entsprechend geblendet waren wir beide. Die weißen Wände mit dem ebenso hellen Boden reflektierten das Licht beinahe schmerzhaft. Ich blinzelte und kämpfte um klare Sicht. Was die Dunkelheit bislang vor mir verborgen hatte, offenbarte sich jetzt in aller Deutlichkeit.
Vor mir kniete Kane Ambrose. Definitiv. Allerdings war seine obligatorische Lederjacke zerrissen, seine üblichen Bluejeans voller roter Flecken, und ihm fehlte ein Schuh. Doch das Schlimmste war nicht seine Kleidung. Es war sein Gesicht. Übersät mit Blut, blauen Flecken und Prellungen so gewaltig wie Gänseeier. Sein linkes Auge war schwarz umrandet, sein rechtes drohte nach und nach zuzuschwellen. Insgesamt sah Kane zum Fürchten aus.
Ich brauchte einen Schreckmoment, bis ich mich gefangen hatte. Dabei beobachtete ich, wie Kane sich langsam von den Knien auf die Seite fallen ließ und dann einfach liegen blieb. Sein Gesicht war vor Schmerz verzerrt, zumindest soweit ich das aufgrund der ganzen Blessuren sagen konnte. Er war zu einer Kugel zusammengekrümmt und stöhnte leise. Ich war abgemeldet. Zum Glück. Denn dadurch gelang es mir, endlich einen klaren Gedanken zu fassen.
Krankenwagen rufen? Die Polizei informieren? Aus einem Instinkt heraus wusste ich, dass beides unklug war. Ich musste Kane helfen. Aber allein.
Zögernd ließ ich mich neben ihm nieder und berührte vorsichtig seine Schulter. Als nichts geschah, wurde ich mutiger. Ich zog ihn zu mir herum, sodass er jetzt auf dem Rücken lag. In dem Moment entspannte er sich. Sein Kopf rollte seltsam zur Seite, vollkommen kraftlos. Als hätte man aus ihm jede Energie gezogen.
Verdutzt blieb ich neben ihm hocken, ohne mich zu rühren. Dann begriff ich. Scheiße! Kane war ohnmächtig geworden. Oder Schlimmeres?
Panisch legte ich meine Finger auf seinen Puls. Erst am Hals. Dann am Arm.
Nichts.
Verdammt, verdammt, verdammt! In meiner Not legte ich mein Ohr auf seinen Brustkorb, schob dafür seine Lederjacke zur Seite. Auch nichts. Hob sich da überhaupt irgendwas?
»Bitte, sei nicht tot«, flehte ich leise und ging hektisch meine Möglichkeiten durch. Krankenwagen. Oder erst Widerbelebung? Wo war überhaupt mein Handy und … Wiederbelebung! Ja, definitiv! Nur … wie ging das doch gleich? Im Fernsehen machten die immer erst die Herzdruckmassage, dann beatmeten sie. Oder andersrum?
Sauerstoff. Das war vermutlich wichtig. Oder sein Herz zum Schlagen überreden?
Ich faltete wahllos meine Hände ineinander, beugte mich dann über seinen Brustkorb und zögerte etwa eine Sekunde, ehe ich so fest ich konnte irgendwo in seiner Herzgegend drückte. Das machte ich aber nur ein einziges Mal, denn ich hatte eindeutig ein seltsames Knacken gehört. Scheiße. Hatte ich ihm was gebrochen? So fest hatte ich doch gar nicht zugedrückt! Also keine Massage. Dann eben Plan B. Entschlossen beugte ich mich über sein Gesicht. Kane war schrecklich zerschlagen, und seine untere Lippe blutete, schwoll bereits an. Trotzdem Mund zu Mund beatmen?
»Jetzt stell dich mal nicht so an«, brummte ich zu mir selbst und packte sein Kinn, zwang seine Lippen auseinander. Mit vor Nervosität überschlagendem Herzschlag atmete ich tief ein und legte dann meinen Mund auf seinen. Ich schmeckte eindeutig Blut, doch das musste ich ignorieren. Gerade wollte ich ihm einen tiefen Stoß meiner Atemluft in seine Lunge pusten, als ich die Veränderung bemerkte.
Seine vorher starren Lippen wurden weich, schmiegten sich an meine. Zu verdutzt reagierte ich eine Sekunde zu spät, vor allem, als sich der Druck beinahe unmerklich erhöhte. Ein Kribbeln jagte über meine Lippen. So intensiv, wie ich es selten zuvor gespürt hatte.
Zeitgleich prallte ich zurück und starrte den ganz eindeutig wachen Kane fassungslos an. »Hast du mich geküsst?«, quiekte ich.
»Du hast mich geküsst«, korrigierte er mit schleppender Stimme. Dabei funkelten seine braunen Augen – zumindest das eine, das noch nicht zugeschwollen war.
»Ich wollte dich widerbeleben!«, fauchte ich.
Jetzt sah er einen kurzen Moment verwirrt aus, dann lachte er leise. Ein schöner Laut, der tief in meinen Magen sickerte und dort etwas zum Flirren brachte. Ich rang das Gefühl hektisch nieder, weil sich Kane durch das Lachen vor Schmerzen krümmte.
»Das sollte eine Wiederbelebung sein? Wolltest du mich wie Dornröschen wachküssen, oder was?«, keuchte er schließlich.
»Du warst wie tot, hast nicht mehr geatmet und keinen Puls gehabt.«
Kane runzelte die Stirn und seufzte leise. »Ich gebe zu, dass es mich kurzfristig ausgeknockt hat, aber dass ich einen Atemstillstand hatte, bezweifle ich stark. Ich fürchte, du bist eher noch mieser im Pulsfühlen als im Beatmen.«
Das verschlug mir die Sprache, sodass ich ihn lediglich anstarren konnte. Kane lag nach wie vor auf dem Rücken lang ausgestreckt vor mir und blutete mein Winnie the Pooh-Kinderhandtuch voll.
»Du musst zum Arzt«, sagte ich schließlich, um von meiner Beatmungsaktion abzulenken. Womöglich hatte er sogar recht und ich hatte nicht richtig gefühlt. Aber ich war in Panik gewesen! »Eventuell habe ich dir bei der Wiederbelebung eine Rippe gebrochen.«
Kane zog lediglich eine Augenbraue in die Höhe. »Das warst nicht du. Keine Sorge«, antwortete er kryptisch.
»Du musst trotzdem ins Krankenhaus.«
»Hab keine Krankenversicherung und kein Geld«, antwortete er. Natürlich. Beschämt senkte ich den Blick. Ich vergaß immer wieder, dass nicht alle Menschen so privilegiert waren wie wir. Eine Krankenversicherung konnten sich viele Familien in Amerika nicht leisten.
Ich unterdrückte ein leises Seufzen der Verzweiflung. Als Krankenschwester war ich denkbar ungeeignet, wie die Wiederbelebung eindrucksvoll bewiesen hatte. Außerdem hasste ich den Anblick von Blut, und bei Erbrochenem wurde mir speiübel. Die perfekten Voraussetzungen, einen verletzten Mann zusammenzuflicken.
»Wo ist euer Erste-Hilfe-Kasten?«, riss mich Kane aus meinen Gedanken. Seine Stimme klang vor Anstrengung gepresst. Endlich verstand ich, was er in unserem Poolhaus gesucht hatte. Keinen Alkohol. Kein Geld. Lediglich Verbandsmull und Pflaster.
»Hier jedenfalls nicht. Warte, ich hole Verbandssachen.« Damit war es offiziell. Ich würde Kane helfen. Warum, war mir selbst unklar. Vielleicht, weil er so schrecklich hilflos aussah und ich Mitleid hatte. Vielleicht, weil ich ihn versehentlich hatte wiederbeleben wollen – so was prägte. Und möglicherweise, ganz vielleicht, weil es das Aufregendste war, das ich bislang erlebt hatte. So einfach war das.
Ich ließ Kane zurück und flitzte am Pool vorbei ins Haus. Ohne zu überlegen, durchquerte ich das riesige Wohnzimmer meiner Eltern und polterte die geschwungene Treppe hinauf. Im ersten Stock angekommen, hielt ich direkt aufs Bad zu. Normale Leute bewahrten ihren Erste-Hilfe-Kasten in der Nähe der Küche auf, weil dort am meisten schiefging. Doch meine Eltern kochten nie. Wenn etwas passierte, dann am ehesten beim Rasieren. Ergo musste ich im Bad nachsehen.
Zum ersten Mal seit bestimmt zehn Jahren betrat ich das private Badezimmer meiner Eltern, das an deren Schlafzimmer angrenzte. Ich hatte mein eigenes im zweiten Stock, sodass ich keine Notwendigkeit sah, hier vorbeizuschauen. Das Bad von Mum und Dad war so groß wie anderer Leute Wohnzimmer. Es gab eine Regendusche, einen Whirlpool in der Ecke und eine frei stehende Badewanne auf silbernen Füßen. Doch das Heiligtum meiner Mutter war ihr Schminktisch, der sich direkt unter dem ausladenden Fenster befand. Zunächst hielt ich darauf zu, wechselte dann aber die Richtung und ging zu den zwei schneeweißen Waschbecken. Im darüber hängenden Spiegelbild erhaschte ich das Gesicht einer jungen Frau, die vor Aufregung rote Wangen und hektische Flecken auf der Stirn hatte. Ich sah in etwa so wüst aus, wie ich mich fühlte.
Der müde Ausdruck in meinen Augen, der mich in den letzten Wochen dermaßen genervt hatte, war verschwunden. Stattdessen funkelte das Blau meiner Iris zum ersten Mal seit Langem. Auch die schreckliche Blässe meiner Haut war wie weggeblasen. Zugegeben, die hektischen Flecken waren eher weniger schön, aber immer noch besser als dieses gespenstische Grau, das mich oft an Asche erinnerte. Die letzten Wochen waren hart für mich gewesen. Und das hatte man mir angesehen.
Unglaublich, was ein bisschen Abwechslung ausmachte. Beinahe sah ich wieder wie ich selbst aus. Na ja, zumindest, solange man nicht zu genau hinsah.
Ich löste mich von meinem Anblick und fand endlich das, was ich suchte. Unauffällig lag der Erste-Hilfe-Kasten im Schrank unter dem Waschbecken. Ich öffnete ihn und schnappte mir so viel ich tragen konnte. Weil ich auch noch das Desinfektionsspray und die Wattepads mitnehmen wollte, benutzte ich mein Schlafshirt als provisorischen Kängurubeutel. Das sah zwar doof aus, war aber praktisch.
Etwa zwei Minuten später war ich zurück bei Kane und lud meine Beute bei ihm ab. Er öffnete lediglich ein Auge und linste zu mir rüber.
»Mit den Sachen sollten wir erst mal was anfangen können«, erklärte ich. Im Poolhaus fand ich saubere Handtücher und eine alte Schüssel, in der ich früher meine Quietscheentchen hatte paddeln lassen. Ich eilte zurück in die Küche und kochte Wasser ab. Damit bewaffnet kniete ich mich neben Kane und erstarrte.
Und nun?
»Du hast keine Ahnung, was du jetzt machen sollst«, stellte er fest. Seine Art zu sprechen war noch verwaschener als zuvor. Ihn musste jede Bewegung seiner Lippen schmerzen. Kein Wunder. Sie waren angeschwollen und bluteten.
»In den Filmen sieht man immer nur, wie die Sachen zusammengesucht werden. Danach kommt ein Schnitt, und der Mensch ist verarztet«, verteidigte ich mich.
In die schlappe Gestalt am Boden kam Bewegung. Stöhnend richtete sich Kane auf und hielt sich dabei krampfhaft den Bauch. Hatte er da ebenfalls was abbekommen? Allmählich hatte ich Zweifel, ob ich klug handelte. In letzter Zeit hatte ich eine Menge schlechter Entscheidungen getroffen, was mein Selbstvertrauen reichlich getrübt hatte. Hoffentlich war das jetzt nicht der nächste Fehler. Wie schwer war Kane wirklich verletzt?
»Vergiss es, Val«, sagte er leise. Erst jetzt fiel mir auf, dass er wie selbstverständlich meinen Spitznamen benutzte. Vermutlich hatte er ihn im Laufe der Zeit aufgeschnappt. Alle meine Freunde nannten mich so, nur meine Eltern blieben bei Valerie. »Ein Arzt ist keine Option. Ich komme schon klar. Du kannst jetzt gehen.«
Anscheinend sah man mir dermaßen an, was ich dachte.
»Träum weiter. Ich lass dich bestimmt nicht allein. Nachher verblutest du und ich muss der Polizei erklären, warum ich dir meine Hilfe verweigert habe. Wegen so was kommt man in den Knast. Was ist denn überhaupt passiert?«
»Nichts, was dich etwas angehen würde.«
»Da du blutend in meinem Poolhaus liegst und mein Lieblingshandtuch aus Kindertagen versaust, geht mich das durchaus etwas an.«
»Erst einmal ist es das Poolhaus deiner Eltern. Und außerdem ist dieses Handtuch so hässlich, dass man es unmöglich versauen kann.« Kanes Hand zitterte, als er sich mit besagtem Handtuch über das Gesicht wischen wollte.
Ich verdrehte die Augen. »Gib her.« Energisch nahm ich es ihm ab, tunkte es ins Wasser und rückte dicht neben ihn. Es war ein seltsames Gefühl, Kane so nah zu sein. Den Gedanken an meinen kleinen Wiederbelebungsversuch verdrängte ich hastig.
In all den Jahren hatte ich stets darauf geachtet, einen Sicherheitsabstand zwischen uns einzuhalten. Schließlich war Kanes Familie in der gesamten Nachbarschaft verrufen. Die meisten hielten die Eltern für drogen- und alkoholsüchtig und die drei Jungs wegen ihrer finsteren Ausstrahlung für Gangmitglieder. So manch ein reicher Familienvater hatte versucht, das kleine Häuschen der Familie Ambrose aufzukaufen. Vergebens. Kanes Vater stand meinem in Sachen Sturheit in nichts nach. Das Haus war ein Familienerbe, weshalb die Ambroses gar nicht einsahen, es zu verlassen. Ungeachtet der Tatsache, dass sie überhaupt nicht hierher passten. Immerhin lebten wir in Montecito, der angesagtesten Gegend von Santa Barbara. Wer hier wohnte, war entweder reich oder berühmt. Oder beides.
Viele Jahre war ich eine perfekt integrierte Bewohnerin des finanzstärksten Bezirks der gesamten USA gewesen. Mittlerweile passte ich genauso wenig hierher wie der verletzte Typ vor mir. Zumindest fühlte es sich momentan so an.
Kane ließ zu, dass ich das Blut von seinen Wangen wusch, lehnte den Kopf gegen den Unterschrank und schloss während meiner Behandlung die Augen. Jedes Mal, wenn der Lappen erneut auf die aufgeplatzten Stellen in seinem Gesicht traf, zuckte er zusammen, doch kein Laut verließ seine Lippen. Das war beinahe unheimlich.
»Also? Was ist passiert?«, nahm ich das Gespräch wieder auf. Die Frage war so essenziell, dass ich nicht lockerlassen durfte. »Du bist verprügelt worden. So viel ist sicher. Wie sieht dein Gegner aus? Liegt der hier irgendwo in Mums Beet und verblutet langsam?«
»Um meinen Gegner musst du dir keine Sorgen machen. Und um mich im Übrigen auch nicht.«
»Ist klar.« Damit drückte ich extra ein wenig fester auf die verletzte Lippe. Kane zog scharf die Luft ein und sah mich böse an. Ich erwiderte den Blick genauso finster. »Du brauchst Hilfe. Mehr, als ich dir geben kann.«
»Du musst erst mal reichen«, antwortete er und sorgte damit für ein nervöses Ziehen in mir. Das war eine Menge Verantwortung, die er da auf mich ablud.
Mir war natürlich klar, dass es mit Blutabtupfen nicht getan war. So wie Kane dasaß, waren die wirklichen Blessuren irgendwo an seinem Oberkörper zu finden. Das, was ich gerade betrieb, war geradezu lächerlich.
Genervt ließ ich den Lappen sinken. »Lass sehen«, forderte ich ihn mit Blick auf seinen Bauch auf.
»Hast du Schmerzmittel?«, hielt er dagegen.
Ich zögerte und zog die Schachtel mit Ibuprofen hervor, die ebenfalls im Verbandskasten zu finden war. Kane nahm sie kommentarlos an sich und schluckte fünf Tabletten auf einmal. Hastig nahm ich sie ihm wieder weg. »Bist du irre?«, fauchte ich.
»Nein, aber ich kann vor Schmerzen kaum atmen.«
»Dann komm hoch. Hier auf die Liege. Vielleicht geht es da etwas besser.« Ich packte ihn unter der Schulter und zog. Er brauchte drei Anläufe, bis er stand, und schrie beim Hochkommen sogar leise auf. Schwankend tat er drei Schritte und ließ sich dann einfach auf die Liege fallen. Dabei zog er zischend Luft ein, kniff die Augen zusammen.
Ich hockte mich neben ihn und zeigte auf seine Lederjacke. »Runter damit. Ich will sehen, was los ist. Dann entscheide ich, ob wir nicht doch einen Krankenwagen rufen.«
»Wenn du das tust, stecke ich in richtigen Schwierigkeiten.«
»Du steckst auch so schon in Schwierigkeiten.«
Daraufhin sah er mich flehend an. »Bitte, Val. Kein Krankenwagen. Ich bin zäh.«
Das bezweifelte ich keineswegs, allerdings wurde ich mit jeder Sekunde nervöser, in der er blasser wurde. »Jacke aus«, blieb ich unerbittlich und half ihm bereits, sich nach vorne zu lehnen. So vorsichtig wie möglich zog ich sie von seinen Armen und musterte das weiße Shirt darunter. Es klebte an seiner Brust fest, war matschig, blutig und schweißdurchtränkt. Normalerweise wäre ich vermutlich davor zurückgeschreckt, doch momentan war ich im Krisenmodus. Zumal Kane vorsichtig das Shirt nach oben zog und selbst einen Blick auf seine Rippen warf. Die schillerten in allen Farben des Regenbogens. Zudem verlief ein sich schwarz verfärbender Abdruck an seiner kompletten rechten Seite entlang.
»Ach du Kacke«, fasste ich das zusammen, was wir wohl beide dachten. Abrupt stand ich auf, um mein Handy zu holen. In der gleichen Sekunde schnappte sich Kane mein Handgelenk, hielt mich zurück.
»Val«, sagte er noch einmal eindringlich in einem Tonfall, der mir eine Gänsehaut über den Körper jagte. Meinen Namen so aus seinem Mund zu hören, machte etwas mit mir. Es alarmierte mich bis in die letzte Haarspitze und sorgte gleichzeitig dafür, dass ich wie elektrisiert stehen blieb. »Ich hab schon Schlimmeres überstanden, aber wenn du jetzt einen Krankwagen rufst, sind wir geliefert.«
»Wir? Wer sind wir?«
»Meine Geschwister, insbesondere die Mädchen. Sobald ein Arzt diese Verletzungen sieht, werden Fragen gestellt. Sehr viele Fragen. Das Jugendamt wird wieder kommen und sich unsere Wohnsituation genau ansehen. Das volle Programm. Wir haben so was Ähnliches schon mal durchgemacht. Kein Spaß. Das garantiere ich dir. Sie werden meine völlig zugedröhnte Mutter entdecken und …« Kane unterbrach sich, schluckte schwer. »Es wird hässlich«, kürzte er knapp ab. »Dabei haben wir das Schlimmste hinter uns, und es muss nicht mit Kinderheim und Drama enden. Wenn du jetzt nicht die Nerven verlierst.«
Ich starrte ihn an. So eindringlich, wie ich es vermutlich noch nie bei jemandem getan hatte. Vehement versuchte ich zu ergründen, was der richtige Weg war. Der normale war offensichtlich: Krankenwagen rufen und der Dinge harren. Aber etwas an Kanes ganzer Haltung ließ mich davon Abstand nehmen.
Er war verzweifelt. Bis ins Mark erschüttert.
»Hast du was Illegales getan?«, fragte ich nach einer langen Schweigepause.
Zu meiner Erleichterung schüttelte er den Kopf. »Ich hab nur meine Familie beschützt.«
Das glaubte ich ihm. Ja, verdammt. Ich glaubte ihm jede Silbe davon. All die Jahre, die ich ihn nun schon heimlich beobachtet hatte, führten genau zu dieser Wahrheit: Kane war kein Schlägertyp, sondern jemand, der alles für seine Geschwister tat.
Jeden Abend kam er pünktlich um kurz vor sechs nach Hause und kümmerte sich dann um seine Schwestern. Er las in seinem Versteck im Garten Bücher, sobald er Zeit für sich hatte. Hängte Wäsche auf. Nicht nur die von sich, sondern die der ganzen Familie. Meiner Meinung nach war er die gute Seele seiner Familie und kein fieser Gangsterboss.
Verdammt. Ich hatte den Kerl echt gut beobachtet. Seit wann war ich so stalkermäßig drauf? Auf der anderen Seite hatten wir einfach viele Jahre nebeneinanderher gelebt, und mein Schlafzimmerfenster im obersten Stock war so ausgerichtet, dass ich hervorragend in den Garten der Ambrose-Familie sehen konnte.
»In Ordnung. Wir probieren es erst mal so, aber deine Rippen sehen aus, als könnten sie gebrochen sein.«
»Das wäre nicht das erste Mal. Ich kenn mich da aus. Die Ärzte machen in dem Fall ohnehin nicht viel und warten ab, dass der Bruch von selbst heilt. Hast du ein Dreieckstuch? Eine Schlinge hilft, um den Druck auf die Rippen zu lindern. Dadurch werden die Schmerzen erträglicher.«
So, wie er es sagte, hatte er genau das Manöver schon öfter gemacht. Instinktiv musterte ich seinen Oberkörper noch genauer. Tatsache. Ich musste nicht lange suchen, um viele kleine und größere Narben zu entdecken, wobei die frischen Blutergüsse sie zu überdecken begannen.
»Val«, riss mich Kane aus meinen Gedanken. »Hör auf zu starren und hilf mir.«
Das löste meine Betrachtung, und in mich kam Bewegung. Ich suchte eine Weile, bis ich schließlich ein weiches Tischtuch fand, das wir notdürftig um seinen Hals schlangen und den Arm auf der Seite mit den Rippenprellungen hineinlegten. Vorher schnitt ich ihm noch das T-Shirt vom Leib. Niemals hätte er die Arme so hoch bekommen, es auszuziehen.
Zum Vorschein kamen unheimliche Tattoos, die aber auch irgendwie … heiß waren.
Eine seltsame Mischung aus Totenköpfen, Äxten und Schlangen, doch dazwischen entdeckte ich kleine, gut versteckte Ranken, die Herzen und Wörter bildeten. Familie, las ich unter anderem. Und ich entdeckte drei Mädchennamen. Vermutlich die seiner Schwestern.
Dass sich all diese Tattoos auf gebräunter Haut und attraktiv geformten Muskeln befanden, machte die Sache noch anziehender.
Er war definitiv ein schöner Mann, Blessuren hin oder her. Kein aufgepumpter Muskelprotz, sondern ein durchtrainierter Athlet. Dass er regelmäßig joggen ging, war mir natürlich nicht entgangen. Außerdem arbeitete er morgens auf dem Bau und schraubte abends an verschiedensten Autos herum. Nicht, dass ich ihn ständig beobachtet hätte, aber … na gut. Ich hatte schon ziemlich oft zu ihm hinübergesehen. Aber zu meiner Verteidigung: Kane sah wirklich gut aus. Verboten gut.
Ich bemühte mich, meine Neugierde nicht zu deutlich zu zeigen, aber das war schwierig. »Es gibt doch noch eine Bedingung für meine Hilfe«, sagte ich in die Stille hinein, um meine nervösen Nerven unter Kontrolle zu bekommen und mich von dem Anblick seines Oberkörpers abzulenken.
Zum Glück hatte er die Augen geschlossen und konzentrierte sich ganz auf sich, sodass er meine Blicke nicht bemerkte. Dass ich ihn heimlich anschmachtete, war für mich alleine schon unangenehm genug. Hätte er das mitbekommen, wäre ich vor Scham im Boden versunken.
»Welche Bedingung?«, fragte er und öffnete wieder die Augen.
Ich bemühte mich, einen klaren Gedanken zu fassen, in dem nicht sein nackter Oberkörper vorkam. »Wir reden nie wieder über meinen Wiederbelebungsversuch. Kein Wort darüber. Keine Witze. Nicht mal Andeutungen. Klar?«
Ein Lächeln huschte über Kanes Gesicht und ließ es gleich viel weicher erscheinen. »Ich hab in meiner Verwirrung ernsthaft gedacht, du wolltest mich küssen«, antwortete er leise und da war es ganz plötzlich: ein seltsames Gefühl der Vertrautheit. Als würden wir uns schon seit vielen Jahren auf solch eine Weise miteinander unterhalten. Da war eine Leichtigkeit, die ich so noch nie gefühlt hatte.
»Nicht dein Ernst. Warum sollte ich dich küssen, obwohl du wie tot vor mir liegst?«, echauffierte ich mich gespielt dramatisch, um der seltsamen Stimmung zwischen uns zu entkommen.
»Das hab ich mich auch gefragt«, murmelte er langsam. »Mein Fehler. Ab heute bin ich dir jedenfalls eine Menge schuldig. Also keine Sorge, der Wiederbelebungskuss bleibt unter uns.«
»Das war kein Kuss!«
»Schade eigentlich. Dabei fing es gerade an, spannend zu werden.«
Im ersten Moment wollte ich ruppig antworten, dann sah ich das amüsierte Funkeln in seinen Augen und musste selbst lachen. »Kein Wort mehr darüber«, bestimmte ich nachdrücklich.
Sobald unser Provisorium richtig saß, seufzte er erleichtert auf. Offenbar half es wirklich gegen den Druck. Langsam ließ er den Kopf gegen die Lehne der Liege sinken. »Fuck!«
Ich blieb stumm neben ihm sitzen, haderte mit mir und seiner Entscheidung. »Und jetzt?«
»Kannst du mich einfach eine Weile hier liegen lassen? Ignorier mich und tu so, als hättest du mich nie gesehen. Was ist denn mit deinen Eltern? Wann kommen sie zurück?«
»Die sind momentan auf einer Tagung. Vermutlich kehren sie am Nachmittag heim.« Ich sah auf die Uhr an der Stirnseite des Poolhauses. »Jetzt ist es vier Uhr nachts. Du hättest noch etwa zehn Stunden, um dich zu bekrabbeln. Soll ich jemanden anrufen?«
Kane überlegte. Dann nickte er. »Kannst du mir mal mein Handy reichen?«
Es lag noch immer auf dem Boden. Als ich es aufhob, sah ich die vielen Dellen und Kratzer auf dem Display. Zwischen Hülle und Handy hatte sich geronnenes Blut angesammelt. Ich überreichte es ihm und sah, dass meine Hand dabei zitterte.
Kane hatte es ebenfalls gesehen, denn er ließ das Handy mit einem leisen Seufzen sinken und sah mich entschuldigend an. »Sorry, dass ich dich in diese Situation gebracht habe. Nur konnte ich nirgendwo hin.«
Ich deutete mit dem Daumen schräg über meine Schulter. »Dein Haus ist nur etwa zehn Meter entfernt.«
Statt zu antworten, warf er mir einen Blick zu, der mir klarmachte, dass das offenbar für ihn keine Option gewesen war.
»Aber was ist denn nur geschehen?«, fragte ich sanft. Was zur Hölle muss vorgefallen sein, dass er sich derart geprügelt hatte.
Er blieb mir die Antwort schuldig. Stattdessen sah er rasch weg und hob das Handy, starrte darauf. Dann ließ er es langsam wieder sinken, schloss müde das eine Auge, mit dem er noch sehen konnte. »Jack hat Nachtschicht. Der verliert seinen Job, wenn er rüberkommt. Und Nathan schläft beim Baby. Wenn ich den wecke, ist Emma wach. Ich … ich fürchte, du bist die einzige Hilfe, die ich im Moment kriegen kann.«
Mit einem Schlag fingen seine Finger an zu zittern. So heftig, dass es auf den gesamten Körper überging. Hastig ließ er das Handy los und ballte die Hände zu Fäusten. Sie waren an den Knöcheln blutig und aufgeplatzt.
Beinahe hätte ich mich neben ihn gehockt, ihn womöglich sogar berührt. Letztlich traute ich mich das aber doch nicht. »Ich hole Eis. Kühlpacks. So viele, wie ich finden kann«, versprach ich stattdessen und lief los, bevor er antworten konnte.
Sobald ich aus der Hütte raus war, atmete ich tief ein. Versuchte mich zu beruhigen. Kane Ambrose. Ausgerechnet er. Dass er mal meine Hilfe brauchen würde, hätte ich niemals für möglich gehalten. Und dass mich das so sehr aus der Bahn warf, erst recht nicht.
Kane
Verzweifelt bemühte ich mich, mich zusammenzureißen, aber der Schock saß zu tief. Mir zitterte der gesamte Körper, ohne dass ich es verhindern konnte. Da half auch kein Anspannen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich dann den Eindruck hatte, ich würde in der Mitte gespalten werden.
Fuck. Schon wieder waren die Rippen gebrochen.
Diesmal hatte ich mich allerdings gewehrt. Zu viel war zu viel gewesen. Noch immer sah ich den Ausdruck in den Augen meines Gegners. Der verhangene Blick. Das fiese Blitzen darin. Er war so im Alkoholrausch gewesen, dass er komplett durchgedreht war. Ein Choleriker. Ein gemeingefährliches Riesenarschloch. Völlig enthemmt. Wie im Blutrausch. Er hätte mich totgeschlagen. Da war ich mir in dieser Sekunde sicher gewesen.
Beruhige dich, Kane, ermahnte ich mich nicht zum ersten Mal. Ich hatte mich gewehrt. Da war nichts Falsches dran gewesen. Nachdem er sich endlich nicht mehr gerührt hatte, war ich noch eine Weile neben ihm liegen geblieben. Vielleicht war ich auch ohnmächtig geworden. Danach hatte ich getan, was getan werden musste. Wie betäubt. Mechanisch. Noch immer klebte die Erde überall an mir, und ich sah die leblosen Augen.
Diese schrecklichen, leblosen Augen, die mir immer wieder Schauer über den Rücken jagten.
Hatte ich die Schaufel weggeräumt? Ich erinnerte mich nicht. Ich erinnerte mich nur noch daran, dass ich mich weggeschleppt hatte. Rüber zum Poolhaus der Familie Bowman. Warum auch immer.
Jetzt lag ich hier und sah zu, wie Val mir ein Kühlpack erst auf ein Auge drückte und dann eine Ladung gefrorener Erbsen quer über meine wunden Fingerknöchel legte. Der brennende Schmerz verebbte augenblicklich und machte einem erträglichen Pochen Platz.
Dass mich ausgerechnet Val gefunden hatte, war natürlich ärgerlich. Aber besser sie als ihre Eltern. Val und ich hatten in unserem Leben nicht mehr als drei Worte zueinander gesagt und unsere Kommunikation ansonsten auf ein harmloses Nicken beschränkt. Eine Notwendigkeit, weil ich sie viel zu heiß fand. Wäre ich ihr auch nur eine Spur nähergekommen, um mit ihr zu sprechen, hätte ich mir garantiert irgendwann die Finger verbrannt. Wann immer ich sie zu Gesicht bekam, musste ich mich daher zwingen, wieder fortzusehen. Das ging schon seit Jahren so.
Ausgerechnet sie hockte in der schlimmsten Nacht meines Lebens neben mir und starrte mich aus diesen wahnsinnig intensiven blauen Augen an. Ausgerechnet, wo ich wirklich und wahrhaftig am Boden lag.
Bei dem Gedanken an die vergangenen Stunden konnte ich nur mit Mühe die Panik unterdrücken, die mich zu überrollen drohte. Verdammt. Was war denn jetzt mit der blöden Schaufel? Lag sie womöglich noch gut sichtbar mitten auf unserem Grundstück? Egal wie sehr ich mich auch bemühte, alles verschwand in einem schwarzen, undurchdringlichen Nebel. Als wollte mein Verstand mich dazu zwingen, das Geschehene zu vergessen.
Die Todesangst. Der pure Hass. Der Moment, in dem ich beschloss zu handeln. Um die zu schützen, die ich liebte.
Meine Brüder und meine Schwestern.
»Hast du Durst?«, riss mich Val aus meinen Gedanken.
Ich musste mich sehr dazu zwingen, das eine Auge zu öffnen, das noch nicht zugeschwollen war. Doch auch damit sah ich sie eher unscharf. Müde schüttelte ich den Kopf. Allein die Vorstellung, mit den Lippen irgendetwas zu berühren, war grauenhaft. Sie fühlten sich wie geschwollene Blasebalge an.
Ich zog das Kühlpack vom Auge herunter auf die Lippen. Fuck. Wie zur Hölle sollte ich rechtzeitig wieder auf den Beinen sein, um die Kids in den Kindergarten zu bringen? Nathan hatte heute volles Programm. Er musste sein Stipendium dingfest machen. Nicht auszudenken, wenn er das nicht bekam. Und Jack? Der … Ich wusste nicht mehr, was mein mittlerer Bruder heute vorhatte. Es war wichtig gewesen. An so viel erinnerte ich mich. Eine neue Jobperspektive. Ganz woanders.
»Nach einer Runde googeln bin ich zu folgender Erkenntnis gekommen: Ich muss diese fiese Platzwunde an deiner Stirn auswaschen. Dafür brauch ich anderes Desinfektionsmittel. Außerdem such ich mal nach Klammerpflastern. Dad hat noch so Dinger von seiner Zeit als Boxer. Aber ich muss dich warnen: Wenn ich das mache, dann gibt es unschöne Narben.«
Narben waren mir so was von egal. Davon hatte ich reichlich. Also nickte ich knapp. Als Val bereits aufsprang, brachte ich noch ein undeutliches »Danke« hervor, bevor ich mich wieder meiner Erschöpfung hingab. Dabei kam ich nicht umhin zu bemerken, dass ich mich in Val getäuscht hatte.
Obwohl ich sie seit Jahren interessant gefunden hatte, waren wir uns immer aus dem Weg gegangen. Eigentlich schade. So, wie sie sich jetzt benahm, war sie mit die spannendste Person weit und breit. Statt die Bullen und den Krankenwagen zu rufen, googelte sie, wie man Platzwunden versorgt. Unfassbar.
Sie weckte mich vermutlich eher versehentlich wieder. Mit einem Tuch wusch sie die fiese Wunde oben an der Stirn aus und hatte sogar eine Pinzette mit dabei. »Da sind Steine drin«, sagte sie nüchtern, als sie meinen misstrauischen Blick bemerkte.
»Mach ruhig«, nuschelte ich und schloss die Augen wieder. Lag es nur an meinen Schmerzen, dass ich ihr in dieser Hinsicht absolut vertraute? Vermutlich. Normalerweise war ich der misstrauischste Mensch der Welt, mal von Jack abgesehen. Bei Val hingegen hatte ich den Eindruck, in sicheren Händen zu sein. Keine Ahnung, wieso. Sie hatte so eine ruhige, freundliche Ausstrahlung.
Eine Ausstrahlung, die ich so niemals vermutet hätte.
Jack hatte sie immer die Eiskönigin genannt. Ihr Augenaufschlag war bei uns oft Thema am Abendbrottisch gewesen. Jack war der Meinung, dass sie ganz sicher ein eingebildetes It-Girl sein musste. Ich war mir sicher, dass sie lediglich auf ihr Äußeres achtete und sich nur von uns fernhielt, weil wir das auch taten. Im Gegensatz zu Jack hatte ich sie nie als eingebildet empfunden. Jetzt fühlte ich mich darin bestätigt. Ihre Augen wirkten sanft. Zugewandt. Von Eis keine Spur.
Als ich das nächste Mal auf die Uhr blickte, war es sechs, und Val klebte soeben ein letztes Pflaster auf die tiefe Schürfwunde an meinem rechten Arm. Ich erinnerte mich nicht mal mehr, wie ich mir die zugezogen hatte. Vermutlich war das bei meinem Sturz passiert. Er hatte so unerwartet heftig zugeschlagen, dass ich zu Boden gegangen war.
Das Brummen meines Handys verhinderte zum Glück, dass ich mich näher mit dieser Erinnerung auseinandersetzen musste.
»Nathan ruft schon zum dritten Mal an«, sagte Val zu mir. »Ich hab versucht, dich zu wecken, aber du hast nicht reagiert.«
Mühsam schluckte ich und schmeckte den schalen Geschmack nach Kupfer und Dreck. Das Brummen erstarb. Nathan hatte aufgegeben.
»Hier. Ich hab aus den Partyutensilien von Dad einen Strohhalm aufgetrieben.« Sie hielt mir ein Glas mit einem fröhlich pink-weiß geringelten Strohhalm vor die Lippen.
Ich zwang mich zu zwei Schlucken und stellte fest, dass das Wasser meinen Geist zügig wiederbelebte. Dadurch erkannte ich auch, dass ich zu lange geschlafen hatte. Fuck. Was machte ich denn jetzt mit Nathan und den Kindern?
Mit einem leisen Stöhnen richtete ich mich in der Liege auf und nahm Val das Glas ab. Ich trank es komplett leer, gab es ihr zurück und versuchte dann testweise, die Beine auf den Boden zu setzen. Aufzustehen. Der Schmerz in meiner Schulter war unbeschreiblich.
»Wo willst du denn hin?«, fragte Val erschrocken. »Bleib gefälligst liegen!«
»Ich muss zu Nathan rüber. Er fährt heute nach Santa Barbara, um sich an der Uni einzuschreiben. Das Baby …« Scheiße. Mir wurde kotzübel und ich musste mich wieder zurücklehnen. Reiß dich zusammen, Kane, dachte ich verzweifelt, aber da war nicht mehr viel Spielraum. Mir ging es einfach nur dreckig.
»Nathan ruft wieder an. Soll ich mit ihm sprechen?«, fragte Val.
Ich hasste es, so hilflos zu sein. Leider half alles nichts. Widerstrebend nickte ich und sah aus halb geschlossenen Lidern zu, wie sich Val mein Handy schnappte und ranging.
»Hey, Nathan. Hier ist Val.«
Vor meinem inneren Auge sah ich, wie Nathan von jetzt auf gleich wach wurde. Ob er Val überhaupt zuordnen konnte?
»Ja, genau die Val. Eure Nachbarin. Kane kann grad nicht.«
Ernsthaft? Musste sie das so formulieren? Wenigstens lief sie ganz leicht rot an, als ihr klar wurde, welche Rückschlüsse Nathan gerade vermutlich zog. Kurioserweise korrigierte sie das nicht, sondern lauschte Nathans Wortschwall. Wenn ich nicht irrte, klang er aufgebracht. Als er zu reden aufhörte, fasste Val das Gehörte mit drei Worten zusammen. »Deine Mum packt.«
Ach du Scheiße. Mum. Sie packte. Das hatte sie schon einige Male angedroht, aber nie wahr gemacht. Meistens war sie zu zugedröhnt, um sich die Mühe zu machen. Auf der anderen Seite hatte sie gestern auch zum ersten Mal seit Langem Prügel von Dad kassiert. Gut möglich, dass ihr das Beine gemacht hatte.
Ich war zu zerschlagen, um mich großartig aufzuregen. Stattdessen unternahm ich einen weiteren Anlauf aufzustehen, gab aber auf. Nichts zu machen. Mein Körper machte einfach nicht mit. Hilflos sah ich Val an, und zum ersten Mal war ich wirklich, wirklich ratlos. So ratlos, dass mir die Worte fehlten.
Val musterte mich von oben bis unten, dann seufzte sie leise. »Nathan, kannst du rüberkommen?« Mein Bruder antwortete etwas. Kurz und knapp, woraufhin Val auflegte.
Ich sah sie fragend an.
»Er kommt rüber. Mit den Mädchen.« Jetzt hörte ich Unsicherheit in Vals Stimme. Wahrscheinlich wurde ihr soeben klar, wie tief sie sich in unser Familiendrama hineinbewegte.
»Sorry«, brachte ich hervor.
Sie winkte ab. »Solange Mum und Dad nicht da sind, ist alles gut. Ich geh zur Gartengrenze und fang deine Geschwister ab.«
»Vorher muss ich was drüberziehen. Die dürfen mich nicht so zugerichtet sehen«, murmelte ich leicht panisch, woraufhin mir Val zwei Decken über den Körper legte. Mein lädiertes Gesicht ließ sich allerdings nicht verstecken. »Naomi«, brachte ich schwach hervor. »Die bekommt Albträume davon.«
»Ich kümmer mich und schick nur Nathan rein.« Sie stand auf und verschwand, ließ mich als nervöses, kribbeliges Wrack zurück. Zum Glück dauerte es nicht lange, bis ich Schritte hörte.
Nathan kam mit der neugeborenen Emma auf dem Arm rein. Als er mich auf der Liege sah, blieb er abrupt stehen. »Ach … du … Scheiße«, brachte er stockend hervor.
Ich hob lediglich eine Hand zum Gruß und rührte mich ansonsten nicht, ließ Nathan Zeit, alles zu erfassen. Als er begriff, wurde sein Blick todernst. »War er das?«
»Wer sonst?«
Nathan knirschte lautstark mit den Zähnen. »Das erklärt Mums Veilchen und ihr dramatisches Kofferpacken. Sie sieht nicht so übel aus wie du, ist aber völlig hysterisch. Sie will wirklich ausziehen. Redet ständig was davon, dass sie es mit Dad keine Sekunde länger aushält.« Wir blickten beide Emma an, die friedlich an Nathans Schulter vor sich hinratzte. Drei Monate war sie nun auf der Welt. Seitdem war alles noch weiter aus den Fugen geraten. Häufig schrie sie die ganze Nacht durch, was Dad kirre machte. Dabei hatten Jack, Nathan und ich sie schon längst zu uns ins Zimmer geholt. Trotzdem flippte er bei jedem kleinen Quäken aus.
»Meint Mum es denn ernst?«, fragte ich vorsichtig. Als Nathan nickte, floss heiße Angst durch meine Adern. »Packt sie auch für uns?«
Nathan lachte trocken auf. »Für uns Jungs bestimmt nicht. Für die Mädchen … Sie hat zumindest Hannas Rucksack in der Hand gehabt.«
Vermutlich hatte ich bis gerade eben ohnehin wenig Blut im Gesicht gehabt, aber jetzt rutschte auch der letzte Rest bis in die Füße. Zumindest fühlte es sich so an. »Sie darf sie nicht mitnehmen«, sagte ich tonlos. »Wir müssen das verhindern. Die Mädchen verstecken. Zur Not die Behörden einschalten.«
Das war ein Schritt, den wir seit Monaten in Erwägung zogen. Die Situation zu Hause war beinahe unerträglich geworden. Natürlich hätte ich längst ausziehen können. Alt genug war ich schließlich. Jack war einige Male kurz davor gewesen, aber Mum hatte sich geweigert, die Mädchen mit uns kommen zu lassen. Also waren wir geblieben. Wir alle. Mitgehangen, mitgefangen. Jetzt spürte ich allerdings, dass wir an einem Scheideweg angekommen waren. In einer Sackgasse, aus der wir nur mit einem beherzten Sprung rauskamen.
»Ruf Jack an«, befahl ich schließlich schweren Herzens. »Was immer er heute vorhatte: Er muss es absagen und sofort zurückkommen. Und du musst los!«
»Ich lass dich doch jetzt nicht allein. Bist du irre?«
»Du kannst dich nur heute für dein Stipendium vorstellen. Los!«
»Ich bekomme auch nächstes Jahr eine weitere Chance. Ich …«
»Nathan, ich meine es ernst. Mach, dass du auf deine Ducati kommst, und schwing deinen Arsch nach Santa Barbara.« Zum Brüllen war meine Luft zu knapp, daher legte ich so viel Drohung in meine Worte, wie ich konnte. Meine Rippen brannten wie die Hölle.
Unbeeindruckt rührte sich Nathan keinen Millimeter. »Du liegst da wie tot. Dass du dich nicht mal aufgerichtet hast, sagt alles. Im Leben lass ich dich so nicht allein. Schon gar nicht mit einer außer Kontrolle geratenen Mum. Ich könnte es mir nie verzeihen, wenn ich zurückkomme, und die Mädchen sind weg.«
Wir starrten einander an und spürten wohl beide, wie sich die Schlinge um unsere Hälse unerbittlich zuzog. Emma wimmerte leise im Schlaf, zog die Beinchen an und pupste. Nathan streichelte liebevoll ihren Rücken und erwiderte meinen wütenden Blick stoisch. »Wir hängen da alle mit drin«, sagte er. »Du hast schon den Preis für diese Nacht bezahlt.« Er zog sein Handy hervor und wählte. Vermutlich rief er Jack erneut an. Dass der Kerl aber auch nie auf Anrufe reagierte. Es war zum Zähneknirschen.
Als Nathan unverrichteter Dinge sein Handy wieder wegsteckte, rollte eine neue Panikwelle heran. Bevor sie mich erreichte, entschloss ich mich zu einem Schritt, den ich niemals von mir erwartet hätte.
»Frag Val um Hilfe. Bitte sie, mit den Mädchen in den Zoo zu gehen. Im Kinderwagen bleibt Emma hoffentlich lange genug friedlich.«
»Mit allen dreien?«, fragte Nathan ungläubig.
»Ja. Naomi kann ihr genug zeigen, damit sie mit dem Baby klarkommt.«
Nathan zeigte mir einen Vogel. »Ist das nicht zu viel verlangt?« Als er jedoch meinen Blick sah, gab er nach. »Also schön. Ich frag sie.«
Kaum war er draußen, schrieb ich Jack eine Nachricht. Darauf reagierte er eigentlich immer.
Kane: Komm sofort nach Hause. Bude brennt. Dad hat mich schwer erwischt. Mum dreht durch. Mädchen in Gefahr. Nathan muss weg. Allein geh ich unter.
Ich schickte sie ab und war mir sicher, dass diese wenigen Zeilen Jack in höchste Alarmbereitschaft versetzen würden. Mehr konnte ich jetzt nicht tun. Danach richtete ich mich auf und angelte nach den Schmerztabletten, die Val vermutlich mit Absicht aus meiner Reichweite gestellt hatte. Ich erwischte sie trotzdem und warf mir eine Handvoll ein. Bislang hatten sie nur mäßig gewirkt – oder ich war schwerer verletzt, als ich dachte. Wenigstens saß ich jetzt auf der Kante der Liege, ohne wieder zusammenzuklappen. Ein Fortschritt.
Die Tür klapperte, und Val tauchte vor mir auf. Sie hatte rote Wangen, die ihr beinahe unverschämt gut standen, und verstrubbelte Haare. Trotz meines Zustands stellte ich erneut fest, dass sie echt niedlich war.
»So ernst?«, fragte sie mich.
Ich nickte. »Wir müssen die Mädchen außer Reichweite bringen. Meine Mum nimmt sie sonst mit.«
Val wirkte wenig überrascht. Wahrscheinlich hatte sie genug Dramen über den Gartenzaun beobachtet und wusste, was ich meinte. Wenn Mum schlecht drauf war, flog auch mal ein Stuhl von der Terrasse. »Von Babys hab ich keine Ahnung«, merkte sie lediglich an.
»Hatten wir alle nicht. Da wächst man rein.« Stöhnend zog ich mich auf die Beine, hielt mich dabei an der Kante eines Sideboards fest. Dieses Poolhaus war luxuriöser eingerichtet als unser Wohnzimmer. Etwas vollgestellt, aber definitiv zu schick, um nie benutzt zu werden.
»Wo willst du denn hin?« Val war mit einem Satz neben mir und legte ihre warme Hand unter meine Achsel, wollte mich stützen. Angesichts der Tatsache, dass ich bestimmt einen Kopf größer war als sie und gut fünfzig Kilo schwerer, zweifelte ich, dass ihre Bemühungen etwas brachten, aber der gute Wille zählte ja auch.
»Ich muss zu Mum, ehe sie irre Sachen tut.«
In Vals Augen sah ich genau, was sie dachte: Du gehörst ins Krankenhaus. Dass sie das nicht aussprach, rechnete ich ihr hoch an. Stattdessen zeigte sie auf die Schmerztabletten. »Hab noch mal nachgeschaut. Zwei könntest du noch nehmen.«
»Hab ich schon.« Dass ich am Limit war, merkte ich schon jetzt. In meinem Kopf breitete sich langsam ein dumpfer Nebel aus. Auf keinen Fall durfte ich mehr einwerfen. Eine zugedröhnte Person in der Familie reichte.
»Wir haben Jack Bescheid gegeben. Der sollte dich so schnell wie möglich ablösen. Wichtig wäre jetzt nur, dass du mit den Mädchen verschwindest. Sobald Mum sie aus dem Nachbarhaus kreischen hört, dreht sie garantiert am Rad.« Uff. Ich stand jetzt ohne Festhalten. Mühsam richtete ich mich auf und stellte mit Erleichterung fest, dass es sogar besser ging als gedacht. Die Stütze für meine Rippen half mir beim Atmen, und die Schmerztabletten regelten den Rest.
Val zögerte keine Sekunde. »Ich geh mit ihnen in den Zoo. Und Kane?«
»Hmmm …«
»Du schaffst das. Zeig es deiner Mum. Die schikaniert euch schon viel zu lange.«
Val
Mit einem Schlag für drei kleine Mädchen verantwortlich zu sein war heftig. Zwar wies mich Nathan blitzschnell in alles ein, wirkte dann aber trotzdem etwas unglücklich, als ich mit den Kindern losmarschierte. Weg von Kanes Elternhaus, das ich seit dieser Nacht mit anderen Augen sah.
Ich hatte von den Schwierigkeiten der Familie immer mal wieder gehört. Dad war sich sicher gewesen, dass die Eltern Drogendealer oder Abhängige waren. Ich hatte immer dagegengehalten und seine hochtrabenden Reden abgebügelt. Schon aus Prinzip, weil meinem Dad das alte Häuschen inmitten der schicken Gegend ganz generell ein Dorn im Auge war. Jetzt musste ich ihm im Stillen recht geben.
Kanes Eltern waren genau das, was mein Dad befürchtet hatte. Bei den Kindern hatte er sich hingegen geirrt. Sie waren keine Minigangster, sondern versuchten lediglich, sich irgendwie durchzuschlagen.
Hör auf, über die Ambrose-Brüder nachzudenken, sondern konzentrier dich aufs Wesentliche, ermahnte ich mich streng. Drei kleine Kinder zu sitten war etwas komplett Neues. Ich rettete mich mit ihnen an den Strand, versorgte die beiden älteren mit reichlich Eis und betete die ganze Zeit, dass das Baby nicht aufwachte. Es tat mir den Gefallen und schlummerte friedlich im Kinderwagen. Gerade überlegte ich, wie es weitergehen sollte, als mein Handy klingelte.
Ich fischte es aus meiner Hosentasche und seufzte. Mum rief an. »Valerie, mein Schatz«, flötete sie zur Begrüßung. »Wir verspäten uns leider noch ein wenig. Dein Vater hat sich bei der Abfahrt verquatscht, und jetzt stehen wir hoffnungslos im Stau.«
»Kein Problem«, sagte ich und hoffte, dass sie meine Erleichterung nicht zu deutlich hörte. »Ich hab heute ohnehin nichts Großartiges vor.«
»Ach, Val. Du musst langsam wirklich über Patrick hinwegkommen und das Leben wieder genießen. Wie wäre es heute Abend mit Pizza und einem guten Film?«
Pizza? Wenn Mum so ein Essen auch nur in Erwägung zog, musste sie mich wirklich für hilfsbedürftig halten. Schon als Kind war jeder Geburtstag ein Kampf gewesen. Shrimps als Appetithäppchen mit besonders gesunden Getränken dazu kamen bei Achtjährigen nun einmal nicht so gut an wie fettige Pizza mit Fanta.
»Ich bin über Patrick hinweg«, antwortete ich ausweichend. »Aber das Pizzaangebot nehme ich trotzdem an. Isst Dad mit?«
Mum lachte leicht hysterisch. »Der sagt, er isst im Countryclub. Wir haben also den Abend für uns. Falls wir jemals ankommen.«
»Lasst euch Zeit.« Ich verabschiedete mich noch möglichst herzlich von Mum und hoffte, dass sie keine Lunte gerochen hatte. Nicht auszudenken, wenn sie auch nur ahnen würde, dass Kane Ambrose in ihr Poolhaus geblutet hatte.
Ich steckte das Handy gerade weg, da brach plötzlich bei allen Kindern gleichzeitig die Hysterie aus. Keine Ahnung, was geschehen war. Hanna weinte plötzlich herzergreifend, Naomi machte mit, und zu allem Überfluss wachte jetzt auch noch das Baby auf.
Als dann zusätzlich mein Handy schon wieder klingelte, war ich völlig überfordert. Statt mich um die Kinder zu kümmern, nahm ich den Anruf an. Vermutlich erhoffte ich mir dadurch Rettung in letzter Sekunde.
»Scheiße«, hörte ich eine Männerstimme fluchen. »Was ist da los bei euch? Val? Sprich mit mir, verdammt!«
»Wer ist da überhaupt?«, fragte ich und nahm hastig das Baby aus dem Wagen, während Hanna von ihrer vierjährigen Schwester in den Arm genommen wurde.
»Jack!«
Jack? Welcher … ach, Scheiße. Der Jack. Um ehrlich zu sein war mir der mittlere der drei Ambrose-Brüder mit am unheimlichsten. Lachen gesehen hatte ich ihn vermutlich noch nie. Stattdessen nickte er mir lediglich knapp zu und strahlte eine »Sprich mich bloß nicht an«-Aura der Extraklasse aus.
»Wo bist du?«, fragte er in der Sekunde.
»Am Strand. Den Mädchen geht es gut.«
»Hörte sich gerade aber anders an.« Jack klang genauso ruppig, wie ich mir ein Gespräch mit ihm immer vorgestellt hatte.
»Willst du meckern? Dann komm her und nimm mir deine Schwestern ab«, antwortete ich eisig.
»Ich bin unterwegs. Wo genau bist du? Ich komme hin.«
Also nannte ich ihm den genauen Strandabschnitt und war erleichtert, als er mir versprach, in weniger als zwanzig Minuten da zu sein.
Die Zeit schaffte ich jetzt auch noch. Irgendwie.
Als Jack uns schließlich fand, hatte sich die gesamte Lage beruhigt. Emma war wieder eingeschlafen, und im Schatten sitzend hatten Naomi, Hanna und ich eine hübsche Sandburg geschaufelt.
Jack hockte sich wie selbstverständlich neben uns und ließ sich leise lachend von seinen kleinen Schwestern rücklings in den Sand werfen. Kurz balgten sie miteinander, ehe Jack zum Aufbruch drängte. Ich kam dem nur zu gerne nach, denn ich musste dringend zurück. Beim Gedanken an das Poolhaus und meine zurückkehrenden Eltern wurde mir ganz anders.
»Dann mal los«, sagte Jack betont gut gelaunt, hob Hanna auf seine Schultern und nahm Naomis Hand. Dann blieb er abrupt noch einmal stehen und nickte mir knapp zu – auf seine typische, leicht schroffe Art. Allerdings sagte er dabei: »Danke, Val. Echt. Vielen Dank für deine Hilfe.«
Ich erwiderte sein Nicken ebenso knapp, und meine Schultern entspannten sich umgehend. Vielleicht war Jack Ambrose doch nicht so ein Kotzbrocken, wie ich immer gedacht hatte.
KAPITEL 2
KAPITEL 2
Kane
Ich musste Nathan bis zu seinem Bike geleiten, damit er endlich nach Santa Barbara aufbrach. Dass mir dieser kurze Fußmarsch alles abverlangte, behielt ich für mich. Kaum war mein kleiner Bruder um die Ecke verschwunden, kotzte ich erst mal in den nächsten Busch, ehe ich mich zu der Konfrontation meines Lebens begab: Mum.
Ich hasste es. Ich hasste es einfach. Schon allein beim Gedanken an ihre müden Augen und die schlaffen Gesichtszüge gärte eine so lodernde Wut in mir, dass ich sie kaum kontrollieren konnte. In diesen Momenten bekam ich manchmal Angst vor mir selbst. Mum mit Schlafmitteln zugedröhnt war kaum zu ertragen. Wenn sie zusätzlich getrunken hatte, war sie die Hölle.