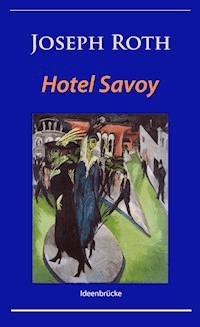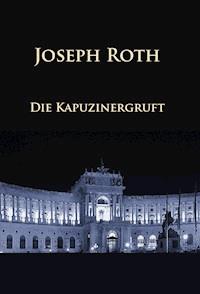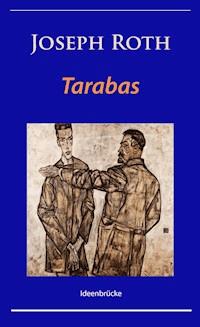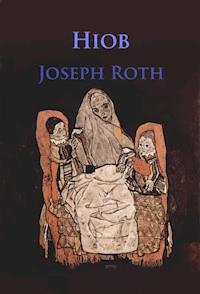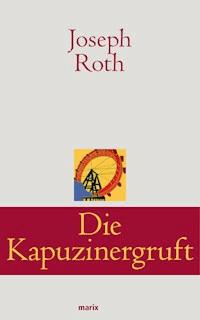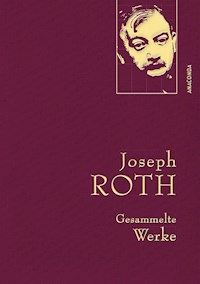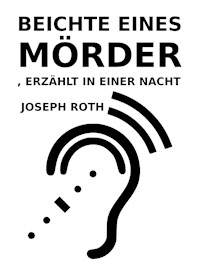
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Beichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht ist ein spannender Roman, der zu dem Spätwerk von Roth zählt. Er spielt Anfang des 20ten Jahrhunderts und handelt von einem scheinbaren Doppelmord. Auszug: Vor einigen Jahren wohnte ich in der Rue des Quatre Vents. Meinen Fenstern gegenüber lag das russische Restaurant »Tari-Bari«. Oft pflegte ich dort zu essen. Dort konnte man zu jeder Stunde des Tages eine rote Rübensuppe bekommen, gebackenen Fisch und gekochtes Rindfleisch. Ich stand manchmal spät am Tage auf. Die französischen Gasthäuser, in denen die altüberlieferten Stunden des Mittagessens streng eingehalten wurden, bereiteten sich schon für die Nachtmähler vor. Im russischen Restaurant aber spielte die Zeit keine Rolle. Eine blecherne Uhr hing an der Wand. Manchmal stand sie, manchmal ging sie falsch; sie schien die Zeit nicht anzuzeigen, sondern verhöhnen zu wollen. Niemand sah nach ihr. Die meisten Gäste dieses Restaurants waren russische Emigranten. Und selbst jene unter ihnen, die in ihrer Heimat einen Sinn für Pünktlichkeit und Genauigkeit besessen haben mochten, hatten ihn in der Fremde entweder verloren, oder sie schämten sich, ihn zu zeigen. Ja, es war, als demonstrierten die Emigranten bewußt gegen die berechnende, alles berechnende und so sehr berechnete Gesinnung des europäischen Westens, und als wären sie bemüht, nicht nur echte Russen zu bleiben, sondern auch »echte Russen« zu spielen, den Vorstellungen zu entsprechen, die sich der europäische Westen von den Russen gemacht hat. Also war die schlecht gehende oder stehengebliebene Uhr im Restaurant »Tari-Bari« mehr als ein zufälliges Requisit: nämlich ein symbolisches. Die Gesetze der Zeit schienen aufgehoben zu sein. Und manchmal beobachtete ich, daß selbst die russischen Taxi-Chauffeure, die doch gewiß bestimmte Dienststunden einhalten mußten, ebensowenig um den Gang der Zeit bekümmert waren wie die anderen Emigranten, die gar keinen Beruf hatten und die von den Almosen ihrer bemittelten Landsleute lebten. Derlei berufslose Russen gab es viele im Restaurant »Tari-Bari«. Sie saßen dort zu jeder Tageszeit und spät am Abend und noch in der Nacht, wenn der Wirt mit den Kellnern abzurechnen begann, die Eingangstür schon geschlossen war und nur noch eine einzige Lampe über der automatischen Stahlkasse brannte. Gemeinsam mit den Kellnern und dem Wirt verließen diese Gäste die Speisestube. Manche unter ihnen, die obdachlos oder angetrunken waren, ließ der Wirt über Nacht im Restaurant schlafen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Beichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht
Beichte eines Mörders, erzählt in einer NachtAnmerkungenImpressumBeichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht
Vor einigen Jahren wohnte ich in der Rue des Quatre Vents. Meinen Fenstern gegenüber lag das russische Restaurant »Tari-Bari«. Oft pflegte ich dort zu essen. Dort konnte man zu jeder Stunde des Tages eine rote Rübensuppe bekommen, gebackenen Fisch und gekochtes Rindfleisch. Ich stand manchmal spät am Tage auf. Die französischen Gasthäuser, in denen die altüberlieferten Stunden des Mittagessens streng eingehalten wurden, bereiteten sich schon für die Nachtmähler vor. Im russischen Restaurant aber spielte die Zeit keine Rolle. Eine blecherne Uhr hing an der Wand. Manchmal stand sie, manchmal ging sie falsch; sie schien die Zeit nicht anzuzeigen, sondern verhöhnen zu wollen. Niemand sah nach ihr. Die meisten Gäste dieses Restaurants waren russische Emigranten. Und selbst jene unter ihnen, die in ihrer Heimat einen Sinn für Pünktlichkeit und Genauigkeit besessen haben mochten, hatten ihn in der Fremde entweder verloren, oder sie schämten sich, ihn zu zeigen. Ja, es war, als demonstrierten die Emigranten bewußt gegen die berechnende, alles berechnende und so sehr berechnete Gesinnung des europäischen Westens, und als wären sie bemüht, nicht nur echte Russen zu bleiben, sondern auch »echte Russen« zu spielen, den Vorstellungen zu entsprechen, die sich der europäische Westen von den Russen gemacht hat. Also war die schlecht gehende oder stehengebliebene Uhr im Restaurant »Tari-Bari« mehr als ein zufälliges Requisit: nämlich ein symbolisches. Die Gesetze der Zeit schienen aufgehoben zu sein. Und manchmal beobachtete ich, daß selbst die russischen Taxi-Chauffeure, die doch gewiß bestimmte Dienststunden einhalten mußten, ebensowenig um den Gang der Zeit bekümmert waren wie die anderen Emigranten, die gar keinen Beruf hatten und die von den Almosen ihrer bemittelten Landsleute lebten. Derlei berufslose Russen gab es viele im Restaurant »Tari-Bari«. Sie saßen dort zu jeder Tageszeit und spät am Abend und noch in der Nacht, wenn der Wirt mit den Kellnern abzurechnen begann, die Eingangstür schon geschlossen war und nur noch eine einzige Lampe über der automatischen Stahlkasse brannte. Gemeinsam mit den Kellnern und dem Wirt verließen diese Gäste die Speisestube. Manche unter ihnen, die obdachlos oder angetrunken waren, ließ der Wirt über Nacht im Restaurant schlafen. Es war zu anstrengend, sie zu wecken und sogar wenn man sie geweckt hätte, wären sie doch gezwungen gewesen, nach einem andern Obdach bei einem andern Landsmann zu suchen. Obwohl ich an den meisten Tagen, wie gesagt, selbst sehr spät aufstand, konnte ich doch manchmal am Morgen, wenn ich zufällig an mein Fenster trat, sehen, daß »Tari-Bari« schon geöffnet war und »in vollem Betrieb«, wie der Ausdruck für Gasthäuser lautet. Die Leute gingen ein und aus. Sie nahmen dort offenbar das erste Frühstück und manchmal sogar ein alkoholisches erstes Frühstück. Denn ich sah manche taumelnd herauskommen, die noch mit ganz sicheren Füßen eingetreten waren. Einzelne Gesichter und Gestalten konnte ich mir merken. Und unter diesen, die auffällig genug waren, um sich mir einzuprägen, befand sich ein Mann, von dem ich annehmen durfte, daß er zu jeder Stunde des Tages im Restaurant »Tari-Bari« anzutreffen sei. Denn sooft ich auch des Morgens ans Fenster kam, sah ich ihn drüben vor der Tür des Gasthauses, Gäste begleitend oder Gäste begrüßend. Und sooft ich am späten Nachmittag zum Essen kam, saß er an irgendeinem der Tische, mit den Gästen plaudernd. Und trat ich spät am Abend, vor »Geschäftsschluß« – wie die Fachleute sagen –, im »Tari-Bari« ein, um noch einen Schnaps zu trinken, so saß jener Fremde an der Kasse und half dem Wirt und den Kellnern bei den Abrechnungen. Im Laufe der Zeit schien er sich auch an meinen Anblick gewöhnt zu haben und mich für eine Art Kollegen zu halten. Er würdigte mich der Auszeichnung, ein Stammgast zu sein wie er – und er begrüßte mich nach einigen Wochen mit dem erkennenden und wortreichen Lächeln, das alte Bekannte füreinander haben. Ich will zugeben, daß mich dieses Lächeln am Anfang störte – denn das sonst ehrliche und sympathische Angesicht des Mannes bekam, wenn es lächelte, nicht geradezu einen widerwärtigen, wohl aber einen gleichsam verdächtigen Zug. Sein Lächeln war nicht etwas Helles, es erhellte also nicht das Gesicht, sondern es war trotz aller Freundlichkeit düster, ja, wie ein Schatten huschte es über das Angesicht, ein freundlicher Schatten. Und also wäre es mir lieber gewesen, wenn der Mann nicht gelächelt hätte.
Selbstverständlich lächelte ich aus Höflichkeit wieder. Und ich hoffte, daß dieses gegenseitige Lächeln vorläufig oder sogar für längere Zeit der einzige Ausdruck unserer Bekanntschaft bleiben würde. Ja, im stillen nahm ich mir sogar vor, das Lokal zu meiden, wenn der Fremde eines Tages etwa anfangen sollte, das Wort an mich zu richten. Mit der Zeit aber ließ ich auch diesen Gedanken fallen. Ich gewöhnte mich an das schattenhafte Lächeln, ich begann, mich für den Stammgast zu interessieren. Und bald fühlte ich sogar den Wunsch nach einer näheren Bekanntschaft mit ihm in mir wach werden.
Es ist an der Zeit, daß ich ihn etwas näher beschreibe: Er war groß gewachsen, breitschultrig, graublond. Mit klaren, manchmal blitzenden, durch Alkohol niemals benebelten blauen Augen sah er die Menschen geradewegs an, mit denen er sprach. Ein mächtiger, sehr gepflegter, graublonder, waagerechter Schnurrbart teilte den oberen Teil des breiten Angesichts von dem unteren, und beide Teile des Angesichts waren gleich groß. Dadurch erschien es etwas langweilig, unbedeutend, das heißt: ohne jedes Geheimnis. Hunderte solcher Männer hatte ich selbst in Rußland gesehn, Dutzende solcher Männer in Deutschland und in den anderen Ländern. Auffallend waren an diesem großen, starken Mann die zarten, langen Hände und ein sanfter, stiller, fast unhörbarer Schritt und überhaupt gewisse langsame, zaghafte und vorsichtige Bewegungen. Deshalb kam es mir zuweilen vor, daß sein Gesicht denn doch etwas Geheimnisvolles barg, insofern nämlich, als es seine gerade, leuchtende Offenheit nur spielte und daß der Mann die Leute, mit denen er sprach, nur deshalb so aufrichtig mit seinen blauen Augen anblitzte, weil er sich denken mochte, daß man Grund haben könnte, ihm zu mißtrauen, wenn er es etwa nicht täte. Und dennoch mußte ich mir bei seinem Anblick immer wieder sagen, daß er, wenn er eine so vollendete, allerdings naive Darstellung der personifizierten Aufrichtigkeit geben konnte, doch in der Tat ein großes Maß von Aufrichtigkeit besitzen mußte. Das Lächeln, mit dem er mir zuwinkte, war vielleicht nur aus Verlegenheit so dunkel: obwohl die großen Zähne blitzten und der Schnurrbart golden schimmerte, als verlöre er gleichsam während des Lächelns seine graue Mischfarbe und würde immer blonder. Man sieht, wie mir der Mann immer angenehmer wurde. Und bald begann ich sogar, mich auf ihn ein bißchen zu freuen, wenn ich vor der Tür des Gasthauses angelangt war, genauso auf ihn wie auf den vertrauten Schnaps und auf den vertrauten Gruß des dicken, angenehmen Wirtes.
Niemals hatte ich im »Tari-Bari« zu erkennen gegeben, daß ich die russische Sprache verstehe. Einmal aber, als ich an einen Tisch mit zwei Chauffeuren zu sitzen kam, wurde ich von ihnen gefragt, geradeheraus, welcher Nationalität ich sei. Ich antwortete, ich sei ein Deutscher. Wenn sie die Absicht hätten, Geheimnisse vor mir zu besprechen, in welcher Sprache auch immer, so möchten sie das bitte tun, nachdem ich wieder fortgegangen wäre. Denn ich verstünde so ziemlich alle europäischen Sprachen. Da aber gerade in diesem Augenblick ein anderer Tisch frei wurde, erhob ich mich und ließ die Chauffeure allein mit ihren Geheimnissen. Also konnten sie mich nicht mehr fragen, was offenbar ihre Absicht gewesen war, ob ich auch Russisch verstehe. Und man wußte es also weiter nicht.
Aber man erfuhr es eines Tages, eines Abends vielmehr, oder, um ganz genau zu sein: in einer späten Nachtstunde. Und zwar dank dem Graublonden, der damals gerade gegenüber dem Büfett saß, ausnahmsweise schweigsam und beinahe düster, wenn diese Bezeichnung überhaupt auf ihn angewandt werden kann.
Ich trat kurz vor Mitternacht ein, mit der Absicht, einen einzigen Schnaps zu trinken und mich gleich darauf zu entfernen. Ich suchte mir also gar nicht erst einen Tisch, sondern blieb an der Theke stehen, neben zwei anderen späten Gästen, die ebenfalls nur auf einen Schnaps hereingekommen zu sein schienen, entgegen ihrem ursprünglichen Plan aber schon längere Zeit hiergeblieben sein mußten; denn mehrere geleerte und halbgeleerte Gläser standen vor ihnen, dieweil es ihnen vorkommen mochte, daß sie erst ein einziges getrunken hatten. So schnell vergeht manchmal die Zeit, wenn man in einem Lokal an der Theke stehen bleibt, statt sich zu setzen. Sitzt man an einem Tisch, so übersieht man in jeder Sekunde, wieviel man genossen hat, und merkt an der Anzahl der geleerten Gläser den Gang der Zeiger. Tritt man aber in ein Gasthaus ein, nur »auf einen Sprung«, wie man sagt, und bleibt auch am Schanktisch stehen, so trinkt man und trinkt und glaubt, es gehörte noch alles eben zu jenem einzigen »Sprung«, den man zu machen gedacht hatte. Das beobachtete ich an jenem Abend an mir selbst. Denn gleich den beiden andern trank auch ich eins und das andere und das dritte, und ich stand immer noch da, ähnlich einem jener ewig hastigen und ewig säumigen Menschen, die ein Haus betreten, den Mantel nicht ablegen, die Klinke in der Hand behalten, jeden Augenblick auf Wiedersehen sagen wollen und sich dennoch länger aufhalten, als wenn sie Platz genommen hätten. Beide Gäste unterhielten sich ziemlich leise mit dem Wirt auf russisch. Was an der Theke gesprochen wurde, konnte der graublonde Stammgast gewiß nur halb hören. Er saß ziemlich entfernt von uns, ich sah ihn im Spiegel hinter dem Büfettisch, er schien auch gar nicht gesonnen, etwas von dem Gespräch zu hören oder gar sich an ihm zu beteiligen. Auch ich tat nach meiner Gewohnheit so, als verstünde ich nichts. Auf einmal aber schlug ein Satz gleichsam von selbst an mein Ohr. Ich konnte mich seiner gar nicht erwehren. Dieser Satz lautete: »Warum ist unser Mörder heute so finster?« Einer der beiden Gäste hatte diesen Satz ausgesprochen und dabei mit dem Finger auf das Spiegelbild des Graublonden hinter dem Büfett gedeutet. Unwillkürlich wandte ich mich nach dem Stammgast um und verriet also, daß ich die Frage verstanden hatte. Man musterte mich auch sofort ein wenig mißtrauisch, in der Hauptsache aber verblüfft. Die Russen haben, nicht mit Unrecht, Angst vor Spitzeln, und ich wollte auf alle Fälle verhüten, daß sie mich für einen hielten. Gleichzeitig aber interessierte mich die immerhin ungewöhnliche Bezeichnung »unser Mörder« in dem Maße, daß ich zuerst zu fragen beschloß, warum man den Graublonden so nenne. Ich hatte, als ich mich umwandte, bemerken können, daß der so ungewöhnlich benannte Stammgast die Frage auch gehört hatte. Er nickte lächelnd. Und er hätte wohl sofort selbst geantwortet, wenn ich gleichgültig geblieben und nicht in dieser kurzen Minute der Gegenstand des Zweifels und des Mißtrauens geworden wäre. »Sie sind also Russe?« fragte mich der Wirt. – Nein, wollte ich antworten, aber zu meiner Verwunderung erwiderte statt meiner der Graublonde hinter meinem Rücken: »Dieser unser Stammgast versteht Russisch und ist ein Deutscher. Er hat immer nur aus Diskretion geschwiegen.« »So ist es«, bestätigte ich, drehte mich um und sagte: »Ich danke Ihnen, Herr!« »Bitte sehr!« sagte er, stand auf und ging auf mich zu. »Ich heiße Golubtschik«, sagte er, »Semjon Semjonowitsch Golubtschik.« Wir gaben uns die Hand. Der Wirt und die beiden anderen Gäste lachten. »Woher wissen Sie über mich Bescheid?« fragte ich. »Man ist nicht umsonst bei der russischen Geheimpolizei gewesen«, sagte Golubtschik. Ich konstruierte mir sofort eine phänomenale Geschichte. Dieser Mann hier, dachte ich, sei ein alter Beamter der Ochrana gewesen und habe einen kommunistischen Spitzel in Paris umgelegt; weshalb ihn auch diese weißrussischen Emigranten so harmlos und beinahe rührend »unseren Mörder« genannt hatten, ohne sich vor ihm zu scheuen. Ja, vielleicht steckten alle vier unter einer Decke.
»Und woher können Sie unsere Sprache?« fragte mich einer der beiden Gäste. – Und wieder antwortete statt meiner Golubtschik: »Er hat im Krieg an der Ostfront gedient und war sechs Monate in der sogenannten Okkupationsarmee!« »Das stimmt!« bestätigte ich, »Er war dann später«, fuhr Golubtschik fort, »noch einmal in Rußland, will sagen: nicht mehr in Rußland, sondern in den Vereinigten Sowjetstaaten, im Auftrag einer großen Zeitung. Er ist Schriftsteller!« Mich verwunderte dieser genaue Bericht über meine Person nur wenig. Denn ich hatte schon ziemlich viel getrunken – und in diesem Zustand kann ich kaum noch das Merkwürdige von dem Selbstverständlichen unterscheiden. Ich wurde sehr höflich und sagte ein wenig gespreizt: »Ich danke Ihnen für das Interesse, das Sie mir so lange bewiesen haben, und für die Auszeichnung, die Sie mir somit schenken!« Alle lachten. Und der Wirt sagte: »Er spricht wie ein alter Petersburger Kanzleirat!« Damit war nun jeder Zweifel an meiner Person ausgelöscht. Ja, man betrachtete mich sogar wohlwollend, und es folgten vier weitere Runden, die wir alle gegenseitig auf unser Wohl tranken.
Der Wirt ging zur Tür, versperrte sie, löschte eine Anzahl Lampen und bat uns alle, Platz zu nehmen. Die Zeiger der Wanduhr standen auf halb neun. Ich trug bei mir keine Uhr, und einen der Gäste nach der Zeit zu fragen schien mir unschicklich. Ich machte mich vielmehr mit dem Gedanken vertraut, daß ich hier die halbe oder die ganze Nacht verbringen würde. Eine große Karaffe Schnaps stand noch vor uns. Sie mußte mindestens, meiner Schätzung nach, zur Hälfte geleert werden. Ich fragte also: »Warum nannte man Sie so merkwürdig vorhin, Herr Golubtschik?«
»Das ist mein Spitzname«, sagte er, »aber auch wieder nicht ganz nur ein Spitzname. Ich habe nämlich vor vielen Jahren einen Mann erschlagen und – wie ich damals glaubte – eine Frau auch.«
»Ein politisches Attentat?« fragte der Wirt, und es wurde mir also klar, daß auch die andern nichts wußten, außer dem Spitznamen.
»Keine Spur!« sagte Semjon. »Ich bin in keiner Beziehung eine politische Persönlichkeit. Ich mache mir überhaupt nichts aus öffentlichen Dingen. Ich liebe das Private. Nur das interessiert mich. Ich bin ein guter Russe, wenn auch ein Russe aus einem Randgebiet – ich bin nämlich im früheren Wolynien geboren. Aber niemals habe ich meine Jugendgenossen begreifen können, mit ihrer verrückten Lust, unbedingt das Leben für irgendeine verrückte oder auch meinetwegen normale Idee herzugeben. Nein! Glauben Sie mir! Das private Leben, die einfache Menschlichkeit ist wichtiger, größer, tragischer als alles Öffentliche. Und das ist vielleicht für heutige Ohren absurd. Aber das glaube ich, das werde ich bis zu meiner letzten Stunde glauben. Niemals hätte ich politische Leidenschaft genug aufbringen können, um einen Menschen aus politischen Gründen zu töten. Ich glaube auch gar nicht, daß politische Verbrecher besser oder edler sind als andere; vorausgesetzt, daß man der Meinung ist, ein Verbrecher, welcher Art er auch sei, könne kein edler Mensch sein. Ich zum Beispiel, ich habe getötet und halte mich durchaus für einen guten Menschen. Eine Bestie, um es glatt zu sagen: eine Frau, meine Herren, hat mich zum Mord getrieben.«
»Sehr interessant!« sagte der Wirt.
»Gar nicht! Sehr alltäglich«, sagte bescheiden Semjon Semjonowitsch. »Und doch nicht so ganz alltäglich. Ich kann Ihnen meine Geschichte ganz kurz erzählen. Und Sie werden sehn, daß es eine ganz simple Geschichte ist.«
Er begann. Und die Geschichte war weder kurz noch banal. Deshalb habe ich beschlossen, sie hier nachzuschreiben.
»Ich habe Ihnen eine kurze Geschichte versprochen«, begann Golubtschik, »aber ich sehe, daß ich wenigstens am Anfang weit ausholen muß; und ich bitte Sie also, nicht ungeduldig zu werden. Ich sagte Ihnen früher, daß mich nur das Privatleben interessiert. Ich muß darauf zurückkommen. Ich will damit sagen, daß man, wenn man genau achtgeben würde, unbedingt zu dem Resultat kommen müßte, daß alle sogenannten großen, historischen Ereignisse in Wahrheit zurückzuführen sind auf irgendein Moment im Privatleben ihrer Urheber oder auf mehrere Momente. Man wird nicht umsonst, das heißt, ohne private Ursache, Feldherr oder Anarchist oder Sozialist oder Reaktionär, und alle großen und edlen und schimpflichen Taten, die einigermaßen die Welt verändert haben, sind die Folgen irgendwelcher ganz unbedeutender Ereignisse, von denen wir keine Ahnung haben. Ich sagte Ihnen früher, ich sei Spitzel gewesen. Ich habe mir oft darüber den Kopf zerbrochen, warum gerade ich ausersehen war, ein so fluchwürdiges Gewerbe zu betreiben, denn es ruht kein Segen darauf, und es ist bestimmt Gott nicht wohlgefällig. Es ist auch noch heute so, der Teufel reitet mich, ohne Zweifel. Sehn Sie, ich leb' ja heute nicht mehr davon, aber ich kann es nicht lassen, nicht lassen. Ganz gewiß gibt es einen solchen Teufel der Spionage oder der Spitzelei. Wenn mich einer interessiert, wie zum Beispiel dieser Herr hier, der Schriftsteller«, Golubtschik deutete mit dem Kopf gegen mich, »so kann ich nicht ruhen, so ruht es nicht eher in mir, als bis ich erforscht habe, wer er ist, wie er lebt, woher er stammt. Denn ich weiß natürlich noch mehr von Ihnen, als Sie ahnen. Sie wohnen da drüben und schauen manchmal des Morgens im Negligé zum Fenster hinaus. Na aber, es ist ja auch nicht von Ihnen die Rede, sondern von mir. Also fahren wir fort. Es war Gott nicht wohlgefällig, aber Sein unerforschter Ratschluß hatte es mir ja vorgezeichnet.
Sie kennen meinen Namen, meine Herren, ich sage lieber: meine Freunde. Denn es ist besser, ›meine Freunde‹ zu sagen, wenn man erzählt, nach guter, alter heimatlicher Sitte. Mein Name ist also, wie Sie wissen: Golubtschik. Ich frage Sie selbst, ob das gerecht ist. Ich war immer groß und stark, schon als Knabe an Wuchs und Körperkraft weit stärker als meine Kameraden; und gerade ich muß Golubtschik heißen. Nun, es gibt noch etwas: Ich hieß gar nicht mit Recht so, das heißt: nach natürlichem Recht sozusagen. Denn das war der Name meines legitimen Vaters. Indessen: Mein wirklicher Name, mein natürlicher, der Name meines natürlichen Vaters war: Krapotkin – und ich bemerke eben, daß ich nicht ohne lasterhaften Hochmut diesen Namen ausspreche. Sie sehen: Ich war ein uneheliches Kind. Dem Fürsten Krapotkin gehörten, wie Sie wissen werden, viele Güter in allen Teilen Rußlands. Und eines Tages erfaßte ihn die Lust, auch ein Gut in Wolynien zu kaufen. Solche Leute hatten ja ihre Launen. Bei dieser Gelegenheit lernte er meinen Vater kennen und meine Mutter. Mein Vater war Oberförster. Krapotkin war eigentlich entschlossen gewesen, alle Angestellten des früheren Herrn zu entlassen. Als er aber meine Mutter sah, entließ er alle – mit Ausnahme meines Vaters. Und so kam es eben. Mein Vater, der Förster Golubtschik, war ein einfacher Mann. Stellen Sie sich einen gewöhnlichen, blonden Förster in dem üblichen Gewande des Försterberufes vor, und Sie haben meinen legitimen Vater vor Augen. Sein Vater, mein Großvater also, war noch Leibeigener gewesen. Und Sie werden begreifen, daß der Förster Golubtschik gar nichts dagegen einzuwenden hatte, daß der Fürst Krapotkin, sein neuer Herr, meiner Mutter häufige Besuche zu einer Stunde machte, in der die verheirateten Frauen bei uns zu Lande an der Seite ihrer angetrauten Männer zu liegen pflegen. Nun, ich brauche nichts weiter zu sagen: Nach neun Monaten kam ich zur Welt, und mein wirklicher Vater hielt sich bereits seit drei Monaten in Petersburg auf. Er schickte Geld. Er war ein Fürst, und er benahm sich genauso, wie sich ein Fürst zu benehmen hat. Meine Mutter hat ihn zeit ihres Lebens nicht vergessen. Ich schließe das aus der Tatsache, daß sie außer mir kein anderes Kind zur Welt gebracht hat. Das will also heißen, daß sie nach der Geschichte mit Krapotkin sich geweigert hat, ihre ›ehelichen Pflichten zu erfüllen‹, wie es in den Gesetzbüchern heißt. Ich selbst erinnere mich genau, daß sie niemals in einem Bett geschlafen haben, der Förster Golubtschik und meine Mutter. Meine Mutter schlief in der Küche, auf einem improvisierten Lager, auf der ziemlich breiten Holzbank, genau unter dem Heiligenbild, während der Förster ganz allein das geräumige Ehebett in der Stube einnahm. Denn er hatte genug Einkünfte, um sich Stube und Küche leisten zu können. Wir wohnten am Rande des sogenannten ›schwarzen Waldes‹ – denn es gab auch einen lichten Birkenwald, und der unsrige bestand aus Tannen. Wir wohnten abseits und etwa zwei bis drei Werst entfernt vom nächsten Dorf. Es hieß Woroniaki. Mein legitimer Vater, der Förster Golubtschik, war, im Grunde genommen, ein sanfter Mann. Niemals habe ich einen Streit zwischen ihm und meiner Mutter gehört. Sie wußten beide, was zwischen ihnen stand. Sie sprachen nicht darüber. Eines Tages aber – ich mochte damals etwa acht Jahre alt gewesen sein – erschien ein Bauer aus Woroniaki in unserem Haus, fragte nach dem Förster, der gerade durch die Wälder streifte, und blieb sitzen, als meine Mutter ihm sagte, daß ihr Mann vor dem späten Abend nicht nach Hause kommen würde. ›Nun, ich habe Zeit!‹ sagte der Bauer. ›Ich kann auch bis zum Abend warten und auch bis Mitternacht und auch später. Ich kann warten, bis ich eingesperrt werde. Und das hat noch mindestens einen Tag Zeit!‹ ›Warum sollte man Sie einsperren?‹ fragte meine Mutter. ›Weil ich Arina, meine leibliche Tochter Arina, mit diesen meinen Händen erwürgt habe‹, antwortete lächelnd der Bauer. Ich kauerte neben dem Ofen, weder meine Mutter noch der Bauer beobachteten mich im geringsten, und ich habe die Szene ganz genau behalten. Ich werde sie auch nie vergessen! Ich werde niemals vergessen, wie der Bauer gelächelt und wie er auf seine ausgestreckten Hände geblickt hat bei jenen fürchterlichen Worten. Meine Mutter, die gerade Teig geknetet hatte, ließ Mehl, das Wasser und das halbausgelaufene Ei auf dem Küchentisch, schlug das Kreuz, faltete dann die Hände über ihrer blauen Schürze, trat nahe an den Besuch heran und fragte: ›Sie haben Ihre Arina erwürgt?‹ ›Ja‹, bestätigte der Bauer. ›Aber warum denn, um Gottes willen?‹ ›Weil sie Unzucht getrieben hat mit Ihrem Mann, dem Förster Semjon Golubtschik. Heißt er nicht so, Ihr Förster?‹ Der Bauer sprach auch all das mit einem Lächeln, mit einem versteckten Lächeln, das hinter seinen Worten gleichsam hervorblinkte wie manchmal der Mond hinter finsteren Wolken. ›Ich bin schuld daran‹, sagte meine Mutter. Ich höre es noch, als ob sie es erst gestern gesprochen hätte. Ich habe ihre Worte behalten. (Damals aber verstand ich sie nicht.) Sie bekreuzigte sich noch einmal. Sie nahm mich bei der Hand. Sie ließ den Bauern in unserer Stube und ging mit mir durch den Wald, immerfort den Namen Golubtschik rufend. Nichts meldete sich. Wir kehrten ins Haus zurück, und der Bauer saß immer noch dort. »Wollen Sie Grütze?« fragte meine Mutter, als wir zu essen begannen. »Nein!« sagte lächelnd und höflich unser Gast, »aber wenn Sie zufällig einen Samogonka im Hause haben – wäre ich nicht abgeneigt.« Meine Mutter schenkte ihm von unserem Selbstgebrannten ein, er trank, und ich erinnere mich genau, wie er den Kopf zurückwarf und wie an seinem von Borsten bewachsenen, zurückgeworfenen Hals gleichsam von außen zu sehen war, daß der Schnaps durch die Kehle rann. Er trank und trank und blieb sitzen. Endlich, die Sonne ging schon unter, es mag ein früher Herbsttag gewesen sein, kam mein Vater zurück. »Ach, Pantalejmon!« sagte er. Der Bauer erhob sich und sagte ganz ruhig: »Komm gefälligst hinaus!« »Warum?« fragte der Förster. »Ich habe eben«, antwortete immer noch ganz ruhig der Bauer, »Arina erschlagen.«
Der Förster Golubtschik ging sofort hinaus. Sie blieben lange draußen. Was sie da gesprochen haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß sie lange draußen blieben. Es mochte wohl eine Stunde sein. Meine Mutter lag auf den Knien vor dem Heiligenbild in der Küche. Man hörte keinen Laut. Die Nacht war hereingebrochen. Meine Mutter zündete kein Licht an. Das dunkelrote Lämpchen unter dem Heiligenbild war das einzige Licht in der Stube, und niemals bis zu dieser Stunde hatte ich mich davor gefürchtet. Jetzt aber fürchtete ich mich. Meine Mutter lag die ganze Zeit auf den Knien und betete, und mein Vater kam nicht. Ich hockte neben dem Ofen. Endlich, es mochten drei oder mehr Stunden vergangen sein, hörte ich Schritte und viele Stimmen vor unserem Haus. Man brachte meinen Vater. Vier Männer trugen ihn. Der Förster Golubtschik muß ein ansehnliches Gewicht gehabt haben. Er blutete an allen Ecken und Enden, wenn man so sagen darf. Wahrscheinlich hatte ihn der Vater seiner Geliebten so zugerichtet.
Nun, ich will es kurz machen. Der Förster Golubtschik hat sich niemals mehr von diesen Schlägen erholt. Er konnte seinen Beruf nicht mehr ausüben. Er starb ein paar Wochen später, und man begrub ihn an einem eisigen Wintertag, und ich erinnere mich noch genau, wie die Totengräber, die ihn holen kamen, dicke, wollene Fäustlinge trugen und dennoch mit beiden Händen um sich schlagen mußten, damit es ihnen wärmer werde. Man lud meinen Vater Golubtschik auf einen Schlitten. Meine Mutter und ich, wir saßen auch in einem Schlitten, und während der Fahrt sprühte mir der helle Frost mit hunderttausend köstlichen, kristallenen Nadeln ins Gesicht. Eigentlich war ich froh. Dieses Begräbnis meines Vaters gehört eher zu den heiteren Erinnerungen meiner Kindheit.
Passons! – wie man in Frankreich sagt. Es dauerte nicht lange, und ich kam in die Schule. Und aufgeweckt, wie ich war, erfuhr ich bald, daß ich der Sohn Krapotkins war. Ich bemerkte es an dem Benehmen des Lehrers und einmal im Frühling an einem denkwürdigen Tage, an dem Krapotkin selber kam, unser Gut zu visitieren. Man schmückte das Dorf Woroniaki. Man hängte Girlanden an beiden Enden der Dorfstraße auf. Man stellte sogar eine Musikkapelle zusammen aus lauter Bläsern, und dazwischen gab es auch Sänger. Man übte eine Woche vorher, unter der Anleitung unseres Lehrers. Aber in dieser Woche ließ mich meine Mutter nicht in die Schule gehn, und nur unter der Hand gewissermaßen erfuhr ich von all den Vorbereitungen. Eines Tages kam Krapotkin wirklich. Und zwar direkt zu uns. Er ließ die Dorfstraße mit Girlanden eine Dorfstraße mit Girlanden sein und die Musiker Musikanten und die Sänger Sänger, und er kam directement in unser Haus. Er hatte einen schönen dunklen und etwas angesilberten Knebelbart, roch nach Zigarren, und seine Hände waren sehr lang, sehr mager, sehr trocken, dürr sogar. Er streichelte mich, fragte mich aus, drehte mich ein paarmal herum, betrachtete meine Hände, meine Ohren, meine Augen, meine Haare. Dann sagte er, meine Ohren wären schmutzig und meine Fingernägel auch. Er zog ein elfenbeinernes Taschenmesser aus der Westentasche, schnitzte mir in zwei, drei Minuten aus einem ganz gewöhnlichen Holzbrett einen Mann mit Bart und langen Armen (später hörte ich, daß er ein sogenannter ›Kunstschnitzer‹ gewesen sei), dann sprach er noch leise mit meiner Mutter, und dann verließ er uns.
Seit diesen Tagen, meine Freunde, wußte ich natürlich ganz genau, daß ich nicht der Sohn Golubtschiks, sondern Krapotkins war. Natürlich tat es mir sehr leid, daß der Fürst verschmäht hatte, die geschmückte Dorfstraße zu passieren, die Musik und die Lieder zu hören. Am besten, so stellte ich mir vor, wäre es wohl gewesen, wenn er in einer großartigen Kalesche, an meiner Seite, von vier schneeweißen Schimmeln gezogen, ins Dorf gekommen wäre. Ich selbst wäre bei dieser Gelegenheit als der rechtmäßige, sozusagen gottgewollte Nachkomme des Fürsten von allen anerkannt worden, vom Lehrer, von den Bauern, von den Knechten, sogar von der Obrigkeit, und die Lieder und die Musik und die Girlanden hätten eher mir als meinem Vater gegolten.