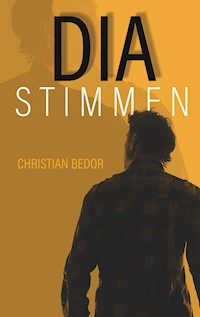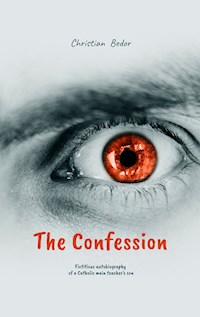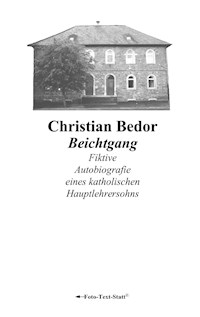
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Thomas Lehr wächst Ende der 50er Jahre als jüngstes von vier Geschwistern in der Schule eines kleinen deutschen Dorfes auf. Er wird von seinen Eltern und der Kirche auch mit körperlicher Strafe streng katholisch erzogen. Anfangs lebt er in der Welt der Zehn Gebote, glaubt an aufrichtige Liebe, Ehrlichkeit und Gehorsam. Für seinen Vater, der Schulleiter ist, muss Thomas als Zehnjähriger Bier und Schnaps kaufen, was ihm große Schuldgefühle bereitet. Ferner erfährt er vom langjährigen Verhältnis des Vaters mit seiner Klassenlehrerin. Die Familienkrankheit Alkoholismus schreitet soweit fort, dass sein Vater nicht mehr arbeiten kann und sterben will. Abzusehen ist, dass sich Thomas zu einem Erwachsenen Kind entwickeln wird, denn Schuld, Angst, Scham und Ohnmacht sind seine Lebensbegleiter. Diese fiktive Autobiografie ist empfehlenswert für Jugendliche und Erwachsene katholischen Glaubens sowie Menschen, die in alkoholkranken Familien leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian Bedor
Beichtgang
FiktiveAutobiografie eines katholischen Hauptlehrersohns
Foto-Text-Statt®
Books on Demand
Für Ewa
INHALT
Anfänge
Tretroller
Mein Bruder
Die Taschenlampe
Vormstein
Der Kürbis
Markus
Capri-Eis
Die Beichte
Die erste heilige Kommunion
Der neue Pfarrer
Der verbotene Baum
Bärbel
Die neue Dorfschule
Hahn
Das Gymnasium
Die kleine Dienstwohnung
Nach Dortmund
Ministrant bei Onkel Eberhard
Anfänge
Es war Karfreitag 19:15 Uhr in der Dienstwohnung. Meine 36-jährige Mutter lag auf der Wohnzimmercouch, als ich Ende der 50er Jahre im ersten Stock der bruchsteinernen Dorfschule Kleinenbachs geboren wurde. Der einzige Dorfarzt und die Hebamme halfen dabei. Mein zwei Jahre älterer Vater spielte zur selben Zeit Orgel in der Kirche, die nur einen Steinwurf weit entfernt lag. Er übte für die Ostermessen.
Nach der Probe kam er nach Hause und nahm an, ich sei noch nicht geboren, denn das Bettzeug stülpte sich genauso auf wie am Nachmittag, als er uns verließ.
»Wann ist es denn soweit?«, fragte er.
»Dahinten liegt Thomas«, antwortete meine Mutter.
Ich lag in einem Babybett ihres Schlafzimmers. Vier Finger der linken Hand hatte ich im Mund und nuckelte daran. Es war dunkel. Geräusche drangen an meine Ohrmuscheln. Doch das beschäftigte mich nicht.
Meine Mutter gab mir nie die Brust. Meine 5-jährige Schwester Marlene war die letzte, die in den Genuss dessen kam. Leider zerkaute sie dabei die Brustwarzen so, dass mir diese Zärtlichkeit für immer versagt blieb.
An ein Babyfoto kann ich mich nicht entsinnen, jedoch daran, dass sich mein 7-jähriger Bruder Clemens vor meiner Geburt für ein weiteres Brüderchen einsetzte –wie er mir später erzählte. Er ließ sich deshalb im Kinderzimmer auf eine Kissenschlacht mit meinen beiden Schwestern ein, die sich ein Mädchen wünschten.
Bei der Taufe hatte ich zum ersten Mal Kontakt mit Pfarrer Seedorn, der mir aber für die darauf folgenden Jahre nicht in Erinnerung blieb.
Die schullose Zeit verlief ohne Zwischenfälle. Bis auf Kinderkrankheiten. Mein ein Jahr jüngerer Freund Peter bat mich eines Nachmittags darum, ihm nicht zu nahe zu kommen. Was ich daraufhin vermied. Wir standen uns etwa sechs Meter gegenüber und ich lag am folgenden Tag mit Windpocken im Bett.
Peter war der Sohn der Reinemachefrau der Schule. Er trug meistens Kniebundhosen aus hellbraunem Leder. Dazu Pullover. Im Sommer kurze Lederhosen. Mit Hemd. Meistens robuste geschlossene Halbschuhe, die seitlich geschnürt waren. Peter hatte ein rundes Gesicht, eine feine Physiognomie. Er war brav und hatte nichts Schlitzoriges – genau wie ich. Allerdings trug er einen Igelhaarschnitt. Wir spielten gern zusammen.
Am frühen Nachmittag war der Himmel bedeckt, etwas trübe. Wie es zum Ausklang des Winters manchmal ist. Ich spielte allein an einer Pfütze vor der Schule, zog mit dem Gummistiefelabsatz Verbindungskanäle zum nächstkleineren Teich, dachte an Peter und schaute tagträumend dem langsam fließenden Wasser zu. Ich war beschäftigt. Nur gut, dass es zuvor geregnet hatte. Meine Mutter hatte mir am Morgen gesagt, ich solle mich nicht vom Haus entfernen, denn es kämen Ärzte und andere Leute. Es ginge um die Einschulung. Weder um solche Untersuchungen noch um den Termin machte meine Mutter großes Aufheben. Kurz und knapp wurde ich darauf hingewiesen.
Ich wunderte mich darüber, dass kein weiteres Kind an den Pfützen mitspielte. So gerne hätte ich Gesellschaft gehabt. Meine 15-jährige Schwester Veronika stand immer früh auf, um mit einem Bus zur Nonnenschule zu fahren. Meine beiden anderen Geschwister saßen jetzt im Unterricht.
Peter hatte keine Zeit, weil sein Vater gestorben war. Er war Holzfäller gewesen. Man sah ihn selten im Dorf. Ich sah ihn nur manchmal, wenn ich Peter am Dorfhang besuchte. Mühlenhofs hatten ein eigenes Haus. Neu gebaut. Mit Balkon. Und weißen Hauswänden. Es roch alles neu darin und es bildete das Schlusshaus in einer Sackgasse, die den Berg hinaufführte. Dort war ein kleiner Wendeplatz für Autos. Zu Fuß konnte man über einen schmalen Treppenpfad am Steilhang zum Haus gelangen.
Ich spielte in den Pfützen und schaute mir die Kringel an, die jetzt vereinzelt von Regentropfen auf der Wasseroberfläche gebildet wurden. Peters Mutter hatte meiner Mutter erzählt, dass ihr Mann eine Zeit lang im Haus aufgebahrt wurde. Eine Nachbarin hielt seinerzeit Totenwache. Als ein Gewitter hereinbrach, schrie sie: »Frau, Frau, der ist ja ganz blau!«
Mich erschrak, dass Peters Vater gestorben war, denn ich dachte immer, Väter mit jungen Kindern könnten nicht sterben. Ich dachte weiter, sie dürften erst sterben, wenn ihre Kinder erwachsen seien.
Zudem hatte ich noch nie eine Leiche gesehen. Ich konnte mir nicht erklären, warum ein Toter bei Gewitter blau wird. Traf das auch auf die Toten in den Gräbern zu? Die Vorstellung machte mir große Angst und ich mied den Kontakt mit Peter mehrere Tage lang.
Meine Mutter erschien am Fenster und rief mich zu sich ins Haus. Es sei Zeit und ich solle kommen, zumal ich mich waschen und umziehen müsse.
Ich bedauerte dies, blickte dann wieder zu meiner Pfütze, steckte beide Hände in die Taschen und ging in die Schule. Im Bad zog ich mich aus, wusch mich und bekam frische Kleidung von meiner Mutter.
Dann betraten wir im Parterre einen Klassenraum, der jetzt als Untersuchungszimmer eingerichtet war. Die meisten Stühle und Tische standen an den Wänden.
Außer ein paar Erwachsenen in weißen Kitteln waren hier viele Kinder mit ihren Müttern. Darunter einige Väter. Manche Kinder kannte ich vom Sehen, doch viele waren mir unbekannt. Das war nicht verwunderlich, denn einen Kindergarten besuchte ich nicht, in dem ich weitere Freunde hätte finden können. Meine Eltern hielten den kirchlichen Kindergarten für ungeeignet. Wegen der Nonnen.
»Thomas Lehr, bitte hierher!«, rief eine Krankenschwester, die neben einem Arzt stand.
Die Untersuchung vollzog sich schnell. Auskleiden – bis auf die Unterhose – messen, wiegen, mit dem rechten Arm über den Kopf greifen und mit den Fingern die linke Ohrmuschel berühren. Die Zähne wurden begutachtet, der linke Oberarm angeritzt. Anschließend half mir meine Mutter beim Anziehen.
Der erste Schultag verlief nicht aufregend. Eine Schultüte gab es für mich nicht. Meine Eltern hielten sie für überflüssig. Einige Kinder hatten Schultüten. An ein Einschulungsfoto kann ich mich nicht erinnern.
Unsere Klasse bestand aus zwei Jahrgängen. Vorne saßen die I-Männchen und dahinter die ehemaligen I-Männchen. Unsere Lehrerin hieß Grewen. Sie war schlank, brünett, mit einem leichten Silberblick. Ich verliebte mich nach einiger Zeit in sie. Die junge katholische Lehrerin musste beide Klassen gleichzeitig unterrichten. Es war ihre erste Lehrerinnenstelle nach dem Referendariat. Fräulein Grewen war etwa 23 Jahre alt.
Unruhe entstand häufig im Klassenraum, doch mit ihrem strengen Blick hat sie sie gleich unterbunden. Ich empfand es als störend, in dieser Klasse zu sitzen mit den älteren Besserwissern im Nacken. Deswegen meldete ich mich nicht. Ich fühlte mich unwohl, denn mir schien es, als wüssten die Zweitklässler jede Antwort auf Fragen an die erste Klasse. Dieser Gedanke schüchterte mich ein.
An einem Tag genoss ich es, länger schlafen zu können und mit meinen Matchbox-Autos zu spielen. Meine Mutter war da und wunderte sich anfangs, dass ich am Morgen so viel Zeit hatte.
Gegen zehn Uhr betrat ich das leere Klassenzimmer und sah Hefte und Bleistifte auf den Tischen. Die Tornister standen neben den Bänken. Meine Mitschüler mussten früher gekommen sein. Ich ging nach draußen.
»Bist du krank?«, fragte mein Mitschüler Tobias, den ich als Ersten auf dem Schulhof während der Pause traf. Er war der Sohn einer besser gestellten Familie und sehr abgebrüht. Ihm machte es nichts aus, zu lügen, oder ein Kaugummi zu klauen.
So im Vorbeigehen.
Tobias war zierlich, mit schmalem Gesicht. Mich beeindruckte, wie er sich beim Sport katzengleich bewegte.
Deswegen war er von nun an mein bester Freund und ich spielte künftig lieber mit ihm als mit Peter.
»Nein, ich bin nicht krank!«, erwiderte ich.
»Wieso fragst du …?«
»Wir sind seit halb acht hier!«
Mir wurde mulmig. Ich war noch nie zu spät gekommen und hatte gedacht, dass der Unterricht heute um zehn begänne. Was würde Fräulein Grewen tun?
Mit zitternden Knien betrat ich das Klassenzimmer. Sofort, nachdem es im Raum ruhig geworden war, stellte sie mich zur Rede. Ich wusste nichts auf ihre Fragen zu erwidern. Was sollte ich auch sagen? Dass ich mich geirrt hatte? Das verbot mir mein Schamgefühl.
»Du wirst heute nachmittag nachsitzen«, sagte sie. »Zwei Stunden.«
Mein Herz pochte mir im Hals.
Mit einer so drastischen Strafe hatte ich nicht gerechnet. Was würde meine Mutter dazu sagen, die mal Lehrerin gewesen war? Und erst mein Vater?
Es ist scheußlich, so bloßgestellt öffentlich bestraft zu werden und sich aus Ohnmacht und Schuld nicht verteidigen zu können. Meinem Freund Tobias wäre in diesem Augenblick bestimmt eine plausible Erklärung eingefallen. Wahrscheinlich hätte er gelogen und wäre dadurch aus dem Schneider gewesen. Vielleicht hätte er etwas von Bauchschmerzen erzählt. Oder von einem Eichhörnchen, dass im Wohnzimmer umhergesaust wäre und er es hätte einfangen müssen. Seine Familie und er wohnten in einem eigenen, großen Haus am Waldrand. Es wäre nicht ungewöhnlich gewesen, wenn sich ein neugieriges Eichhörnchen auf den Balkon verirrt hätte. Ob Lüge oder Wahrheit. Niemand könnte es nachprüfen. Tobias wäre nicht der Atem gestockt. Er hätte einen Ausweg gewusst und wäre unbescholten davongekommen.
So saß ich, nachdem ich meiner Mutter beim Mittagessen das Missgeschick gebeichtet hatte, und sie darüber sehr erzürnt war, in einer Mädchenklasse. Es war eine höhere Klasse, die am Nachmittag Handarbeitsunterricht bei Fräulein Grewen hatte. Häkeln, Stricken, Nähen. Ich saß im hinteren Teil des Raums, bekam Rechenaufgaben und quälte mich damit herum. Zu diesem Zeitpunkt schwor ich mir, nie wieder die Unterrichtszeiten zu vergessen.
Welch eine Demütigung. Die Aufgaben strengten mich an. Doch die Mädchen mit ihrem Strickzeug waren freundlich zu mir. Es war eine willkommene Abwechslung für sie, einen Jungen aus einer der unteren Klassen bei sich zu haben. Sie staunten über meine Anwesenheit und ein Mädchen fragte mich leise, warum ich nachsitzen müsse.
Als Fräulein Grewen sich einigen Schülerinnen in der vorderen Bankreihe zuwandte, um ihnen mehr von der Kunst des Strickens zu zeigen, half mir ein anderes Mädchen, das in meiner Nähe saß, bei einer Lösung. Das war bei Strafe verboten. Ich stand große Angst aus. Wahrscheinlich würde ich eine weitere Strafe bekommen – und die Helferin auch! Wie sollte ich dem Mädchen das klar machen?
Aber zum Glück wurden wir nicht erwischt.
Tretroller
An diesem sonnigen Sommernachmittag parkte unser Llyod 400 parallel zur steinernen Freitreppe. Er hatte sogar ein Faltschiebedach. Dunkelblau war er und so abgestellt, dass ein Erwachsener zwischen ihm und der Treppe hindurchgehen konnte. Mein Vater, der als Einziger aus der Familie einen Führerschein besaß, musste offenbar noch mal weg. Sonst hätte er den Wagen in den umgebauten Schweinestall gestellt.
Mit dem Tretroller, der meinem Bruder Clemens gehörte, aufblasbare Reifen und keine Vollgummireifen hatte, fuhr ich vor der Treppe und der Baumreihe hin und her.
Manchmal schlängelte ich mich zwischen den Bäumen durch oder fuhr hinter das Gebäude, wo der Schulhof umzäunt war. Hier gab es einen großen Sägemehlkasten, der im Sportunterricht benutzt wurde, damit Schulkinder Springen lernen konnten. Wenn kein Unterricht war, spielten manchmal kleine Kinder in diesem Kasten. Ab und zu kamen auch Ältere und spielten Schlagball.
Dann war der Sägemehlkasten ihr Mal.
An diesem Nachmittag war niemand auf dem Platz. In kurzer Hose und einem Sommerhemd fuhr ich gedankenverloren darüber und steuerte wieder zurück vor die Schule, um zu sehen, ob mein Vater gekommen sei. Aber ich sah ihn nicht. Hin und wieder fuhr ich mit dem Roller zwischen Auto und Treppe hindurch und erinnerte mich an Fahrten, die wir als Familie mit dem Auto unternommen hatten. Da für mich auf dem Rücksitz kein Platz mehr war, wurde eine Dixan-Tonne hinter den Beifahrersitz gestellt, auf der ich sitzen konnte. Mein Vater rauchte meistens während der Fahrt. Stuyvesant. Für Augenblicke schien es mir, als entfalte sich das Aroma seiner Zigaretten, die ich manchmal am Automaten für ihn zog, in meiner Nase. Ich sehnte mich nach ihm und es wäre schön gewesen, wenn er gekommen wäre. Aber ich wusste nicht, wo er war und wann er zurückkam.
Während ich vorm Haus kreiste, erschien plötzlich meine Mutter im Toilettenfenster und rief: »Fahr' nicht zwischen Auto und Treppe durch, sonst machst du das Auto kaputt! Fahr' dort, wo genug Platz ist!«
Sie musste mich beobachtet haben. Vielleicht hatten wir auch ausgemacht, dass ich mich nicht zu weit von der Schule entfernen sollte.
»Ja, ja, ich passe schon auf!«, rief ich zurück.
Dann war meine Mutter wieder verschwunden. Ich schaute kurz zum Fenster und vergewisserte mich, dass sie nicht mehr guckte. Abseits des Autos fuhr ich einige Bögen, stemmte das Bein kräftiger gegen den Boden, um mehr Tempo zu bekommen und flitzte dann doch zwischen Auto und Treppe hindurch. Dabei konnte ich beide Füße auf die Tretrollerfläche stellen.
Aufgrund des ausreichenden Tempos gab mir der Roller eine Zeit lang das Gefühl, dass ich schwerelos bin und schnell vorwärts komme, ohne auch nur einen einzigen Finger dafür zu krümmen.
Anfangs machte ich meine Schleifen beliebig, indem ich mich dem Auto mal von vorne, mal von hinten näherte. Ich fuhr Kreise, Ovale, Slalom – wozu sich die Bäume am besten eigneten.
Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, versuchte ich, die Linkskurven nach Passieren des vorderen rechten Kotflügels immer kleiner zu machen. Das wurde mehr und mehr zu einem Balanceakt. Einerseits brauchte ich genug Schwung, um während der Durchfahrt den Boden nicht mit den Füßen zu berühren, andererseits durfte ich nicht zu viel Fahrt haben, um nicht aus der Kurve getragen zu werden.
Zwar konnte ich mit dem Roller bremsen, doch hätte ich das Manöver ausbalancieren müssen. Erstens hatte der Roller aus Altersgründen weder ein hinteres noch ein vorderes Schutzblech – an denen sich die Bremsen befanden – und zweitens hätte ich während der Durchfahrt den rechten Fuß zum Bremsen nicht nach hinten stellen können: man verliert die schwungvolle Balance dabei und könnte ins Trudeln kommen.
Also musste ich meinen Lenkkünsten vertrauen. Mehrere Fahrten gelangen, bis ich auf einmal in der abschließenden Kurve auf dem geschotterten Untergrund wegrutschte. Ich stürzte, schlug auf die Knie und stellte kurz darauf fest, dass meine rechte Hand stark blutete. Beide Knie waren aufgeschürft.
Vor Schreck und Schmerz schrie ich auf und fing an zu weinen. Meine Mutter musste das gehört haben.
Sie schaute aus dem Fenster, sah meine stark blutende Hand und kam unverzüglich herunter.
Erst sagte sie, ein Pflaster würde genügen. Nachdem wir jedoch oben angekommen waren und sie mich notdürftig mit Mull verbunden hatte, entschied sie schnell, mit mir zu Dr. Bergmann zu gehen, der seine Praxis im eigenen Haus hatte.
Wir nahmen den schmalen Weg Richtung Kirche und mussten bei ihm privat klingeln, denn die Sprechstunde begann erst später. Meine Hand verband er, gab mir eine Tetanusspritze in den Oberschenkel und entschied, dass wir nach Kürstadt ins Krankenhaus fahren müssten.
Mein Vater solle uns hinbringen.
Meine Mutter und ich gingen eilig nach Hause. Wo mein Vater plötzlich herkam, wusste ich nicht. In der Schule gab es kein Telefon. Er sagte, er sei bei Fräulein Grewen gewesen – die am Dorfrand wohnte – und er habe mit ihr über ihre Prüfungsvorbereitungen gesprochen. Mein Vater war ihr Mentor.
Wir drei fuhren im Lloyd nach Kürstadt. Die Wunde brannte und tat sehr weh. Ich weinte vor Schmerzen. Jetzt kam auch noch Blut durch den Mull. Das machte mir Angst. Im Krankenhaus angekommen, schaute der Arzt kurz unter den Verband und murmelte etwas von einer Operation: Die Sehne des rechten Ringfingers war mir durch den Sturz durchtrennt worden, weil der Roller keine Lenkergriffe mehr hatte. Die Gummigriffe waren durch das ständige Rollerhinwerfen kaputt gegangen. Dadurch hatten sich die Überreste nach innen schieben können und gaben die scharfen Rohrenden des Lenkers frei. Am rechten Rohrende hatte ich mich verletzt. Ich brüllte noch mehr im Krankenhaus. Mehrere Männer und eine Schwester in weißen, langen Kitteln kamen zu mir und wollten mich in den Operationsraum schleifen. Ein Raum, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Mit einer großen runden Lampe an der Decke, die mehrere Scheinwerfer trug. An der darunter befindlichen Liege waren seitlich Lederriemen befestigt. Das nahm ich nur oberflächlich wahr.
Ich schrie und stemmte mich gegen das Gezerre der Ärzte, die augenfällig Mühe mit mir hatten.
Ein Arzt redete auf meine Eltern ein, sie sollten mit mir sprechen und mir sagen, dass bald alles vorüber sei.
Je weniger ich mich dagegen stellen würde, desto eher könnte ich operiert werden und wieder nach Hause fahren.
Doch das half nichts. Ich schrie weiter.
Dann hoben mich starke Arme auf die Liege, drückten mich herunter und fingen damit an, mich mit den braunen Lederriemen festzuschnallen. Ich zappelte und strampelte, selbst als sie mich schon so fest angebunden hatten, dass ich spürte, nicht mehr von diesem Tisch fliehen zu können. Meine Eltern verließen den Operationssaal. Ich weiß nicht mehr, ob ich sie noch um Hilfe bat, oder ob sie mein Geschrei nicht mehr ertragen konnten.
Dann drückte mir jemand einen topfförmigen Apparat aufs Gesicht, wobei ich den Kopf, der nicht festgeschnallt war, immer hin- und herdrehte, um ihm zu entkommen. Der Druck war zu stark. Ich sah nur noch die große Operationslampe, dann ein transparentes Vlies, diesen grobgitterförmigen Apparat …
Kurz darauf roch ich etwas Unbekanntes und jemand fing an zu zählen. Meine Kräfte verließen mich.
Als ich aufwachte, lag ich hinten im Auto und hörte Motorgeräusche. Wir fuhren. Ich hob meinen rechten Arm hoch und sah eine riesige Bandage an der Hand. Es war die Hand, an der ich immer Daumen lutschte. Jetzt hatten mir die Ärzte einen so großen Verband gemacht, dass ich meinen Daumen dazu nicht mehr benutzen konnte. Dabei war nur der Ringfinger verletzt. Warum hatten die Ärzte auch den Daumen verbunden? Sollten die Chirurgen während der Narkose etwas von meinen Eltern erfahren haben? Sie wollten mir schon seit langer Zeit das Lutschen abgewöhnen. Seit ich denken kann, lutschte ich gern am Daumen und vermisste es nun sehr.
Trotzdem wollte ich jetzt am Lieblingsdaumen lutschen, aber das ging nicht, weil die ganze Hand umwickelt war.
Ich roch an ihr und fing an zu weinen, weil sie so stank. Daraufhin lutschte ich am linken Daumen, der nicht so gut schmeckte. Außerdem war er nicht sauber. Mein rechter Daumen war stets sauber. Selbst wenn ich im Sägemehlkasten gespielt hatte, war der obere Teil des Daumens immer blitzblank.
Oft hatte ich einen Schmutzkranz an der Daumenwurzel. Aber das störte mich nicht. Hauptsache ich konnte Daumenlutschen.
Es war mein Vater, der einen Tag nach meinem Unfall sagte: »Na, hoffentlich hörst du jetzt endlich auf mit Daumenlutschen. Das wäre eine gute Gelegenheit, solange der Verband dran ist.«
Nachdem der Verband entfernt war, lutschte ich erneut am rechten Daumen.
Mein Bruder
Clemens und ich, inzwischen acht Jahre alt, hatten ein gemeinsames Zimmer, das von der Küche aus erreichbar war. Jeder ein Bett. Auf meiner Bettseite stand ein großer, weißer Kleiderschrank, in dem unsere Anziehsachen und Bettwäsche untergebracht waren. In der Ecke – neben seinem Bett – war ein vierbeiniger, rechteckiger Tisch, mit einer gehäkelten Decke darauf. Es war der Schularbeitstisch meines Bruders, auf dem ein Grundig-Röhrenradio stand. Abends empfing es für Clemens auf Mittelwelle englische Hits von Radio Luxemburg. Das hörte sich stets verrauscht an. Manchmal musste man den Sender neu anpeilen, um ihn besser zu empfangen. Mein Bruder erklärte mir, dass man Radio Luxemburg nicht auf UKW hören könne, denn der Sender befände sich im weit entfernten Ausland.
Für die englischen Hits käme man nicht drumherum, den MW-Knopf zu drücken. Bei diesem Radio musste ich glücklicherweise nicht lange am Knopf drehen, denn es hatte zwei Skalen und zwei rote Sendesuchmarkierungen. So konnte man auf UKW und auf MW seinen Stammsender immer eingestellt lassen.
Radio Tele Luxemburg mit Camillo Felgen und seiner Novesia Goldnuß-Werbung. Aufgrund des Rauschens schien es mir, als befände sich Camillo irgendwo im Weltraum. Außerdem dachte ich immer, der Moderator habe was mit Reifen zu tun. Die Songs verstand ich nicht. Sie wirkten wegen der andersartigen Sprache auf mich befremdend.
Es war ein Radio mit einem magischen, grünen Auge. Seine Veränderungen zeigten an, ob ein Sender klar empfangen wurde. Im Idealfall bildeten die dunkelgrünen Flächen ein schmales Kreuz und gaben hellgrüne Felder frei.
Das war für mich faszinierend.
Ich verbrachte Minuten damit, vor dem Tisch auf einem Stuhl zu knien – bei sehr leise eingestellter Lautstärke – am Senderknopf zu drehen und die Bewegungen dieses magischen Auges zu beobachten. Dabei konnte ich mich verlieren und träumen.