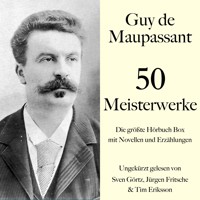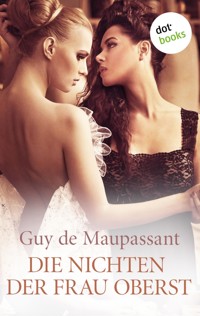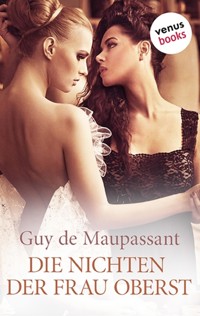7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Penguin Edition
- Sprache: Deutsch
Ein charmanter Verführer, getrieben von seiner eigenen Gier
Georges Duroy will hoch hinaus! Nach seiner Entlassung aus dem Militär strebt der gerissene Schönling ein Leben in der vornehmen Gesellschaft von Paris an. Schnell macht er Bekanntschaft mit den einflussreichen Persönlichkeiten der Stadt und hat diese schon bald in der Hand. Auch innerhalb der Damenwelt wird er so beliebt wie berüchtigt, und alle nennen ihn nur noch Bel Ami. Doch Duroy ist unersättlich und stößt die Menschen aus seinem Leben, wie es ihm beliebt, bis er alles erreicht zu haben scheint, was er sich immer gewünscht hat …
Maupassants gesellschaftskritischem Roman wurden Parallelen zum Leben des Schriftstellers nachgesagt. Mit seiner Geschichte eines skrupellosen Aufsteigers traf er den Nerv der Zeit, und Bel Ami wurde zum Welterfolg.
PENGUIN EDITION. Zeitlos, kultig, bunt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Große Emotionen, große Dramen, große Abenteuer – von Austen bis Fitzgerald, von Flaubert bis Zweig. Ein Bücherregal ohne Klassiker ist wie eine Welt ohne Farbe.
Guy de Maupassant wurde 1850 geboren und stammte aus einer alten lothringischen Adelsfamilie. Er studierte für einige Zeit Jura in Paris und nahm 1870/71 am Deutsch-Französischen Krieg teil. Ab 1871 war er in Paris als Ministerialbeamter tätig. Dort lernte er Gustave Flaubert kennen und wurde von diesem zum Schreiben angeleitet. Er schrieb etwa 260 Novellen sowie einige Romane. Seit 1891 in geistiger Umnachtung lebend, starb Maupassant 1893 in Passy bei Paris.
«Flaubert hat ihn entdeckt, Zola gefördert, Tolstoi bewundert, Turgenjew verehrt und Tschechow geliebt.»
Marcel Reich-Ranicki
«Dieser Roman ist ein Sitten-, genauer Unsittenbild.»
François Bondy
«Psychogramm eines skrupellosen Aufsteigers und Sittenbild in einem.»
Maike Albath, Deutschlandfunk
Guy de Maupassant
BEL-AMI
Roman
Aus dem Französischen vonWaltraud Kappeler
Mit einem Nachwort von François Bondy
Die Originalausgabe erschien 1885
unter dem Titel Bel-Ami.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe by Manesse Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Regg Media in Adaption der traditionellen Penguin Classics Triband-Optik aus England
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-30739-4V001
www.penguin-verlag.de
Erster Teil
I
Als die Kassiererin ihm das Wechselgeld auf sein Fünffrancstück herausgegeben hatte, verließ Georges Duroy das Restaurant.
Da er gut aussah, aber auch die Haltung des ehemaligen Unteroffiziers wahrte, straffte er seinen Körper, zwirbelte seinen Schnurrbart mit militärischer und angewöhnter Gebärde und ließ seinen Blick im Kreise über die verspäteten Gäste schweifen – einen jener Blicke des hübschen Burschen, die sich wie die Flügelschläge eines Sperbers ausbreiten.
Die Frauen hatten die Köpfe zu ihm erhoben, drei junge Arbeiterinnen, eine ältere, schlecht gekämmte, ungepflegte Musiklehrerin, die einen stets staubigen Hut und ein schief sitzendes Kleid trug, und zwei Bürgersfrauen mit ihren Gatten, Stammgäste dieses billigen Lokals.
Wie er auf dem Gehsteig angelangt war, verweilte er einen Augenblick und fragte sich, was er tun sollte. Es war der 28. Juni, und es blieben ihm gerade noch drei Franc vierzig bis zum Monatsende in der Tasche. Das bedeutete, je nachdem, zwei Abendessen ohne Mittagsmahl oder zwei Mittagsmahlzeiten ohne Abendessen. Und er überlegte, dass die Mittagessen zweiundzwanzig Sou kosteten, statt dreißig Sou am Abend. Wenn er sich mit einem Mittagessen begnügte, blieben ihm ein Franc zwanzig, was wiederum zweimal einen Imbiss mit Brot und Wurst bedeutete, darüber hinaus zwei Glas Bier auf dem Boulevard. Das war sein großes Nachtvergnügen und seine größte Ausgabe; und so ging er nun die Rue Notre-Dame-de-Lorette hinunter.
Er schritt genauso aus wie zur Zeit, als er die Uniform der Husaren trug, die Brust gewölbt, die Beine leicht gespreizt, als wäre er eben vom Pferd gestiegen; und er marschierte rücksichtslos auf der menschenüberfüllten Straße weiter, stieß an Schultern, drängte die Leute beiseite, um nicht selbst ausweichen zu müssen. Er schob seinen alten, recht mitgenommenen Zylinderhut leicht übers Ohr und setzte den Absatz kräftig aufs Pflaster. Er schien stets jemanden herauszufordern, die Passanten, die Häuser, die ganze Stadt, mit dem Schneid eines schönen Soldaten, der wieder ins Zivilleben geraten ist.
Obwohl er einen Anzug zu sechzig Franc trug, bewahrte er eine gewisse auffällige Eleganz, die ein wenig vulgär, bei ihm aber echt war. Groß, gut gebaut, blond, ein leicht rötliches Kastanienblond, mit einem aufgezwirbelten Schnurrbart, der sich auf seiner Oberlippe zu kräuseln schien, hellblauen, von einer winzigen Pupille durchbohrten Augen, mit naturgelocktem, in der Mitte gescheiteltem Haar glich er ganz und gar den üblen Figuren in den volkstümlichen Romanen.
Es war an einem jener Sommerabende, wo es in Paris an Luft mangelt. Die Stadt, heiß wie ein Dampfbad, schien in der drückenden Hitze Schweiß abzusondern. Die Abwässer bliesen durch ihre granitenen Mäuler den verpesteten Atem; die unterirdischen Küchen warfen durch ihre niedrigen Fenster einen widerlichen Dunst von Spülwasser und abgestandenen Saucen auf die Straße. Die Concierges saßen hemdsärmelig und Pfeife rauchend rittlings auf Strohstühlen unter den Eingangsportalen, und die Passanten bewegten sich mit müden Schritten vorwärts, den Hut in der Hand.
Als Georges Duroy zum Boulevard gelangte, hielt er nochmals an, unschlüssig, was er tun sollte. Er hatte nun Lust, bis zu den Champs-Elysées und der Avenue du Bois-de-Boulogne zu gehen, um unter den Bäumen etwas frische Luft zu schöpfen; aber es quälte ihn auch ein Verlangen, das Verlangen nach einem amourösen Abenteuer.
Wie würde es sich ihm zeigen? Er wusste es nicht, aber er erwartete es seit drei Monaten, jeden Tag, jede Nacht. Immerhin stahl er sich da und dort etwas Liebe, dank seinem guten Aussehen und seinem galanten Benehmen, aber er erhoffte stets mehr und Besseres.
Mit leeren Taschen und heißem Blut fühlte er sich aufgereizt beim Anblick der umherschweifenden Frauen, die an den Straßenecken murmeln: «Kommen Sie mit mir, junger Mann?», doch da er sie nicht bezahlen konnte, wagte er nicht, ihnen zu folgen; auch erwartete er etwas anderes, andere, weniger ordinäre Küsse.
Er liebte jedoch die Quartiere, wo es von Straßenmädchen wimmelte, ihre Bälle, ihre Kaffeehäuser, ihre Straßen; er liebte es, sie zu streifen, mit ihnen zu plaudern, sie vertraulich anzusprechen, ihr heftiges Parfum einzuatmen, sich ihnen nah zu fühlen. Es waren immerhin Frauen, Geschöpfe der Liebe. Er verachtete sie nicht mit der angeborenen Verachtung der Männer aus gutem Hause.
Er schwenkte zur Madeleine und folgte der Menge, die erschöpft von der Hitze dahinfloss. Die großen, überfüllten Cafés reichten bis über den Gehsteig. Sie stellten ihre trinkenden Gäste unter dem grellen, harten Licht wie in einem Schaufenster aus.
Vor ihnen auf eckigen oder runden Tischchen enthielten die Gläser rote, gelbe, grüne und braune Getränke in allen Farbtönen; und in den Karaffen sah man die großen, durchsichtigen Eiswürfel glänzen, welche das schöne, klare Wasser kühlten.
Duroy hatte seinen Gang verlangsamt, und das Verlangen zu trinken trocknete ihm die Kehle aus. Ein heißer Durst, der eines Sommerabends, plagte ihn, und er dachte an die köstliche Empfindung, wenn die kalten Getränke in den Mund fließen. Aber wenn er zwei Bier an einem Abend trank, dann war es aus mit dem kümmerlichen Mahl von morgen. Er kannte sie allzu gut, die hungrigen Stunden von Ende Monat.
Er sagte sich: «Ich muss zehn Stunden überstehen, dann werde ich mein Bier im ‹Café Américain› genehmigen. Verdammt noch mal, was habe ich für einen Durst!» Und er betrachtete all diese sitzenden und trinkenden Menschen, die ihren Durst stillen konnten, sooft es ihnen gefiel. Keck und herausfordernd ging er an den Cafés vorbei, und mit einem Blick schätzte er am Aussehen, an der Kleidung, wie viel Geld jeder Gast auf sich tragen mochte. Ein Zorn über diese friedlich sitzenden Menschen überkam ihn. Würde man in ihren Taschen wühlen, man fände Gold, Kleingeld in Silber und Soustücke. Jeder musste im Durchschnitt zwei Louisdor besitzen; es saßen wohl hundert im Café; hundert mal zwei Louis machen viertausend Franc. Er murmelte: «Die Schweine!», während er sich anmutig in den Hüften wiegte. Hätte er einen dieser Kerle an der Straßenecke in einem kleinen Winkel vor sich gehabt, er hätte ihm, bei Gott, den Hals umgedreht, ohne Skrupel, wie er es an den Tagen der großen Manöver mit dem Geflügel der Bauern tat.
Und er erinnerte sich an seine beiden Afrika-Jahre, an die Art, wie er die Araber auf den kleinen Posten im Süden ausplünderte. Ein grausames und vergnügtes Lächeln glitt über seine Lippen, als er an einen Ausritt dachte, der drei Männer aus dem Ouled-Alane-Stamm1 das Leben gekostet, seinen Kameraden und ihm zwanzig Hühner, zwei Schafe und Gold eingebracht hatte, und dazu noch Stoff zum Lachen für ein halbes Jahr.
Man hatte die Schuldigen nie gefunden, man hatte übrigens auch kaum nach ihnen gefahndet, denn der Araber wurde ein wenig als natürliche Beute des Soldaten betrachtet.
In Paris war es anders. Man konnte nicht unbehelligt auf Raub ausgehen, den Revolver in der Hand und den Säbel an der Seite, weit von der zivilen Gerichtsbarkeit entfernt. In seinem Innern erwachten alle Instinkte des Unteroffiziers, den man im eroberten Land losließ. Zweifellos trauerte er seinen beiden Wüstenjahren nach. Wie schade, dass er nicht dort geblieben war! Aber eben, er hatte sich für die Rückkehr Besseres erhofft. Und jetzt … In der Tat, er befand sich in einem schönen Schlamassel!
Er ließ seine Zunge mit leisem Schnalzen durch den Mund wandern, als ob er die Trockenheit des Gaumens nachprüfen wollte.
Die Menge glitt erschöpft und langsam an ihm vorbei, und er dachte in einem fort: «Tölpel! All diese Dummköpfe haben Geld in ihrer Westentasche.» Munter pfeifend stieß er an die Schultern der Menschen. Herren, die er angerempelt hatte, drehten sich aufbegehrend um, Frauen sagten: «Welch ungehobelter Kerl!»
Er ging am Vaudeville-Theater vorbei und blieb vor dem «Café Américain» stehen, um sich zu fragen, ob er nicht sein Bier nehmen sollte, so sehr quälte ihn der Durst. Bevor er sich entschloss, schaute er auf den beleuchteten Uhren in der Straßenmitte nach der Zeit. Es war Viertel nach neun. Er kannte sich. Sobald das Glas voll Bier vor ihm stünde, würde er es hinunterstürzen. Was konnte er nachher bis elf Uhr noch tun?
Und er lief weiter. «Ich gehe bis zur Madeleine», sagte er zu sich, «und komme dann gemächlich zurück.»
Als er an der Ecke der Place de l’Opéra angelangt war, kreuzte er einen korpulenten jungen Mann, den er schon irgendwo gesehen zu haben glaubte. Er folgte ihm, suchte in seinem Gedächtnis, wobei er halblaut wiederholte: «Wo, zum Teufel, habe ich diesen Typ kennengelernt?»
Er grub in seinen Gedanken, ohne sich an ihn zu erinnern, dann plötzlich, durch ein seltsames Wirken des Gedächtnisses, erschien ihm derselbe Mann, jünger, weniger dick und in der Husarenuniform. Er rief laut: «Natürlich, Forestier!» und beschleunigte seine Schritte, um dem Spaziergänger auf die Achsel zu klopfen.
Der andere drehte sich zurück, schaute ihn an und sagte dann: «Was wollen Sie von mir, mein Herr?»
Duroy lachte und erwiderte: «Erkennst du mich nicht mehr?»
«Nein.»
«Georges Duroy vom sechsten Husarenregiment.»
Forestier streckte ihm beide Hände entgegen. «Ach, alter Freund, wie geht es dir?»
«Sehr gut, und dir?»
«Leider nicht allzu gut; weißt du, meine Brust ist jetzt nichts mehr wert, ich huste sechs Monate im Jahr, als Folge einer Bronchitis, die ich in Bougival im Jahr meiner Rückkehr nach Paris erwischte. Es sind jetzt vier Jahre her!»
«Wirklich! Und doch siehst du so kräftig aus.»
Forestier ergriff den Arm seines alten Kameraden und sprach von seiner Krankheit, berichtete von Konsultationen, den Meinungen der Ärzte, ihren Ratschlägen und den Schwierigkeiten, ihre Anordnungen in seiner Stellung zu befolgen. Man hieß ihn, den Winter im Süden zu verbringen; aber konnte er das? Er war verheiratet und Journalist, in einer guten Position.
«Ich leite den politischen Teil der ‹Vie Française›, ich schreibe über den Senat im ‹Salut›2 und von Zeit zu Zeit literarische Berichte in der ‹Planète›3. Du siehst, ich habe meinen Weg gemacht.»
Duroy betrachtete ihn überrascht. Er war sehr verändert, viel reifer. Er hatte nun den Gang und die Haltung, die Kleidung eines gesetzten, selbstsicheren Herrn und den Bauch eines Mannes, der gut zu essen pflegt. Früher war er mager gewesen, rank und geschmeidig, unbesonnen, ein Streithahn und ein Aufschneider und immer in Schwung. Paris hatte in drei Jahren aus ihm einen ganz anderen Menschen gemacht, einen wohlbeleibten, ernsten Herrn mit leicht angegrauten Schläfen, obwohl er nicht mehr als siebenundzwanzig Jahre zählte.
Forestier fragte: «Wohin gehst du?»
«Nirgendwohin, ich drehe eine kleine Runde vor dem Heimgehen.»
«Gut, willst du mich zur ‹Vie Française› begleiten, wo ich noch Korrekturabzüge lesen muss? Nachher nehmen wir zusammen ein Bier.»
«Ich komme mit.»
Beim Gehen fassten sie sich mit jener leichten Vertraulichkeit unter, die zwischen Mitschülern und Regimentskameraden andauert.
«Was tust du in Paris?», fragte Forestier.
Duroy zuckte die Achseln. «Ich nage ganz einfach am Hungertuch. Als meine Zeit um war, wollte ich hierher kommen, um … um Karriere zu machen, oder vielmehr, um in Paris zu leben; nun bin ich seit einem halben Jahr im Büro der Nordbahn angestellt, für tausendfünfhundert Franc im Jahr, nicht mehr und nicht weniger.»
Forestier murmelte: «Verdammt, das ist nicht viel.»
«Gewiss, aber wie soll ich da heraus? Ich kenne keinen, ich kann mich auf niemanden berufen, ich bin allein. Am guten Willen fehlt es mir nicht, aber an den Möglichkeiten.»
Sein Kamerad betrachtete ihn von Kopf bis Fuß wie ein Mann, der es gewohnt ist, seine Untergebenen zu beurteilen.
«Schau, mein Freund, hier hängt alles vom Selbstvertrauen ab. Ein nur halbwegs gewitzter Mensch wird leichter Minister als Bürovorsteher. Man muss imponieren und nicht bitten. Aber wie, zum Teufel, hast du eigentlich nichts Besseres gefunden als diese Beamtenstelle bei der Nord?»
Duroy erwiderte: «Ich habe überall gesucht und nichts gefunden. Aber jetzt habe ich etwas in Aussicht: Man bietet mir eine Stelle als Reitlehrer in der Manège Pellerin an. Dort bekomme ich mindestens dreitausend Franc.»
Forestier blieb mit einem Ruck stehen. «Tu das nicht», sagte er. «Es ist töricht, wo du doch zehntausend Franc verdienen solltest. Du verbaust dir deine Zukunft für immer. In deinem Büro bist du wenigstens versteckt, niemand kennt dich, du kannst davon lassen, wenn du willst, und deinen Weg machen. Aber einmal Reitlehrer, ist alles vorbei. Es ist, als ob du Oberkellner in einem Lokal wärst, wo ganz Paris diniert. Wenn du nämlich den Herren der Gesellschaft oder ihren Söhnen Reitstunden erteilt hast, können sie sich nicht mehr daran gewöhnen, dich als ihresgleichen anzunehmen.»
Er verstummte, überlegte einige Sekunden und fragte dann: «Hast du das Abitur?»
«Nein, ich bin zweimal durchgefallen.»
«Das macht nichts, wenn du deine Schuljahre abgesessen hast. Wenn von Cicero oder Tiberius die Rede ist,4 weißt du noch ungefähr, was es bedeutet?»
«Ja, ungefähr.»
«Gut, niemand weiß mehr darüber, bis auf zwanzig Dummköpfe, die nicht imstande sind, sich aus der Affäre zu ziehen. Es ist nicht schwer, als gescheit zu gelten, glaub mir. Die Hauptsache ist, sich nicht in seiner Unwissenheit ertappen zu lassen. Du manövrierst, du meidest die Schwierigkeiten, du gehst um das Hindernis herum und stopfst den andern das Maul mit einem Lexikon. Alle Menschen sind dumm wie Gänse und unwissend wie Karpfen.»
Er sprach wie ein bestandener und welterfahrener Mann, und er betrachtete lächelnd die vorüberziehende Menge. Doch plötzlich begann er zu husten und blieb stehen, bis der Anfall vorüber war. Dann seufzte er entmutigt: «Ist es nicht schrecklich, diese Bronchitis nicht loswerden zu können? Wir stehen doch mitten im Sommer. Aber diesen Winter fahre ich nach Menton, um sie auszuheilen. Egal, was passiert, die Gesundheit geht vor.»
Sie langten beim Boulevard Poissonnière vor einer großen Glastür an, auf welche beidseitig eine offene Zeitung angeschlagen war. Drei Menschen standen davor und lasen sie.
Über der Tür lockte, wie ein Ruf, in großen, feurigen, mit von Gaslichtern ausgeleuchteten Lettern: «La Vie Française». Die Spaziergänger, die in die Helle dieser strahlenden drei Worte traten, erschienen im grellen Licht, klar und deutlich wie am Mittag, und fielen alsbald wieder in den Schatten zurück.
Forestier stieß die Tür auf und sagte: «Tritt ein!» Duroy stieg eine schmutzige Prunktreppe empor, die von der ganzen Straße her sichtbar war, gelangte in ein Vorzimmer, wo die zwei Bürodiener seinen Kameraden begrüßten, und blieb dann in einer Art Wartezimmer stehen, einem staubigen und verwahrlosten Raum, dessen grünlich abgeschossene Bespannung aus Plüschimitation mit Flecken übersät und teilweise zerfressen war, als hätten Mäuse daran genagt.
«Setz dich», sagte Forestier, «ich bin in fünf Minuten zurück», und verschwand durch eine der drei Türen, die zum Arbeitszimmer führten.
Ein fremdartiger, seltsamer, unbeschreiblicher Geruch, der Geruch von Redaktionsräumen, herrschte hier. Duroy blieb etwas eingeschüchtert und vor allem verblüfft sitzen. Von Zeit zu Zeit eilten Männer an ihm vorbei, kamen zur einen Tür herein und gingen zur andern hinaus, ehe er die Gelegenheit fand, sie anzuschauen. Einmal waren es sehr junge Leute mit geschäftiger Miene, ein Blatt Papier in der Hand, das bei ihrem Lauf flatterte, ein andermal Setzer, aus deren schwarzverschmierten Leinenkitteln ein blütenweißer Hemdkragen und elegante Hosen schauten. Sie trugen mit Sorgfalt bedruckte Papierstreifen, frische, noch feuchte Abzüge. Manchmal trat ein mit allzu auffälliger Eleganz gekleideter Herr, irgend so ein kleiner Laffe, ein; die Taille war allzu eng in den Gehrock gezwängt, die Beine zeichneten sich allzu stark unter dem Stoff ab, die Füße steckten in allzu spitzen Schuhen. Es mochte irgendein Lokalreporter sein, der das Neueste vom Abend brachte.
Noch andere kamen, ernst und wichtigtuerisch, mit hohen, flachrandigen Hüten, als wollten sie sich so von den übrigen Menschen unterscheiden.
Forestier erschien wieder, einen großen Herrn am Arm, der etwa dreißig bis vierzig Jahre alt sein mochte und einen schwarzen Anzug mit weißer Krawatte trug. Er war dunkelhaarig, hatte den Schnurrbart in spitze Enden gezwirbelt und blickte anmaßend und selbstzufrieden in die Welt.
Forestier sagte: «Leben Sie wohl, verehrter Meister.»
Der andere drückte ihm die Hand. «Auf Wiedersehen, mein Lieber», und den Stock unter dem Arm, stieg er leise pfeifend die Treppe hinunter.
Duroy fragte: «Wer ist das?»
«Das ist Jacques Rival, weißt du, der berühmte Reporter und Duellant. Er hat eben seine Abzüge korrigiert. Garin, Montel und er sind, was Geist und Aktualität betrifft, die besten Berichterstatter, die wir hier in Paris haben. Für wöchentlich zwei Artikel verdient er bei uns dreißigtausend Franc im Jahr.»
Im Hinuntergehen begegneten sie einem langhaarigen, dicken, unsauber wirkenden Männchen, das keuchend die Treppe erklomm.
Forestier grüßte ehrerbietig. «Norbert de Varenne», sagte er, «Verfasser der ‹Toten Sonnen›, noch ein Mann der hohen Honorare. Jede Erzählung, die er uns liefert, kostet dreihundert Franc, und die längsten umfassen nicht einmal zweihundert Zeilen. Aber gehen wir ins ‹Napolitain›5, ich verschmachte langsam vor Durst.»
Sobald sie vor dem Cafétischchen saßen, bestellte Forestier zwei Bier und leerte das seine in einem Zug, während Duroy die Flüssigkeit in kleinen Schlucken trank und sie wie etwas Wertvolles kostete und genoss.
Sein Begleiter schwieg, schien nachzudenken; und plötzlich fragte er: «Weshalb solltest du dich nicht im Journalismus versuchen?»
Der andere schaute erstaunt auf und sagte: «Nun … es ist … ich habe noch nie etwas geschrieben.»
«Ach was, man versucht es, legt mal los! Du könntest für mich Auskünfte einholen, einigen Dingen nachgehen, Besuche machen. Für den Anfang bekämst du zweihundertfünfzig Franc und die Fahrspesen. Soll ich mit dem Direktor reden?»
«Aber gewiss, von Herzen gern.»
«Dann komm doch morgen zu mir zum Essen. Wir sind nur fünf oder sechs, der Chef, Monsieur Walter, seine Frau, Jacques Rival und Norbert de Varenne, den du eben sahst, dazu eine Freundin meiner Frau. Einverstanden?»
Duroy zögerte und stammelte schließlich verlegen und errötend: «Die Sache ist nur … Ich habe nämlich keinen passenden Anzug.»
Forestier war verblüfft. «Du hast keinen Frack?», fragte er. «Donnerwetter, das ist allerdings unerlässlich. Siehst du, in Paris ist es besser, kein Bett zu haben als keinen Frack.»
Dann begann er plötzlich in der Westentasche zu wühlen und zog eine Handvoll Goldstücke heraus, nahm zwei Louisdor, legte sie seinem alten Kameraden hin und sagte in herzlich vertrautem Ton: «Du kannst sie mir zurückgeben, wann du willst. Miete oder kauf die Kleider, die du brauchst, mit einer Anzahlung auf Raten. Mach’s, wie du kannst, aber komm morgen um halb acht zum Essen, Rue Fontaine 17.»
Duroy steckte das Geld verwirrt ein und brachte stotternd hervor: «Du bist zu liebenswürdig. Ich bin dir sehr dankbar; du kannst versichert sein, dass ich es nicht vergesse…»
Der andere unterbrach ihn: «Schon gut, schon gut. Noch ein Bier, nicht wahr?» Und er rief: «Herr Ober, zwei Bier!»
Als sie ausgetrunken hatten, sagte der Journalist: «Wollen wir noch ein Stündchen bummeln?»
«Aber gern.»
Und sie machten sich auf den Weg zur Madeleine. «Was sollen wir nun anfangen?», fragte Forestier. «Man behauptet, dass ein Spaziergänger in Paris sich stets unterhalten könne; das stimmt nicht. Ich selbst weiß nie, wohin ich gehen soll, wenn ich abends etwas flanieren will. Im Bois spazieren ist nur mit einer Frau amüsant, aber man hat nicht immer eine zur Hand. Die Konzertcafés mögen meinen Apotheker und seine Gattin beglücken, nicht mich. Also, was tun? Nichts. Es sollte hier einen Sommergarten geben wie den Parc Monceau, der auch nachts offen stünde, wo man sich unter den Bäumen bei guter Musik mit kühlen Getränken erfrischen könnte. Es dürfte keine Vergnügungsstätte sein, eher ein Ort, wo man flanieren kann. Der Eintritt müsste hoch sein, um die Damenwelt anzuziehen. Man könnte sich auf den sandbestreuten, elektrisch beleuchteten Alleen ergehen, sich nach Belieben setzen, um die Musik von nah oder fern zu hören. Früher gab es etwas Ähnliches bei Musard, allerdings mit dem Einschlag von Tingeltangel und zu viel Tanzmusik. Auch hatte man zu wenig Platz, zu wenig Schatten, zu wenig lauschiges Dunkel. Ich denke an einen wunderschönen, weiten Garten. Das wäre verlockend. Aber wohin möchtest du nun gehen?»
Duroy schien verlegen und wusste nicht, was er sagen sollte; endlich meinte er: «Ich kenne die ‹Folies-Bergères›6 noch nicht. Ich würde ganz gern einmal hineinschauen.»
Sein Begleiter rief: «Die ‹Folies-Bergères›, Donnerwetter, da werden wir rösten wie auf einem Grill. Na gut, einverstanden, amüsant ist es immer.»
Sie machten kehrt gegen die Rue du Faubourg-Montmartre.
Die beleuchtete Fassade des Hauses warf einen hellen Schein auf die vier Straßen, die dort zusammenliefen. Eine Reihe von Droschken wartete auf den Schluss der Vorstellung.
Forestier trat ein. Duroy hielt ihn zurück: «Wir müssen erst zur Kasse.»
Der andere antwortete großspurig: «Mit mir bezahlt man nichts.»
Als er sich der Türkontrolle näherte, grüßten ihn drei Männer. Der mittlere gab ihm die Hand.
Der Journalist fragte: «Ist noch eine gute Loge frei?»
«Aber sicher, Monsieur Forestier.»
Er nahm die Karte, die man ihm reichte, stieß an die gepolsterte Tür, deren Flügel mit Leder verziert waren, und schon standen sie mitten im Saal.
Tabakdunst verschleierte wie feiner Nebel den Hintergrund, die Bühne und die andere Theaterseite. Von allen Zigarren und Zigaretten, die geraucht wurden, stieg er in dünnen, weißlichen Fäden auf, und dieser Dunst bildete unter dem hohen Gewölbe um den Lüster, über dem menschenerfüllten ersten Rang, einen Himmel voll Rauchwolken.
Im weiten Foyer, das zum Rundgang führte, wo die aufgeputzte Menge der Mädchen zwischen der dunklen Masse der Männer schweifte, erwartete eine Frauengruppe die Ankömmlinge vor einem der drei Schanktische, hinter denen drei geschminkte und verblühte Händlerinnen von Getränken und Liebesdiensten thronten.
Die hohen Spiegel gaben ihre Rücken und die Gesichter der Vorübergehenden wieder.
Forestier, als Mann, der Respekt erheischt, rückte rasch vor, indem er Leute beiseiteschob.
Er näherte sich einer Logenschließerin. «Loge siebzehn?», sagte er.
«Hier bitte.»
Man schloss sie in eine kleine, rottapezierte Holzschachtel, in der vier ebenfalls rote Stühle so nah beieinander standen, dass man sich kaum durchzwängen konnte. Die beiden Freunde setzten sich; zur Rechten wie zur Linken erstreckte sich eine Folge ähnlicher Abteile in einer langen, geschwungenen Linie, die beidseits an die Bühne grenzte; Menschen saßen darin, von denen man nur Kopf und Brust sah.
Auf der Bühne vollführten drei junge Männer, ein großer, ein mittlerer und ein kleiner, in anliegendem Trikot hintereinander Kunststücke am Trapez.
Erst trat der Große mit kurzen, raschen Schritten lächelnd vor und grüßte mit einer Kusshand. Unter dem Trikot zeichneten sich seine Arm- und Beinmuskeln ab; er drückte die Brust heraus, um seinen hervorstehenden Bauch zu verbergen. Mit dem gepflegten Mittelscheitel, der das Haar in zwei gleiche Partien teilte, glich sein Gesicht demjenigen eines Friseurgehilfen. Mit graziösem Sprung ergriff er das Trapez und wirbelte wie ein Rad im Kreis herum oder blieb mit steifen Armen, den ausgestreckten Körper waagrecht, im Raum, sich nur durch die Kraft seiner Handgelenke an der Stange haltend.
Dann sprang er zu Boden und grüßte von Neuem lächelnd unter dem Tusch des Orchesters und stellte sich an die Kulissen, wobei er bei jedem Schritt seine Beinmuskeln spielen ließ.
Der zweite, kleiner und untersetzt, trat vor, um dieselbe Übung zu wiederholen, die dann vom letzten unter dem kräftigen Applaus des Publikums nochmals dargeboten wurde.
Aber Duroy kümmerte sich nicht um die Vorstellung, sondern wandte den Kopf nach hinten auf den Wandelgang voller Männer und Prostituierter.
Forestier sagte: «Schau mal auf das Parkett: lauter Kleinbürger mit ihren Frauen und Kindern, brave Dummköpfe, die herkommen, um was zu sehen. In den Logen Lebemänner, einige Künstler, einige Flittchen und hinter uns die tollste Mischung, die Paris bietet. Wer sind diese Männer? Sieh sie dir doch an. Es ist alles da, alle Berufe und Schichten, aber das Pack überwiegt. Dort die Angestellten aus Banken, Geschäften, Ministerien; Reporter, Zuhälter, Offiziere in Zivil; Gecken im Frack, die eben im Restaurant dinierten und die nach der Oper in die ‹Italiens› gehen, und außerdem eine große Zahl von zweifelhaften Elementen, die sich nirgendwo einreihen lassen. Was die Frauen betrifft: nur eine Sorte, die leichten Mädchen vom ‹Américain›, Dirnen für einen oder zwei Louis, die auf den Fremden für fünf Louis warten und ihren Stammkunden ein Zeichen geben, wenn sie frei sind. Seit zehn Jahren kennt man sie alle; man kann sie jahraus, jahrein allabendlich an denselben Plätzen sehen, wenn sie nicht gerade einen Kuraufenthalt in Saint-Lazare oder in Lourcine machen.»
Duroy hörte ihm nicht mehr zu. Eine der Frauen hatte sich an die Loge gelehnt und schaute ihn an, eine üppige Brünette mit weißgepuderter Haut, schwarzen, mit dem Stift in die Länge ausgezogenen Augen unter riesigen falschen Wimpern. Ihr allzu mächtiger Busen spannte die dunkle Seide ihres Kleides, und ihre geschminkten Lippen, rot wie eine Wunde, verliehen ihr etwas Bestialisches, Glühendes, Lasterhaftes, aber trotzdem Begehrenswertes.
Mit einer Kopfbewegung winkte sie eine Kollegin herbei, eine ebenfalls dicke Rotblonde, und sagte so laut, dass man es hören musste: «Schau den hübschen Kerl: wenn er mich für zehn Louis haben will, sage ich nicht nein.»
Forestier drehte sich um und klapste lächelnd Duroy auf den Schenkel. «Das gilt dir, du hast Erfolg, mein Lieber. Kompliment.»
Der ehemalige Unteroffizier war errötet; mechanisch befühlte er die beiden Goldstücke in seiner Westentasche.
Der Vorhang war gefallen, das Orchester spielte nun einen Walzer.
«Wir könnten vielleicht einen Gang durch die Galerie machen», meinte Duroy.
«Wie du willst.»
Sie traten hinaus und wurden sofort vom Strom der Menschen mitgerissen. Sie wurden gedrängt, gestoßen, gedrückt, hin und her geschoben und hatten, während sie so gingen, eine Heerschar von Hüten vor sich. Die Dirnen schritten zu zweit durch diese Menge, teilten sie mit Leichtigkeit, glitten zwischen Ellbogen und Brustkasten durch, gleich wie Fische im Wasser, als ob sie in dieser Männerflut zu Hause wären.
Entzückt ließ sich Duroy treiben, sog trunken die von Tabak, Menschengeruch und Nuttenparfum verdorbene Luft ein. Forestier jedoch schwitzte, atmete schwer, hustete.
Er sagte: «Gehen wir in den Garten.»
Sie bogen nach links ab und kamen in eine Art Wintergarten, in dem zwei große, geschmacklose Springbrunnen Kühle spendeten. Unter Eiben und Thujen in Kübeln tranken Männer und Frauen an Blechtischen.
«Noch ein Bier?», fragte Forestier.
«Ja, gern.»
Sie setzten sich und betrachteten das vorbeigehende Publikum. Von Zeit zu Zeit blieb eine Nachtschwärmerin stehen und fragte mit ausdruckslosem Lächeln: «Offerieren Sie mir etwas, Monsieur?» Wenn Forestier antwortete: «Ein Glas Wasser am Brunnen», entfernte sie sich und schimpfte: «Pfui, du Flegel!»
Aber die üppige Brünette, die sich eben an die Loge der beiden Kameraden gelehnt hatte, erschien wieder. Sie ging herausfordernd am Arm der dicken Blondine. Die beiden bildeten tatsächlich ein schön aussortiertes Frauenpaar.
Als sie Duroy bemerkte, lächelte sie, als ob ihre Augen einander schon heimliche und intime Dinge anvertraut hätten. Dann nahm sie einen Stuhl, wies auch ihrer Freundin einen Platz an und setzte sich ihm ohne weiteres gegenüber. Mit heller Stimme bestellte sie zwei Grenadine.
Forestier meinte überrascht: «Du bist auch nicht schüchtern, du!»
«Dein Freund gefällt mir», antwortete sie. «Ein hübscher Bursche, tatsächlich. Für ihn könnte ich, glaube ich, allerhand anstellen.»
Duroy war verlegen und wusste nichts zu sagen. Er drehte an seinem gekräuselten Schnurrbart und lächelte einfältig.
Der Kellner brachte den Fruchtsaft, den die Frauen in einem Zug tranken. Dann standen sie auf, die Brünette versetzte Duroy einen leichten Fächerschlag auf den Arm und sagte mit einem freundschaftlichen Nicken: «Danke, mein Schatz. Gesprächig bist du allerdings nicht.»
Dann gingen sie mit wiegenden Hintern weiter.
Forestier lachte. «Hör mal, alter Freund, weißt du, dass du Erfolg bei Frauen hast? So was musst du pflegen; das kann dich weit bringen.»
Er schwieg eine Sekunde und nahm im träumerischen Ton der Menschen, die laut überlegen, den Gedanken wieder auf: «Durch sie erreicht man sein Ziel am schnellsten.»
Und da Duroy immer noch lächelte, ohne zu antworten, fragte er: «Bleibst du noch? Ich hab genug, ich gehe heim.»
«Ja, ich bleibe noch ein wenig», murmelte der andere. «Es ist noch nicht spät.»
Forestier erhob sich. «Also gut, leb wohl. Auf morgen. Vergiss es nicht, Rue Fontaine 17, um halb acht.»
«Einverstanden, auf morgen. Danke.»
Sie gaben einander die Hand, und der Journalist entfernte sich.
Sobald der andere gegangen war, fühlte sich Duroy frei und langte erneut heiter nach den beiden Goldstücken in seiner Tasche. Dann erhob er sich und begann durch die Menge zu schlendern, die er aufmerksam musterte.
Bald erblickte er die beiden Frauen, die blonde und die braune, die noch immer in der Haltung stolzer Bettlerinnen durch die Männer wandelten.
Er ging geradewegs auf sie zu, doch als er ihr ganz nahe war, traute er sich nicht mehr.
Die Braune sagte: «Hast du die Sprache wiedergefunden?»
Er stammelte: «Natürlich», unfähig, etwas anderes als dieses Wort herauszubringen.
So standen sie alle drei da, vom Menschenstrom aufgehalten und ihn ihrerseits um sich herum aufhaltend.
Dann sagte sie schnell: «Kommst du mit mir?»
Zitternd vor Begierde antwortete er grob: «Ja, aber ich habe nur einen Louis in der Tasche.»
Sie lächelte gleichgültig: «Macht nichts», und nahm zum Zeichen ihres Anspruchs seinen Arm.
Beim Hinausgehen überlegte er, dass er mit den restlichen zwanzig Franc sich leicht einen Anzug für den morgigen Abend mieten könnte.
II
«Monsieur Forestier, bitte?»
«Dritter Stock, Türe links.»
Der Concierge hatte in freundlichem Ton geantwortet, aus dem etwas wie Hochachtung für seinen Mieter klang. Georges Duroy stieg die Treppe hinauf.
Er fühlte sich nicht wohl in seiner Haut, er war ein wenig geniert und eingeschüchtert. Zum ersten Mal in seinem Leben trug er einen Abendanzug, und seine zusammengewürfelte Kleidung beunruhigte ihn. Sie erschien ihm überall mangelhaft; die Stiefel waren nicht aus Lackleder, immerhin aus feinem Material, da er in Sachen Schuhwerk anspruchsvoll war. Das Hemd zu vier Franc fünfzig, das er am Morgen noch im «Louvre» gekauft hatte, trug einen zu dünnen Plastron, der schon brüchig war. Da seine Alltagshemden mehr oder weniger schadhaft waren, hätte er selbst das am wenigsten abgetragene auf keinen Fall anziehen können. Die etwas zu weite Hose saß schlecht am Bein, schien sich um die Wade zu rollen und sah zerknittert aus, wie es mit fremden Kleidern geschieht, die nur zufälligerweise unsere Glieder bedecken. Einzig der Frack, der ungefähr seiner Figur entsprach, passte nicht übel.
Mit Herzklopfen und beklommen stieg er langsam die Treppe hinauf. Ihn quälte die Angst, lächerlich zu wirken. Plötzlich sah er einen Herrn in großer Toilette vor sich, der ihn betrachtete. Sie standen einander so nahe, dass er sich selbst im Spiegel sah, der auf dem Treppenabsatz der ersten Etage das Bild einer langen, galerieartigen Perspektive zurückwarf. Eine warme Freude durchlief ihn, dass er so viel besser wirkte, als er gedacht hätte.
Weil er zu Hause nur einen kleinen Rasierspiegel besaß, hatte er sich nicht ganz betrachten können, und da er die verschiedenen Partien seines improvisierten Anzugs nur schlecht sah, hatte er ihre Unvollkommenheit übertrieben und sich ängstlich eingebildet, grotesk zu wirken.
Beim Anblick seiner selbst im Spiegel hatte er sich nun aber nicht einmal erkannt, er hatte einen andern, einen Mann von Welt vor sich gesehen, einen, den er auf den ersten Blick sehr beeindruckend fand, sehr elegant. Und wie er sich nun genau anschaute, musste er zugeben, dass das Ganze zu seiner Zufriedenheit ausgefallen war.
Dann begann er mit sich selbst zu üben, wie ein Schauspieler, der seine Rolle einstudieren will. Er lächelte sich zu, streckte sich die Hand entgegen, machte Gebärden, drückte seine Gefühle aus: Verwunderung, Freude, Zustimmung. Er probierte auch verschiedene Nuancen des Lächelns und des Augenspiels, um als galanter Mann den Damen anzudeuten, dass er sie bewunderte und begehrte.
Im Treppenhaus wurde eine Tür geöffnet. Er bekam Angst, ertappt zu werden, und begann, schnell die Treppe hinaufzusteigen, voll Furcht, von irgendeinem Gast seines Freundes beim Grimassenschneiden beobachtet worden zu sein.
Im zweiten Stockwerk sah er einen anderen Spiegel und verlangsamte den Schritt, um sich vorbeigehen zu sehen. Seine Erscheinung dünkte ihn wirklich elegant. Er bewegte sich gewandt. Ein unbändiges Selbstvertrauen erfüllte ihn. Mit diesem Äußeren musste er Erfolg haben, dazu kamen die Entschlossenheit, der er sich bewusst war, sein Wunsch, Karriere zu machen, und seine innere Unabhängigkeit. Er verspürte beim Erklimmen der letzten Etage Lust, in großen Sätzen hinaufzuspringen. Vor dem dritten Spiegel hielt er an, zwirbelte den Schnurrbart mit gewohnter Gebärde, nahm den Hut ab, um seine Frisur in Ordnung zu bringen, und murmelte halblaut, wie er es oft tat: «Eine ausgezeichnete Erfindung.» Dann streckte er die Hand zur Klingel aus und läutete.
Die Tür ging auf, und schon stand er einem ernsten, gutrasierten, schwarzgekleideten Diener gegenüber, dessen Haltung so gediegen war, dass Duroy von Neuem verlegen wurde, ohne recht zu begreifen, woher diese unbestimmte Erregung kam: vielleicht aus einem unbewussten Vergleich des Schnitts ihrer beiden Kleider. Dieser Lakai in Lackschuhen fragte beim Abnehmen des Überziehers, den Duroy aus Angst, seine Flecken zu zeigen, am Arm trug: «Wen darf ich melden?»
Dann rief er den Namen durch einen angehobenen Türvorhang weiter in den Salon, den man nun betreten musste.
Doch Duroy, der auf einmal seine Sicherheit verloren hatte, fühlte, wie er, schreckerstarrt, schwer atmete. Nun würde er den ersten Schritt in sein lang erwartetes, erträumtes Dasein tun. Trotz seines Zögerns trat er vor. Eine junge blonde Frau erwartete ihn. Sie stand allein in einem großen, hell erleuchteten Raum, der wie ein Gewächshaus voller Pflanzen war.
Völlig aus der Fassung gebracht, hielt er an. Wer war diese lächelnde Dame? Dann erinnerte er sich, dass Forestier verheiratet war, und der Gedanke, dass diese hübsche, elegante Blondine die Frau seines Freundes sein musste, verwirrte ihn völlig.
Er stammelte: «Gnädige Frau, ich bin …»
Sie reichte ihm die Hand. «Ich weiß, Monsieur. Charles hat mir von der gestrigen Begegnung erzählt. Ich bin entzückt, dass er den guten Einfall hatte, Sie für heute zum Essen zu bitten.»
Er errötete bis an die Ohren und wusste nichts mehr zu sagen. Er fühlte, wie er geprüft, von Kopf bis Fuß gemustert, gewogen und beurteilt wurde.
Er wollte sich entschuldigen, einen Grund für die Nachlässigkeit seiner Toilette erfinden, doch es fiel ihm nichts ein, und so wagte er es nicht, dieses heikle Thema zu berühren.
Er setzte sich auf den Stuhl, den sie ihm anwies, und als er den weichen und biegsamen Samt unter sich federn fühlte – als er eingesunken, gestützt, umfangen von diesem molligen Möbel war, dessen gepolsterte Arm- und Rücklehnen ihm angenehmen Halt boten –, schien ihm, er trete in ein neues, bezauberndes Leben, er ergreife Besitz von etwas Wunderbarem, er werde jemand, er sei gerettet. Erst jetzt betrachtete er Madame Forestier, deren Augen immer noch auf ihm ruhten.
Sie trug ein hellblaues Kaschmirkleid, das ihre biegsame Taille und den üppigen Busen betonte. Die Haut der Arme und des Halses hob sich aus einem Schaum weißer Spitzen, welche das Oberteil und die Ärmel zierten. Die auf dem Kopf zusammengehaltenen Haare kräuselten sich ein wenig im Nacken und bildeten über dem Hals ein Wölkchen von blondem Flaum.
Unter ihrem Blick, der ihn irgendwie an denjenigen der Kokotte in den «Folies-Bergères» erinnerte, wurde er sicherer. Sie hatte graue Augen, von einem merkwürdigen, ausdrucksvollen Blaugrau, eine feine Nase, volle Lippen, ein leicht fleischiges Kinn, ein anziehendes, unregelmäßiges Gesicht voller Charme und Schalk. Es war eines jener Frauenantlitze, die in jedem Zug einen eigenen Reiz preisgeben, voll Bedeutung sind und in denen jede Regung etwas zu sagen oder zu verschweigen scheint.
Nach einer kurzen Pause fragte sie: «Sind Sie schon lange in Paris?»
Er fasste sich langsam wieder und antwortete: «Erst seit einigen Monaten, Madame. Ich bin bei der Eisenbahn angestellt, aber Forestier meint, mich mit seiner Hilfe im Journalismus unterbringen zu können.»
Nun lächelte sie freundlicher und wohlwollender, und sie bemerkte leise: «Ich weiß.»
Es klingelte abermals. Der Diener meldete: «Madame de Marelle.»
Es war eine kleine Dunkelhaarige, vom Typ, den man brünett nennt.
Sie trat rasch ein, von Kopf bis Fuß in ein schlichtes dunkles Kleid gegossen. Nur eine rote Rose in ihrem schwarzen Haar zog die Aufmerksamkeit heftig an und schien ihre Züge zu bestimmen, ihren besonderen Charakter zu betonen. Sie verlieh ihr die lebhafte und leidenschaftliche Note, die zu ihr passte.
Ein kleines Mädchen in kurzem Rock folgte ihr.
Madame Forestier eilte ihr entgegen: «Guten Tag, Clotilde.»
«Guten Tag, Madeleine.»
Sie küssten sich. Das Kind bot mit der Sicherheit einer Erwachsenen seine Stirne und sagte: «Guten Tag, Cousine.»
Madame Forestier gab ihr einen Kuss und stellte vor: «Monsieur Georges Duroy, ein guter Dienstkamerad von Charles. – Madame de Marelle, meine Freundin und ein bisschen meine Verwandte.»
Sie fügte bei: «Wissen Sie, wir machen keinerlei Umstände, wir sind zwanglos unter uns. Einverstanden?»
Der junge Mann verbeugte sich.
Die Tür öffnete sich erneut, und ein kleiner, untersetzter, rundlicher Herr erschien am Arm einer schönen, viel größeren und jüngeren Dame von distinguierten Manieren und gemessenem Auftreten. Es waren der Deputierte Monsieur Walter, Finanzmann, ein Geld- und Geschäftsmensch, Jude aus dem Midi und dazu Direktor der «Vie Française», und seine Gattin, geborene Basile-Ravalau, Tochter des Bankiers gleichen Namens.
Dann kamen hintereinander der elegante Jacques Rival und Norbert de Varenne, dessen Rockkragen von den langen herabhängenden Haaren leicht fettig glänzte und von einigen weißen Schuppen gesprenkelt war.
Seine schlecht gebundene Krawatte schien nicht mehr ganz neu. Er tänzelte mit der Grazie eines alten Beau einher, nahm Madame Forestiers Hand und drückte einen Kuss auf das Gelenk. Bei der Verbeugung breiteten sich seine langen Haare wie Wasser über den nackten Arm der jungen Frau.
Auch Forestier trat ein und entschuldigte sich für seine Verspätung. Er war auf der Redaktion durch die Affäre Morel aufgehalten worden. Monsieur Morel, ein radikaler Abgeordneter, hatte dem Ministerium eine Anfrage über ein Kreditbegehren gestellt, das die Kolonisierung Algeriens betraf.
Der Diener verkündete: «Madame, es ist serviert.»
Man trat ins Speisezimmer. Duroy hatte seinen Platz zwischen Madame de Marelle und ihrer Tochter. Von Neuem fühlte er sich geniert, denn er befürchtete, einen Fehler in der Handhabung von Gabel, Löffel oder Gläsern zu begehen. Vor ihm standen deren vier, darunter ein bläulich getöntes. Was mochte man wohl daraus trinken?
Alle löffelten stumm ihre Suppe, dann fragte Norbert de Varenne: «Haben Sie den Bericht über den Prozess Gauthier gelesen? Merkwürdige Sache!»
Man begann über diesen Fall von Ehebruch, der mit komplizierter Erpressung einherging, zu diskutieren. Man sprach darüber nicht wie im Familienkreis über Zeitungsberichte, eher wie unter Ärzten über eine Krankheit oder unter Südfrüchtehändlern über Gemüse. Man empörte sich nicht und schien nicht über Tatsachen erstaunt; mit professioneller Neugier und völliger Gleichgültigkeit für das Verbrechen selbst suchte man nach seinen heimlichen Ursachen. Man war bemüht, die Beweggründe der Handlungen zu erklären, alle gedanklichen Vorgänge festzuhalten, die zum Drama, als dem wissenschaftlichen Resultat eines besonderen Seelenzustandes, führten. Auch die Frauen machten an dieser mühseligen Wahrheitsermittlung leidenschaftlich mit. Noch andere Tagesgeschehnisse wurden untersucht, kommentiert, nach allen Seiten gedreht und gewogen. Man tat es mit jenem praktischen Blick und der besonderen Sehweise der Nachrichtenkrämer, der zeilenschindenden Händler menschlicher Komödien, so wie Kaufleute die Gegenstände, die sie der Kundschaft liefern, prüfen, wenden und drehen.
Dann kam die Rede auf ein Duell, und Jacques Rival ergriff das Wort. Das war seine Domäne, kein anderer mochte sich darüber verbreiten.
Duroy wagte kein Wort von sich zu geben. Er betrachtete von Zeit zu Zeit seine Nachbarin, deren runde Brust ihn bezauberte. Ein Diamant hing an einem Goldfaden von ihrem Ohrläppchen, wie ein über die Haut hingeglittener Wassertropfen. Ab und zu machte sie eine Bemerkung, welche die anderen zum Lächeln reizte. Sie war drollig, nett, mit unerwarteten Geistesblitzen, den Geistesblitzen eines erfahrenen jungen Dings, das die Welt unbekümmert anschaut und sie mit leicht wohlwollender Skepsis beurteilt.
Duroy suchte umsonst nach einem Kompliment für sie, und als ihm keines einfiel, beschäftigte er sich mit der Tochter, schenkte ihr ein, hielt ihr die Schüsseln, bediente sie.
Die Kleine, die ernster als die Mutter schien, dankte gemessen mit leichtem Kopfnicken: «Sie sind sehr freundlich, Monsieur», und hörte den Erwachsenen mit nachdenklicher Miene zu.
Das Diner war ausgezeichnet, und alle lobten es überschwänglich. Monsieur Walter aß fast wortlos wie ein Drescher und betrachtete schräg unter seinen Brillengläsern die Speisen, die man ihm bot. Norbert de Varenne tat es ihm nach und ließ hie und da einen Saucetropfen auf seinen Hemdplastron fallen.
Forestier überwachte lächelnd und ernsthaft den Tisch und tauschte mit seiner Frau Blicke des Einverständnisses zweier Komplizen, denen ein schwieriges Werk zu gelingen scheint.
Die Gesichter röteten sich; die Stimmen schwollen an. Immer wieder flüsterte der Diener in die Ohren der Tischgäste: «Corton, Château-Laroze?»
Duroy fand den Corton nach seinem Geschmack und ließ sich jedes Mal das Glas füllen. Eine köstliche Heiterkeit überkam ihn, eine warme Heiterkeit, die vom Magen in den Kopf stieg, seine Glieder durchfloss, ihn ganz durchdrang. Ein wunderbares Wohlgefühl überflutete ihn, ein Wohlgefühl des Lebens und Denkens, des Leibes und der Seele.
Er verspürte Lust zu sprechen, sich hervorzutun, angehört und geschätzt zu werden wie diese Männer, deren geringste Äußerungen man hochachtungsvoll auskostete. Im ständig fließenden Gespräch reihte sich ein Gedanke an den andern. Auf ein Wort, auf ein Nichts sprang man von einem Gegenstand zum andern, nachdem man die Ereignisse des Tages hatte Revue passieren lassen und im Vorbeigehen tausend Fragen berührt hatte. Dann kam man wieder auf die Interpellation über die Kolonisierung Algeriens zurück.
Monsieur Walter gab zwischen zwei Gängen einige witzige Bemerkungen zum besten und bewies seinen skeptischen, unverblümten Geist. Forestier sprach von seinem morgigen Artikel. Jacques Rival forderte eine Militärregierung, die allen Offizieren nach dreißig Jahren Kolonialdienst Land zusprach.
«So könnte man eine tatkräftige Gesellschaft aufbauen, die das Land seit Langem kennt und liebt, seine Sprache spricht und sich in den schwierigen Fragen der Ortspolitik auskennt, an denen die Neuankömmlinge unweigerlich straucheln.»
Norbert de Varenne unterbrach ihn: «Ja, sie wären durch in allem, außer in der Landwirtschaft. Sie würden Arabisch sprechen, aber sie wüssten nicht, wie man Runkelrüben steckt und Korn sät. Sie wären gewandte Fechter, aber unwissend im Verwenden von Dünger. Nein, man sollte dieses junge Land für alle öffnen. Fähige Männer werden sich behaupten, die andern unterliegen. So will es das Gesetz der Gesellschaft.»
Eine kurze Stille folgte. Alle lächelten.
Georges Duroy öffnete den Mund, und verwundert über den Klang seiner Stimme, als hätte er sie noch nie gehört, sagte er: «Am meisten fehlt es da unten an gutem Land. Die wirklich fruchtbaren Güter sind so teuer wie in Frankreich und dienen schwerreichen Parisern als Geldanlage. Die richtigen Kolonisten, die armen, die aus Hunger auswandern, werden in die Wüste zurückgedrängt, wo es kein Wasser gibt und wo nichts gedeiht.»
Alle schauten ihn an. Er spürte, wie ihm das Blut in den Kopf stieg.
Monsieur Walter fragte ihn: «Kennen Sie Algerien, mein Herr?»
Er antwortete: «Jawohl, ich war achtundzwanzig Monate dort und habe in allen drei Provinzen gelebt.»
Norbert de Varenne, der die Affäre Morel schon vergessen hatte, fragte ihn unvermittelt nach einem Brauch, den er von einem Offizier erfahren hatte. Er betraf den M’zab7, eine kleine eigenartige Republik mitten in der Sahara, in der trockensten Gegend dieser glühenden Region.
Duroy hatte den M’zab zweimal besucht und berichtete von den Sitten dieses Landes, wo Wassertropfen Gold wert sind, wo jeder Einwohner zu allen öffentlichen Diensten aufgeboten und wo die Ehrlichkeit im Handel strenger eingehalten wird als bei den zivilisierten Völkern.
Vom Wein und vom Wunsch angeregt, zu gefallen, sprach er mit einem gewissen wichtigtuerischen Eifer, erzählte Regimentsanekdoten, Beispiele arabischen Lebens, Kriegsabenteuer. Er fand sogar einige malerische Ausdrücke, um jene kahlen gelben Gegenden unter der verzehrenden Sonnenglut und in ihrer unendlichen Trostlosigkeit zu beschreiben.
Alle Damen hatten ihre Augen auf ihn gerichtet. Madame Walter murmelte in ihrer bedächtigen Art: «Mit Ihren Erinnerungen könnten Sie eine reizende Artikelserie verfassen.»
Jetzt betrachtete Walter den jungen Mann über seine Brillengläser hinweg, wie er es immer tat, wenn er ein Gesicht besser anschauen wollte. Die Speisen aber betrachtete er unten durch.
Forestier packte die Gelegenheit: «Verehrter Herr Direktor, ich sprach Ihnen vor kurzem von Georges Duroy und bat Sie, ihn mir für den politischen Informationsdienst als Hilfskraft beizuordnen. Seit uns Marambot verließ, habe ich niemanden mehr für rasche und vertrauliche Informationen, und die Zeitung leidet darunter.»
Der alte Walter wurde ernst und schob die Brille ganz auf die Stirn, um Duroy gerade in die Augen zu sehen. Dann sagte er: «Monsieur Duroy besitzt zweifellos eine originelle Ader. Wenn er morgen um drei Uhr zu einem Gespräch vorbeikommen will, können wir alles regeln.»
Hierauf drehte er sich ganz dem jungen Manne zu. «Verfassen Sie doch gleich eine kleine, freigestaltete Artikelfolge über Algerien. Sie können von Ihren Erinnerungen sprechen und sie mit der Frage der Kolonisierung verbinden, wie Sie es eben taten. Das ist aktuell, sehr aktuell, und ich bin gewiss, dass es unseren Lesern sehr gefallen wird. Aber beeilen Sie sich. Wir brauchen den ersten Artikel schon morgen oder übermorgen, während in der Kammer darüber verhandelt wird, um das Publikum zu ködern.»
Mit der ernsthaften Anmut, die sie überall an den Tag legte und die all ihre Worte wie eine Gunst erscheinen ließen, fügte seine Frau hinzu: «Und dann haben Sie dafür einen reizenden Titel: ‹Erinnerungen eines Chasseur d’Afrique8›, nicht wahr, Monsieur Norbert?»
Der alte Dichter, der spät zu Ruhm gekommen war, fürchtete alle Neulinge. Er antwortete trocken: «Ja, ausgezeichnet, unter der Bedingung, dass in der Folge der Ton gewahrt bleibt, das ist nämlich die große Schwierigkeit, der richtige Ton, wie in der Musik.»
Madame Forestier warf Duroy einen lächelnden, beschützenden Kennerblick zu, der zu sagen schien: «Du wirst es bestimmt schaffen.» Madame de Marelle hatte sich ihm mehrere Male zugewandt, und der Diamant in ihrem Ohr zitterte ständig, als wollte sich der zarte Tropfen lösen und niederfallen.
Das kleine Mädchen blieb ernst und unbeweglich und senkte den Kopf über den Teller.
Der Diener ging unterdessen um den Tisch und schenkte Johannisberger in die blauen Gläser. Dann erhob Forestier sein Glas zu einem Trinkspruch und rief Monsieur Walter zu: «Auf das Wohlergehen der ‹Vie Française›!»
Alle verneigten sich gegen den lächelnden Direktor, und siegestrunken leerte Duroy sein Glas in einem Zug. Es schien ihm, er hätte jetzt ein ganzes Fässchen austrinken, einen Ochsen verzehren, einen Löwen erwürgen können. Er spürte in seinen Gliedern übermenschliche Kraft, unbezwingliche Entschlossenheit und unendliche Hoffnung im Herzen. Von nun an war er im Kreis dieser Menschen zu Hause, er hatte darin eine Stellung, einen Platz erobert.
Mit neuer Sicherheit ruhte sein Blick auf den Gesichtern, und er wagte es zum ersten Mal, das Wort an seine Nachbarin zu richten: «Madame, Sie tragen die schönsten Ohrringe, die ich je gesehen habe.»
Sie wandte sich ihm lächelnd zu. «Die Idee, Diamanten einfach an das Ende eines Fadens zu befestigen, ist von mir. Es wirkt wie Tau, nicht?»
Verwirrt über seine Kühnheit und voller Angst, eine Dummheit auszusprechen, murmelte er: «Reizend … aber das Ohr bringt alles erst zur Geltung.»
Sie dankte ihm mit einem Blick, einem hellen Frauenblick, der bis ins Herz drang.
Als er den Kopf drehte, begegnete er abermals den wohlwollenden Augen Madame Forestiers, aber jetzt glaubte er darin lebhaftere Nuancen der Munterkeit, der Schelmerei und der Ermutigung zu lesen.
Alle Männer sprachen nun gestikulierend und mit erhobener Stimme zu gleicher Zeit. Man diskutierte über das große Projekt der Untergrundbahn. Das Thema war erst am Schluss des Nachtischs erschöpft, denn jeder hatte über die Langsamkeit des Pariser Verkehrs etwas zu sagen, über die Nachteile der Straßenbahn, den Ärger mit den Omnibussen und die Grobheit der Droschkenkutscher.
Dann verließ man das Esszimmer, um den Kaffee einzunehmen. Duroy bot der Kleinen zum Scherz den Arm. Sie bedankte sich ernst und reckte sich auf die Zehenspitzen, um die Hand auf den Arm ihres Nachbarn zu legen.
Beim Betreten des Salons hatte er wieder den Eindruck, in ein Gewächshaus zu kommen. Große Palmen öffneten in allen vier Ecken ihre eleganten Fächer, hoben sich bis zur Decke und breiteten sich dann wasserfallähnlich aus.
Auf beiden Seiten des Kamins streckten säulenartige runde Gummibäume ihre langen dunkelgrünen Blätter stufenweise übereinander aus. Auf dem Flügel standen zwei runde, fremdartige Gewächse, das eine mit rosaroten, das andere mit weißen Blüten, unwahrscheinlich und zu schön, um wirklich zu sein.
Die Luft war frisch und von unbestimmtem, zartem Duft erfüllt.
Da er seiner selbst jetzt sicherer war, betrachtete der junge Mann aufmerksam den Raum. Er war nicht groß, außer den Pflanzen zog nichts den Blick an, keine grelle Farbe drängte sich auf, aber man fühlte sich wohl darin, entspannt und ausgeruht. Man war sanft eingehüllt von etwas, das sich wie eine Liebkosung um den Leib legte.
Die Wände waren mit blassviolettem, altem Stoff bespannt, der mit gelben, fliegengroßen Seidenblümchen übersät war. Portieren aus blaugrauem, mit roten Seidennelken besticktem Uniformtuch fielen über die Türen und die Sitzgelegenheiten aller Art, die zwanglos im Gemach herumstanden. Sofas, riesige oder zierliche kleine Sessel, Polsterhocker und Taburette waren mit Louis-Seize-Seide oder schönem, crèmefarbenem, granatgemustertem Utrechter Samt überzogen.
«Nehmen Sie Kaffee, Monsieur Duroy?»
Madame Forestier streckte ihm mit dem freundlichen Lächeln, das nie ihre Lippen verließ, ein gefülltes Tässchen hin.
«Gerne, Madame, danke schön.»
Er nahm die Tasse, und wie er sich ängstlich nach vorn beugte, um mit der silbernen Zuckerzange ein Stück Zucker aus der Dose zu fischen, die das Kind ihm hinhielt, bemerkte die junge Frau halblaut: «Machen Sie Madame Walter doch ein wenig den Hof.»
Sie entfernte sich, noch ehe er ein Wort hervorbrachte.
Er trank erst seinen Kaffee aus, den er auf dem Teppich zu verschütten fürchtete, dann versuchte er unbeschwerter nach einem Weg, sich der Gemahlin seines künftigen Chefs zu nähern, um ein Gespräch anzuknüpfen.
Plötzlich bemerkte er, dass sie eine leere Tasse in der Hand hielt, und da kein Tisch in der Nähe stand, wusste sie nicht wohin damit.
Er trat vor. «Erlauben Sie, gnädige Frau.»
«Danke, Monsieur.»
Er trug die Tasse weg und kam zu ihr zurück.
«Wenn Sie wüssten, Madame, welch gute Stunden mir die ‹Vie Française› dort unten in der Wüste geschenkt hat. Es ist tatsächlich die einzige Zeitung, die man außerhalb Frankreichs lesen kann, sie ist literarischer, geistreicher, weniger eintönig als alle andern. Man findet darin von allem etwas.»
Sie lächelte mit liebenswürdiger Gleichgültigkeit und antwortete bedächtig: «Monsieur Walter hatte große Mühe, diese Art Zeitung zu schaffen, die einem neuen Bedürfnis entsprach.»
Und sie begannen zu plaudern. Das Wort ging ihm leicht und etwas nichtssagend vom Mund; in seiner Stimme lag ein eigenartiger Zauber, im Blick viel Anmut und in seinem Schnurrbart ein unwiderstehlicher Reiz. Hübsch und locker kräuselte er sich über seiner Oberlippe, von einem rötlich getönten Blond mit einer helleren Nuance an den aufstehenden Enden.
Sie sprachen von Paris, der Umgebung, den Seineufern, von Badeorten und Sommerfreuden, von all den gewöhnlichen Dingen, über die man unendlich lange plaudern kann, ohne seinen Geist anzustrengen.
Als dann Norbert de Varenne sich mit einem Glas Likör in der Hand näherte, entfernte sich Duroy diskret.
Madame de Marelle, die ein Gespräch mit Forestier geführt hatte, rief ihn zu sich und sagte unvermittelt: «Sie wollen sich also im Journalismus versuchen, mein Herr?»
Er begann in unbestimmten Wendungen von seinen Plänen zu reden, wandte sich dann wieder den Themen zu, die er mit Madame Walter erörtert hatte, und da er sie jetzt besser beherrschte, zeigte er eine gewisse Überlegenheit und wiederholte eben gehörte Dinge, als stammten sie von ihm. Dabei schaute er ständig seiner Nachbarin in die Augen, um allem, was er sagte, einen tiefen Sinn zu verleihen.
Sie erzählte ihrerseits Anekdoten mit dem Charme einer Frau, die weiß, wie geistreich sie ist, und die stets amüsieren will. In einem Anflug von Vertraulichkeit legte sie die Hand auf seinen Arm, senkte die Stimme, um Nichtigkeiten zu sagen, die so einen intimen Charakter annahmen. Er genoss es im Innersten, diese junge Frau zu berühren, die ihm ihre Aufmerksamkeit zuwandte. Er hätte sich ihr sogleich ergeben, sie verteidigen mögen, ihr zeigen, wessen er fähig war, und in seinen abgehackten Antworten trat die ganze Unruhe seines Herzens zutage.
Plötzlich rief Madame de Marelle unvermittelt: «Laurine!», und das kleine Mädchen kam herbei.
«Setz dich hierher, mein Kind, du könntest dich am Fenster erkälten.»
In Duroy erwachte eine irrsinnige Lust, das Kind zu küssen, als ob er etwas von diesem Kuss auf die Mutter übertragen könnte.
Mit väterlicher Galanterie fragte er: «Erlauben Sie mir, Ihnen einen Kuss zu geben, Mademoiselle?»
Das Mädchen erhob erstaunt die Augen. Madame de Marelle sagte lachend: «Antworte: ‹Für heute recht gern, Monsieur, aber es wird nicht immer so bleiben.›»
Sogleich nahm Duroy Platz, setzte Laurine auf seine Knie und berührte mit den Lippen die feinen Lockenhaare auf der Stirn des Kindes.
Die Mutter wunderte sich: «Na schau, sie ist nicht davongerannt, wie erstaunlich. Sie lässt sich gewöhnlich nur von Frauen küssen. Sie sind unwiderstehlich, Monsieur Duroy.»
Er errötete, ohne ein Wort zu sagen, und wiegte leicht das Kind auf seinen Knien.
Madame Forestier näherte sich und rief überrascht: «Schau, Laurine ist gezähmt, welches Wunder!»
Auch Jacques Rival kam herzu, eine Zigarre im Mund. Da brach Duroy auf, aus Angst, nach getanem Werk durch ein ungeschicktes Wort seinen begonnenen Eroberungen in die Quere zu kommen.
Er verabschiedete sich, drückte zart die ausgestreckten Hände der Damen, schüttelte kräftig die Hände der Männer. Er bemerkte, dass die von Jacques Rival warm und trocken war und seinen Druck herzlich erwiderte, die von Norbert de Varenne feucht und kühl und den Fingern entglitt, die des alten Walter kalt und weich, kraft- und ausdruckslos war, die von Forestier mollig und warm.
Sein Freund sagte ihm halblaut: «Morgen, um drei Uhr, vergiss es nicht.»
«Ach nein, hab keine Angst.»
Als er wieder auf der Treppe stand, verspürte er Lust hinunterzurennen, so groß war seine Freude. Er nahm immer zwei Stufen auf einmal. Doch plötzlich sah er im großen Spiegel der zweiten Etage einen eiligen Herrn, der ihm hüpfend entgegenkam. Beschämt hielt er jäh an, als hätte man ihn bei einem Fehler ertappt.
Dann betrachtete er sich lange, erfreut, ein so gut aussehender junger Mann zu sein, lächelte sich dann selbstgefällig zu und nahm mit einer ehrerbietigen Verbeugung Abschied von seinem Bild, wie man es von großen Herrschaften tut.
III
Als Georges Duroy wieder auf der Straße stand, zögerte er. Er verspürte Lust zu laufen, in Gedanken an seine Zukunft träumerisch vor sich hin zu gehen und die milde Nachtluft einzuatmen. Aber die Artikelserie, die der alte Walter bei ihm bestellt hatte, verfolgte ihn, und er beschloss, sofort heimzukehren, um sich an die Arbeit zu machen.
Er ging mit großen Schritten, gelangte zum äußeren Boulevard und folgte ihm bis zur Rue Boursault, wo er lebte. Das sechsstöckige Haus war von zwanzig bescheidenen Arbeiter- und Bürgerfamilien bevölkert. Auf der Treppe, deren schmutzige Stufen er mit Wachsstreichhölzern beleuchtete und wo Papierfetzen, Zigarettenstummel, Küchenabfälle herumlagen, überkam ihn ein Gefühl des Ekels. Er wollte diese Umgebung so schnell wie möglich verlassen und wie die Reichen in teppichbelegten Räumen wohnen. Ein schwerer Geruch nach Essen erfüllte das Treppenhaus von unten bis oben, ein Geruch von Latrinen und Menschen, ein bleibender Geruch nach Unrat und altem Gemäuer, den kein Luftzug zu vertreiben vermochte.
Das Zimmer des jungen Mannes im fünften Stockwerk blickte auf den riesigen Einschnitt der Westbahn, gerade über dem Tunnelausgang beim Bahnhof Batignolles, wie in eine tiefe Schlucht. Duroy öffnete das Fenster und stützte sich auf die Brüstung aus verrostetem Eisen.
Unter ihm, im Grunde des dunklen Loches, schauten ihn drei unbewegliche Signallichter wie große Tieraugen an, weiter hinten kamen andere und nochmals andere. Lange und kurze Pfiffe tönten immer wieder durch die Nacht, die einen nah, die andern kaum hörbar aus der Richtung von Asnières, und ihre Modulationen glichen dem Ruf menschlicher Stimmen. Einer näherte sich mit klagendem Ton, der sich von Minute zu Minute verstärkte. Bald tauchte ein großes gelbes Licht auf und kam tosend in vollem Lauf heran. Duroy sah die lange Wagenreihe wie einen Rosenkranz in einem Tunnel verschwinden.
Dann sagte er sich: «Los, an die Arbeit!» Er stellte seine Lampe auf den Tisch, aber als er beginnen wollte, bemerkte er, dass er nur ein Bündel Briefpapier besaß.
Nun, er würde die Bogen auseinanderfalten. Er tauchte die Feder in die Tinte und schrieb mit seiner schönsten Schrift den Titel: «Erinnerungen eines Chasseur d’Afrique».
Hierauf suchte er nach dem Anfang des ersten Satzes. Die Stirn in die Hand gestützt, die Augen auf das weiße Papierblatt gerichtet, das vor ihm lag, saß er da.
Was sollte er sagen? Von allem, was er eben erzählt hatte, kam ihm nichts mehr in den Sinn, keine Anekdote, keine Begebenheit, nichts. So dachte er: «Ich muss mit der Abreise beginnen.» Und er schrieb: «Es war im Jahre 1874, ungefähr Mitte Mai, als das erschöpfte Frankreich sich von den Katastrophen des Schreckensjahres erholte.»
Er hielt inne, unschlüssig, wie er zum Folgenden übergehen sollte, zu seiner Einschiffung, seiner Reise, seinen ersten Eindrücken. Nachdem er zehn Minuten lang überlegt hatte, beschloss er, die Einleitung auf den nächsten Tag zu verschieben und mit der Schilderung Algiers zu beginnen.
Er schrieb auf das Blatt: «Algier ist eine schneeweiße Stadt …», aber es gelang ihm nicht, noch etwas mehr von sich zu geben. Er sah in der Erinnerung die schöne, helle Stadt vor sich, deren niedere Flachdachhäuser wie ein Wasserfall vom Hügel zum Meer niederfielen, aber er fand keine Worte mehr, um das auszudrücken, was er gesehen und gefühlt hatte.
Nach einer großen Anstrengung fügte er bei: «Sie ist teilweise von Arabern bewohnt …», dann warf er die Feder auf den Tisch und stand auf.
Auf dem kleinen Eisenbett, in der Mulde, die sein Körper gegraben hatte, sah er seine hingestreuten Werktagskleider, leer, müde, schlaff, hässlich wie die Lumpen des Leichenschauhauses. Auf einem Strohstuhl schien sein einziger Hut offen dazuliegen, wie um ein Almosen zu empfangen. Die Wände, deren graue Tapete mit blauen Blumenbuketts übersät war, hatten ebenso viele Flecken wie Blumen, alte, verdächtige Flecken, deren Ursprung nicht zu bestimmen war, von zerdrückten Insekten oder von Öltropfen, pomadeverschmierten Fingerspitzen oder Schaumspritzern aus dem Waschbecken. Es roch nach verschämter Armut, der Armut des möblierten Zimmers in Paris. Verzweiflung über sein elendes Leben wurde in ihm wach. Er sagte sich, dass er hier hinaus müsse, dass er schon morgen Schluss machen müsse mit dieser kümmerlichen Existenz.
Nun packte ihn plötzlich wieder ein neuer Arbeitseifer: Er setzte sich nochmals an den Tisch und begann Sätze zu suchen, die den fremdartigen und zauberhaften Charakter von Algier wiedergeben sollten, dieses Vorzimmer zum geheimnisvollen tiefen Afrika. Es war das Afrika nomadisierender Araber und unbekannter Negerstämme, das unerforschte, lockende Land, von dem man in zoologischen Gärten unwahrscheinliche Märchentiere zeigt, Strauße, dieses merkwürdige Federvieh, ernsthafte Kamele, monströse Nilpferde, unförmige Nashörner und Gorillas, die erschreckenden Brüder der Menschen.
Verschwommen stiegen Gedanken in ihm auf, die er vielleicht im Gespräch, nie aber in geschriebenen Sätzen wiedergeben konnte. In fiebriger Erregung ob seines Unvermögens erhob er sich abermals mit schweißfeuchten Händen und pochenden Schläfen.
Als sein Blick noch auf die Wäscherechnung fiel, die der Concierge am selben Abend hingelegt hatte, fasste ihn wilde Verzweiflung. In einer Sekunde waren sein Glücksgefühl und mit ihm sein Selbstvertrauen und sein Zukunftsglaube verschwunden. Aus, alles war aus, er würde nichts erreichen, er würde es zu nichts bringen; er fühlte sich leer, unfähig, unnütz, verworfen.
Und wieder stützte er sich auf die Fensterbrüstung, gerade als der Zug mit jähem, heftigem Brausen aus dem Tunnel fuhr. Er eilte durch Felder und Ebenen abwärts, dem Meere zu. Da überwältigte ihn die Erinnerung an seine Eltern.
Diese Eisenbahnwagen würden nur einige Meilen von ihrem Haus entfernt vorbeifahren. Er sah es vor sich, das Häuschen am Hang, hoch über Rouen und dem breiten Seinetal, am Eingang des Dorfes Canteleu.