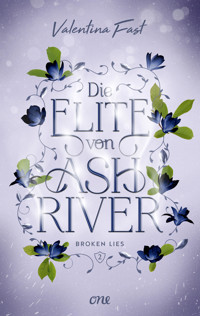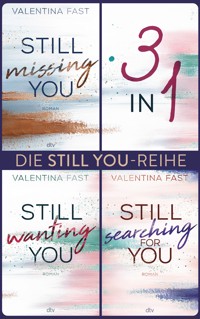7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Seit die 17-jährige Isabelle Monvision aus ihrer Heimat verbannt wurde, ist nichts mehr, wie es mal war. Nicht nur hat sie ihre Hexenfähigkeiten vollständig eingebüßt, auch das Vertrauen zu Gaston ist mit den vergangenen Geschehnissen zu Bruch gegangen. Dennoch kämpft sie sich mit ihm und seinen Freunden durch die zahlreichen Gefahren des Magischen Waldes – wissend, dass sie nur im Reich auf der anderen Seite der Berge in Sicherheit sein kann. Mit allen Mitteln versucht Gaston sie auf dem unsicheren Weg dorthin zu beschützen. Dabei ahnt keiner von ihnen, dass dies nur der Anfang ist und Isabelle die Schlüsselfigur eines jahrhundertealten Krieges werden wird... //Alle Bände der märchenhaften Magie-Reihe: -- Belle et la magie 1: Hexenherz -- Belle et la magie 2: Hexenzorn -- Belle et la magie: Alle Bände in einer E-Box// Die »Belle et la magie«-Reihe ist abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Im.press Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2016 Text © Valentina Fast, 2016 Lektorat: Konstanze Bergner Umschlagbild: shutterstock.com / © fotogestoeber / © kaisorn / © fluke samed Umschlaggestaltung: formlabor Gestaltung E-Book-Template: Gunta Lauck Schrift: Alegreya, gestaltet von Juan Pablo del Peral Satz und E-Book-Umsetzung: readbox publishing, Dortmund
Prolog
Obwohl ich versuchte, wirklich versuchte, mich mit aller Macht dagegen zu wehren, schien es, als wären meine kompletten Sinne auf Belle fixiert. Auf ihren Gang, darauf, wie sie sprach, ja sogar darauf, wie sie die pinke Katze an sich drückte.
Seit diesem Kuss, zu dem der Waldnymph uns verführt hatte und der noch immer auf meinen Lippen zu brennen schien, war mir, als könnte ich mich auf nichts anderes mehr konzentrieren.
Gleichzeitig hasste ich mich, hasste mich, weil ich sie in Gefahr gebracht hatte, obwohl ich sie nur schützen wollte. Ihr hätte in den letzten Tagen, in denen wir durch den Magischen Wald gereist waren, so viel passieren können. Verdammt, und das nur, weil ich mir sicher gewesen war, sie zu überfordern, wenn ich ihr zu viel Informationen auf einmal gab.
Ich blickte auf den dunklen Nachthimmel und schwor mir, es von nun an besser zu machen. Was auch immer ich fühlte, war nichts im Vergleich zu dem, was auf dem Spiel stand. Würde ich mich auch nur einmal noch verschätzen oder nicht richtig aufpassen, könnte das ihren Tod bedeuten. Vor allem jetzt, da ihr Vater, der Herrscher über die Zauberer, aufgetaucht war.
Mein Blick glitt wieder auf Belle, die müde wirkte, jedoch nicht aufgab. Nein, ihr sollte nie wieder etwas geschehen, dafür würde ich sorgen – egal, wie hoch der Preis dafür auch sein mochte …
1. Kapitel
Auszug aus der Geschichte des Magischen Waldes:
Die Bewohner des Magischen Waldes leben in Frieden und Eintracht. Unruhestifter werden mit sofortiger Wirkung des Magischen Waldes verwiesen und verwirken ihr Recht auf eine Rückkehr.
Die Nacht war schon längst angebrochen, als wir erneut einen Fluss erreichten. Er war sogar noch breiter als der, über den uns die Sirenen geleitet hatten. Jedoch gab es hier eine Brücke.
Meine Augen wanderten hoch zu dem imposanten Bauwerk. Gaston fing meinen Blick wohl auf, denn er bemerkte: »Das ist die einzige Stelle in der Nähe, an der uns die Sirenen den Bau einer Brücke erlaubt haben. Direkt dahinter befindet sich das Reich der Wicca.«
Ich kniff die Augen zusammen, nicht nur, da es dunkel war, sondern auch, um die Höhe der Brückenkonstruktion zu bemessen. Ich schätzte sie auf gute acht Meter. Gruselig!
»Wieso macht man nicht einfach eine flache Brücke, statt einer, die in die Höhe verläuft?«, fragte ich in die Runde.
»Wegen des verdammt guten Ausblicks«, antwortete mir Fiona. »Die Erschaffer des Reiches wollten schon damals die Schönheit dieses Ortes gekonnt in Szene setzen.«
Sprach’s und marschierte los. Und obwohl sie nicht mehr ganz so angespannt zu sein schien, wirkten ihre Schritte doch noch ein wenig steif.
Ich konnte mir gut vorstellen, dass mich ein Kuss mit Sergej, der zu Fionas engstem Freundeskreis gehörte, ebenso aus der Bahn geworfen hätte.
Betont forsch erklomm Fiona nun die Stufen der Brücke.
Sergej folgte ihr in gewissem Abstand und schien sie doch die ganze Zeit über zu beobachten. Interessant!
Neben ihm ging Robert.
Auch Gaston hielt es nicht mehr am Fleck und selbst Pinky begann bereits, die hölzernen Stufen hochzuklettern.
Ich seufzte leise und tat es ihnen nach. Immer weiter, immer höher.
Als ich den höchsten Punkt erreichte, hielt ich mich am Geländer fest, die Augen weit aufgerissen angesichts des majestätischen Anblicks, der sich mir bot.
»Das ist doch nicht …« Meine Stimme verlor sich im Wind und wurde davongetragen. Meine Haare flogen umher, so dass ich sie mit einer Hand festhalten musste. Ganz deutlich glaubte ich das Schwanken der Brücke zu spüren, doch das machte mir im Moment keine Angst. Dafür war ich viel zu gefangen von der Aussicht.
Hinter dem dunklen Wald erhob sich eine riesige Burg, erhellt von Hunderten goldener Lichter, die ihr ein geradezu verwunschenes Antlitz verliehen. Unzählige kleine Türme reckten sich empor, verschmolzen mit der umliegenden Dunkelheit. Die Burg wurde umrahmt von einer steinernen Mauer und einem tiefen Graben. Nur eine riesige Zugbrücke führte zu dem einzigen, für mich sichtbaren Tor dieser Burganlage.
»Gebaut nach dem Vorbild des Mont-Saint-Michel in Frankreich«, erklärte mir Gaston hörbar stolz. Er war neben mir stehengeblieben, um mit mir gemeinsam diesen Anblick in sich aufzusaugen.
»Die Gründer wussten wirklich, wie man etwas in Szene setzt«, lächelte ich leise.
»Kommt ihr? Ich möchte endlich nach Hause.« Fiona, die bereits etliche Schritte voraus war, drehte sich ungeduldig zu uns um.
»Ja!« Gaston packte mein Handgelenk und zog mich mit sich.
Ich war zu fasziniert, um etwas zu sagen. Fasziniert und eingeschüchtert zugleich. Dieses Reich war so viel größer, als ich es mir ausgemalt hatte. Am Fuße der Burg, aber noch innerhalb der Mauer, waren unzählige kleine Häuser zu sehen, die sich dicht an dicht reihten. Dort mussten Hunderte Wicca leben. Und dann kam ich … Eine unbedeutende kleine Hexe – nein, Wicca. Ohne Kräfte.
Bei dem Gedanken daran, wie Bernard mir meine Kräfte entrissen hatte, bildete sich ein Kloß in meinem Hals und Tränen brannten hinter meinen Augen.
Mein Vater … mein eigener Vater …
Und was hatte meine Mutter getan? Mich vertrieben, sobald sie das Mal der Wicca in meinem Nacken entdeckt hatte …
Der wieder aufkeimende Schmerz saß so tief, dass ich meine Lippen aufeinanderpressen musste, während ich weiterlief.
Wir erreichten das Ende der Brücke. Ich stieg die Treppe hinunter, Gaston war schon eine Stufe weiter. Plötzlich ertönte ein lautes Knacken. Noch bevor ich überhaupt realisierte, was geschah, brach das Holz unter mir weg und mein Bein stürzte in die Tiefe.
Ich konnte nicht einmal schreien, so sehr erschrak ich mich, auch da sich das zersplitterte Holz durch meine hautenge Hose bohrte und meine Haut aufschlitzte.
Gaston zog mich an meinem Handgelenk hoch und riss mich zu sich, während gleichzeitig die gesamte Stufe unter mir wegbrach und in die rauschenden Wogen des Flusses segelte.
Ein Keuchen entfuhr mir, als der Schmerz plötzlich einsetzte.
Gaston hatte mich hochgehoben und flog geradezu die restlichen Stufen der Brücke hinab.
Robert und Sergej rannten an uns vorbei nach oben. Ich hörte sie leise Zaubersprüche murmeln, bis ihre Stimmen sich verloren und Gaston mich neben Fiona auf dem Boden absetzte.
Er warf mir einen besorgten Blick zu, bevor auch er wieder die Brücke hinaufhastete.
Fiona kniete sich neben mich und riss meine Hose einfach auf. Sofort begann sie damit, meine Wunden zu untersuchen, die sich von meinen Waden bis zu meinen Oberschenkeln hinaufzogen. Sie konzentrierte sich, hielt ihre Hände darüber und kurz darauf spürte ich, wie ihre Magie mich berührte. Ein schmerzhaftes Ziehen setzte ein, das aber nichts im Vergleich zu meinen vorherigen Schmerzen war. Ich biss die Zähne zusammen.
Fiona beendete die Tortur. »Die Wunden sind so tief, dass ich sie nicht heilen kann.« Sie richtete sich wieder auf und streckte mir ihre Hand entgegen. Ich ergriff sie und ließ mir von ihr aufhelfen. »Aber wenigstens konnte ich die Blutung stoppen und deine Schmerzen ein wenig lindern. Wir müssen die Verletzungen sofort versorgen, sobald wir angekommen sind.«
»So ein Pech muss man erst mal haben«, murmelte ich. Der Schock ließ mein Herz noch immer zu schnell pumpen. Mein Blick glitt hin zum Wasser, dann noch einmal hoch zur Brücke und ein neuerlicher Schauder überrollte meinen Rücken.
»Pech war das sicher nicht«, knurrte Sergej, der gerade mit den anderen wieder zu uns herunterkam und mich anschaute, als hätte ich die Brücke eigenhändig in Brand gesteckt.
»Ich habe nichts gemacht. Echt nicht!« Sofort presste ich meine Lippen aufeinander.
»Natürlich warst du das nicht.« Robert lachte trocken und zum ersten Mal, seitdem wir uns kennengelernt hatten, wirkte er geradezu außer sich vor Wut.
»Aber … was ist denn los?«
»Ein Zauber«, antwortete Gaston. Mehr sagte er nicht. Sein Blick fixierte mein blutendes, mit Schrammen übersätes Bein, das pochte, wenn ich es belastete.
»Was für ein Zauber?« Fiona war schneller als ich.
»Moment«, herrschte ich dazwischen, noch bevor einer der Jungs auf Fionas Frage antworten konnte. »Soll das etwa bedeuten, dass das jemand absichtlich gemacht hat? So richtig absichtlich? Mit dem Wissen, dass ich mir das Genick hätte brechen können?«
»Wir sind nicht sicher …«
»Robert, sieht sie etwa so aus, als würde sie wollen, dass man ihre Gefühle schont?« Gastons Stirn legte sich in tiefe Falten, sein Blick glitt zu mir. »Ja, verdammt, so ist es, Belle. Aber mach dir keine Sorgen.«
»Keine Sorgen?!« Nun lachte ich trocken und bückte mich nach Pinky, die gerade zu meinen Füßen schnurrte, als hätte sie meine Anspannung bemerkt. Gut, dass ich sie vorhin nicht auf dem Arm gehabt hatte … »Sicher: War bestimmt nur ein Scherz. Jetzt haben wir alle köstlich gelacht«, entfuhr es mir.
»Hm«, machte Robert und legte seinen Kopf schief, während er mich und meine pinke Katze betrachtete. »Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dass du nicht heulst und –«
»Wie dem auch sei …«, unterbrach ihn Gaston. »Wir sollten weitergehen. Unser Ziel ist nah und Belles Schrammen müssen versorgt werden. In unserem Reich wird sich alles aufklären.«
Gastons Worte, die ermutigend klingen sollten, brachten wieder Bewegung in unsere Gruppe – im wahrsten Sinne des Wortes. Doch blieb er den Rest des Weges auffällig nah bei mir.
Jedes Mal wenn ich einen Schritt mit dem verwundeten Bein machte, knickte ich leicht ein und keuchte vor Schmerz. Ich wollte mir überhaupt nicht ausmalen, wie sich meine Verletzung ohne Fionas »Behandlung« angefühlt hätte …
Bevor wir den nahen Waldabschnitt betraten, ließ ich Pinky wieder hinunter, denn so langsam spürte ich die Anstrengung.
Als die Bäume des Wäldchens, das uns von der Burgfestung noch trennte, schließlich an uns vorbeigezogen waren, wurde auch mein gesundes Bein von Schritt zu Schritt schwerer. Es war, als würde es mir jeden Moment den Dienst verweigern wollen – was ich ihm wirklich nicht verübeln konnte. Doch ich presste meine Zähne zusammen und versuchte mir die Erschöpfung und den Schmerz, der mich ein wenig schwindeln ließ, nicht anmerken zu lassen.
Als wir aus dem Wald hinaustraten, war der Anblick erneut schier überwältigend. Aus der Nähe sah dieses Reich noch viel gigantischer aus. Nun konnte man sogar schon vereinzelte Stimmen hören, weit weg zwar, und doch klangen sie seltsam nah. Die Lichter strahlten nun groß und erhaben. Sie erhellten den edlen Sandstein, aus dem die gesamte Anlage zu bestehen schien.
»Keine Angst: Du wirst dich hier wohlfühlen«, flüsterte Fiona mir zu und brachte mich dazu, sie schockiert anzusehen.
Sie quittierte meinen wahrscheinlich ziemlich dämlichen Blick mit einem Lächeln. »Wirklich!«
»Merci.« Ich konnte nicht ausdrücken, was mir das aus ihrem Mund bedeutete. Es war wie ein Friedensangebot – das ich nur allzu gerne annahm, denn es konnte absolut nicht schaden, noch jemanden an meiner Seite zu wissen, der mich wenigstens ein bisschen leiden konnte. Und das lag nicht an Selbstsucht, sondern war eher reiner Selbsterhaltungstrieb.
Offenbar gab es jemanden, der mich hier nicht haben wollte. Jetzt schon.
Ich hätte Angst empfinden müssen, doch Gastons Arm berührte meinen. Nur ganz leicht, aber genug, damit ich mich von ihm beschützt fühlte.
Egal, wie viele Informationen er mir vorenthalten hatte, wie gemein er zu mir gewesen war oder wie sehr er auch versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, dass er mich mochte: Ich wusste einfach, dass er mich nicht im Stich lassen würde.
»Komm, wir sollten gehen. Die anderen werden schon ganz ungeduldig«, lächelte Gaston mich an und griff ein weiteres Mal nach meinem Handgelenk, um mich sanft vorwärts zu dirigieren.
Schließlich erreichten wir die Stelle, an deren gegenüberliegender Seite sich die hochgezogene Brücke befand.
Fiona vollführte sofort einen Zauber, der den Torwachen zeigen sollte, wer wir waren. Sie formte mit ihren Händen eine riesige Projektion von unseren Gesichtern, die in der Dunkelheit um uns herum geradezu gespenstisch strahlte.
Nur wenige Sekunden später, als die Projektion verpuffte, hörte man das gleichmäßige Rattern von mächtigen Ketten, an denen die Brücke scheinbar hing. Und tatsächlich: Das hölzerne Ungetüm setzte sich langsam in Bewegung, bis es mit einem großen Ruck direkt vor uns auf den Boden plumpste und Staub aufwirbelte.
Noch immer hielt Gaston mich an meinem Handgelenk fest und stützte mich damit ein wenig, denn meine Kräfte schwanden zusehends.
Neben mir fauchte Pinky, als ich einen Schritt auf die Brücke zumachte. Ich bückte mich mühsam zu ihr runter und sie sprang sofort in meinen freien Arm, so dass ich sie an meine Brust drücken konnte.
Fiona, Robert und Sergej hatten bereits die Hälfte der Brücke überquert, als wir nun losgingen. Am riesigen Burgtor blieben sie jedoch stehen und warteten auf uns, bis wir wieder zu ihnen aufschlossen.
Gerade, als wir das Ende der Brücke passiert hatten, wurde sie schon wieder hochgezogen, begleitet vom Gänsehaut erregenden Rasseln der Ketten.
Ich schaute mich mit zusammengekniffenen Augen um und entdeckte einen Mann, der auf einem kleinen Wachturm über uns stand, mit seiner Hand wedelte und damit die Brücke auf magische Weise in Bewegung versetzte.
Kurz drückten Gastons Finger ein wenig fester meine Hand, brachten mich dazu, meine Augen der Stadt zuzuwenden, die sich nun vor uns auftat.
Auf den ersten Blick schien alles nur aus Steinen zu bestehen, doch dann sah ich das viele kunstvoll verbaute Holz, was diesem Ort einen zusätzlichen Zauber schenkte.
Obwohl sich die Nacht schon längst herabgesenkt hatte und überall Laternen mit rotgolden tanzenden Flammen leuchteten, waren die schmalen Gassen voller Leben. Überall hörte man das heitere Gemurmel von Wicca, die zwischen den Häusern und den kleinen Läden umherliefen und sich unterhielten.
Für einen Moment fühlte ich mich in meine Pariser Schulzeit zurückversetzt. Es war, als würde man durch dieselben schmalen Straßen laufen, an deren Rändern kleine Stühle und Tische standen, voll besetzt mit Kundschaft, die lautstark nach einem weiteren Wein oder Kaffee verlangte.
Ein Lächeln huschte über meine Lippen und meine Anspannung löste sich langsam. Ich betrachtete die Leute um mich herum, die so anders und doch so ähnlich schienen wie die Hexen und Zauberer. Weder trugen sie schwarze Mäntel, noch ausschließlich weiße. Ihre Kleidung war bunt gemischt, obwohl ich insgesamt das Gefühl hatte, sie bevorzugten – ebenso wie wir Hexen auch – dunklere Töne. Kurz fühlte ich mich tatsächlich, als würde ich nach Hause kommen – bevor ich mir klarmachte, dass ich aus meinem Dorf verstoßen worden war und es wahrscheinlich nie wieder als meine »Heimat« bezeichnen dürfte.
Sofort war das kleine Hochgefühl dahin, meine Augen begannen wieder verdächtig zu brennen.
Weil mein rechter Arm von Gaston gestützt wurde und in meinem linken Pinky saß, die ebenfalls den Trubel um uns herum verfolgte, blinzelte ich heftig und hoffte, niemand bemerkte, dass ich kurz davor stand, loszuheulen.
»Wir haben nun gleich Mitternacht«, sagte Gaston, als wir abbogen und in eine ruhigere Gasse traten, die relativ steil nach oben verlief.
Beim Anstieg machte sich meine Wunde einmal mehr bemerkbar und begann, heftig zu pochen.
»Wir gehen direkt nach Hause, damit wir deine Verletzungen versorgen können und du noch ein wenig Ruhe bekommst, bevor du morgen alles erfährst, was du wissen musst«, erklärte mir Gaston.
Ich nickte und sah schnell auf Pinky hinunter, um das Glitzern meiner Augen zu verbergen, das er sonst zweifelsohne bemerkt hätte. »Oui, je…«, murmelte ich und räusperte mich sofort. »Das wäre nett. Danke.«
Um nicht zu stolpern, musste ich meinen Blick wieder auf den Weg richten, heftete ihn jedoch beinahe krampfhaft an Fiona, Robert und Sergej, die vor uns herliefen.
»Belle?«
»Ja?«, fragte ich und ließ mich dabei von ihm immer weiterführen, immer höher, wo der Wind nur so durch die Gasse fegte und an meinen Haaren zerrte.
»Ich mag es, wenn du Französisch sprichst«, erwiderte er leise und als ich ihn dann doch ansah, drehte er sein Gesicht kurz weg, als würde er nicht wollen, dass sich unsere Blicke trafen.
Zum Glück, denn so bemerkte er nicht das schiefe Grinsen, das sich sofort um meinen Mund legte und all meine Sorgen für einen kurzen Augenblick zur Seite drängte.
»Merci«, lächelte ich und versuchte meiner Stimme nicht anhören zu lassen, wie sehr ich mich über seine Worte freute. »Wo werde ich eigentlich untergebracht?«
»Bei mir. Fiona, Sergej und Robert wohnen ebenfalls dort. Wie in einer Wohngemeinschaft.«
»Was ist mit deinen Eltern?«, fragte ich und blinzelte überrascht.
»Sie sind nicht da. Eigentlich sind sie fast nie da, weil sie in der Menschenwelt arbeiten und dort den Wicca, die nicht im Magischen Wald leben wollen, helfen, sich zurechtzufinden. Ebenso wie die Eltern der anderen, weshalb wir alle zusammenwohnen«, erklärte er und betrachtete belustigt mein Gesicht. »Ja, es gibt einige, die nicht hier leben wollen und sich bei den Menschen wohler fühlen.«
»Interessant. Ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Also mich immer verstecken. Klar, ich gehe dort zur Schule, aber bisher war ich immer froh, wenn ich nach Hause –« Ich verzog meinen Mund. »Na ja. Du weißt schon …«
Sanft drückte Gaston mein Handgelenk, munterte mich aber schon allein mit dem Lächeln auf, das er mir zuwarf. Das kleine Grübchen auf seiner Wange zeigte sich und ließ mich dahinschmelzen. »Es wird sicher alles gut gehen.«
»Wir werden sehen«, murmelte ich und atmete tief durch, während wir, in Rücksichtnahme auf mein verletztes Bein, langsam weitergingen.
Nach einigen Minuten erreichten wir ein schmales Haus, dessen Fenster Blumenkästen voller blauer Hortensien zierten. Als hätte jemand gewusst, dass dies meine Lieblingsblumen waren …
Sergej öffnete die dunkelbraune Haustür vor uns. Anscheinend wurden auch hier die Türen nicht abgeschlossen, was diesen Ort für mich noch ein wenig sympathischer machte.
Erst als wir die Schwelle zur Haustür überschritten, löste Gaston vorsichtig seine Hand von meinem Gelenk und hinterließ damit eine Leere, die ich mir nicht erklären konnte. Schnell huschten meine Augen ins Innere.
Der Flur, in dem wir uns nun befanden, war schmal und lang. An dessen Ende führte eine ebenso schmale Treppe in das nächste Stockwerk, während zuvor mehrere Räume rechts und links abgingen.
Gaston zeigte auf die erste Tür: »Das ist das Gäste-WC.« Dann ging er weiter und öffnete die Tür gegenüber. »Hier befindet sich unser Wohnzimmer. Ansonsten gibt es hier unten noch die Küche und ein Arbeitszimmer.« Diese Räume zeigte er mir jedoch nicht – wahrscheinlich, weil er merkte, wie müde ich war.
Wir hielten direkt auf die schmale Holztreppe zu. Als wir hinaufstiegen, knarzte sie unter unseren Füßen.
In der nächsten Etage war der Flur wieder schmal und erneut erblickte ich eine Treppe auf der gegenüberliegenden Seite. Dazwischen befanden sich zwei Türen.
»Das hier sind Roberts und Sergejs Zimmer. Ganz oben befinden sich Fionas und mein Zimmer. Und deines.«
»Gute Nacht. Wir sehen uns dann morgen«, rief Fiona uns zu und begann schon einmal, die Treppe zu erklimmen.
Ich winkte ihr. »Gute Nacht.«
Wieder überraschte sie mich, indem sie mir ein kleines Lächeln zuwarf, bevor sie sich wieder umwandte.
»Gute Nacht.« Robert ging ebenfalls zu seinem Zimmer, gähnte dabei laut und verschwand im Innern.
»Ihr kommt ohne mich klar?«, fragte Sergej, die Hand bereits an der Türklinke.
»Sicher, gute Nacht«, erwiderte Gaston und auch ich nickte Sergej zu.
Dann erklomm ich zusammen mit Gaston die Treppe ins obere Stockwerk und Pinky, die die ganze Zeit über ruhig auf meinem Arm gesessen hatte, wurde langsam zappelig. Gaston führte mich bis zur vorletzten Tür, öffnete sie für mich und bedeutete mir, einzutreten.
Das Erste, was mir auffiel, war, wie schmal und gleichzeitig hoch das Zimmer erschien. Dann fiel mein Blick auf die kleine Wendeltreppe, die nach oben auf eine Empore führte, wo sich eine Tür befand.
»Was ist da oben?«, fragte ich neugierig.
»Ein weiteres Bad, das du dir aber mit mir teilen müsstest.«
Ich hob meine Augenbrauen und starrte Gaston an, der sich sichtlich bemühte, nicht zu lachen. »Das wird sicher witzig.«
»Robert und Sergej teilen sich ebenfalls ein Bad. Fiona ist die Einzige, die eins für sich allein hat«, erklärte er mir sofort.
»Schon okay«, lächelte ich müde und schaute mich weiter um.
Unter der Empore befanden sich ein kleines Sofa sowie ein Regal, das in die Wand eingebaut zu sein schien. Direkt links von mir stand ein Kleiderschrank und rechts an der Wand erspähte ich einen bauchigen Sessel, auf dem schon Viele Platz genommen zu haben schienen.
Ich ging zur Wendeltreppe und erklomm sie. Oben entdeckte ich das Bett, auf dem ich Pinky absetzte. Sie rollte sich sofort müde zusammen. Die Tür zum Bad befand sich nur einen Meter davon entfernt.
»Wie kann es sein, dass hier oben drei Zimmer sind und unten nur zwei – also die von Robert und Sergej?«, fragte ich und schaute aus dem Dachfenster, hinter dem jedoch nichts zu sehen war.
»Die Zimmer unten sind etwas breiter, die hier oben hingegen sehr schmal, haben aber dafür noch eine Empore, damit man mehr Platz hat – wegen der Dachschräge. So sind die meisten Häuser hier gebaut«, erklärte Gaston mir und räusperte sich dann leise. »Fiona kann dir morgen sicher helfen, dich ein wenig einzurichten, falls du das möchtest«, fügte er noch hinzu und etwas in seiner Stimme ließ mich ihn anschauen.
Er stand unten und blickte zu mir hoch. Zweifelnd. Hatte er etwa Angst, dass es mir hier nicht gefiel?
»Ich finde alles sehr hübsch«, lächelte ich ihn an und ging dann weiter ins Badezimmer. Es war in einem schlichten Beige gehalten, besaß eine Toilette, ein Waschbecken sowie eine Dusche. Zudem befand sich direkt mir gegenüber eine weitere Tür.
Ich hörte, wie mir Gaston folgte, und konnte spüren, dass er dicht hinter mir stehenblieb. »Auf der anderen Seite ist mein Zimmer.«
»Dachte ich mir schon«, murmelte ich verlegen und begann plötzlich zu gähnen. Schnell machte ich ihm Platz, damit er an mir vorbeigehen konnte. »Entschuldige.«
»Hier.« Er drückte mir eine Art Jutebeutel in die Hand. »Das sollte für heute Abend reichen. Fiona hat alles vorher schon besorgt. Du kannst ruhig zuerst duschen gehen. Handtücher sind im Schrank unter dem Waschbecken. Bitte gib mir Bescheid, sobald du die Wunden gesäubert hast, denn ich muss sie mir noch einmal ansehen.«
Noch einmal lächelte er mich an, bevor er die Tür zu seinem Zimmer öffnete. Leider konnte ich nichts erkennen, weil es zu dunkel darin war.
Nachdem er die Tür hinter sich geschlossen hatte, öffnete ich den Beutel und entdeckte eine Zahnbürste, Zahnpasta, einen Kamm für meine Haare sowie Shampoo und Duschgel. Ein dankbares Lächeln erschien auf meinen Lippen.
Ich warf einen kritischen Blick auf Gastons Zimmertür, die nun hoffentlich zubleiben würde, und begann, mich auszuziehen. Die schwere, eiserne Weste landete zusammen mit den anderen Sachen auf dem Boden und sofort fühlte ich mich herrlich leicht. Doch erst, als das warme Wasser der Dusche auf mich niederregnete, begannen meine Muskeln sich langsam zu entspannen.
Ich konzentrierte mich ganz auf das Rauschen des Wassers, auf die winzigen Wassertropfen, die wie weiche Perlen über meine Haut huschten. Dazu die angenehme Schwere, die sich über meine Glieder legte. Klar: Mein Bein brannte höllisch, denn egal, wie sehr ich es versuchte, gelangte trotzdem Shampoo in die Wunde.
Als ich aus der Dusche stieg, kramte ich mir ein Handtuch heraus und trocknete mich hastig ab, mein Bein etwas behutsamer, bevor ich meine Haare mit geübten Griffen kämmte und die Knoten der letzten Tage löste.
Ich wollte gerade in mein neues Zimmer gehen, als mir einfiel, dass ich keine Sachen für die Nacht hatte. Kurz zögerte ich, doch dann ging ich zu Gastons Tür und klopfte.
»Gaston?«
»Ja?«, kam es gedämpft von der anderen Seite der Tür, als würde er sich gerade ausziehen.
Einen winzigen Moment lang überlegte ich, ob ich die Tür nicht einfach aufreißen sollte, um zu überprüfen, ob meine Vermutung richtig war. Doch dann schüttelte ich, mich selbst tadelnd, meinen Kopf.
»Hast du eventuell ein Shirt für mich, das ich zum Schlafen anziehen kann? Ich bin übrigens fertig.«
»Augenblick.«
Ich starrte die Tür an und zog den Knoten des Handtuchs, mit dem ich meinen Körper umwickelt hatte, ein wenig fester zusammen, bevor ich meine zuvor getragenen Sachen vom Boden aufhob. Als ich wieder aufstand, öffnete sich die Tür auf der anderen Seite. Gaston erschien, in seiner Hand ein schwarzes Shirt. Doch viel interessanter war sein Anblick, denn er selbst trug obenherum nichts.
»Hier«, meinte er ebenso überrascht über meinen Aufzug und starrte mein Handtuch an, während er seine Hand ausstreckte.
Ich nahm ihm das Shirt ab und lächelte, musterte ihn nun gleichfalls. Er war durchtrainiert und breiter als ich gedacht hatte.
»Gefällt dir, was du siehst?«, zog ich ihn auf.
Meine Worte schienen ihn aus seinen Träumereien zu holen, denn sofort schnaufte er und verdrehte die Augen, was ganz untypisch für ihn war. »Seit wann bist du diejenige, die die Anmachsprüche reißt?«
Das Kesse aus meinem Lächeln verschwand und ich begann so laut zu lachen, dass das Geräusch an den feuchten Wänden des Badezimmers widerhallte. »Ich hätte dein Starren auch ignorieren können. Aber so ist es doch viel lustiger.«
»Ich habe nicht gestarrt«, erwiderte er sofort ernst.
»Bien sûr«, zwinkerte ich ihm zu und machte mich daran, in mein Zimmer zu gehen. Doch bevor ich die Tür hinter mir schloss, wandte ich mich noch einmal um und schaute ihn ernst an. »Du solltest nicht länger leugnen, dass du mich attraktiv findest, denn das würde unser Zusammenleben um einiges leichter machen.«
»Non, mon ange, das würde alles nur noch komplizierter machen«, erwiderte er und dieses Mal war seine Stimme sanft, auch wenn seine Worte es nicht waren. »Zieh dich an und dann kannst du mich rufen.«
Obwohl er mich verwirrte, schloss ich meine Tür hinter mir und warf die Kleidung auf den Boden, wie ich es zu Hause schon immer getan hatte. Dann wickelte ich mich aus meinem Handtuch und streifte das Shirt über. Ich hatte keine frische Unterwäsche, aber Gaston auch noch darum zu bitten, wäre wahrscheinlich zu viel des Guten gewesen. Es war ja nicht so, als würde ich mich ihm anbieten wollen. Nur …
Es war einfacher, mich mit solchen Banalitäten abzulenken, als an mein Zuhause denken zu müssen … An Vincent, von dem ich immer noch nicht wusste, wie es ihm ging … An Sandrine, die mich verraten hatte … An meine Mutter, die mich verbannt hatte … Oder an meinen Halbbruder, von dem ich nichts gewusst hatte und bei dem ich zusehen musste, wie er vor meinen Augen starb …
Heftig schüttelte ich meinen Kopf und strich mir über mein Gesicht.
Mit einer fließenden Bewegung ließ ich mich auf das Bett sinken, das erstaunlich weich war, und versank zwischen der schneeweißen Bettwäsche, die roch, als wäre sie gerade frisch gewaschen worden.
Pinky miaute protestierend im Schlaf, als ich sie vorsichtig anstupste, nur um sie ein wenig zu ärgern. Lächelnd schob ich sie ans Ende des Bettes, damit ich selbst ein wenig Platz zum Schlafen hatte.
»Ich bin fertig!«, rief ich. Ob Gaston mich hören konnte?
Offenbar. Denn kurz darauf öffnete er die Tür zu meinem Zimmer – er trug noch immer kein Shirt – und trat ein. »Wie fühlst du dich?«
»Müde«, gestand ich und beobachtete, wie er sich vor mich stellte, dann in die Hocke ging und mein Bein in Augenschein nahm. Das Schlimmste hatte mein Unterschenkel abbekommen.
»Das ist normal.« Er stellte eine kleine Tube auf den Boden, die ich zuvor nicht bemerkt hatte. Seine Finger berührten vorsichtig die unversehrte Haut meines Beines, während seine Augenbrauen sich zusammenzogen und er sich ganz auf meine Wunden konzentrierte. »Die Salbe wird helfen.«
Obwohl es verdammt wehgetan hatte, war ich in diesem Moment einfach nur froh, dass ich mich vor über einem Monat von Sandrine hatte überreden lassen, eine dauerhafte Haarentfernung vorzunehmen.
»Machst du das öfter?« Meine Stimme war peinlich heiser, als er die Tube aufdrehte, eine Portion der gelben Salbe auf seine Finger drückte und dann begann, sie auf meinen Wunden zu verteilen. Es brannte höllisch – und gleichzeitig wurde mein Gehirn von Bildern unseres heißen Kusses überflutet.
Ich schluckte und versuchte mich auf etwas anderes als seine Muskeln zu konzentrieren. Wie zum Beispiel auf seine Schultermuskeln, die ganz schön ausgeprägt waren und sich bei jeder seiner Bewegungen anspannten. O Mann …
»Belle?«
»Mhm?« Mein Mund war trocken und obwohl ich wahrlich kein Feigling war, traute ich mich nicht, ihn anzusehen, denn ich wusste nicht, wie gut ich darin war, ganz bestimmte Gefühle vor ihm zu verbergen.
»Schau mich an.«
»Besser nicht.«
»Warum nicht?« Er klang belustigt.
»Musst du noch einen Verband anlegen, oder so?«, murmelte ich leise und biss mir auf meine Unterlippe.
»Nein, die Wunden verheilen besser, wenn sie an der Luft sind, weshalb du heute Nacht auch dein Bein nicht unter die Decke stecken solltest.«
»Okay. Gute Nacht, Gaston. Und danke.« Ich entzog ihm mein Bein, denn mir fiel auf, dass er schon längst aufgehört hatte, die Salbe zu verteilen und es einfach nur festhielt. Als würde er das Ende der Berührung hinauszögern wollen.
Vorsichtig schnappte ich mir die Decke – wobei ich darauf achtete, dass mein verletztes Bein rausschaute – und legte mich hin, bevor ich das Kissen zurechtrückte und Gaston nun endlich ansah. »Außer, du möchtest dich zu mir gesellen.«
Sein Lachen kam so plötzlich, das es mich zunächst überraschte, weil es so ungewohnt klang. Es war ansteckend, ein wenig rau und dunkel.
»Gute Nacht, mon ange.«
Ich lächelte und schaute dabei zu, wie er noch immer lachend aus dem Raum ging und die Tür hinter sich schloss.
Wenig später hörte ich das Rauschen der Dusche. Die Vorstellung, wie er wohl darunter aussehen mochte, ließ mich knallrot anlaufen, weil meine Gedanken in eine Richtung abdrifteten, die absolut nicht der Situation entsprachen. Eigentlich sollte ich traurig, wütend, enttäuscht oder auch melancholisch sein.
Doch ich konnte an nichts anderes als an Gastons Körper unter der Dusche denken, während ich langsam zur Musik des Wassers einschlief.
2. Kapitel
Auszug aus dem Regelwerk der Wicca:
Jeder Wicca, der innerhalb dieses Reiches leben möchte, hat sich den Regeln zu beugen, die zu unser aller Wohl niedergeschrieben wurden.
Am nächsten Morgen wurde ich durch leises Miauen und eine winzige Zunge, die über mein Gesicht schleckte, geweckt.
Ich öffnete ein Auge und blickte direkt in die tiefschwarzen Pupillen von Pinky, die mich vorwurfsvoll anschaute.
»Bonjour, ma minette«, murmelte ich und betrachtete die kleine Miezekatze, wie ich sie gerade betitelt hatte. Sie rieb ihr Gesicht an meinem, in der Hoffnung, dass ich ihrem Hunger ein Ende bereitete.
Natürlich hatte sie Hunger. Den hatte sie immer.
Ihre Antwort war ein lautes Miau.
»D’accord«, gähnte ich und strich mir erfolglos den Schlaf aus meinem Gesicht, während ich mich langsam aufsetzte. Mein Blick glitt nach oben zu dem kleinen Dachfenster, über dem dunkle Herbstwolken hingen. Einen Moment lang versank ich in diesem Anblick, bevor ich schwerfällig aus dem Bett krabbelte und mich streckte. Dabei untersuchte ich kurz mein Bein, auf dem aber nur noch ein paar leuchtend rote Narben zu sehen waren. Ein kleines Lächeln stahl sich auf meine Lippen, auch weil ich schon wieder an Gaston denken musste.
Schnell schüttelte ich den Kopf. Ich verhielt mich echt bescheuert! Sollte ich nicht eigentlich sauer auf ihn sein? Doch er hatte mich immerhin davor bewahrt, in den Fluss zu fallen, also würde mein endgültiges Urteil über ihn wohl nicht ganz so schrecklich ausfallen.
Ich wollte gerade ins Badezimmer marschieren, als mir meine neue Wohnsituation wieder einfiel und ich zunächst einmal gewissenhaft klopfte. Ich ließ einen Moment verstreichen, bevor ich – da ich nichts hörte – die Tür öffnete und hineinging, um mich für den Tag frischzumachen.
Eine Viertelstunde später stand ich vor meinem Bett, noch immer in dem schwarzen Shirt, an dem Gastons Geruch haftete, und starrte missmutig auf den Klamottenhaufen zu meinen Füßen. Ich hatte wirklich, wirklich absolut keine Lust, diese schmutzige Kleidung heute noch einmal zu tragen.
Auf einmal klopfte es unten an der Tür. Überrascht wandte ich mich um, doch da trat schon jemand ins Zimmer.
Es war Fiona. Sie schaute mich mit erhobenen Augenbrauen an und musterte meinen knappen Aufzug abschätzig.
»Guten Morgen«, rief ich ihr zu.
»Dir auch einen guten Morgen«, erwiderte sie seltsam gut gelaunt und schloss die Tür wieder hinter sich. »Du brauchst Kleidung und Gaston meinte, ich soll dir zudem beim Einrichten helfen.«
»Ja, das wäre nett«, nickte ich und stieg die schmale Wendeltreppe hinunter, während Pinky sich auf meinem Bett räkelte, als hätte sie mich vorhin nicht so vehement wecken wollen.
Mit einem Stirnrunzeln betrachtete ich Fionas vergnügten Gesichtsausdruck, der sie geradezu sympathisch wirken ließ. Ich hatte keine Ahnung, was ich davon halten sollte. War das hier ein ernst gemeintes Friedensangebot? Ein Waffenstillstand? Oder nur eine Ablenkungstaktik?
»Ich würde sagen, du solltest von nun an nicht mehr ausschließlich Schwarz tragen, weil das einfach zu auffällig wäre. Obwohl du sowieso auffallen wirst, weil du neu bist.«
»Juhu, ich bin die Neue«, seufzte ich und hob meine Augenbrauen. »Also, wie machen wir das mit den Klamotten?«
»Einen Moment noch«, murmelte sie und plötzlich war draußen ein lautes Poltern zu hören. Die Tür schlug auf und Gaston, Robert und Sergej trugen drei riesige Säcke herein. Sie warfen sie mit einem lauten Stöhnen auf den Boden.
»Was ist das drin? Steine?«, keuchte Sergej, den ich noch nie so aus der Puste gesehen hatte, und stützte sich auf seinen Knien ab.
»Mach auch etwas Rotes«, raunte Gaston Fiona zu, ebenso außer Atem, und ging schon wieder aus dem Zimmer – aber nicht ohne noch einen kurzen Blick auf meine nackten Beine zu werfen.
Seine Freunde folgten ihm.
Als die Tür hinter den Jungs wieder zugefallen war, öffnete ich neugierig den ersten Sack, dessen grober Leinen auf meiner Haut kratzte, als ich das Seil aufzog, das die Öffnung zusammenhielt. Sofort schlug mir der Geruch von alter, schmutziger Wäsche entgegen.
Schockiert stolperte ich zurück und hielt mir die Nase zu, während ich Fiona entgeistert anstarrte. »Ernsthaft?! Hasst ihr mich so sehr?«
»Ich kann keine Kleidung aus Luft erschaffen. Aber ich kann Kleidung verändern«, erklärte sie selbstgefällig, während sie die Türen meines Schrankes öffnete und tief einatmete. Dann hob sie ihre Hände und ließ grüne Funken aus ihren Handflächen sprühen, die die Leinensäcke umkreisten und mit einer erschreckenden Leichtigkeit die Kleidung hervorholten. Innerhalb eines sprühenden Funkenregens verwandelten sich die ehemals abgetragenen Stücke in neue, bevor sie wie von Geisterhand durchs Zimmer flogen und sorgfältig im Schrank aufgehängt wurden, allein durch Fionas gemurmelten Zauber. Einen Zauber, den ich nicht begreifen konnte. Auch war ich einfach nur fasziniert von dem Anblick.
Wie war das nur möglich? Sie konnte nur wenig älter sein als ich, allerhöchstens zwanzig vielleicht, und doch war sie eine mächtige Wicca. Ich hätte sicher noch Jahre für solch eine Kraft gebraucht – wenn ich meine Magie noch gehabt hätte … Doch bei ihr sah alles so unerhört leicht aus.
Eine unsinnige Eifersucht wallte in mir auf, während ich zusah, wie die Leinensäcke in sich zusammenfielen und Fiona mit der Kraft ihrer Magie und einem zufriedenen Nicken die Schranktüren schloss.
Sie drehte sich zu mir herum, völlig ernst, frei von Überheblichkeit, die ich ihr an dieser Stelle durchaus zugetraut hätte. »Und nun das Zimmer. Was ist deine Lieblingsfarbe?«
»Keine Ahnung«, erwiderte ich und dachte nach. »Grau?«
»Grau ist keine Farbe.«
»Doch, sie ist –«
»Du weißt, was ich meine«, winkte sie ab und legte ihren Kopf schief, während sie das Zimmer betrachtete. »Ich denke, dass ein bisschen was Helles nicht schaden könnte.« Sie wedelte mit ihrer Hand, woraufhin erneut grüne Funken aufstoben und das Zimmer innerhalb eines Wimpernschlags cremefarbene Wände hatte. Das Holz der Empore, die Tür sowie die Wendeltreppe blieben weiterhin dunkelbraun.
»Dazu ein bisschen Farbe«, murmelte sie noch und auf einmal wurde das Sofa unter der Empore pink, ebenso wie die Bettwäsche auf meinem Bett. Sie wedelte erneut mit ihrer Hand und erzeugte über meinem Bett einen Vorhang, an dem kleine Lichter blinkten. »Und?«
»Pink?!«, fragte ich und hob meine Augenbraue, so wie sie zuvor.
»Pink«, nickte sie und machte sich daran, aus meinem Zimmer zu gehen. »Das ganze Schwarz macht sicher depressiv.«
»Danke.«
Sie reagierte nicht darauf, sondern verschwand, doch ich wusste genau, dass sie mich gehört hatte.
Einen Moment lang blickte ich ihr nach und hatte ein ganz seltsames Gefühl dabei. Fast so … als würde ich sie mögen?
Ich schüttelte meinen Kopf und öffnete den Schrank, der nun voller Kleidung und Schuhe war. Einfach unglaublich, wie leicht ihr der Zauber von der Hand gegangen war, ein Zauber, den so manche erfahrene Hexe aus meinem ehemaligen Dorf nicht zu vollbringen vermochte …
Zwischen meine Faszination mischte sich aber auch ein gemeines Ziehen, angesichts der Erkenntnis, dass ich höchstwahrscheinlich niemals so würde zaubern können. Musste ich mich nun an den Gedanken gewöhnen? War das mein Schicksal? Eine Hexe ohne Zauberkräfte? – Nein, eine Wicca … Ebenso wie meine Eltern Wicca waren. Angeblich …
Doch hätte mein Vater, der mir meine Magie genommen hatte, dann nicht etwas gesagt? Oder wenigstens meine Mutter: die Frau, die mich die letzten siebzehn Jahre aufgezogen hatte?
Heftig schüttelte ich meinen Kopf und strich mir mit einem lauten, qualvollen Seufzen über mein Gesicht, um diese Gedanken abzuschütteln. Das hier würde mein neues Leben sein. Irgendwie.
Ich zog ein dunkelrotes Kleid aus dem Schrank, das mir als Erstes ins Auge sprang. Es war kurz, sehr kurz. Aber mit einer schwarzen Strumpfhose würde es richtig gut aussehen.
Zehn Minuten später ging ich in dem dunkelroten Kleid, blickdichter Strumpfhose, einem schwarzen Cardigan und schwarzen Absatzstiefeln nach unten. Der Flur selbst hatte keine Fenster, weshalb die Helligkeit in der lichtdurchfluteten Küche beinahe erschreckend war.
Ich blieb für einen Moment im Türrahmen stehen und betrachtete Gaston, Robert, Fiona und Sergej, die schweigend an einem rustikalen Eichenholztisch saßen und jeweils eine Zeitung in der Hand hielten. Auch die restliche Küche bestand aus Eichenholz, dazwischen glänzten moderne Elektrogeräte. Kurz fragte ich mich, wofür sie diese überhaupt brauchten, wenn sie doch so gut zaubern konnten.
Pinky huschte an mir vorbei und bediente sich wie selbstverständlich an der Schale voller Milch, die in einer Ecke aufgestellt worden war.
Als hätte Gaston mein Starren bemerkt, hob sich sein Kopf und unsere Blicke begegneten sich. Einen Moment lang hielt ich die Luft an, als ich die Narbe an seiner Wange sah, die ich ihm zugefügt hatte und vielleicht nicht mehr rückgängig machen konnte.
Doch womöglich war meine Sorge umsonst, schließlich waren diese Wicca hier mächtig, wohlmöglich sogar mächtig genug, um meinen Bann zu lösen.
»Guten Morgen«, lächelte ich ihn an und Erleichterung durchflutete mich dabei, brachte mich zum Strahlen.
Sofort runzelte Gaston verwirrt seine Stirn, bevor er seine Augen leicht zusammenkniff, als würde er eine List in meinem Verhalten vermuten. »Morgen.«
»Guten Morgen«, murmelten Fiona, Robert und Sergej gleichzeitig, weiterhin vertieft in ihre Zeitung.
»Ich habe dir Müsli besorgt.« Gaston stand auf, um eine Müslipackung, Milch und eine Schale aus den Schränken zu holen.
Ich stellte mich neben ihn und plötzlich traten mir Tränen in die Augen, weil das hier das verdammt Süßeste war, was jemals ein Kerl für mich gemacht hatte. Gaston hatte tatsächlich meine Lieblingsmüslisorte gekauft …
»Alles in Ordnung?« Er hielt inne und beugte seinen Kopf leicht zu mir herunter, während seine Finger unter mein Kinn griffen und mein Gesicht anhoben.
»Klar«, erwiderte ich leise und schluckte. »Danke. Das ist echt –«
»Keine Ursache. Ist nichts Besonderes.«
Ich schnaufte, als ich seine abwehrende Haltung bemerkte, die mir möglicherweise signalisieren sollte, dass ich keine große Sache daraus machen sollte, obwohl wir beide wussten, dass sein Verhalten nicht selbstverständlich war.
»Klar. Trotzdem danke.«
Denn für mich war es eine große Sache. Er hätte mir auch sonst was vorsetzen können, ebenso wie ich ihm damals, als er in unser Haus kam.
Mist, ich wurde sentimental!
Gaston räusperte sich und begab sich wieder an den Tisch, während ich mir mein Müsli fertigmachte, mich auf den freien Platz neben ihn setzte und zu essen begann. Dabei genoss ich diese Frühstücksstille, in der die meisten Leute noch keine Lust hatten, zu sprechen.
Ich beobachtete die anderen und stellte fest, dass Fiona Toast aß, Robert trockene Reiswaffeln, Sergej Cornflakes und Gaston Frühstückswaffeln, die nur so in Sirup schwammen.
Mein Mund klappte auf und ich blinzelte mehrmals.
»Jap, das sind die Fertig-Dinger aus der Tüte. Gaston kauft sich die immer in Amerika, weil dort der Zuckergehalt am höchsten ist«, erklärte mir Robert, der grinsend weiteraß, jedoch seine Zeitung hinlegte und mir zuzwinkerte.
»Redet über euer eigenes Essen.«
»Ich hab doch überhaupt nichts gesagt«, kicherte ich und presste schnell meine Lippen aufeinander, als Gaston mich anfunkelte. »Ich hätte nur nicht gedacht, dass du so ein … Süßer bist.«
»Er steht voll auf den ganzen Süßkram, je ekliger, umso besser«, meinte nun Fiona und grinste Gaston mit vollen Wangen und geschlossenen Lippen an.
»Könnten wir bitte aufhören, über mein Essverhalten zu sprechen?« Gaston stieß seinen halbvollen Teller von sich weg und machte sich daran, aufzustehen. »Außerdem müssen wir beide eh los.«
»Ich habe noch nicht aufgegessen«, protestierte ich sofort und schob mir hastig einen weiteren Löffel Müsli in den Mund, doch er schaute mich nur böse an.
»Schon gut«, lenkte ich ein.
Ich stand auf und grinste Sergej, Robert und Fiona an, die ebenfalls lächelten, und räumte mein Frühstück weg, bevor ich Gaston folgte, der bereits in den Flur hinausgelaufen war.
»Jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt. Also ich finde, dass das eine absolut entzückende neue Seite an dir ist.«
»An mir ist überhaupt nichts entzückend«, murmelte er und drückte mir einen Wollmantel in die Hand, den er vom Kleiderständer im Flur nahm und den ich noch nicht kannte.
Wortlos zog ich den dunkelroten Mantel an und runzelte nur vielsagend meine Stirn.
Gaston schüttelte seinen Kopf, als hätte er nichts mehr zu sagen und zog seine eigene Jacke an. Dabei fiel mir auf, dass er heute eine Jeans sowie einen grauen Pullover trug, was beides seine sportliche Figur betonte. Als er vor mir das Haus verließ, konnte ich nicht anders, als ihm auf den Hintern zu schauen, der verdammt gut aussah in dieser Hose.
»Ich weiß, dass du mir auf den Hintern starrst«, knurrte er und ging schon die schmale Gasse hinauf, während ich die Tür hinter mir schloss.
»Und ich weiß, dass du darauf stehst, wenn ich dir auf den Hintern starre«, rief ich ihm zu.
Sein Blick war betont finster, als er sich zu mir umdrehte, und doch konnte ich in seinen Augen ein Strahlen erkennen, das ich das letzte Mal bemerkt hatte, nachdem er mich im Wald geküsst hatte. »Seit wann baggerst du mich so schamlos an?«
»Vielleicht möchte ich auch einfach von meiner Angst in dieser neuen, ungewohnten Situation ablenken.« Ich holte zu ihm auf, so dass wir nebeneinander hergingen. Dabei stellte ich fest, dass mein Bein fast gar nicht mehr wehtat. »Wie viel Uhr haben wir eigentlich?«
»Sieben.«
Ich nickte, während ich die hübschen Fassaden der Steinhäuser betrachtete, die aus der Ferne mit der Burg verschmolzen, als wären sie alle aus einem Stein gehauen worden. »Was machen wir jetzt?«
»Jetzt lernst du Abby kennen.«
»Wer ist Abby?«
»Warum bist du nur so gesprächig?«
»Weil ich vielleicht nervös bin?«
Er blieb stehen und schaute mich an, prüfte, ob ich log, und auf einmal strich er mit seinem Daumen über meine Wange, fast so, als würde er es selbst kaum merken. »Du brauchst keine Angst haben, mon ange.«
»Sag mal, flirtest du jetzt mit mir?«
Sofort ließ er seine Hand fallen und machte einen Schritt zurück. »Nein. Ich bin nur nett zu dir.«
Mein Seufzen sprach für sich, als ich mich wieder in Bewegung setzte und er wortlos neben mir herging.
Ich hatte keine Ahnung, warum mir das so wichtig war, aber vielleicht lag es auch einfach daran, dass ich diesen unglaublichen Kuss nicht vergessen konnte. Genauso wie die Tatsache, dass Gaston mich freiwillig so geküsst hatte, es gewollt hatte. Und jetzt wollte ich … mehr?
Ich wusste nicht, was ich wollte, wusste nur, dass ich es mochte, mit ihm zu diskutieren. Und wenn er mich ansah, als würde er mich jeden Moment gegen eine Wand drücken und –
»Belle?«
»Quoi?«, fragte ich erschrocken und blinzelte schnell, um das eindeutig nicht jugendfreie Bild aus meinem Kopf zu bekommen.
»Geht es dir gut? Du bist ganz rot.« Gaston lief weiter, doch er betrachtete mich eingehend von der Seite, während er mich gleichzeitig in die nächste Gasse dirigierte.
»Und du bist ein Idiot!«, erwiderte ich und strich mir über mein Gesicht, das nun sicher so rot wie eine Tomate war.
»Was habe ich denn jetzt wieder gemacht?« Verwirrung sprach so deutlich aus seiner Stimme, dass ich gelacht hätte, wäre ich nicht gerade damit beschäftigt gewesen, mein Kopfkino abzustellen.
»Nichts. Lass es uns vergessen«, murmelte ich und atmete tief durch. Gastons Blick brannte immer noch auf mir. »Hör auf mich anzustarren, das macht es nicht besser.«
»Was denn?«
»Nichts!«, fauchte ich und folgte ihm durch einen Torbogen, der uns in eine Art Vorplatz der eigentlichen Burg geleitete, die hoch über uns aufragte.
»Ihr Frauen, ihr seid so –«
»Sag bloß nichts Falsches«, erklang es auf einmal hinter uns.
Gleichzeitig fuhren wir herum und fanden uns einer zirka vierzehnjährigen Schönheit gegenüber, die uns mit großen, vergnügt blitzenden Augen musterte. Ihr langes, schwarzes Haar glänzte im Morgenlicht und ihre Lippen waren mit einem schwarzen Lippenstift geschminkt, während sie selbst ebenfalls nur Schwarz trug. – Aha, warum durfte ich hier noch mal kein Schwarz tragen?!
»Hey, ich bin Abby. Du bist sicher Isabelle Monvoisin. Ich freue mich wahnsinnig, dich kennenzulernen«, plapperte sie sofort drauflos und schnappte sich meine Hand, um sie zu schütteln.
Einen Moment lang starrte ich ihre langen, ebenfalls schwarz lackierten Fingernägel an, bevor ich mich an meine Erziehung erinnerte. »Hallo, die Freude ist ganz meinerseits. Nenn mich ruhig Belle.«
»Belle«, wiederholte sie und nickte, als könnte sie sich dadurch meinen Namen besser merken. »Ihr wolltet sicher zu mir.«
Ich warf Gaston einen fragenden Blick zu, der Abby ein Lächeln schenkte, das so herzlich war, dass ich mich kurz darüber wunderte, wie nett er aussehen konnte – wenn er wollte. »Richtig. Wir sind gestern angekommen und ich denke, dass es am einfachsten ist, wenn du sie in alles einweihst, bevor wir zum Abte gehen.«
Meinen verwirrten Gesichtsausdruck ignorierte Gaston einfach, während er das Mädchen vor uns geradezu anstrahlte. Verdammt, ich war sofort eifersüchtig. Auch wenn ich sehr wohl erkannte, dass es eher ein geschwisterliches Lächeln war, konnte ich das Gefühl von Neid einfach nicht abstellen. Darauf, dass Gaston diese Abby so anlächelte, darauf, dass ihre Wimpern so lang waren und beinahe ihre Augenbrauen berührten, und darauf, dass sie so unglaublich hübsch war. Ihre riesigen, grünen Augen schienen mich zu hypnotisieren.
»Ja, das wird am besten sein. Macht es dir was aus, wenn ich Belle gleich entführe? Wahrscheinlich ist es am einfachsten, wenn ich mit ihr ein wenig spazieren gehe«, strahlte Abby Gaston an.
Gastons warme Reaktion sprach Bände und drückte aus, wie sehr er das Mädchen mochte. »Das kannst du gerne tun. Wir sehen uns dann beim Mittagessen wieder und dann können wir gemeinsam zum Abte gehen.«
Mich hatte er noch nie so freundlich angesehen. War ich jetzt ernsthaft eifersüchtig auf dieses halbe Kind?
»Super. Dann bis später.«
Gaston nickte und schaute mich nicht einmal mehr an, als er sich umdrehte und einfach wieder ging. Penner!
»Er steht auf dich«, flüsterte Abby auf einmal, als wir uns wieder in Bewegung setzten und gemeinsam am Fuße der Burg entlanggingen. Sie steuerte zielstrebig auf eine Seitentür zu und hielt sie mir auf.
»Möglich«, war meine vage Antwort, weil ich sie erstens nicht kannte und zweitens noch ein wenig verstimmt über Gastons Abgang war.
»Auf jeden Fall! Jedes Mal, wenn er dich angesehen hat, war es, als würde sein Puls gleich explodieren wollen. Total niedlich, dass sein Herz schneller schlägt, wenn er dich sieht.«
»Das ist doch … Woher willst du das wissen?«, platzte ich heraus und schüttelte meinen Kopf. »Das ist unmöglich.«
»Es ist möglich«, kicherte Abby und zeigte trotz ihres schwarzen Lippenstifts wie jung sie doch eigentlich war. »Ich kann nämlich eure Aura sehen. Und eure pulsieren im Takt eures Herzschlags.«
»Interessant«, murmelte ich – Nein, das war echt gruselig! – und folgte ihr immer tiefer in die Burg hinein, deren hohe Steinwände uns nun umgaben wie ein Sarg.
»Ich weiß auch, dass es unheimlich klingt. Nicht mehr viele haben diese Fähigkeit und ich wurde … nun ja, wahrscheinlich gesegnet oder sowas. Ich kann aber keine Gedanken lesen. Keine Angst!«
»Zum Glück, ansonsten wäre das jetzt echt peinlich geworden«, erwiderte ich und stockte, als Abby eine schmale Holztür aufdrückte und wir auf einen Balkon hinaustraten.
Vor uns erstreckte sich der Magische Wald, hinter dem gerade die Sonne aufging und alles in einem warmen Rot erstrahlen ließ. Herbstwind strich mir durch meine Haare und wirbelte sie herum, so dass ich sie ständig hinter mein Ohr streichen musste.
»Wunderschön, oder?«
»Es ist einfach unglaublich«, flüsterte ich, als könnte ein laut ausgesprochenes Wort diesen wahrhaft magischen Moment zerstören.
»Das hier ist einer meiner Lieblingsorte. Wenn du willst, kann ich ihn dir gerne ausleihen. Falls du mal Zeit für dich selbst brauchst. Selbst Gaston kennt das hier nicht.«
»Wie kommt das?«, fragte ich und lehnte mich gegen die dicke Mauer, die uns vor einem tiefen Abgrund trennte.
»Na ja, ich lebe hier und kenne jede Ecke dieser Burg. Er ist fast immer unterwegs.«
»Ach, wirklich?«
»Ja, ständig. Er, Fiona, Robert und Sergej gehören zu den besten Kämpfern ihres Jahrgangs. Sie werden später einmal hier im Magischen Wald für die Garde der Wicca arbeiten und uns vor möglichen Gefahren beschützen«, erklärte sie voller Stolz und lächelte verträumt auf den Wald hinunter. »Und dieser Ort hat es unbedingt verdient, beschützt zu werden. Ist er nicht perfekt?«
Mein Nicken kam nur zögernd, denn für einen kurzen Moment vergaß ich die Schönheit um uns herum und betrachtete Abby fragend. »Was ist die Garde der Wicca?«
»Das ist so etwas wie die Polizei in der Menschenwelt.«
Ich sog die vielen Informationen auf, die sie mir so freiwillig gab, und war gleichzeitig dankbar dafür, dass sie mich für meine Unwissenheit nicht schräg ansah. »Und was machen alle anderen, die hier leben?«
»Manche wechseln zwischen der Menschenwelt und dieser Welt hin und her, andere waren schon immer hier und arbeiten auch hier, wieder andere bleiben in der Menschenwelt und kommen nur hierher, um Urlaub zu machen. Gastons Eltern zum Beispiel.«
»Wie bei den Hexen«, murmelte ich und mein Blick wanderte in die Richtung, wo ich unser Dorf vermutete. Ungefähr.
Von der Anhöhe aus, auf der dieses Reich lag, konnte man die Berge sehen, hinter denen sich meine Heimat befand.
Ich fragte mich, wie es wohl Vincent ging. Und Sandrine … Auch wenn ich enttäuscht, wütend und fürchterlich traurig wegen allem war, was sie mir angetan hatte, konnte ich nicht aufhören, an sie zu denken. Immerhin waren wir einst beste Freundinnen gewesen. Ob sie wohl vor das Tribunal gestellt worden war?
Bei dem Gedanken daran schluckte ich. Wenn wir Hexen ein Verbrechen an unserer Rasse vermuteten, konnten wir sehr streng sein. Das wusste ich aus früheren Berichten über Hexen, die vor das Tribunal gestellt wurden. Nicht selten wurden die betreffenden Hexen verbannt oder gar gehängt.
Doch daran wolle ich nicht denken, nein! Gleichwohl meine Mutter mich meiner Heimat verwiesen hatte, würde sie bestimmt nicht zulassen, dass meinen Freunden ein so schlimmes Leid widerfuhr. Oder doch?
Wusste ich denn wirklich so viel über meine Mutter? Immerhin hatte sie ihr eigenes Kind verbannt und einem Fremden überlassen.
Nein, ich durfte nicht darüber nachdenken, ansonsten würde ich es niemals schaffen, nach vorne zu blicken.
»Weißt du, du bist aus einem ganz bestimmten Grund hier«, begann Abby und biss sich auf ihre schwarz gemalte Unterlippe, wie ich im Augenwinkel beobachten konnte. Sie wirkte nervös, weshalb ich sie nicht unterbrach. »Ich habe dich gesehen. In einem … Traum. Und meine Träume sind ein wenig anders als normale Träume. Ich sehe in ihnen einen Teil der Zukunft. Nie alles. Aber immer einen Teil, der sich bewahrheitet.«
»Moment«, unterbrach ich sie, als sie gerade Luft holte, um weiterzusprechen, während ich mich nun ganz auf sie konzentrierte und meine Gedanken von meiner Heimat löste. »Gaston wollte mich so unbedingt hierherbringen, weil du in die Zukunft sehen kannst?«
»Ja«, nickte sie, ohne Stolz oder sonstige Überheblichkeit, sondern völlig neutral, als wäre es das Normalste auf der Welt. »Aber ich sehe sie nie genau. Immer nur verschwommen.«
»Und du hast mich gesehen, ja?« Mir schwante Böses.
»Richtig. Ich habe dich als unsere zukünftige Herrscherin gesehen und Gaston als deinen persönlichen Beschützer. Deshalb fand ich es auch so wichtig, dass er nach dir sucht und dich persönlich hierherbegleitet. Er ist Teil deiner Zukunft.«
Ich blinzelte sie so sehr an, dass mir ein wenig schwindelig wurde und ich mich an der Mauer festhalten musste. »Was?!«
»Ja, ich weiß. Es klingt so –«
»Bescheuert? Völlig hirnrissig? Absolut unmöglich?« Ein leicht hysterisches Lachen entfuhr mir, während ich meine Finger wieder von der Mauer löste. »Non. C’est impossible!«
»Ich weiß, dass es sich unmöglich anhört. Aber das ist es, was ich gesehen habe. Entschuldige bitte. Vielleicht hätte ich dir das schonender beibringen sollen.«
»Nein, alles wird gut«, stoppte ich uns beide und hob meine Hand, um nachzudenken. »Deine Visionen sind also unsicher?«
»Manchmal.«
»Also könnte es sein, dass du etwas falsch interpretiert haben könntest?«
»Möglich, aber –«
»Bien, dann haben wir ja alles geklärt«, atmete ich auf und lächelte sie an – war gleichzeitig jedoch völlig aufgelöst und hatte nicht einmal eine Ahnung, weshalb.
»Es ist möglich. Aber es kommt so gut wie nie vor«, vervollständigte sie ihren vorherigen Satz und betrachtete mich traurig. »Es tut mir leid. Aber so wie es aussieht, wirst du irgendwann Herrscherin über dieses Reich.«
»Und deshalb wollten die anderen so unbedingt, dass ich sie begleite?«, fragte ich sicherheitshalber nach, obwohl ich mir am liebsten die Ohren zugehalten und weiter alles von mir gewiesen hätte. Doch Abby wirkte nicht so, als würde sie nachgeben. Sie schien sich ihrer Sache sicher zu sein. Das bedeutete aber noch lange nicht, dass ich es auch war …
»Ich habe von dir geträumt, schon als ich ein Kind war und bevor ich in den Magischen Wald kam. Von einer Hexe, durch deren Adern das Blut einer Wicca fließt. Als ich vor ein paar Jahren hierhergekommen bin, habe ich dies dem Abte erzählt und dann setzte er alles in Bewegung.«
»Wie meinst du das?«
»Er hat aus den besten Anwärtern eine Truppe zusammengestellt, die deine Freunde werden sollten und irgendwann deine engsten Beschützer und Vertrauten. Vor allem ging es dabei aber um Gaston, der laut meiner Vision dein persönlicher Leibwächter werden wird. Aber sie fanden dich erst nach Jahren. Deine Mutter hat dich gut beschützt.«
»Meine Mutter?«
»O ja, du warst mit allen möglichen Schutzzaubern belegt. Gaston musste dich küssen, um den stärksten der Zauber brechen zu können, nachdem all seine vorherigen Versuche gescheitert waren. Er musste dir etwas verabreichen.«
»Wie bitte?!«
»Ja, bei dir zu Hause, relativ zu Beginn, nachdem du ihn mit in das Hexendorf gebracht hast. Er hat mich danach angerufen. Er hatte in seinem Mund ein Pulver, das du einnehmen musstest. Weil du aber kein Pfefferminz mochtest – das Pulver schmeckt nämlich nach Pfefferminz –, konnten wir es dir nicht übers Essen verabreichen«, erklärte sie und lächelte mich unschuldig an – dabei müsste sie doch den Schmerz sehen können, der mich gerade überrollte und mir die Luft zum Atem nahm.
Ich erinnerte mich noch ganz genau an den Kuss, erinnerte mich an den Geschmack von Minze und daran, das Gaston behauptet hatte, er hätte es nur getan, um herauszufinden, ob seine Narben davon verschwinden würden – wie beim Kuss der wahren Liebe … Und ich hatte mich zuvor schon immer gewundert, dass er mir ständig Pfefferminzbonbons anbieten wollte …
»Warum?«
»Du warst mit einem Zauber belegt, der dir die Klarheit genommen hat. Hast du denn keine Veränderung an dir bemerkt? Du hattest nie Fragen gestellt und alles einfach so hingenommen. Gaston hat dir deine Klarheit wiedergegeben.«
»Wie konntet ihr das wissen?«
»Ich habe es vermutet. Es war früher gang und gäbe, dass man seine Kindern unter solch einen Zauber gestellt hat, damit sie nicht versehentlich die Familie verrieten.«
»Ich habe das dringende Bedürfnis, zu kotzen«, murmelte ich und strich mir über mein Gesicht. »Meine Mutter hat mich also unter einen Zauber gestellt und Gaston hat ihn aufgehoben, in dem er mich geküsst hat? – Wow, ich bin … Keine Ahnung was ich gerade bin, aber ich bin viel davon.«
Wut, Trauer, Unverständnis und Furcht durchfluteten mich gleichzeitig. Was war, wenn Gaston mich deshalb immer nur geküsst hatte? Und: Wieso hatte meine Mutter das alles getan? Und warum glaubte ich Abby das alles überhaupt? Sie könnte mir ja sonst was erzählen …
»Es tut mir leid, dass du es so erfahren musstest, aber Gaston durfte dir vorher nichts sagen. Wir mussten dich hierherbringen, damit du auf alles vorbereitet werden kannst. Damit du lernst, eine richtige Wicca zu sein – na ja, oder eben auch die Herrscherin über die Wicca. Wenn du es vorher gewusst hättest, dann hättest du dich wohlmöglich geweigert.«
»Hätte ich«, gab ich ehrlich zu und seufzte, bevor ich Abby anschaute, die für ihr Alter ganz schön reif wirkte. Doch wieso sollte ich ihr das alles glauben?
Ich schüttelte meinen Kopf und betrachtete Abby eingehend. »Du bist also eine Seherin und kannst unsere Aura erspüren. Gibt es sonst noch etwas über dich zu wissen?«
»Ich bin ein Waisenkind und wurde vom Abte in der Menschenwelt gefunden, bevor er mich hierhergebracht hat. Daher wohne ich auch hier in der Burg und nicht in den Häusern. Ansonsten bin ich recht uninteressant.«
»Ja genau, fast schon langweilig«, lachte ich auf.
Sie lachte ebenfalls und ihr Lachen war beinahe hypnotisch, so unwirklich und melodisch, wie es oft in Büchern beschrieben wurde. »Ich mag deinen Humor. Du gehörst zu den wenigen, die mich normal behandeln. Dafür danke ich dir.«
»Wieso sollte ich dich anders behandeln?«
»Na ja«, meinte sie schulterzuckend und schaute auf den Wald. »Ich bin schon ein wenig anders.«
»Könnte auch an deinem Lippenstift und deinem gruftigem Aussehen liegen.«
»Quatsch!«, kicherte sie sofort. »Das ist die neueste Mode unter den Schülerinnen. Ich sehe damit voll gut aus.«
»Schülerinnen?«
»Klar, wir haben hier eine Schule, auf die die Kinder und Jugendlichen nach ihrem regulären Unterricht in der Menschenwelt gehen. Auch wenn sie schon als Kinder zaubern können, bedeutet es noch lange nicht, dass sie ihre Kräfte gut beherrschen. Du wirst sicher ebenfalls daran teilnehmen. Wahrscheinlich könnten wir sogar vormittags in den Unterricht gehen, denn es gibt einige der etwas älteren Schüler, die bereits den Unterricht in der Menschenwelt abgeschlossen haben, hier jedoch noch ganztägig die Schulbank drücken müssen.«
»Und du gehst hier wann zur Schule?«
»Immer. Ich nehme keinen Unterricht in der Menschenwelt, weil die Einflüsse dort noch ein wenig stärker sind als in unserem Reich. Die Menschen sind so – unbeherrscht. Das macht die Sache mit der Aura ein wenig unangenehm für mich.«
»Inwiefern?«, hakte ich nach, weil sie so leicht darüber redete und ich nicht das Gefühl hatte, dieses Thema wäre ihr unangenehm.
»Teenager sind sehr nervig. Ständig verknallt, ständig wütend, ständig Probleme.« Sie schüttelte ihren Kopf und grinste. »Hier ist es nicht anders, aber Wicca, selbst die jungen, haben eine ganz eigene Aura, die mehr von ihren Kräften, als von ihren Emotionen geleitet wird. Sie überlagert diese ganzen Gefühle ein bisschen. Es ist einfacher. Na ja, du wirst auf jeden Fall sehr viel Spaß hier haben.«
»Aber ich … ich kann nicht mehr zaubern«, verzog ich meinen Mund und beobachtete gespannt ihre Reaktion.
Aber sie lächelte, als hätte sie es schon gewusst, und wirkte für einen kurzen Moment wie eine Erwachsene auf mich. »Das bekommen wir schon irgendwie hin.«
»Vielleicht«, murmelte ich und schaute wieder auf den Wald. »Ich habe das Gefühl, dass ich rein gar nichts über unsere Welt weiß, über den Magischen Wald.«
»Und damit liegst du wahrscheinlich sogar richtig. Aber keine Sorge: Du wirst alles erfahren und glaube mir, es ist wahrscheinlich interessanter, wenn man sich wirklich interessiert, als wenn man als Kind zur Schule gezwungen wird.«