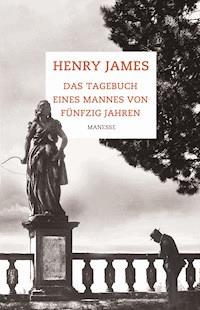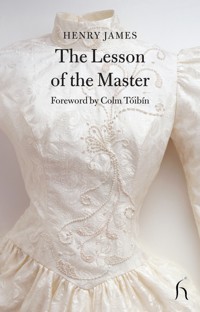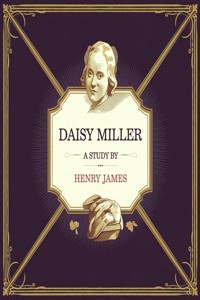14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zum ersten Mal auf Deutsch: Frühe Erzählungen von Henry James
Im Komponieren schicksalhafter Zufallsbegegnungen und märchenhafter Wendungen ist Henry James unerreicht. Mit sprachlicher wie psychologischer Raffinesse macht er das Unwahrscheinliche plausibel und öffnet den Blick auf die Abgründe menschlicher Beziehungen. Die hier erstmals ins Deutsche übersetzten fünf Geschichten unterstreichen seinen Rang als einer der bedeutendsten amerikanischen Autoren an der Wende zur Moderne.
Frei von materiellen Sorgen und ohne eine wirkliche Aufgabe loten James’ Helden ihre Bestimmung vornehmlich auf Reisen aus: auf dem Weg von der Neuen in die Alte Welt, von der Stadt aufs Land. So flieht der kunstsinnige Mr. Locksley nach einer Trennung aus der von gesellschaftlichen Pflichten regierten Metropole New York in die ländliche Idylle Neuenglands. Die Liebe zu einer unschuldigen Fischertochter bahnt sich an. Doch nichts ist, wie es zunächst scheint.
Trug oder Wirklichkeit? Drama oder Lustspiel? Trotz großer realistischer Genauigkeit gelingt es Henry James, die Gefühle seiner Helden und den Ausgang der Handlung in der Schwebe zu halten. In den hier ausgewählten Kabinettstücken, die zwischen 1866 und 1884 entstanden, treibt er gewohnt virtuos sein Spiel mit Ahnung und Zweifel der Leser.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
MANESSEBIBLIOTHEK DER WELTLITERATUR
Inhaltsverzeichnis
EIN LANDSCHAFTSMALER
Erinnern Sie sich noch, wie vor einem Dutzend Jahren die Nachricht vom Platzen der Verlobung des jungen Locksley mit Miss Leary eine Reihe unserer Freunde aufgeschreckt hat? Dieses Ereignis erregte damals einiges Aufsehen. Beide Parteien durften in gewisser Weise für sich beanspruchen, etwas Besonderes zu sein: Locksley seines Reichtums wegen, den man für enorm hielt, und die junge Dame ihrer Schönheit wegen, die wahrhaftig sehr groß war. Ich hörte des Öfteren, ihr Liebster vergleiche sie gern mit der Venus von Milo, und tatsächlich: Wenn Sie sich die verstümmelte Göttin im Vollbesitz ihrer Gliedmaßen vorstellen, herausgeputzt von Madame de Crinoline1 und unter dem Kronleuchter im Gesellschaftszimmer in belangloses Geplauder vertieft, mögen Sie eine ungefähre Vorstellung von Miss Josephine Leary bekommen. Locksley war, Sie erinnern sich, ein eher kleingewachsener Mann, dunkelhaarig und nicht besonders gutaussehend; und wenn er mit seiner Verlobten so umherspazierte, wunderte sich nahezu jeder darüber, dass er es gewagt hatte, einer jungen Dame von solch stattlichen Proportionen einen Antrag zu machen. Miss Leary hatte die grauen Augen und kastanienbraunen Haare, wie ich sie in meiner Vorstellung stets mit der berühmten Statue verbunden hatte. Die einzige Unzulänglichkeit, die ihre Züge trotz ihrer großen Offenheit und Anmut aufwiesen, war ein gewisser Mangel an Lebhaftigkeit. Was Locksley außer ihrer Schönheit noch angezogen hatte, fand ich nie heraus: In Anbetracht der Kurzlebigkeit seiner Zuneigung war es ja vielleicht wirklich nur ihre Schönheit gewesen. Ich sage, seine Zuneigung war von kurzer Dauer, da es hieß, die Auflösung der Verlobung sei von ihm ausgegangen. Sowohl er als auch Miss Leary hüllten sich in dieser Frage wohlweislich in Schweigen, doch ihre Freunde und Feinde hatten natürlich hundert Erklärungen parat. Am populärsten bei jenen, deren Wohlwollen Locksley gehörte, war die, dass er sich erst angesichts unübersehbarer Anzeichen für die – was? Unredlichkeit? der Dame, erst angesichts des unwiderlegbaren Beweises für das außerordentlich geldgierige Wesen Miss Learys zurückgezogen habe (derartige Ereignisse werden, wie Sie wissen, in vornehmen Kreisen ganz so diskutiert wie bei Zusammenkünften anderer Art ein mit Spannung erwarteter Preisboxkampf, der dann doch nicht stattfindet). Sie sehen, man traute unserem Freund durchaus zu, für eine«Idee»zu Felde zu ziehen. Zugegebenermaßen war dieser Vorwurf, der da gegen Miss Leary erhoben wurde, völlig neu, doch da Mrs Leary, die Mutter, eine Witwe mit vier Töchtern, mir seit langem als unverbesserlicher alter Geizhals bekannt war, war ich so frei, ihrer Erstgeborenen eine ähnliche Neigung zuzutrauen. Vermutlich vertrat die Familie der jungen Dame ihrerseits eine sehr überzeugende eigene Version des Ungemachs, das sie erlitten hatte. Sie wurde dafür jedoch schon recht bald durch Josephines Heirat mit einem Gentleman entschädigt, dessen Aussichten beinahe ebenso glänzend waren wie jene ihres alten Bräutigams. Und welche Entschädigung erhielt er? Genau davon handelt meine Geschichte.
Locksley verschwand, wie Sie sich erinnern werden, aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Die oben erwähnten Ereignisse fanden im März statt. Als ich ihn im April in seiner Wohnung aufsuchen wollte, sagte man mir, er habe sich« aufs Land»zurückgezogen. Doch Ende Mai traf ich ihn. Er erzählte mir, er sei auf der Suche nach einem ruhigen, nicht überlaufenen Ort am Meer, wo er ein einfaches Leben führen und Skizzen anfertigen könne. Er sah sehr schlecht aus. Ich schlug Newport 2 vor und erinnere mich noch daran, dass er kaum die Kraft hatte, über den kleinen Scherz zu lachen. Wir gingen auseinander, ohne dass ich ihm hatte weiterhelfen können, und danach verlor ich ihn für sehr lange Zeit gänzlich aus den Augen. Er starb vor sieben Jahren im Alter von fünfunddreißig. Fünf Jahre lang war es ihm also gelungen, sein Leben vor den Blicken der Menschen abzuschirmen. Durch Umstände, auf die ich hier nicht näher einzugehen brauche, gelangte ein großer Teil seiner persönlichen Besitztümer in meine Hände. Wie Sie sich erinnern werden, war er das, was man einen schöngeistigen Menschen nennt, das heißt, er interessierte sich ernsthaft für Kunst und Literatur. Er schrieb einige sehr schlechte Gedichte, schuf aber eine Reihe bemerkenswerter Gemälde. Er hinterließ eine Menge Aufzeichnungen zu allen möglichen Themen, von denen nur wenige von allgemeinem Interesse sind. Einen Teil davon schätze ich allerdings sehr – jenen nämlich, der sein privates Tagebuch ausmacht. Es umfasst den Zeitraum zwischen seinem fünfundzwanzigsten und seinem dreißigsten Lebensjahr, in dem die Aufzeichnungen dann plötzlich abbrechen. Wenn Sie mich zu Hause aufsuchen, werde ich Ihnen die Skizzen und Gemälde zeigen, die sich in meinem Besitz befinden, und Sie, wie ich zuversichtlich glaube, zu meiner Überzeugung bekehren, dass er das Zeug zu einem großen Maler hatte. Unterdessen will ich Ihnen die letzten hundert Seiten seines Tagebuchs vorlegen, als Antwort auf Ihre Frage, wie die mächtige Nemesis 3 sein Verhalten Miss Leary gegenüber, seine Verschmähung der erhabenen Venus Victrix4, abschließend beurteilte. Das noch nicht lange zurückliegende Ableben der Person, die bei der Verfügung über Locksleys persönliche Habe mehr zu sagen hatte als ich, versetzt mich in die Lage, agieren zu können, ohne mir Zurückhaltung auferlegen zu müssen.
Cragthorpe, 9. Juni. – Die Feder in der Hand, saß ich einige Minuten lang da und überlegte, ob ich auf diesem neuen Boden, unter diesem neuen Himmel diese sporadischen Berichte über meinen Müßiggang fortführen sollte. Ich denke, ich werde den Versuch auf jeden Fall wagen. Und wenn’s misslänge, so misslingt’s, wie Lady Macbeth bemerkt.5 Ich stelle fest, meine Einträge sind dann am längsten, wenn mein Leben am langweiligsten ist. Deshalb hege ich keinen Zweifel, dass ich, einmal in die Eintönigkeit des dörflichen Lebens eingetaucht, von morgens bis abends dasitzen und vor mich hin kritzeln werde. Wenn nichts geschieht… Doch meine prophetische Seele sagt mir, dass etwas geschehen wird. Ich bin fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass etwas geschieht – und wenn es nichts anderes ist, als dass ich ein Bild male.
Als ich vor einer halben Stunde heraufkam, um zu Bett zu gehen, war ich todmüde. Jetzt, nachdem ich ein Weilchen aus dem Fenster gesehen habe, ist mein Verstand hellwach und klar, und ich habe das Gefühl, ich könnte bis zum Morgen schreiben. Aber leider habe ich nichts, worüber ich schreiben könnte. Und außerdem muss ich zeitig zu Bett, wenn ich früh aufstehen will. Das ganze Dorf schläft schon, nur ich gottloser Großstadtmensch bin noch auf! Die Lampen auf dem Platz vor dem Haus flackern im Wind; da draußen gibt es nichts außer vollkommener Dunkelheit und dem Geruch der ansteigenden Flut. Ich war den ganzen Tag auf den Beinen, bin mühsam von der einen Seite der Halbinsel zur anderen gewandert. Was für eine famose Frau Mrs M. doch ist, dass sie an diesen Ort gedacht hat! Ich muss ihr einen glühenden Dankesbrief schreiben. Noch nie zuvor, so will mir scheinen, habe ich eine unberührte Küstenlandschaft gesehen. Noch nie zuvor habe ich an der Schönheit von Wellen, Felsen und Wolken Gefallen gefunden. Ich bin von einer sinnlichen Verzücktheit erfüllt ob des Lebens, des Lichtes und der Transparenz der Luft, die ihresgleichen suchen. Ich verstumme in ehrfürchtiger Bewunderung angesichts der großartigen Vielfalt an Farben und Geräuschen, die dem Ozean eigen sind, und dabei habe ich vermutlich bei weitem noch nicht alle erlebt. Ich kam hungrig, müde, mit wunden Füßen, sonnenverbrannt und schmutzig zum Abendessen zurück – glücklicher, kurz gesagt, als ich es in den letzten zwölf Monaten je war. Und nun möge der Pinsel triumphieren!
11. Juni. – Erneut ein Tag auf den Beinen und auch auf See. Ich habe heute Morgen beschlossen, dieses widerwärtige kleine Wirtshaus zu verlassen. Ich halte es in meinem Federbett keine weitere Nacht aus. Ich fasste den Entschluss, mir eine andere Aussicht zu suchen als auf den Stadtbrunnen und die Gemischtwarenhandlung. Nach dem Frühstück erkundigte ich mich bei meinem Wirt, ob es wohl möglich sei, in einem der Farm-oder Landhäuser in der Umgebung unterzukommen. Doch mein Wirt konnte oder wollte mir nicht weiterhelfen. So beschloss ich, auf gut Glück loszugehen – mit offenen Augen die Gegend zu durchstreifen und an die Gastfreundschaft der Einheimischen zu appellieren. Doch noch nie sind mir Leute begegnet, denen es an dieser liebenswürdigen Eigenschaft derart mangelte. Bis zur Essenszeit hatte ich die Suche verzagt aufgegeben. Nach dem Mittagessen schlenderte ich zum Hafen hinunter, der sich ganz in der Nähe befindet. Die Klarheit des Wassers und die leichte Brise, die darüber hinwegstrich, verleiteten mich dazu, ein Boot zu mieten und meine Erkundungen wiederaufzunehmen. Ich wurde eines alten Kahns mit einem kurzen Stummel von Mast habhaft, der, da er sich genau in der Mitte befand, das Boot wie einen auf dem Kopf liegenden Pilz aussehen ließ. Ich nahm Kurs auf das, was ich für eine Insel hielt und was auch tatsächlich eine Insel ist, die, langgestreckt und flach, drei oder vier Meilen vor der Stadt liegt. Ich segelte eine halbe Stunde lang direkt vor dem Wind und lief schließlich auf den abfallenden Strand einer kleinen Bucht auf. So eine hübsche kleine Bucht! So heiter, so still, so warm, so weitab der Stadt, die, weiß und halbkreisförmig, in der Ferne lag! Ich sprang an Land und warf den Anker aus. Vor mir erhob sich eine steile, von einem verfallenen Fort oder Turm gekrönte Klippe. Ich machte mich auf den Weg hinauf und näherte mich ihm von der Landseite. Das Fort ist ein hohles altes Gerippe. Wenn man vom Strand hinaufschaut, sieht man den heiteren blauen Himmel durch die ins Leere führenden Schießscharten. Das Innere ist mit Felsbrocken, Dornengestrüpp und Unmengen herabgestürzten Mauerwerks angefüllt. Ich kletterte auf allen vieren zur Brustwehr hinauf und wurde mit einem herrlichen Blick auf das Meer belohnt. Jenseits der weiten Bucht sah ich Stadt und Land wie in Miniatur gemalt vor mir ausgebreitet und auf der anderen Seite den unendlichen Atlantik – über den, nebenbei bemerkt, all die schönen Sachen aus Paris kommen. Ich verbrachte den ganzen Nachmittag damit, kreuz und quer über die Hügel zu wandern, die die kleine Bucht umschlossen, in der ich an Land gegangen war. Ohne auf die Zeit und meine Schritte zu achten, beobachtete ich die über den Himmel segelnden Wolken und die wolkengleichen Segel am Horizont, lauschte dem melodischen Aneinanderreiben der von den Wellen in ständiger Bewegung gehaltenen Kieselsteine, tötete harmlose Blutsauger. Die einzige Empfindung, deren ich mich deutlich entsinne, ist, dass ich mich wieder wie ein zehnjähriger Junge fühlte und vage Erinnerungen an Samstagnachmittage in mir aufstiegen, an die Freiheit, durch das Wasser zu waten oder gar hineinzugehen, um zu schwimmen, und an die Aussicht, in der Dämmerung mit einer wunderbaren Geschichte, wie ich beinahe eine Schildkröte gefangen hätte, nach Hause zu humpeln. Als ich an den Strand zurückkam, stellte ich fest – aber ich weiß sehr gut, was ich feststellte, und ich brauche es wohl kaum zu meiner Demütigung hier zu wiederholen. Der Himmel weiß, dass ich nie ein praktisch veranlagter Mensch gewesen bin. Was dachte ich an die Gezeiten? Da lag mein alter Kahn hoch und trocken, und der rostige Anker ragte aus den flachen grünen Steinen und seichten Pfützen hervor, die die ablaufende Flut zurückgelassen hatte. Das Boot auch nur einen Zoll, geschweige denn weit mehr als ein Dutzend Yard zu bewegen überstieg meine Kräfte. Langsam kletterte ich die Klippe wieder hinauf, um zu sehen, ob von dort oben irgendwo Hilfe auszumachen war. Weit und breit war keine in Sicht, und ich war schon im Begriff, mich völlig niedergeschlagen auf den Rückweg zu machen, als ich ein schmuckes kleines Segelboot hinter einer benachbarten Klippe hervorschießen und die Küste entlangkommen sah. Ich beschleunigte meine Schritte. Als ich unten ankam, entdeckte ich den Neuankömmling etwa hundert Yard vom Strand entfernt. Der Mann an der Ruderpinne schien mich mit einigem Interesse zu betrachten. Im Stillen betend, dass er so etwas wie Mitleid empfinden möge, forderte ich ihn durch Rufe und Gesten auf, zu einer kleinen felsigen Landspitze zu kommen, die sich ein Stückchen weiter oben befand und zu der ich mich begab, um ihn dort zu treffen. Ich erzählte ihm meine Geschichte, und er nahm mich bereitwillig an Bord. Er war ein höflicher alter Gentleman aus der Seefahrerzunft, der offenbar zu seinem Vergnügen in der Abendbrise kreuzte. Sowie wir angelegt hatten, suchte ich den Eigentümer meines alten Kahns auf, berichtete ihm von meinem Missgeschick und erbot mich, für den Schaden aufzukommen, sollte sich am Morgen herausstellen, dass das Boot welchen genommen hatte. Bis dahin ist es dort wohl sicher, wie heimtückisch der nächste Gezeitenwechsel auch sein mag. – Doch zurück zu meinem alten Gentleman. Ich habe da fraglos eine Bekanntschaft gemacht, wenn nicht sogar einen Freund gewonnen. Ich schenkte ihm eine sehr gute Zigarre, und noch bevor wir den Hafen erreichten, waren wir schon vollkommen vertraut miteinander. Im Tausch für meine Zigarre nannte er mir seinen Namen; dabei lag etwas in seiner Stimme, was anzudeuten schien, dass ich keineswegs das schlechtere Geschäft gemacht hätte. Sein Name ist Richard Blunt,«obwohl mich die meisten der Kürze halber einfach Kapitän nennen», fügte er hinzu. Dann erkundigte er sich nach meinem Namen und meinen Absichten. Ich belog ihn nicht, erzählte ihm aber nur die halbe Wahrheit, und wenn er sich deshalb irgendwelche romantischen Vorstellungen von mir macht, nun ja, dann soll er das ruhig tun, Gott schütze seine schlichte Seele! In Wirklichkeit verhält es sich so, dass ich mit der Vergangenheit gebrochen habe. Ich bin – wie ich glaube, ruhig und überlegt – zu dem Entschluss gelangt, dass es um meines Erfolges, jedenfalls aber um meines Glückes willen erforderlich ist, eine Weile lang meinem bisherigen Selbst abzuschwören und ein einfaches, ungekünsteltes Wesen anzunehmen. Wie kann ein Mann einfach und ungekünstelt sein, von dem man weiß, dass er hunderttausend im Jahr hat? Das ist der größte Fluch. Es ist schlimm genug, sie zu haben; dass bekannt ist, dass man sie hat, ja lediglich bekannt zu sein, weil man sie hat, ist absolut verdammenswert. Vermutlich bin ich zu stolz, um glücklich reich zu sein. Nun will ich sehen, ob Armut das Richtige für mich ist. Ich habe einen Neubeginn gewagt. Ich habe beschlossen, einzig und allein auf meine eigenen Verdienste zu bauen. Scheitere ich damit, werde ich auf meine Millionen zurückgreifen; doch mit Gottes Hilfe werde ich meine Fähigkeiten erproben und feststellen, aus welchem Stoff ich bin. Jung sein, stark sein, arm sein – das ist, in diesem gesegneten neunzehnten Jahrhundert, die wesentliche Basis für soliden Erfolg. Ich habe den Entschluss gefasst, wenigstens einen kleinen Schluck aus den reinen Quellen der Inspiration meiner Zeit zu nehmen. Ich antwortete dem Kapitän mit jener Zurückhaltung, wie eine kurze Prüfung dieser Grundsätze sie gebot. Welch eine Wonne ist es, in der Vorstellung eines armen Mannes als sein Bruder durchzugehen! Ich fange an, Achtung vor mir zu haben. So viel weiß der Kapitän: dass ich ein gebildeter Mann bin mit einer Neigung zur Malerei; dass ich hierhergekommen bin, um diese Neigung durch das Studium der Küstenlandschaft zu befördern, aber auch um meiner Gesundheit willen. Zudem habe ich Anlass zu glauben, dass er meine finanziellen Mittel für beschränkt und mich für einen recht sparsamen Menschen hält. Amen! Vogue la galère!6 Den Höhepunkt meiner Geschichte bildet jedoch sein äußerst gastfreundliches Angebot, mir Unterkunft zu gewähren. Ich hatte ihm von meinen diesbezüglich erfolglosen Bemühungen vom Vormittag erzählt. Er ist eine seltsame Mischung aus einem Gentleman der alten Schule und einem altmodischen, hitzköpfigen Handelskapitän. Ich nehme an, gewisse Züge dieser Charaktere sind beliebig austauschbar.
« Junger Mann», sagte er, nachdem er mehrmals nachdenklich an seiner Zigarre gezogen hatte,«ich sehe nicht ein, warum Sie in einem Wirtshaus wohnen sollen, wenn es um Sie herum Leute gibt, die so viel Platz im Haus haben, dass sie gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Ein Wirtshaus ist kein richtiges Haus, geradeso wie diese neumodischen Schraubendampfer keine richtigen Schiffe sind. Wie wäre es, wenn Sie mitkommen und sich die Sache ansehen? Ich besitze ein ganz respektables Haus dort hinten, links von der Stadt. Sehen Sie die alte Werft mit den baufälligen Lagerhäusern und die lange Ulmenreihe dahinter? Ich wohne inmitten der Ulmen. Wir haben den hübschesten kleinen Garten auf der ganzen weiten Welt, er reicht bis zum Meer hinunter. Es ist so ruhig, wie es nur sein kann, fast wie auf einem Friedhof. Die hinteren Fenster gehen auf den Hafen hinaus, wissen Sie, und Sie können zwanzig Meilen die Bucht hinauf und fünfzig Meilen aufs Meer hinaus sehen. Dort können Sie den lieben langen Tag vor sich hin malen und brauchen ebensowenig eine Störung zu befürchten, wie wenn Sie da draußen auf dem Feuerschiff wären. Außer mir und meiner Tochter hält sich niemand im Haus auf, und sie ist eine vollkommene Dame, Sir. Sie gibt Musikunterricht an einer höheren Mädchenschule. Sehen Sie, wir könnten das Geld gut brauchen, wie man so sagt. Wir haben bisher noch nie einen Pensionsgast aufgenommen, weil uns noch nie einer über den Weg gelaufen ist, aber ich denke, wir werden die Gepflogenheiten schon lernen. Ich nehme an, Sie haben schon als Pensionsgast logiert; sicher können Sie uns da den einen oder anderen Rat geben.»
In dem wettergegerbten Gesicht des alten Mannes war etwas so Liebenswürdiges und Aufrichtiges, in seinem Auftreten etwas so Freundliches, dass ich, unter dem Vorbehalt der Einwilligung seiner Tochter, sogleich eine Vereinbarung mit ihm traf. Morgen soll ich ihre Antwort erfahren. Ebendiese Tochter scheint mir ein recht dunkler Fleck im Gesamtbild. Lehrerin an einer höheren Mädchenschule – wahrscheinlich an der Anstalt, von der Mrs M. gesprochen hatte. Vermutlich ist sie über dreißig. Ich denke, ich kenne die Spezies.
12. Juni, Vormittag. – Es gibt außer dem Herumkritzeln tatsächlich nichts, was ich tun könnte.« Barkis will.»7 Kapitän Blunt teilte mir heute Morgen mit, seine Tochter lächle gnädig. Ich soll mich heute Abend einfinden, mein karges Gepäck werde ich jedoch schon in ein, zwei Stunden hinschicken.
Abend. – Hier bin ich, und ich bin gut untergebracht. Das Haus liegt keine Meile vom Gasthof entfernt und ist über eine sehr hübsche Straße zu erreichen, die am Hafen entlangführt. Gegen sechs fand ich mich ein, Kapitän Blunt hatte mir den Weg beschrieben. Eine sehr höfliche alte Negerin öffnete mir und führte mich dann in den Garten, wo ich meine Freunde beim Blumengießen antraf. Der alte Mann trug seinen Hausmantel und Pantoffeln. Er hieß mich herzlich willkommen. Seine Umgangsformen haben etwas erfreulich Ungezwungenes – die von Miss Blunt übrigens auch. Sie empfing mich äußerst freundlich. Die verstorbene Mrs Blunt muss eine wohlerzogene Frau gewesen sein. Und was Miss Blunts Alter betrifft, so ist sie keine dreißig, sondern um die vierundzwanzig. Sie trug ein adrettes weißes Kleid, dazu ein violettes Band am Hals und eine Rosenknospe im Knopfloch – oder wie auch immer man den entsprechenden Platz am weiblichen Busen nennen mag. Ich meinte zu erkennen, dass diese Kleidung eine gewisse Höflichkeit, eine gewisse Ehrerbietung zur Feier meiner Ankunft zum Ausdruck bringen sollte. Ich glaube nicht, dass Miss Blunt jeden Tag weißen Musselin trägt. Sie gab mir die Hand und hielt mir einen sehr freimütigen kleinen Vortrag über ihre Gastfreundschaft.« Wir hatten bisher noch nie irgendwelche Hausgenossen», sagte sie,«und deshalb ist dies alles neu für uns. Ich weiß nicht, was Sie erwarten. Ich hoffe, nicht allzu viel. Lassen Sie es uns wissen, wenn Sie etwas brauchen. Wenn wir Ihren Wunsch erfüllen können, werden wir dies sehr gern tun; können wir es nicht, kündige ich jetzt schon an, dass wir rundweg ablehnen werden.»Bravo, Miss Blunt! Das Beste an allem ist, dass sie fraglos schön ist, und zwar auf stattliche Weise: großgewachsen und recht drall. Wie lautet die übliche Beschreibung eines hübschen Mädchens? Weiß und rot? Miss Blunt ist kein hübsches Mädchen, sie ist eine schöne Frau. Sie hinterlässt einen Eindruck von schwarz und rot; das heißt, sie ist eine blühend aussehende Brünette. Sie hat volles, welliges schwarzes Haar, das ihren Kopf wie eine dunkle Strahlenkrone, wie ein schattenhafter Heiligenschein umrahmt. Auch ihre Augenbrauen sind schwarz, die Augen selbst aber von einem kräftigen Blaugrau wie jene Schieferfelsen, die ich gestern unter den vor- und zurückrollenden Wellen schimmern sah. Ihre eigentliche Stärke ist jedoch ihr Mund. Er ist sehr groß und birgt die schönsten Zahnreihen auf dieser ganzen beschwerlichen Welt. Ihr Lächeln ist ausnehmend intelligent, ihr Kinn voll und ein wenig breit. All dies ergibt eine leidliche Aufzählung, aber noch kein Bild. Ich habe mir das Hirn zermartert, um herauszufinden, ob ihr Typ oder ihre Gestalt mich mehr beeindruckte. Fruchtloses Grübeln! Im Ernst, ich glaube, es war keines von beiden; es war die Art, wie sie sich bewegte. Sie geht wie eine Königin. Es war die bewusste Haltung ihres Kopfes und das unbewusste«Hängenlassen»ihrer Arme, die unbefangene Anmut und Würde, mit der sie langsam den Gartenpfad entlangschlenderte und an einer ach so roten Rose roch! Sie hat offenbar sehr selten das Bedürfnis, etwas zu sagen; spricht sie jedoch, so ist es stets zur Sache, und legt es die Sache nahe, lächelt sie dabei ganz reizend. Wenn sie nicht sehr gesprächig ist, so gewiss nicht aus Schüchternheit. Vielleicht aus Gleichgültigkeit? Die Zeit wird es weisen, wie so manch anderes auch. Ich gehe davon aus, dass sie liebenswürdig ist. Überdies ist sie intelligent; sie ist vermutlich recht zurückhaltend und möglicherweise sehr stolz. Sie ist, kurz gesagt, eine Frau von Charakter. Da stehen Sie vor uns, Miss Blunt, in voller Lebensgröße – ganz entschieden das Bildnis einer Dame8. Nach dem Tee gab sie für uns im Wohnzimmer ein kleines Konzert. Ich gestehe, der Anblick des dämmrigen kleinen Raumes, der nur von einer einzigen Kerze auf dem Klavier und von der Ausstrahlung des Spiels von Miss Blunt erhellt wurde, entzückte mich mehr als die Musik selbst. Miss Blunt hat ganz offenkundig einen exzellenten Anschlag.
18. Juni. – Nun bin ich schon fast eine Woche hier. Ich bewohne zwei sehr freundliche Zimmer. Mein Maleratelier ist ein riesiger, recht schmuckloser Raum mit sehr gutem Licht von Süden. Ich habe ihn mit einigen alten Drucken und Skizzen herausgeputzt, und er ist mir schon sehr ans Herz gewachsen. Als ich mein künstlerisches Handwerkszeug so malerisch wie möglich angeordnet hatte, bat ich meine Gastgeber herein. Der Kapitän sah sich ein paar Sekunden schweigend um und erkundigte sich dann hoffnungsvoll, ob ich mich schon einmal an einem Schiff versucht hätte. Auf meine Antwort hin, dass mein Können dafür noch nicht ausreiche, verfiel er erneut in ehrerbietiges Schweigen. Seine Tochter lächelte anmutig, stellte freundlich Fragen und bezeichnete alles als entzückend und schön, was mich etwas enttäuschte, hatte ich sie doch für eine Frau gehalten, die eine gewisse Originalität besitzt. Sie gibt mir Rätsel auf. Oder ist sie vielleicht doch nur ein ganz gewöhnlicher Mensch, und der Fehler liegt bei mir, der ich Frauen stets weitaus mehr Bedeutung zumesse, als ihr Schöpfer ihnen zugedacht hat? Über Miss Blunt habe ich einige Fakten zusammengetragen. Sie ist nicht vierundzwanzig, sondern siebenundzwanzig Jahre alt. Seit ihrem zwanzigsten Lebensjahr gibt sie Musikunterricht an einem großen Pensionat, das in unmittelbarer Nähe der Stadt liegt und an dem sie einst selbst ihre Ausbildung erhielt. Das Gehalt, das sie an dieser – soweit ich weiß, leidlich florierenden – Anstalt bezieht, bildet, zusammen mit den Einkünften aus einigen zusätzlichen Unterrichtsstunden, die Haupteinnahmequelle des Haushalts. Doch zum Glück gehört Blunt das Haus, und seine Ansprüche und Gewohnheiten sind von der einfachsten Art. Was wissen er oder seine Tochter schon von den angeblich so wichtigen weltlichen Bedürfnissen, der großen Bandbreite weltlicher Vergnügungen? Miss Blunts einziger Luxus sind ein Abonnement für die Leihbücherei und ein gelegentlicher Spaziergang am Strand, den sie, wie eine von Miss Brontës Heldinnen9, in Gesellschaft eines alten Neufundländers entlangschreitet. Ich fürchte, sie ist beklagenswert unwissend. Sie liest nichts außer Romanen. Doch darf ich annehmen, dass sie aus der Lektüre dieser Werke gewisse eigene praktische Erkenntnisse gezogen hat.«Ich lese alle Romane, deren ich habhaft werden kann», sagte sie gestern,«aber ich mag nur die guten. ‹Zanoni›,10 den ich gerade ausgelesen habe, mag ich sehr.»Ich muss dafür sorgen, dass sie sich einige der Klassiker vornimmt. Ich wünschte, einige dieser mürrischen New Yorker Erbinnen sähen, wie diese Frau lebt. Und ich wünschte auch, ein halbes Dutzend von ces messieurs11 aus den Klubs könnten heimlich einen Blick auf das gegenwärtige Leben ihres bescheidenen Dieners werfen. Wir frühstücken um acht Uhr. Unmittelbar danach macht sich Miss Blunt, versehen mit einem schäbigen alten Hut und Umschlagtuch, auf den Weg zur Schule. Ist das Wetter schön, fährt der Kapitän zum Fischen hinaus, und ich bin mir selbst überlassen. Zweimal habe ich den alten Mann begleitet. Beim zweiten Mal hatte ich das Glück, einen großen Blaubarsch zu fangen, den es dann zum Abendessen gab. Der Kapitän ist ein Musterbeispiel eines unerschrockenen Seemanns mit seiner lose sitzenden blauen Kleidung, seinem extrem breitbeinigen Gang, seinem krausen weißen Haar und seinem fröhlichen wettergegerbten Antlitz. Er stammt aus einem englischen Seefahrergeschlecht. Das altertümliche Haus erinnert mehr oder weniger an eine Schiffskajüte. Zwei-, dreimal habe ich den Wind um seine Mauern pfeifen hören, als wäre man draußen auf offener See. Und irgendwie wird die Illusion durch die ungewöhnliche Intensität des Lichts noch geschürt. Von meinem Atelier aus lassen sich die Wolken wunderbar beobachten. Oft sitze ich eine geschlagene halbe Stunde lang da und schaue ihnen zu, wie sie vor meinen hohen, vorhanglosen Fenstern vorbeisegeln. Befindet man sich weiter hinten im Zimmer, hat man das Gefühl, sie gehörten zu einem Meereshimmel, und tatsächlich sieht man, wenn man näher kommt, draußen die weite, graue See, in die der Himmel übergeht. In diesem Teil der Stadt herrscht vollkommene Ruhe. Es ist, als sei jede menschliche Betriebsamkeit aus ihm gewichen, um nie mehr zurückzukehren, und nur eine Art melancholischer Resignation zurückgeblieben, die alles überlagert. Die Straßen sind sauber, freundlich und luftig, doch gerade dieser Umstand scheint einen den eindringlichen Ernst, der allenthalben herrscht, nur noch stärker empfinden zu lassen. Er deutet darauf hin, dass der weite Himmel in das Geheimnis ihres Niedergangs eingeweiht ist. Die anhaltende Stille hat etwas Gespenstisches. Oft hören wir das Geklapper von den Werften und die Befehle, die auf den im Hafen ankernden Barken und Schonern ausgegeben werden, bis hierher.
28. Juni. – Mein Experiment funktioniert viel besser, als ich es zu hoffen gewagt habe. Ich fühle mich äußerst wohl; mein Seelenfrieden übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Ich arbeite eifrig; mir gehen nur angenehme Dinge durch den Kopf. Die Vergangenheit hat ihre Schrecken beinahe verloren. Seit einer Woche bin ich jetzt jeden Tag zum Zeichnen draußen gewesen. Der Kapitän setzt mich mit dem Boot an einem bestimmten Punkt an der Küste in der Nähe des Hafens ab, und ich wandere quer über die Felder zu einer Stelle, wo ich eine Art Rendezvous mit einem Fels und dem Schatten habe, den er besonders effektvoll wirft; bisher hat sich dieses Naturschauspiel recht zuverlässig an unsere Verabredung gehalten. Hier stelle ich meine Staffelei auf und male bis zum Sonnenuntergang. Dann gehe ich zurück zum Ausgangspunkt, wo der Kapitän mich wieder abholt. Alles ist sehr ermutigend. Der Horizont meines Schaffens erweitert sich zusehends. Und außerdem macht mich die Überzeugung, dass ich für ein Leben in (bescheidener) Arbeit und (relativer) Entbehrung offenbar nicht gänzlich ungeeignet bin, unsagbar glücklich. Ich bin in meine Armut richtig verliebt, wenn ich so sagen darf. Warum auch nicht? Unter diesen Umständen gebe ich keine achthundert im Jahr aus.
12. Juli. – Seit einer Woche haben wir schlechtes Wetter: Dauerregen, Tag und Nacht. Dies ist zweifellos gleichzeitig die heiterste und die düsterste Gegend in ganz Neuengland. Der Himmel hier kann lächeln, gewiss; aber wie finster er auch dreinschauen kann! Ich habe eher lustlos und bei recht ungünstigen Bedingungen an meinem Fenster gemalt… In diesem strömenden Regen macht Miss Blunt sich auf den Weg zu ihren Schülern. Sie hüllt ihren hübschen Kopf in eine große wollene Kapuze, ihre schöne Figur in eine Art feminin geschnittenen Mackintosh12; ihre Füße steckt sie in schwere Überschuhe, und über dem Ganzen balanciert sie einen Stoffschirm. Wenn sie nach Hause kommt, bietet sie mit den Regentropfen, die auf ihren roten Wangen und dunklen Wimpern glitzern, ihrem schlammbespritzten Mantel und ihren von der feuchten Kälte ganz roten Händen einen äußerst erfreulichen Anblick. Ich versäume es nie, sie mit einer besonders tiefen Verbeugung zu begrüßen, wofür sie mich mit einem außerordentlich liebenswürdigen Lächeln belohnt. Diese Alltagsseite ihres Charakters gefällt mir an Miss Blunt besonders. Diese hehre Alltagstracht aus Schönheit und Würde kleidet sie mit der Schlichtheit eines antiken Gewandes. Wenig Verwendung hat sie für Fischbeinstäbe13 und Volants. Welch eine Poesie versteckt sich doch hinter roten Händen! Ich küsse die Ihren, Mademoiselle. Ich tue es, weil Sie sich selbst zu helfen wissen; weil Sie sich Ihren Lebensunterhalt selbst verdienen; weil Sie aufrichtig , schlicht und (obwohl doch eine verständige Frau) unwissend sind; weil Sie zur Sache sprechen und zielstrebig handeln; weil Sie, kurz gesagt, so ganz anders sind als – manche Ihrer Schwestern.
16. Juli. – Am Montag klarte es weitgehend auf. Als ich nach dem Aufstehen ans Fenster trat, erinnerten Himmel und Meer in ihrer Heiterkeit und Frische an ein gelungenes englisches Aquarell: 14 Die See ist von einem tiefen purpurnen Blau; darüber sieht der wolkenlose heitere Himmel geradezu blass aus, während er sich über dem Land in unendlicher Intensität wölbt. Hier und da schimmert auf dem von einer leichten Brise bewegten dunklen Wasser eine weiße Schaumkrone, flattert das weiße Segeltuch eines Fischerbootes. Ich habe fleißig Skizzen angefertigt; nur ein paar Meilen entfernt habe ich einen großen, einsam gelegenen Teich entdeckt, der in eine recht eindrucksvolle Landschaft aus kahlen Felsen und grasbewachsenen Hängen eingebettet ist. Vom einen Ende aus hat man einen weiten Blick auf das offene Meer; am anderen steht, tief verborgen im Laub eines Apfelgartens, ein altes Bauernhaus, das so aussieht, als spukte es darin. Westlich des Teichs erstreckt sich eine weite Ebene aus Fels und Gras, Strand und Marschland. Die Schafe weiden darauf wie auf einem Moor in den Highlands. Außer ein paar verkrüppelten Kiefern und Zedern ist kein Baum zu sehen. Möchte ich Schatten, suche ich ihn im Schutz eines der großen moosbewachsenen Findlinge, die ihre glitzernden Schultern der Sonne entgegenrecken, oder in einer der langgestreckten Talmulden, wo ein Gestrüpp aus Brombeersträuchern einen Tümpel säumt, in dem sich der Himmel spiegelt. Ich habe mein Lager gegenüber einem kahlen braunen Hügel aufgeschlagen, den ich, mit Fleiß und Ausdauer, auf die Leinwand banne; und da wir nun seit einigen Tagen den immer gleich heiteren Himmel hatten, ist es mir gelungen, eine recht erfreuliche kleine Studie beinahe fertigzustellen. Ich breche gleich nach dem Frühstück auf. Miss Blunt gibt mir, in eine Serviette eingewickelt, reichlich Brot und kaltes Fleisch mit, die ich zur Mittagszeit in meiner sonnigen Einöde in Sichtweite des schlummernden Ozeans mit meinen farbbeschmierten Fingern gierig an die Lippen führe. Um sieben Uhr kehre ich zum Abendessen zurück, bei dem wir einander die Geschichte unseres Tagewerks erzählen. Für die arme Miss Blunt ist es tagaus, tagein die gleiche Geschichte: eine ermüdende Abfolge von Unterrichtsstunden in der Schule und in den Häusern des Bürgermeisters, des Pastors, des Metzgers und des Bäckers, deren junge Damen natürlich alle Klavierunterricht erhalten. Doch sie klagt nicht, ja sie sieht nicht einmal sehr müde aus. Wenn sie zum Abendessen ein frisches Baumwollkleid angezogen und die Haare wieder in Ordnung gebracht hat, wenn sie dann, dergestalt zurechtgemacht, mit ihren sachten Schritten leise hierhin und dorthin huscht, während sie unser Abendmahl zubereitet, in die Teekanne lugt, den großen Brotlaib aufschneidet, oder wenn sie sich auf die niedrige Stufe vor der Haustür setzt und ausgewählte Passagen aus der Abendzeitung vorliest, oder auch wenn sie, nach dem Essen, die Arme verschränkt (eine Haltung, die ihr besonders gut steht) und noch immer auf der Türstufe sitzend, den Abend in behaglicher Untätigkeit verplaudert, während ihr Vater und ich uns an einer wohlriechenden Pfeife gütlich tun und dabei zusehen, wie nach und nach die Lichter an verschiedenen Stellen der im Dunkel versinkenden Bucht aufleuchten: In diesen Augenblicken sieht sie so hübsch aus, so heiter, so unbeschwert, wie es einer verständigen Frau ansteht. Wie stolz der Kapitän auf seine Tochter ist! Und sie ihrerseits – wie treu ist sie dem alten Mann ergeben! Ihre Anmut erfüllt ihn mit Stolz, ihr Feingefühl, ihre Urteilskraft, ihr Humor, so wie er ist. Er hält sie für die vollkommenste aller Frauen. Er umsorgt sie, als wäre sie nicht seine altvertraute Esther, sondern eine erst jüngst in die Familie aufgenommene Schwiegertochter. Und in der Tat, wäre ich sein eigener Sohn, könnte er nicht liebenswürdiger zu mir sein. Sie – nein, warum soll ich es nicht sagen? – wir sind fraglos ein sehr glücklicher kleiner Haushalt. Wird das immer so bleiben? Ich sage«wir», denn Vater wie Tochter haben mir – er direkt, sie, wenn ich mir nicht zu viel einbilde, nach Art ihres Geschlechts, indirekt – hundertmal versichert, ich sei bereits ein geschätzter Freund. Eigentlich ist es ganz natürlich, dass ich ihr Wohlwollen gewonnen habe, bin ich ihnen meinerseits doch stets mit ausgesuchter Höflichkeit begegnet. Der Weg zum Herzen des alten Mannes führt über ein beflissen achtungsvolles Auftreten seiner Tochter gegenüber. Ich glaube, er weiß, dass ich Miss Blunt verehre. Sollte ich jedoch jemals die Grenzen der Höflichkeit überschreiten, bekäme ich es zweifellos mit ihm zu tun. All dies ist, wie es sein sollte. Menschen, die mit Dollars und Cents geizen müssen, haben das Recht, in ihren Gefühlen anspruchsvoll zu sein. Ich selbst bilde mir nicht wenig auf meine guten Manieren meiner Gastgeberin gegenüber ein. Dass mein Betragen bisher untadelig war, ist jedoch ein Umstand, den ich mir hier in keiner Weise als Verdienst anrechne, denn ich bin überzeugt, selbst der impertinenteste Kerl (wer immer er auch sei) käme nicht auf den Gedanken, sich dieser jungen Dame gegenüber Freiheiten herauszunehmen, ohne dass ihm dies unmissverständlich gestattet worden wäre. Diese unergründlichen dunklen Augen haben etwas äußerst Einhaltgebietendes. Ich erwähne das lediglich, weil ich es in künftigen Jahren, wenn meine bezaubernde Freundin nur noch ein ferner Schatten sein wird, beim Durchblättern dieser Seiten als erfreulich empfinden werde, schriftliches Zeugnis für das eine oder andere zu finden, was ich sonst wahrscheinlich allein meiner Phantasie zuschriebe. Ich frage mich, ob Miss Blunt, wenn sie dereinst die Register ihres Gedächtnisses nach irgendeinem trivialen Sachverhalt, nach irgendeinem prosaischen Datum oder halb verschütteten Markstein durchsucht, auch auf dieses unser kleines Geheimnis, wie ich es nennen darf, stoßen und eine alte verblasste, von den Aufzeichnungen der nachfolgenden Jahre überschriebene Notiz ähnlichen Inhalts entziffern wird. Natürlich wird sie das. Nüchtern betrachtet ist sie eine Frau mit einem ausgezeichneten Gedächtnis. Ob sie jemand ist, der vergibt, oder nicht, weiß ich nicht; aber sicher ist sie niemand, der vergisst. Zweifellos ist Tugend um ihrer selbst willen erstrebenswert, doch verschafft es doppelte Befriedigung , zu einem Menschen höflich zu sein, der dies zu würdigen weiß. Ein weiterer Grund für mein erfreulich gutes Verhältnis zum Kapitän ist, dass ich ihm die Möglichkeit biete, seine eingerostete Weltläufigkeit wieder aufzupolieren und mit seinen zuweilen recht kuriosen, bruchstückhaften Kenntnissen altmodischer Lektüre zu renommieren. Es ist ihm eine Wonne, sein fadenscheiniges Seemannsgarn vor einem einfühlsamen Zuhörer zu spinnen. Diese warmen Juliabende im süß duftenden Garten sind genau der richtige Rahmen für seine liebenswerte Redseligkeit. In diesem Punkt besteht zwischen uns eine recht sonderbare Beziehung. Wie viele seiner Berufskollegen vermag der Kapitän dem Drang zum Aufschneiden und Fabulieren nicht zu widerstehen, selbst wenn es um Themen geht, die sich dafür gar nicht eignen, und es ist äußerst vergnüglich zu beobachten, wie er seinen Zuhörer gleichsam auf die Stimmung in seinem tiefsten Innern hin abhorcht, um sich zu vergewissern, ob dieser auch bereit sei, seine hinterlistigen Flunkereien zu schlucken. Bisweilen gehen diese beim Erzählen indes völlig unter: Im unerschöpflichen Sammelbrunnen der meerwassergetränkten Phantasie des Kapitäns sind sie, wie ich mir wohl vorstellen kann, sehr hübsch, doch die Verpflanzung in die seichten Binnenseen meiner vom Leben an Land geprägten Denkart verkraften sie nicht. Dann wieder, wenn der Zuhörer sich in einer verträumten, sentimentalen Stimmung befindet, in der er seine Prinzipien ganz und gar vergisst, trinkt er das Salzwasser, das der alte Mann ihm einschenkt, eimerweise, ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Was ist schlimmer – eine hübsche kleine Lüge, die niemandem schadet, vorsätzlich zu erzählen oder vorsätzlich zu glauben? Vermutlich kann man nicht vorsätzlich glauben; man gibt nur vor zu glauben. Meine Rolle in dem Spiel ist deshalb fraglos ebenso verwerflich wie die des Kapitäns. Vielleicht finde ich an seinen schönen Verdrehungen der Tatsachen Gefallen, weil ich mich selbst einer solchen Verdrehung bediene, weil ich selbst unter völlig falscher Flagge segle. Ich frage mich, ob meine Freunde Verdacht geschöpft haben. Wie sollten sie? Ich bilde mir ein, meine Rolle im Großen und Ganzen recht gut zu spielen. Ich bin erfreut, dass es mir so leicht fällt. Damit meine ich nicht, dass es mir wenig Mühe bereitet, auf den Luxus und die tausend kleinen Annehmlichkeiten zu verzichten, die mir früher zu Gebote standen – diesen habe ich mich, dem Himmel sei Dank, nie so mit Leib und Seele verschrieben, dass nicht ein einziger heilsamer Schock die Bande hätte lösen können –, sondern dass es mir besser als erwartet gelingt, jene unzähligen stillschweigenden Anspielungen zu unterdrücken, die mich ernsthaft verraten könnten.
Sonntag, 20. Juli. – Dies war ein sehr erfreulicher Tag für mich, obwohl ich natürlich keinerlei Arbeit nachgegangen bin. Am Vormittag hatte ich ein entzückendes tête-à-tête mit meiner Gastgeberin. Sie hatte sich beim Treppensteigen den Knöchel verstaucht und war deshalb gezwungen, zu Hause auf dem Sofa zu bleiben, anstatt sich auf den Weg zur Sonntagsschule und zum Gottesdienst zu machen. Der Kapitän, der es mit der Frömmigkeit sehr genau nimmt, brach allein auf. Als ich ins Wohnzimmer kam, während gerade die Kirchenglocken läuteten, fragte mich Miss Blunt, ob ich denn nie zum Gottesdienst ginge.
« Nie, wenn es zu Hause Besseres zu tun gibt», sagte ich.
« Was kann besser sein, als in die Kirche zu gehen?», fragte sie mit bezaubernder Naivität.
Sie saß zurückgelehnt auf dem Sofa, den Fuß auf einem Kissen, die Bibel auf dem Schoß. Sie wirkte keineswegs betrübt, weil sie dem Gottesdienst fernbleiben musste, und anstatt ihre Frage zu beantworten, nahm ich mir die Freiheit, ihr das auch zu sagen.
« Ich bedauere aber, dass ich nicht hingehen kann», erklärte sie.«Wissen Sie, es ist in der ganzen Woche die einzige Geselligkeit für mich.»
« Sie sehen es also als Geselligkeit», sagte ich.
« Ist es nicht schön, seine Bekannten zu treffen? Ich gebe zu, die Predigt interessiert mich nie sonderlich, und die Kinder unterrichte ich auch nur ungern. Aber ich trage gern meine beste Haube und singe gern im Chor und spaziere auf dem Heimweg auch gern ein Stück mit…»
« Mit wem?»
« Mit jedem, der sich anbietet, mich zu begleiten. »
« Mit Mr Johnson, zum Beispiel», sagte ich.
Mr Johnson ist ein junger Anwalt aus dem Dorf, der hier einmal in der Woche einen Besuch macht und dessen Aufmerksamkeiten Miss Blunt gegenüber bereits registriert werden.
« Ja», antwortete sie,«mit Mr Johnson, zum Beispiel.»
« Er wird Sie sicherlich sehr vermissen!»
« Wahrscheinlich. Wir singen aus dem gleichen Gesangbuch. Worüber lachen Sie? Er gestattet mir liebenswürdigerweise, das Buch zu halten, während er mit den Händen in den Taschen neben mir steht. Letzten Sonntag habe ich die Geduld verloren. ‹Mr Johnson›, habe ich gesagt, ‹halten Sie doch bitte das Buch! Wo bleiben Ihre Manieren?› Da hat er mitten in der Lesung laut aufgelacht. Heute wird er das Buch zweifellos selbst halten müssen.»
« Was für eine ‹feinsinnige Seele› er ist! Ich nehme an, er wird nach dem Gottesdienst vorbeikommen. »
« Vielleicht. Ich hoffe es.»
« Ich hoffe, er kommt nicht», sagte ich unverblümt.« Ich werde mich hier zu Ihnen setzen und mich mit Ihnen unterhalten, und ich möchte nicht, dass unser tête-à-tête gestört wird.»
« Haben Sie mir etwas Bestimmtes zu sagen?»
« Nichts so Bestimmtes wie Mr Johnson vielleicht. »
Miss Blunt hat eine sehr hübsche Art, größere Sachlichkeit vorzutäuschen, als ihrem Wesen tatsächlich zu eigen ist.
« Dann hat er weitaus größere Rechte als Sie», sagte sie.
« Ach, Sie geben zu, dass er Rechte hat?»
« Keineswegs. Ich stelle lediglich fest, dass Sie keine haben.»
« Sie irren sich. Ich habe Anrechte, die ich geltend machen werde. Ich habe ein Anrecht auf Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit, wenn ich Ihnen einen Morgenbesuch abstatte.»
« Ihrem Anrecht wird natürlich Rechnung getragen. Bitte sagen Sie: War ich unhöflich?»
« Unhöflich vielleicht nicht, aber taktlos. Es hat Sie nach der Gesellschaft eines Dritten verlangt, und Sie können nicht erwarten, dass ich davon begeistert bin.»
« Und warum nicht, bitte schön? Wenn ich, eine Dame, mich mit Mr Johnsons Gesellschaft abfinden kann, weshalb sollten Sie, sein Geschlechtsgenosse, es dann nicht auch können?»
« Weil er so unerhört eingebildet ist. Aber Sie als Dame, oder jedenfalls als Frau, mögen eingebildete Männer ja.»
« Ach tatsächlich? Ich bezweifle nicht, dass ich, als Frau, alle möglichen ungehörigen Vorlieben habe. Das ist eine alte Geschichte.»
« Geben Sie wenigstens zu, dass unser Freund eingebildet ist.»
« Zugeben? Ich habe das schon hundertmal gesagt. Ich habe es ihm selbst schon gesagt.»
« In der Tat! Dann ist der Punkt also bereits erreicht?»
« Welcher Punkt, bitte?»
« Jener kritische Punkt in der Freundschaft zwischen einer Dame und einem Herrn, an dem sie einander alle möglichen ergötzlichen Vorwürfe an den Kopf werfen und sich gegenseitig moralischer Verirrungen beschuldigen. Seien Sie auf der Hut, Miss Blunt! Zwei intelligente Neuengländer beiderlei Geschlechts, jung, unverheiratet, sind sich schon recht nahegekommen, wenn sie beginnen, sich gegenseitig moralische Vorhaltungen zu machen. Sie haben Mr Johnson also gesagt, er sei eingebildet? Und vermutlich haben Sie hinzugefügt, er sei überdies schrecklich sarkastisch und pietätlos. Was hat er darauf erwidert? Lassen Sie mich überlegen. Hat er jemals gesagt, Sie seien ein wenig affektiert? »
« Nein, er hat es Ihnen überlassen, mir das auf diese äußerst geistreiche Art zu sagen. Vielen Dank, Sir.»
« Er hat es mir überlassen, das zu bestreiten – was wesentlich angenehmer ist. Halten Sie meine Art für geistreich?»
« Ich halte das Ganze in Anbetracht des Tages und der Stunde für sehr profan, Mr Locksley. Wie wäre es, wenn Sie gingen und mich in meiner Bibel lesen ließen?»
« Und was soll ich unterdessen tun?», fragte ich.
« Lesen Sie in Ihrer Bibel, sofern Sie eine haben. »
« Ich habe keine.»
Ich war dennoch gezwungen, mich zurückzuziehen, allerdings nicht ohne das Versprechen erhalten zu haben, dass sie mir in einer halben Stunde erneut eine Audienz gewähren werde. Die arme Miss Blunt ist es ihrem Gewissen schuldig, eine bestimmte Anzahl von Kapiteln zu lesen. Was für eine reine, aufrechte Seele sie ist! Und welch ein erbauliches Schauspiel bietet doch ein gut Teil der weiblichen Frömmigkeit! Frauen finden für alles einen Platz in ihren geräumigen kleinen Köpfen, geradeso wie sie in ihren bewunderungswürdig unterteilten Koffern für alles einen Platz finden, wenn sie auf Reisen gehen. Ich bezweifle nicht, dass diese junge Dame ihre Religion geradeso wie ihre Sonntagshaube in einer Ecke verstaut – und sie, wenn der geeignete Augenblick gekommen ist, wieder hervorholt und nachdenklich betrachtet, während sie sie vor dem Spiegel aufsetzt und den lediglich eingebildeten Staub wegbläst, denn welcher weltliche Schmutz kann schon ein halbes Dutzend Lagen Batist und Seidenpapier durchdringen. Du meine Güte, wie tröstlich ist es, einen hübschen, sauberen Feiertagsglauben zu haben! – Als ich ins Wohnzimmer zurückkam, saß Miss Blunt noch immer mit ihrer Bibel im Schoß da. Aus irgendeinem Grund war ich nicht mehr zum Scherzen aufgelegt. So fragte ich sie ganz nüchtern und sachlich, was sie gelesen habe. Und sie antwortete mir ebenso nüchtern und sachlich. Sie erkundigte sich, wie ich meine halbe Stunde verbracht hätte.
« Mit dem Denken guter Sabbatgedanken», sagte ich.«Ich war im Garten spazieren.»Und dann sagte ich frei heraus, was mir auf der Seele lag.«Ich habe dem Himmel dafür gedankt, dass er mich, einen armen, einsamen Wanderer, in einen so friedvollen sicheren Hafen geführt hat.»
« Sind Sie denn so arm und einsam?», fragte Miss Blunt recht unvermittelt.
« Haben Sie jemals von einem Kunststudenten unter dreißig gehört, der nicht arm gewesen wäre?», erwiderte ich.«Auf mein Wort, ich muss mein erstes Bild erst noch verkaufen. Und was meine Einsamkeit angeht, so gibt es auf der ganzen Welt keine fünf Menschen, denen wirklich etwas an mir liegt.»
« Wirklich etwas an Ihnen liegt? Ich fürchte, Sie nehmen es zu genau. Außerdem halte ich fünf gute Freunde für eine ganze Menge. Ich schätze mich mit zweien schon sehr glücklich. Aber wenn Sie keine Freunde haben, sind Sie wahrscheinlich selbst daran schuld.»
« Vielleicht», sagte ich, während ich im Schaukelstuhl Platz nahm,«vielleicht aber auch nicht. Finden Sie mich denn so schrecklich abweisend? Finden Sie mich nicht vielmehr recht gesellig?»
Sie verschränkte die Arme und schaute mich einen Augenblick lang schweigend an, ehe sie antwortete. Es würde mich nicht wundern, wenn ich ein wenig rot geworden wäre.
« Mit einem Wort, Mr Locksley, Sie möchten ein Kompliment hören. Ich habe Ihnen kein einziges Kompliment gemacht, seit Sie hier sind. Wie sehr müssen Sie gelitten haben! Aber es ist schade, dass Sie nicht noch ein Weilchen gewartet haben, anstatt jetzt einen so plumpen Köder auszulegen. Für einen Künstler zeigen Sie wenig künstlerisches Gespür. Männer können einfach nicht warten. Finde ich Sie ‹abweisend›? Finde ich Sie nicht ‹gesellig›? Angesichts dessen, was mir durch den Kopf geht, ist es vielleicht doch gar nicht so schlecht, dass Sie ein Kompliment hören wollten. Ich finde Sie charmant. Ich sage das ganz offen; aber ebenso aufrichtig sage ich auch, dass meiner Meinung nach nur sehr wenige andere Menschen Sie charmant fänden. Ich kann entschieden behaupten, dass Sie nicht gesellig sind. Dafür sind Sie viel zu wählerisch. Sie sind mir gegenüber aufmerksam, weil Sie wissen, dass ich weiß, dass Sie es sind. Sehen Sie, das ist der entscheidende Punkt: Ich weiß, dass Sie wissen, dass ich es weiß. Unterbrechen Sie mich nicht; ich werde jetzt meine ganze Beredsamkeit aufbieten. Ich möchte, dass Sie verstehen, warum ich Sie nicht für gesellig halte. Sie nennen Mr Johnson eingebildet; aber, ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass er auch nur halb so eingebildet ist wie Sie. Sie sind zu eingebildet, um gesellig zu sein; das ist er nicht. Ich bin eine unbedeutende, einfältige Frau – einfältig, Sie wissen schon, im Vergleich zu Männern. Mich kann man gönnerhaft behandeln – ja, das ist das richtige Wort. Wären Sie ebenso liebenswürdig zu jemandem, der genauso stark, genauso scharfsichtig ist wie Sie, zu jemandem, dem es genauso widerstrebt wie Ihnen, einem anderen