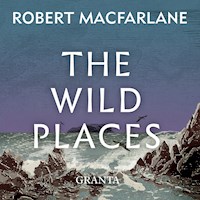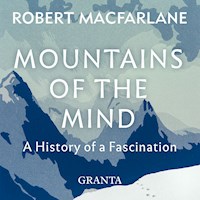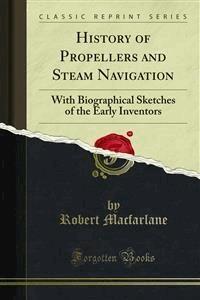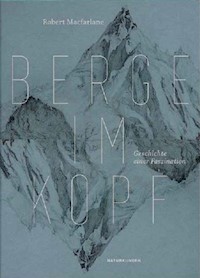
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Naturkunden
- Sprache: Deutsch
Gipfel zu besteigen ist eine kulturelle Erfindung, die vor dreihundert Jahren begann und nicht nur spektakuläre Blicke in jähe Abgründe bot, sondern auch in die nicht minder schwindelerregende Vergangenheit der Erde. In der Romantik wandelten sich die Berge endgültig vom gemiedenen Ort des Schreckens zu einem der Anziehung. Die vermeintliche Heimat von Drachen wurde zum begehrten Ziel menschlichen – vor allem männlichen – Forscherdrangs. Ob Naturwissenschaftler oder Abenteurer, ob Philosophen oder Poeten, sie alle versprachen sich in den eisigen, sauerstoffarmen Höhen unvergleichliche Erfahrungen und Erkenntnisse, für die es sein Leben zu riskieren lohnt: der Sog von Macht und Angst, das Gefühl von Erhabenheit und das Erleben fragiler Schönheit. In seinem preisgekrönten Debüt, das ihn schlagartig bekannt machte, folgt Robert Macfarlane den Vorstellungswelten der bisweilen fatalen Faszination, die Auftürmungen von Granit-, Basalt- und Kalksteinschichten bis heute in Menschen auslösen, sodass sie nichts anderes mehr als Berge im Kopf haben. Wie kein Zweiter weiß Macfarlane, das eigene Erleben mit dem Gelesenen zu verbinden. Anschaulich und ebenso belesen wie lebendig verbindet er die eigenen Klettererfahrungen mit den Berichten legendärer Bergaufstiege, wie beispielsweise dem Versuch George Mallorys am Mount Everest, von dessen Höhen dieser 1924 nicht wiederkommen wird. Drei Jahre vor seinem Tod schreibt er an seine Frau Ruth: "Der Everest hat die steilsten Grate und die furchtbarsten Abgründe, die ich je gesehen habe. Liebling – ich kann dir nicht beschreiben, wie sehr er von mir Besitz ergriffen hat."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Macfarlane
BERGEIMKOPF
Geschichte einer Faszination
Aus dem Englischen vonGaby Funk
Für meine Großeltern
NATURKUNDEN NO. 65
herausgegeben von Judith Schalansky
bei Matthes & Seitz Berlin
INHALT
1 BESESSENHEIT
2 DAS GROSSE BUCH AUS STEIN
3 VOM STREBEN NACH ANGST
4 GLETSCHER UND EIS: STRÖME DER ZEIT
5 HÖHE: DER GIPFEL UND DIE AUSSICHT
6 JENSEITS ALLER KARTEN
7 EIN NEUER HIMMEL UND EINE NEUE ERDE
8 EVEREST
9 DER SCHNEEHASE
Anmerkungen
Danksagung
Verwendete Literatur
Abbildungen
Register
»O the mind, mind has mountains …«
GERARD MANLEY HOPKINS (1844–1889), CA. 1880
1
BESESSENHEIT
»Ich dachte an die grenzenlose Leidenschaft, die Männer dazu bringt, beängstigende Aufstiege zu unternehmen. Nichts kann sie davon abhalten, […] ein Berg kann dieselbe unwiderstehliche Anziehungskraft ausüben wie ein Abgrund.«
THÉOPHILE GAUTIER, 1868
Ich war zwölf Jahre alt, als ich im Haus meiner Großeltern im schottischen Hochland erstmals auf eine der großen Bergsteigergeschichten stieß: Der Kampf um den Everest, ein Bericht über die britische Expedition von 1924, bei der George Mallory und Andrew Irvine in Gipfelnähe verschwanden.
Wir verbrachten den ganzen Sommer in diesem Haus. Mein Bruder und ich durften überall hingehen, außer in das Arbeitszimmer meines Großvaters, das sich am Ende des Flurs befand. Wenn wir Verstecken spielten, kroch ich oft in den großen Schrank in unserem Zimmer. Er roch stark nach Kampfer, und auf dem Schrankboden lagen überall Schuhe herum, sodass es schwierig war, aufrecht zu stehen. Auch der Pelzmantel meiner Großmutter hing darin; er war von einer Plastikfolie umhüllt, um die Motten fernzuhalten. Es war ein seltsames Gefühl, die Hand auszustrecken, um den weichen Pelz zu berühren, und stattdessen den glatten Kunststoff zu spüren.
Der schönste Raum im Haus war der Wintergarten, den meine Großeltern das Sonnenzimmer nannten. Der Boden war mit grauen Steinplatten ausgelegt und immer kalt; zwei seiner Wände waren riesige Fenster. An eines dieser Fenster hatten meine Großeltern den Umriss eines Habichts geklebt, den sie aus schwarzem Karton ausgeschnitten hatten, der kleinere Vögel abschrecken sollte. Aber regelmäßig flogen welche gegen das Fenster und starben, weil sie das Glas für Luft hielten.
Es war zwar Sommer, aber dennoch war das Innere des Hauses von der kalten, mineralischen Luft des Hochlands erfüllt, und jede Oberfläche, die man berührte, fühlte sich kühl an. Beim Essen lag das massive Silberbesteck, das aus der Anrichte hervorgeholt wurde, schwer und kalt in unseren Händen. Abends, wenn wir ins Bett gingen, waren die Laken eisig. Ich kroch so tief hinein wie möglich und zog mir die Bettdecke über den Kopf, um einen Hohlraum zu erzeugen. Darin atmete ich so tief ein und aus, wie ich konnte, bis ich das Bett aufgewärmt hatte.
Überall im Haus gab es Bücher. Mein Großvater hatte gar nicht versucht, sie zu ordnen, und so standen sehr unterschiedliche Bücher direkt nebeneinander. Den Platz auf einem kleinen Regal im Esszimmer teilten sich neben Mr. Crabtree Goes Fishing, Der Hobbit und The Fireside Omnibus of Detective Stories auch die beiden ledergebundenen Bände von John Stuart Mills System der deduktiven und induktiven Logik. Es gab mehrere Bücher über Russland, deren Titel ich nicht ganz verstand, und Dutzende über Entdeckungsreisen und Bergsteigen.
Eines Nachts konnte ich nicht schlafen und ging hinunter, um mir etwas zum Lesen zu holen. Auf einer Seite des Flurs lag ein hoher Stoß aus aufeinander gestapelten Büchern. Etwa aus der Mitte des Stapels zog ich mehr oder weniger zufällig einen großen grünen Band heraus, wie einen Ziegelstein aus einer Mauer, und ging damit ins Sonnenzimmer. Im hellen Mondlicht setzte ich mich auf die breite, steinerne Fensterbank und begann Der Kampf um den Everest zu lesen.
Das eine oder andere darüber wusste ich schon von meinem Großvater, der mir von der Expedition erzählt hatte. Aber mit seinen ausführlichen Beschreibungen, den 24 Schwarz-Weiß-Bildern und den ausfaltbaren Landkarten, auf denen so exotische Namen wie Östlicher Rongbuk-Gletscher, Dzongpen von Shekar und Lhapka La verzeichnet waren, war das Buch doch um einiges beeindruckender als sein Bericht. Beim Lesen wurde ich davongetragen bis in den Himalaja. Bilder stürmten auf mich ein. Ich sah die endlosen Steinwüsten Tibets, die sich bis zu den weißen Bergen in der Ferne hinzogen; ich sah die dunkle Pyramide des Everest, die Sauerstoffflaschen auf den Rücken der Bergsteiger, die sie wie Taucher aussehen ließen. Ich sah die mächtigen Eiswände am Nordsattel, welche die Männer mithilfe von Fixseilen und Leitern überwanden wie mittelalterliche Soldaten die Festungsmauern einer feindlichen Stadt, und schließlich das mit Schlafsäcken in den Schnee gelegte schwarze T bei Lager IV, das den Bergsteigern in den unteren Lagern, die mit Fernrohren die Gipfelregion beobachteten, anzeigte, dass Mallory und Irvine verschollen waren.
Eine Stelle ergriff mich mehr als alle anderen. Es war jene, in der Noel Odell, der Geologe der Expedition, jenen Moment beschreibt, in dem er Mallory und Irvine zum letzten Mal sah:
Auf einmal lichtete sich der Nebel über mir und der Gipfel wurde klar. Auf einem Schneefelde unter der vorletzten Stufe zur Gipfelpyramide erspähte ich einen schwarzen Punkt, der sich der Felsenstufe näherte. Ein zweiter folgte, während der erste den Vorsprung erkletterte. Leider zog sich der Vorhang wieder zu …1
Immer wieder las ich diese Stelle und wünschte mir nichts sehnlicher, als einer dieser beiden winzigen Punkte zu sein und in der dünnen Luft ums Überleben zu kämpfen.
Das genügte – ich hatte mich dem Abenteuer verschrieben. In einem Anfall von Lesewut, wie er wegen der dafür erforderlichen Zeit nur in der Kindheit möglich ist, plünderte ich die Bibliothek meines Großvaters und hatte gegen Ende des Sommers etwa ein Dutzend der berühmtesten Expeditionsberichte von den Bergen der Welt und den beiden Polen gelesen, einschließlich der Leidensgeschichte von Apsley Cherry-Garrard in der Antarktis The Worst Journey in the World, John Hunts Mount Everest, Kampf und Sieg und Edward Whympers dramatischem Bericht von seinen Berg- und Gletscherfahrten in den Alpen.
Die kindliche Vorstellungskraft vertraut mehr als die von Erwachsenen darauf, dass eine Geschichte stimmt und alles tatsächlich so geschehen ist, wie es erzählt wird. Ein Kind kann sich auch besser einfühlen, und als ich diese Bücher las, erlebte ich das Geschehen intensiv mit, und als einer der Entdecker. Ich verbrachte mit ihnen die Abende in ihren Zelten und taute gefrorenen Pemmikan über einem Kocher auf, der mit Seehundfett betrieben wurde, während draußen der Wind pfiff. Ich zog meinen Schlitten durch hüfthohen Polarschnee. Ich stolperte über Schneeverwehungen, stürzte Rinnen hinab, kletterte über Grate und schritt auf Bergrücken aus. Von den Gipfeln der Berge blickte ich auf die Welt herab, als handele es sich dabei um eine Landkarte. Mindestens zehn Mal kam ich fast ums Leben.
Ich war fasziniert von den Entbehrungen, die diese Männer – denn es waren fast immer nur Männer – auf sich nahmen und aushielten. An den Polen war es so kalt, dass Weinbrand zu festem Eis gefror und die Zungen der Hunde an ihrem Fell kleben blieben, wenn sie versuchten, sich zu lecken. Auch die Bärte der Männer froren an ihren Jacken fest, wenn sie nach unten schauten. Bekleidung aus Wolle wurde durch die Kälte so steif wie Metall und musste mit einem Hammer weichgeklopft werden. In der Nacht mussten die Forschungsreisenden ihre beinhart gefrorenen Schlafsäcke aus Rentierfell zuerst mühsam Zentimeter für Zentimeter auftauen, bis sie hineinkriechen konnten. In den Bergen gab es Wechten, die wie waagrechte Wellen über die Gratkanten hinausragten, es gab die unsichtbaren Gefahren der Höhe sowie Lawinen und Schneestürme, welche die Welt in einem einzigen Augenblick in ein weißes Nichts verwandeln konnten.
Vorläufige Karte der Mount-Everest-Expedition von 1921
Abgesehen von Hillarys und Tenzings erfolgreicher Besteigung des Everest im Jahr 1953 und der Rettung der gesamten Crew von Ernest Shackleton im Jahr 1916 – nachdem Frank Worsley, der Kapitän der »Endurance«, seine unglaubliche Navigationskunst bewiesen hatte und die »James Caird«, das kleine Rettungsboot, 800 Meilen (1288 Kilometer) durch die stürmische See des südlichen Ozeans gesteuert hatte, um zusammen mit Shackleton einen Rettungstrupp für die zurückgebliebene Mannschaft der »Endurance« zu organisieren, woran Shackleton unerschütterlich festhielt, während das alte Europa wie Packeis auseinanderbrach – führten fast alle diese Geschichten zum Tod oder zu irgendeiner Form von Verstümmelung. Ich mochte diese grässlichen Details. In einigen der Pol-Abenteuer gab es kaum eine Seite, auf der nicht der Verlust eines Crewmitglieds oder eines Körperteils zu beklagen war. Zuweilen bedeutete Körperteil zwangsläufig Teammitglied. Auch Skorbut wütete unter den Entdeckern und führte dazu, dass das Fleisch sich auflöste und wie feuchter Biskuit von den Knochen fiel. Ein Mann litt so sehr daran, dass ihm am ganzen Körper das Blut aus den Poren quoll.
Da war aber noch etwas anderes an diesen Geschichten, was mich tief bewegte: die Schauplätze, an denen sie spielten. Die Kargheit der Landschaft, in der die Männer unterwegs waren, zog mich an – die Wüstenlandschaften der Berge und der Pole mit ihrem strengen manichäischen Dualismus von Schwarz und Weiß. Auch sittliche Werte wurden in diesen Berichten polarisiert. Mut und Feigheit, Ruhe und Anstrengung, Gefahr und Sicherheit, richtig und falsch: Die unerbittliche Natur ihrer Umgebung ordnete alles nach diesem binären Prinzip. Ich wünschte mir, dass mein Leben auch immer so geradlinig verlaufen würde, so einfach hinsichtlich seiner Prioritäten.
Ich begann diese Männer zu lieben: die Polarforscher mit ihren Schlitten, ihren Liedern und ihrer Schwäche für Pinguine ebenso wie die Bergsteiger mit ihren Pfeifen, ihrer Unbekümmertheit und ihrem Durchhaltevermögen. Ich liebte die Widersprüchlichkeit zwischen ihrer rauen Erscheinung – die robusten Kniebundhosen aus Tweed, die stoppeligen Koteletten und Schnurrbärte, die Seide und das Bärenfett, mit dem sie sich vor der Kälte schützten – und ihrer fast schon elitären Sensibilität für die Schönheit der Landschaften, durch die sie sich bewegten. Hinzu kam die Kombination aus unglaublichem Wagemut und aristokratischer Finesse – beispielsweise wurden bei der Expedition zum Everest im Jahr 1924 sechzig Dosen Wachteln in Gänseleberpastete und ein edler Jahrgang Montebello-Champagner mitgeschleppt, zu deren Genuss sich die Teilnehmer Fliegen umbanden. Und die Akzeptanz, dass ein gewaltsamer Tod wenn nicht wahrscheinlich, so doch immerhin leicht möglich war.
Sie schienen mir damals die vorbildlichen Reisenden zu sein: unbeeindruckt von Hindernissen und die Bescheidenheit in Person. Ich sehnte mich danach, so zu sein wie sie. Ich sehnte mich besonders danach, die Widerstandskräfte des kleinen Birdie Bowers zu besitzen, Scotts rechter Hand, der sich während der Seereise auf der »Terra Nova« jeden Morgen an Deck mit einem Eimer Meerwasser wusch und in der Lage war, bei Temperaturen von minus 30 Grad Celsius tief und fest zu schlafen – ja, zu schlafen.
Vor allem aber fühlte ich mich zu diesen Männern hingezogen, die weit reisten, um die Gipfel der höchsten Berge zu besteigen. So viele von ihnen kamen dabei ums Leben. Ich lernte die Liste der Opfer auswendig: Mallory und Irvine am Everest, Mummery am Nanga Parbat, Donkin und Fox am Koshtan Tau im Kaukasus … Die Liste ging weiter und weiter, durch die Ränge der weniger bekannten Toten. Die Bergsteiger beflügelten meine Fantasie ähnlich wie die Polarexpeditionen: durch die Schönheit und Gefährlichkeit der Landschaft, durch die Weite des Raumes, durch die völlige Nutzlosigkeit des Ganzen – nur eben in großen Höhen anstatt in hohen Breitengraden. Sicherlich hatten diese Leute ihre Fehler. Sie waren anfällig für die Sünden ihrer Zeit: Rassismus, Sexismus und ausgeprägter Snobismus. In ihre Tapferkeit mischte sich ein starker Egoismus. Aber damals bemerkte ich diese Charakterzüge nicht. Alles, was ich sah, waren unglaublich tapfere Männer, die hinaustraten in das verheißungsvoll glitzernde Licht des Unbekannten.
Das Buch, das zweifellos den stärksten Eindruck bei mir hinterlassen hat, war Annapurna von Maurice Herzog, das er 1951 von einem Krankenhausbett aus diktierte. Er konnte es nicht selbst schreiben, weil er keine Finger mehr hatte. Herzog war der Leiter einer Mannschaft aus französischen Bergsteigern, die im Frühjahr 1950 mit dem Ziel in den nepalesischen Himalaja reiste, die erste Gruppe zu sein, die einen der vierzehn Achttausender der Welt bestieg.
Nach einem mühseligen Monat der Gebietserkundung unter dem Zeitdruck des nahenden Monsuns gelangte das französische Team schließlich in das Zentrum des Annapurna-Massivs, eine entlegene Welt aus Fels und Eis, die von den höchsten Bergen der Welt wie von einem Ring umschlossen ist. »Der Talkessel, in dem wir uns befinden, ist völlig unerschlossen: Noch nie hat ein Mensch die Berge ringsumher gesehen«, schrieb Herzog.
Kein einziges Tier, keine Pflanze gedeiht hier. Im reinen Licht des Morgens erhöht das Fehlen jedes Lebens, die Vereinsamung der Natur, nur unsere innere Kraft. Wer mag die Erhebung verstehen, die wir aus diesem Nichtsein schöpfen, während sich die Menschen an der üppigen Mannigfaltigkeit der lebendigen Natur begeistern?
Langsam kam die Mannschaft am Berg immer höher, indem sie nach und nach Hochlager errichtete. Die Höhe, die extreme Kälte und die schweren Lasten begannen, ihren Tribut zu fordern. Aber je schwächer Herzog körperlich wurde, desto stärker wurde seine Überzeugung, dass der Gipfel erreichbar sei. Am 3. Juni schließlich verließen Herzog und der Bergführer Louis Lachenal aus Chamonix das am höchsten gelegene Lager V, um zu versuchen, den Gipfel der Annapurna zu erreichen.
Der Schlussanstieg des Berges verlief über eine lange, gebogene Eisrampe, die das Team »Sichelgletscher« getauft hatte, und über einen steilen Felsriegel bis zum Gipfel. Abgesehen von diesem Felsaufschwung bot die Route keine technischen Schwierigkeiten, und da Herzog und Lachenal froh darüber waren, Gewicht sparen zu können, ließen sie ihr Seil zurück.
Das Wetter war schön und wolkenlos, als sie von Lager V aufbrachen. Doch ein klarer Himmel verursacht die niedrigsten Temperaturen, und es war so kalt, dass beide Männer beim Höhersteigen spürten, wie ihre Füße erfroren. Bald war klar, dass sie entweder umkehren müssten oder Gefahr liefen, ernsthafte Erfrierungen davonzutragen. Sie setzten den Aufstieg fort.
In seinem Bericht beschreibt Herzog, wie er sich immer mehr von dem löst, was geschieht. Die reine, dünne Luft, die kristallene Schönheit der Berge und die seltsame Schmerzlosigkeit der Erfrierungen sorgten dafür, dass er in einen Zustand der dumpfen Gelassenheit geriet, die ihn unempfindlich machten gegenüber seinen schlimmer werdenden Erfrierungen.
Die Art, wie ich meinen Gefährten und meine Umgebung sehe, hat etwas Unwirkliches … Innerlich muss ich über unsere jämmerlichen Anstrengungen lächeln. Zugleich sehe ich mir bei all meinen Bewegungen von außen zu. Doch sie sind gar nicht mehr angestrengt, es ist, als wäre die Schwerkraft aufgehoben. Diese durchsichtigen, in höchster Reinheit sich darbietenden Formen sind nicht mehr der Berg, den ich ersteige. Es ist ein Berg, den ich träume.
Noch immer wie in Trance – und für die Schmerzen unerreichbar – suchten sich Herzog und Lachenal einen Weg durch den abschließenden Felsriegel und erreichten den Gipfel:
Lachenal stampft mit den Füßen auf: Er fühlt, dass sie erstarren. Ich auch. Aber ich achte kaum darauf. Der höchste Gipfel, den Menschen je bezwangen! Er liegt unter unseren Füßen! Vor meinem Geist zieht die Reihe unserer Vorgänger, der großen Pioniere des Himalaja, vorüber: Mummery, Mallory und Irvine, Bauer, Welzenbach, Tilman, Shipton … Wie viele sind tot, wie viele fanden in diesen Bergen ein Ende, wie sie es sich schöner nicht wünschen konnten? […] Mein Ende ist nahe, ich fühle es, aber es ist ein Ende, wie alle Bergsteiger es sich wünschen, im Einklang mit der Leidenschaft, die sie ihr Leben lang beseelt. Ich war den Bergen mit weit offenen Sinnen dankbar dafür, dass sie sich mir heute in ihrer ganzen Schönheit zeigen. Ich empfinde ihr Schweigen wie die Stille einer Kirche. Ich leide nicht und fühle nicht die geringste Bangigkeit.
Das Leiden und die Angst kamen später. Während Herzog über den Felsriegel abstieg, verlor er seine Handschuhe, und als er das Lager IV erreichte, war er kaum noch in der Lage zu gehen. Sowohl an seinen Füßen als auch seinen Händen hatte er schwerste Erfrierungen davongetragen. Während des verzweifelten Rückzugs über steiles Gelände hinab ins Basislager stürzte er und brach sich mehrere Knochen in seinen bereits fürchterlich zugerichteten Füßen. Als er sich abseilen musste, riss ihm das Seil die Haut in dicken Streifen von den Händen.
Sobald das Gelände flacher wurde, konnte Herzog getragen werden, und er wurde in einem Tragesack, in einem Korb, auf einem Schlitten und zuletzt auf einer Trage vom Berg heruntergebracht. Während des Rückmarschs waren seine Hände und Füße in Plastikfolie eingepackt, um sie vor weiteren Schäden zu schützen. Erreichten sie abends das Lager, spritzte ihm Expeditionsarzt Oudot das Betäubungsmittel Novocain, ferner Acetylcholin und Penizillin in die Arterien der Oberschenkel und Unterarme, indem er ihm die lange Nadel in die linke und die rechte Leiste und in seine Ellbogen stieß. Das war eine so schmerzhafte Erfahrung, dass Herzog darum bettelte, ihn sterben zu lassen. Im Tal angelangt, waren seine Füße schwarz und braun geworden; als sie Gorakpur erreichten und in Sicherheit waren, hatte Oudot ihm fast alle Zehen und Finger amputiert.
Ich las Annapurna in diesem Sommer drei Mal. Es leuchtete mir ein, dass Herzogs Entscheidung für den Gipfel richtig war, obwohl er sie teuer bezahlen musste. Was waren schon Zehen und Finger, da waren er und ich uns einig, im Vergleich dazu, auf diesen wenigen Quadratmetern Schnee gestanden zu haben? Selbst wenn er gestorben wäre, hätte es sich gelohnt. Das war die Lehre, die ich aus Herzogs Buch zog: Der schönste Tod ist der auf einem Gipfel – lieber Gott, bewahre mich vor einem Tod in den Tälern.
12 Jahre nachdem ich Annapurna zum ersten Mal gelesen hatte – 12 Jahre, in denen ich fast alle meine Ferien in den Bergen verbracht hatte –, stieß ich in einem Antiquariat in Schottland auf eine weitere Ausgabe. In dieser Nacht saß ich lange da und las es noch einmal durch, und es zog mich wieder in seinen Bann. Kurz darauf verabredete ich mich mit einem Kletterpartner, einem Freund aus dem Militärdienst mit dem Namen Toby Till, und buchte Flüge für eine Woche in den Alpen.
Wir kamen Anfang Juni in Zermatt an und hofften, das Matterhorn noch klettern zu können, bevor im Sommer die Horden einfielen und die Route blockierten. Der Berg war jedoch noch in einen dicken Eispanzer gehüllt, ein Besteigungsversuch war uns zu gefährlich. So fuhren wir ins nächste Tal weiter, wo die Schneeschmelze schon weiter sein sollte. Wir hatten vor, hoch oben zu zelten und am nächsten Morgen das Lagginhorn über seinen leichten Südostgrat zu besteigen. Ich dachte kurz darüber nach, dass das Lagginhorn mit 4 010 Metern fast genau halb so hoch ist wie die Annapurna.
In der Nacht schneite es. Ich lag wach und lauschte dem Geräusch der schweren Schneeflocken, die auf das Überzelt fielen. Sie verklumpten und bildeten dunkle Schattenkontinente auf dem Stoff, bis diese für die abschüssige Zeltbahn zu schwer wurden und mit einem leisen Zischen auf den Boden hinabrutschten. In den frühen Morgenstunden hörte es auf zu schneien, aber als wir morgens um 6 Uhr den Reißverschluss des Eingangs öffneten, schimmerte ein Unheil verkündender gelblicher Lichtschein wie ein Sturmbote durch die Wolken. Es war uns nicht ganz geheuer, als wir in Richtung Grat aufbrachen.
Als wir den Grat betreten hatten, stellte er sich als schwieriger heraus, als er von unten ausgesehen hatte. Das Problem war die etwa ein Meter tiefe Altschneeschicht auf den Felsen, die noch einmal von 15 Zentimeter Neuschnee bedeckt war. Die Schichten hatten sich nicht verbunden, der Neuschnee war feucht und schwer. Faulschnee ist entweder körnig wie Zucker oder er bildet einzelne Becherkristalle – egal, um welche Form es sich handelt, er erzeugt immer instabile Schichten in der Schneedecke.
Matterhorn
Anstatt einfach von Fels zu Fels zu klettern, mussten wir uns durch den Schnee wühlen und konnten nie sicher sein, ob wir beim nächsten Schritt auf Stein oder ins Leere treten würden. Es gab auch keine Spuren, denen wir hätten folgen können: Offensichtlich war seit dem letzten Sommer niemand mehr auf dem Grat gewesen. Und außerdem war es kalt, schneidend kalt. Wenn mir die Nase lief, froren die Rinnsale sofort auf meinem Gesicht fest. Der Wind ließ meine Augen tränen, und die Wimpern meines rechten Auges froren zusammen. Ich musste sie voneinander trennen, indem ich mit meinen Fingern die Lider auseinanderzog.
Nach zwei Stunden Arbeit näherten wir uns dem Gipfel, doch der Grat wurde steiler und wir kamen daher noch langsamer vorwärts. Ich spürte die Kälte bis in die Knochen. Ich hatte auch den Eindruck, dass mein Gehirn langsamer und weniger präzise arbeitete, so als ob die Kälte meine Gedanken eingefroren und zähflüssig gemacht hätte. Natürlich hätten wir umkehren können. Doch wir gingen weiter.
Die letzten 15 Meter zum Gipfel waren wirklich sehr steil und führten durch tiefen, unverfestigten Schnee. Ich hielt an, um die Lage zu beurteilen. Es sah aus, als könnte der Berg jeden Augenblick den ganzen Schnee abwerfen, so wie man sich eines Mantels entledigt. Hin und wieder glitten kleinere Schneerutsche an mir vorbei. Ich hörte das Geräusch von fallenden Steinen aus der Ostwand des Berges.
Ich hatte die Spitzen meiner Schuhe in den Schnee gerammt, vor mir baute sich der steile Hang auf. Ich bog meinen Kopf nach hinten und schaute zum Himmel hinauf. Wolken rasten über den Gipfel, und einen Moment lang schien der Berg langsam auf mich herabzustürzen.
Ich drehte mich um und rief zu Toby, der ein paar Meter unter mir stand, hinab: »Sollen wir weitergehen? Mir gefällt das hier nicht. Das Ganze kann jederzeit ins Rutschen kommen.«
Unterhalb von Toby verengte sich der Hang zu einer Rinne, die auf den Steilabbruch an der Südseite des Grates zulief. Wenn ich ausrutschte oder der Schnee unter mir nachgab, würde ich an Toby vorbei rutschen, ihn aus dem Stand reißen, und dann würden wir Hunderte von Metern im freien Fall auf den Gletscher hinabstürzen.
»Natürlich gehen wir weiter, Rob, klar!«, rief Toby zurück.
»Gut.«
Ich hatte nur ein Eisgerät dabei, aber der Hang war so steil, dass zwei angebracht gewesen wären. Improvisation war gefragt. Ich nahm den Pickel in die linke Hand und machte die gekrümmten Finger der rechten Hand so steif wie möglich. Ich würde versuchen, sie in den Schnee zu rammen und wie eine Eishaue einzusetzen, um Halt zu bekommen. Nervös ging ich los.
Der Schnee hielt, der Behelfspickel bewährte sich, und plötzlich standen wir auf einem Gipfel von der Größe eines Küchentisches und klammerten uns an die aus dem Schnee ragenden Eisenstangen des Gipfelkreuzes, starr vor Angst und begeistert zugleich. Rings um uns gähnte der Abgrund. Es war, als balancierten wir auf der Spitze des Eiffelturmes. Die Wolken hatten sich verzogen, und gleißend weißes Licht hatte die Düsternis des frühen Morgens verdrängt. Ich entdeckte den gelben Punkt unseres Zeltes Hunderte von Metern unter uns. Aus dieser Höhe betrachtet löste sich der Gletscher, den wir am Tag vorher überquert hatten, um zum Fuß des Grates zu kommen, in ein Muster aus flachen, bleichen Wellen auf. Ich sah Dutzende kleine Schmelzwasserseen, die sich in den Vertiefungen zwischen den Wellen gebildet hatten und die im Sonnenlicht wie Spiegel blinkten. Ihre Bläue war atemberaubend. Im Westen ergoss sich das Licht der aufgehenden Sonne über die Flanken der Mischabelgruppe. Der eisige Wind peitschte gegen meine Wangen, bis sie gefühllos wurden, und drang kalt durch die kleinsten Öffnungen meiner Bekleidung.
Ich blickte auf meine Hände. Ich hatte während des ganzen Aufstiegs dünne Handschuhe getragen, aber nachdem ich die Hand immer wieder in den harten Schnee gerammt hatte, waren drei Fingerspitzen am rechten Handschuh aufgerissen. Diese Finger spürte ich nicht mehr. Eigentlich spürte ich die ganze Hand nicht mehr, wie ich seltsamerweise ohne jede Spur von Beunruhigung feststellte. Ich hielt die Hand vor meine tränenden Augen. Die Fingerkuppen, die der eisigen Luft ausgesetzt gewesen waren, hatten eine wächserne gelbliche Farbe angenommen und wirkten durchsichtig wie alter Käse.
Ich hatte keine Ersatzhandschuhe dabei. Aber es blieb sowieso keine Zeit, sich darüber zu sorgen, denn der Schnee, der beim Aufstieg unser Gewicht gerade noch gehalten hatte, wurde bestimmt schon von der Morgensonne aufgeweicht. Wir mussten so schnell wie möglich hinunter.
Beim Abstieg kamen wir rasch und effizient voran, bis wir schließlich auf ein letztes Hindernis stießen. Es war eine Schneebrücke, ein schmaler, leicht durchhängender Schneegrat von etwa 9 Meter Länge, der sich wie ein zum Trocknen aufgehängtes Laken zwischen zwei Felsnadeln spannte. Er war viel zu scharf und zu zerbrechlich, um direkt auf ihm zu queren, aber es gab auch keine Möglichkeit, ihn zu umgehen. Wir mussten also an der Flanke des Grates entlangqueren, so wie wir es beim Aufstieg schon getan hatten, und würden dabei ein ungleich größeres Risiko eingehen, dass das Gebilde zusammenbricht und uns mit in die Tiefe reißt.
Toby begann, sich einen kleinen Sitzplatz in den weichen Schnee zu treten.
»Gehe ich angesichts deiner Bemühungen richtig davon aus, dass ich vorgehen soll?«, fragte ich ihn.
»Ja, bitte, das wäre großartig!«
Ich stieg vorsichtig ein und schlug die Steigeisen in die fast senkrechte Flanke des Grates, während sich das Seil zwischen Toby und mir waagrecht spannte. Wo immer ich meinen Fuß auch hinsetzte, der Schnee rutschte wie nasser Zucker mit einem Zischen weg. Da bin ich nun, dachte ich mir, stehe in einer fast senkrechten Wand aus matschigem Schnee und quere sie seitlich wie eine Krabbe, mit Frostschäden an drei Fingern und nur einem Eisgerät. Ich verfluchte Maurice Herzog. Dann schaute ich hinunter.
Zwischen meinen Beinen blickte ich ins Nichts. Als ich wieder ein Steigeisen in den Schnee stieß, löste sich unter meinem Fuß ein großer Brocken, stürzte, sich mehrmals überschlagend, hinab in Richtung Gletscher und zerfiel. Ich hing an der Flanke, beide Arme nach oben gestreckt, und sah ihm nach. In meinem Hintern spürte ich ein Prickeln, das sich nach vorn in die Leisten und zu den Oberschenkeln ausbreitete. Bald war mein gesamter Unterleib nur noch ein summender, wimmelnder Schwarm der Angst. Der Abgrund unter mir wirkte riesig und bösartig, so als ob er mich einsaugen und in seine Leere mitreißen wollte.
Nur ein Eisgerät – warum hatte ich nur eines mitgenommen? Wieder benutzte ich meine rechte Hand, die mit den wächsernen Fingern, um sie in den Schnee zu stoßen. Die Finger schmerzten nicht, das war hilfreich. So stieg ich in einem regelmäßigen Rhythmus weiter: Schritt, Schritt, greifen, greifen, fluchen. Schritt, Schritt, greifen, greifen, fluchen.
Natürlich schafften wir es – andernfalls würde ich dies nicht schreiben können –, und als wir dann, unsere Rucksäcke als Schlitten benutzend, über die restlichen Hänge zu unserem Zelt hinabfuhren, jauchzten wir vor Freude und Erleichterung, dass wir es bis zum Gipfel und wieder zurück geschafft hatten.
Als ich zwei Stunden später auf einem Felsblock neben dem Zelt saß, schaute ich meine Finger mit müdem Desinteresse an. Es war doch noch ein schöner Tag geworden, warm und windstill, und die Landschaft erstrahlte im klaren gleichmäßigen Sonnenlicht großer Höhe. Geräusche waren in dieser dünnen Luft weithin hörbar, und ich vernahm das Klimpern und Reden der Bergsteiger, die nicht ganz einen Kilometer entfernt vom Weissmies abstiegen. Meine rechte Hand fühlte sich nicht so recht an, als sei sie ein Teil von mir. Ich war dann doch irgendwie erleichtert festzustellen, dass nur die Kuppen meiner drei Finger betroffen waren, und das nicht einmal besorgniserregend tief. Als ich mit ihnen gegen den Felsen klopfte, war ein harter, hohler Ton zu hören, wie wenn Holz gegen Metall schlägt. Ich holte mein Taschenmesser heraus und begann sie zu schälen. Auf dem flachen grauen Felsen zwischen meinen Knien wuchs ein Häufchen kleiner Hautfetzen. Schließlich war ich auf der rosa Haut angelangt, und meine Fingerspitzen schmerzten bei jedem Ansetzen des Messers. Den Scheiterhaufen meiner Hautschichten verbrannte ich in der orangefarbenen Flamme eines Feuerzeugs. Sie verschwanden knisternd und begleitet vom Geruch verkohlten Fleisches.
Vor drei Jahrhunderten hätte man es noch für Wahnsinn gehalten, auf einen Berg zu steigen und dabei sein Leben aufs Spiel zu setzen. Damals konnte sich kaum jemand vorstellen, dass eine wilde Landschaft irgendeinen Reiz ausüben könne. Im Denken des 17. und frühen 18. Jahrhunderts wurde eine Landschaft vor allem danach beurteilt, wie fruchtbar sie war. Wiesen, Obstgärten, Weiden, ertragreiche Ackerböden – das waren ihre idealen Bestandteile. Verlockend war damals also die gezähmte, urbar gemachte Natur, eine Landschaft, der mit Pflug, Hecke und Graben eine menschliche Ordnung aufgezwungen wurde. Noch 1791 schrieb der Autor und Landschaftsmaler William Gilpin, »die Mehrheit der Menschen« würde die Wildnis nicht schätzen. »Es gibt kaum jemanden, der das geschäftige Treiben des Ackerbaus nicht den größten Werken der rauen Natur vorzieht.« Berge, die wildesten Werke der Natur, waren nicht nur für die Landwirtschaft unbrauchbar, sondern auch in ästhetischer Hinsicht abstoßend: Man hielt ihre zerklüfteten, gewaltigen Umrisse für etwas, das den natürlichen Gleichmut der Seele störte. Die höflicheren Menschen des 17. Jahrhunderts bezeichneten die Berge missbilligend als »Wüsten«; sie wurden aber auch als »Furunkel«, »Warzen«, »Geschwulste« und »Wucherungen auf dem Antlitz der Erde« abgewertet oder sogar, von den lippenähnlichen Graten und den vaginalen Talfurchen inspiriert, als »Scham der Natur« bezeichnet.
Zudem waren Berge gefährliche Aufenthaltsorte. Man glaubte, dass Lawinen bereits von so geringfügigen Anlässen ausgelöst werden konnten wie einem Hüsteln, dem Bein eines Käfers oder dem Flügelschlag eines Vogels, der dicht über einen schneebeladenen Hang dahinfliegt. Man konnte in den blauen Schlund einer Gletscherspalte stürzen und erst Jahre später zerschlagen und steif gefroren vom Gletscher wieder ausgespuckt werden. Oder man konnte einem Gott, einem Halbgott oder einem Ungeheuer begegnen, die verärgert waren, weil man ihr Territorium durchquert hatte – Berge galten traditionell als Sitz des Übernatürlichen und Feindseligen. In seinen berühmten Reisen beschreibt Jean de Mandeville den Stamm von Mördern, die, angeführt vom mysteriösen »Alten Mann der Berge«, hoch oben unter den Gipfeln des Elbrus-Massivs leben. In Thomas Morus’ Utopia hausen »im Hochgebirge« die Zapoleten, ein »furchterregendes, wildes und grausames Volk«. Zugegebenermaßen waren Berge in der Vergangenheit ein Ort der Zuflucht für Völker im Belagerungszustand – beispielsweise flohen Lot und seine Töchter ins Gebirge, als sie aus Zoar vertrieben wurden –, aber allgemein waren sie eine Landschaftsform, die es zu meiden galt. Es hieß, dass man Berge um jeden Preis umgehen sollte, und so ging man an ihren Flanken entlang oder, falls absolut notwendig – wie etwa für viele Händler, Soldaten, Pilger und Missionare – durchquerte sie, bestieg aber sicherlich nicht ihre Gipfel.
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts suchte man jedoch erstmals die Berge aus anderen Beweggründen auf als aus reiner Notwendigkeit. Und mit der Zeit entwickelte sich ein allgemeines Bewusstsein für die Schönheit der Gebirgslandschaft. 1786 wurde der Gipfel des Mont Blanc erreicht, und das Bergsteigen im eigentlichen Sinn entstand Mitte des 19. Jahrhunderts aus wissenschaftlichem Erkenntnisdrang (in der Frühzeit dieses Sports hätte kein Bergsteiger, der etwas auf sich hielt, einen Gipfel bestiegen, ohne dort oben wenigstens den Siedepunkt von Wasser zu bestimmen), war zweifellos aber auch von der Schönheit inspiriert. Die komplexe Ästhetik von Eis, Sonnenlicht, Fels, Höhe, senkrechten Abbrüchen und klarer Luft – was der englische Schriftsteller und Maler John Ruskin als die »endlose Klarheit des Raumes, die immerwährende Reinheit des ewigen Lichtes« bezeichnete – empfand der Mensch des ausgehenden 19. Jahrhunderts unbestritten als prachtvoll. Die Berge begannen eine starke und oft verhängnisvolle Anziehungskraft auf den menschlichen Geist auszuüben.
»Die Wirkung dieses seltsamen Matterhorns auf die Vorstellungskraft ist tatsächlich so groß, dass selbst die ernsthaftesten Philosophen sich ihr nicht entziehen können«, behauptete Ruskin 1862 stolz von seinem Lieblingsberg. Drei Jahre später wurde das Matterhorn erstmals bestiegen; beim Abstieg stürzten vier der erfolgreichen Erstbesteiger tödlich ab.
Um die Jahrhundertwende waren alle Alpengipfel bestiegen – die der Westalpen hauptsächlich durch Engländer und ihre einheimischen Führer –, und fast alle Alpenpässe auf Karten verzeichnet. Das sogenannte Goldene Zeitalter des Alpinismus war vorüber. Viele hielten die Berge Europas für passé, und das Interesse der Bergsteiger wandte sich dem Höhenbergsteigen zu, bei dem sie sich extremen Anstrengungen und noch größeren Risiken aussetzten, um die Gipfel des Kaukasus, der Anden und des Himalaja zu erreichen: Ushba, Popocatépetl, Nanga Parbat, Chimborazo oder Kasbek, an dem in der griechischen Mythologie Prometheus von Hephaistos an den Fels gekettet wurde.
Die Macht, die diese hohen Berge an der Schwelle zum 20. Jahrhundert auf ihre Bewunderer ausübten, war enorm, und oft wurden sie zum Objekt einer Besessenheit. Der Kangchendzönga, ein Achttausender, der bei gutem Wetter vom hoch gelegenen Darjeeling aus zu sehen ist, fesselte jahrzehntelang die Sahibs und Memsahibs, die im Sommer der Hitze des indischen Tieflands entflohen.
»Klar und sauber zeichnet sich der schneebedeckte Gipfel des Kangchenzönga vor dem dunkelblauen Himmel ab, so ätherisch wie der Geist, weiß und rein im Sonnenlicht […]. Wir sind erbaut«, stimmte Francis Younghusband an, der englische Offizier und Forschungsreisende, der die Briten 1904 bei ihrem Angriff auf Tibet anführte. Ein begieriges Publikum verfolgte 1892 über die Berichte in der Londoner Tageszeitung The Times die Geschicke der gewagten Expedition von Martin Conway zum Gasherbrum im Karakorum. Und der Everest, der höchste und mächtigste Gipfel von allen, verzauberte ganz Großbritannien, das diesen Berg weitgehend als den seinen betrachtete. Unter den Verzauberten war auch George Mallory, dessen Tod am Nordostgrat im Jahr 1924 die Nation schockierte. Ein Zeitungsnachruf für Mallory und Irvine machte voller Bewunderung auf die »enge geistige Verbundenheit zwischen den Menschen daheim und den Gipfelstürmern« aufmerksam.
Edward Lear, Kangchenjunga from Darjeeling, 1879
Die Gefühle und die Einstellungen, von denen die frühen Bergsteiger angetrieben wurden, bestimmen heute noch die Vorstellungen der westlichen Welt, wenn sie nicht sogar noch tiefer verwurzelt sind. Millionen von Menschen huldigen dem Kult der Berge. Das Senkrechte, das Wilde, das Eisige – all diese Landschaftsformen werden mittlerweile verehrt. Ihre Darstellungen durchdringen eine urbanisierte westliche Zivilisation, die immer gieriger nach Wildnis und Wildheit sucht, nach Grenzerfahrungen, selbst wenn es sich dabei nur um solche aus zweiter Hand handelt. Der Bergsport ist eine der am schnellsten wachsenden Freizeitaktivitäten der letzten zwanzig Jahre. Geschätzte 10 Millionen Amerikaner gehen jedes Jahr bergsteigen, 50 Millionen wandern. Rund 4 Millionen Briten halten sich für mehr oder weniger gute Berggänger. Weltweit wird der Umsatz mit Outdoor-Produkten und -Dienstleistungen auf 7,8 Milliarden Euro im Jahr geschätzt, Tendenz steigend.2
Was das Bergsteigen von anderen Freizeitaktivitäten unterscheidet, ist die Tatsache, dass manche seiner Anhänger dabei umkommen. Innerhalb von sieben mörderischen Wochen starben im Sommer 1997 in den Alpen 103 Menschen. Allein im Mont-Blanc-Gebiet ist die durchschnittliche Zahl der Todesfälle pro Jahr fast dreistellig. Es gibt Winter, in denen im schottischen Hochland mehr Menschen umkommen als auf den Straßen ringsum. Als Mallory den Everest anging, war dieser die letzte Bastion der Erde, die sich noch nicht hatte erobern lassen, der »Dritte Pol«. Heute ist er ein gigantischer, geschmackloser, eisiger Taj Mahal, eine kunstvoll mit Zuckerguss glasierte Hochzeitstorte, auf deren Hauptrouten Expeditionsveranstalter jährlich Hunderte von unerfahrenen Kunden hinauf- und hinablotsen. Seine Hänge sind mit Leichen aus der heutigen Zeit übersät: Die meisten liegen in jenem Bereich, der allgemein als Todeszone bezeichnet wird, in einer Höhe, in der sich der menschliche Körper nicht mehr erholt und einem allmählichen, aber unaufhaltsamen Degenerationsprozess unterworfen ist.
Im Verlauf von drei Jahrhunderten hat sich also in der westlichen Welt ein tiefgreifender Wandel in der Wahrnehmung der Berge vollzogen. Jene Eigenschaften, derentwegen die Berge einst gemieden wurden – Steilheit, Einsamkeit, Gefährlichkeit –, wurden nun als ihre größten Attraktionen gepriesen.
Diese Veränderung war so drastisch, dass sie – aus heutiger Perspektive betrachtet – verdeutlicht, wie stark unsere Reaktion auf Landschaften kulturell geprägt ist. Das heißt: Wenn wir eine Landschaft betrachten, sehen wir nicht das, was dort ist, sondern weitgehend das, was wir dort erwarten. Wir schreiben einer Landschaft Eigenschaften zu, die sie nicht von sich aus besitzt, Wildheit beispielsweise oder Trostlosigkeit, und bewerten sie entsprechend. Mit anderen Worten: Wir lesen Landschaften. Wir interpretieren ihre Formen vor dem Hintergrund unserer eigenen Erfahrung und Erinnerung sowie unseres gemeinsamen kulturellen Gedächtnisses. Obwohl die Menschen die Wildnis traditionsgemäß auch aufsuchten, um der Kultur oder den Konventionen zu entfliehen, haben sie diese Wildnis doch so wahrgenommen, wie alles wahrgenommen wird: nämlich durch einen Filter von Assoziationen. Der Dichter und Landschaftsmaler William Blake hat dies auf den Punkt gebracht. »Der Baum«, schrieb er, »der die einen zu Freudentränen rührt, ist in den Augen anderer nur ein grünes Ding, das im Weg steht.« Dasselbe gilt, historisch betrachtet, für die Berge. Jahrhundertelang galten sie als nutzlose Hindernisse, als »beträchtliche Auswölbungen«, wie Dr. Johnson sie abwertend bezeichnet hat. Nun werden sie zu den erlesensten Formen der Natur gezählt, und es gibt Leute, die aus Liebe zu ihnen bereit sind zu sterben.
Was wir einen Berg nennen, ist also in Wirklichkeit das Zusammenspiel der physischen Erscheinungsformen der Welt und der menschlichen Vorstellungskraft – ein Berg in unserem Kopf. Und wie sich der Mensch gegenüber den Bergen verhält, hat kaum etwas mit den tatsächlichen Objekten aus Fels und Eis zu tun. Berge sind nur geologische Zufallsprodukte. Sie töten nicht absichtlich und wollen auch nicht gefallen. Alle emotional besetzten Eigenschaften, die sie besitzen, werden ihnen von der menschlichen Fantasie zugeschrieben. Wie Wüsten, die arktische Tundra, tiefe Ozeane, Dschungel und all die anderen wilden Landschaften, die wir uns zu Lebewesen romantisiert haben, sind Berge einfach da. Und sie bleiben da, wenn auch ihre physische Form durch die Kräfte der Geologie und der Witterung nach und nach verändert wird, denn sie bestehen jenseits der Wahrnehmung durch den Menschen weiter. Sie sind jedoch auch das Produkt der menschlichen Wahrnehmung; über Jahrhunderte hinweg hat man sich ein Bild von ihnen gemacht. Dieses Buch versucht aufzuzeichnen, wie sich diese Vorstellungen von den Bergen im Lauf der Zeit verändert haben.
Eine Kluft zwischen Vorstellung und Wirklichkeit zeichnet alles menschliche Tun aus, in Bezug auf die Berge ist diese aber besonders stark ausgeprägt. Stein, Fels und Eis fassen sich wesentlich unangenehmer an, als es das geistige Auge erwartet, und die Berge der Welt stellten sich oft als widerspenstiger, auf verhängnisvolle Art realer heraus als die Berge im Kopf. Wie Herzog an der Annapurna und ich am Lagginhorn begriff, sind die Berge, die man bestaunt, über die man liest, von denen man träumt und die man begehrt, nicht diejenigen, die man besteigt. Letztere bedeuten harter, steiler, scharfkantiger Fels und eisiger Schnee, extreme Kälte und eine intensive Ausgesetztheit, die einem den Magen zusammenkrampfen kann und in den Eingeweiden spürbar wird. Sie bedeuten Bluthochdruck, Übelkeit und Erfrierungen – und unbeschreibliche Schönheit.
Es gibt einen Brief von George Mallory, den er während der Erkundungsexpedition zum Everest im Jahr 1921 an seine Frau Ruth schrieb. Die Vorhut der Expedition lagerte mehr als 100 Kilometer vom Berg entfernt, zwischen einem tibetischen Kloster und der Zunge des Gletschers, der vom Fuß des Everest herabzog. Hier brach das Eis, beschrieb Mallory, »wie die riesigen Wellen eines braunen, wütenden Meeres«. Es war ein unwirtlicher Ort, kalt, hoch gelegen und dem Wind ausgesetzt, der sich durch den mitgeführten Schnee und Staub materialisierte und in schmutzigen Wirbeln durch die Felsen fegte. Mallory hatte diesen Tag, den 28. Juni, mit einer ersten Annäherung an den Berg verbracht, an dem er drei Jahre später sterben würde. Es war ein anstrengender Tag für ihn gewesen: Morgens um Viertel nach drei war er aufgestanden und erst nach 8 Uhr abends zurückgekehrt. Nach einem kilometerlangen Marsch über Gletschereis, Moränen und Fels. Zweimal war er in Gletschertümpel gestürzt.
Am Ende dieses Tages lag Mallory erschöpft in seinem beengten, durchhängenden Zelt und schrieb im fleckigen Licht einer Sturmlampe einen Brief nach Hause. Er wusste, dass seine Arbeit am Berg für dieses Jahr wahrscheinlich beendet sein würde, wenn der Brief einen Monat später bei ihr in England eintraf. Den größten Teil nahm der Bericht über die Anstrengungen des vergangenen Tages ein, aber in den letzten Absätzen versuchte Mallory, Ruth zu vermitteln, wie er sich dabei fühlte, an einem solchen Ort zu sein und eine solche Tat in Angriff zu nehmen. »Der Everest hat die steilsten Grate und die furchtbarsten Abgründe, die ich je gesehen habe«, schrieb er. »Liebling – ich kann dir nicht beschreiben, wie sehr er Besitz von mir ergriffen hat.«
Dieses Buch versucht zu erklären, wie das möglich ist: Wie ein Berg so vehement Besitz von einem Menschen ergreifen kann. Wie etwas, das letztendlich nur eine Fels- und Eismasse ist, solch eine außergewöhnliche Anziehungskraft ausüben kann. Aus diesem Grund untersucht es nicht, auf welche Weise die Menschen die Berge bestiegen haben, sondern was sie sich darunter vorgestellt haben, was sie für die Berge empfunden und wie sie die Berge wahrgenommen haben. Daher geht es weniger um Namen, Daten, Gipfel und Höhenangaben, wie in den Standardgeschichten vom Bergsteigen, sondern eher um Eindrücke, Gefühle und Vorstellungen. Es ist eigentlich auch keine Geschichte des Bergsteigens, sondern eine Geschichte der Vorstellungen davon.
»Hohe Berge sind – für mich – eine Empfindung«, erklärt Junker Harold in Lord Byrons Prosagedicht Childe Harold’s Pilgrimage, während er nachdenklich in das ruhige Wasser des Genfer Sees schaut. Die folgenden Kapitel zeichnen in Form einer Genealogie nach, welche emotionalen Beziehungen zu den Bergen aufeinander folgten, wie diese Gefühle jeweils entstanden sind, übernommen wurden, sich veränderten und weitergegeben wurden, bis sie der Einzelne oder ein ganzes Zeitalter annahm. Das Schlusskapitel erörtert, was dazu führte, dass George Mallory so besessen vom Everest war, dass er wegen dieses Berges seine Frau und seine Familie verließ und schließlich von ihm getötet wurde. Mallory ist ein Paradebeispiel für die Themen dieses Buches, da sich in ihm die verschiedenen Empfindungen für die Berge mit ungewohnter und tödlicher Vehemenz vereinigten. Für dieses Kapitel habe ich Mallorys Briefe und Tagebücher um meine eigenen Vermutungen ergänzt, um die drei Everest-Expeditionen der 1920er-Jahre, an denen Mallory teilnahm, spekulativ zu rekonstruieren.
Um einen historischen Abriss der Gefühlsempfindungen zu den Bergen zu entwerfen, müssen wir in der Zeit weit zurückgehen – vor meine ängstliche Querung des steilen Schneehangs in den Alpen, noch vor Herzog, dem auf dem Gipfel der Annapurna die Namen seiner illustren Vorgänger durch den Kopf gehen, noch vor Mallory, der am Fuß des Everest auf seinem Lager einen Brief an Ruth kritzelt, während in der Ecke die Sturmlampe leise surrt. Sogar noch vor jene vier Männer, die im Jahr 1865 von den Felsen des Matterhorns stürzen. Wir müssen zurück in jene Zeit, in der das moderne Repertoire an Empfindungen für die Berge zu entstehen begann. Also zurück in den Sommer 1672. In die für die Jahreszeit ungewöhnliche Kälte auf einem Pass, über den der Philosoph und Geistliche Thomas Burnet seinen jungen aristokratischen Zögling, den Earl of Wiltshire, über die Alpen und hinab in die Lombardei führt. Denn bevor die Berge geliebt werden konnten, musste ihre Entstehung geklärt werden, und dafür stellte sich Burnet als unentbehrlich heraus.
2
DAS GROSSE BUCH AUS STEIN
»Unsere Phantasien können beeindruckt werden, wenn wir die Berge als Monumente der langsamen Arbeit gewaltiger Naturkräfte durch unzählige Jahrhunderte betrachten.«
LESLIE STEPHEN, 1871
August 1672 – Hochsommer auf dem europäischen Kontinent. In Mailand und Genua schwitzten die Bürger unter der starken europäischen Sonne. Fast 2000 Meter höher fröstelt Thomas Burnet am Simplon-Pass, einem der wichtigsten Übergänge der Alpen. Mit ihm friert der junge Graf von Wiltshire, ein Ur-Ur-Enkel von Thomas Boleyn, dem Vater der unglücklichen Anne, der zweiten Frau König Heinrichs VIII., die er hinrichten ließ. Der Junge brauchte eine Ausbildung, hatte seine Familie entschieden, und Burnet, ein anglikanischer Geistlicher mit außergewöhnlich reicher Vorstellungskraft, hat diese Aufgabe übernommen. Sie sollte zu einem zehnjährigen Bildungsurlaub von seinem Lehrstuhl am Christ’s College in Cambridge führen. Er wird zum Beschützer und Reiseleiter einer ganzen Reihe heranwachsender Aristokraten; der junge Graf ist der Erste von ihnen.
Für Burnet ist es ein Vorwand, den katholischen Kontinent zu besuchen. Die beiden werden mit ihrem mürrischen Führer und seinen wiehernden Maultieren den Simplon-Pass überqueren und danach Richtung Süden reisen, am schillernden Lago Maggiore entlang, dann durch die Obstgärten und Dörfchen der Gebirgsausläufer, schließlich über das grüne Fries der Lombardischen Ebenen bis hinab zu den blassen, erbaulichen Städten Norditaliens, die der Junge sehen muss – an erster Stelle Mailand.
Simplonpass mit Böshorn und Fletschhorn
Doch zunächst steht die Überquerung der Alpen an. Es gibt wenig, was den Simplon-Pass anziehend macht. Am höchsten Punkt des Passes steht eine rudimentäre Herberge, aber sie ist kein angenehmer Ort für eine Übernachtung. Die Kälte dort oben geht einem bis auf die Knochen, und es gibt Bären und Wölfe in der Gegend. Die Herberge selbst ist eigentlich ein Schuppen und wird bewirtschaftet von Savoyarden, Schäfern, die widerwillig auch noch die Gäste betreuen.
Trotz dieser zahlreichen Unannehmlichkeiten ist Burnet glücklich. Denn hier hat er mitten in den Bergen einen Ort entdeckt, der vollkommen anders ist als jeder andere Ort, den er kennt, und der sich so seinen Vergleichsmöglichkeiten entzieht. Für Burnet ist diese Landschaft wahrlich einzigartig auf dieser Erde. Obwohl es Sommer ist, liegt dort Schnee in hohen, vom Wind geformten und hart gefrorenen Verwehungen, denen die Sonne offenbar nichts anhaben kann. Im Sonnenlicht schimmern sie golden, im Schatten sehen sie aus wie das cremige Grauweiß von Knorpel. Felsbrocken so groß wie Gebäude liegen dort verstreut und werfen blaue Schatten. Das Geräusch fernen Donners rollt von Süden heran, doch die einzigen Blitze sind mehr als eintausend Meter unterhalb von Burnet über dem Piemont sichtbar. Er ist entzückt davon, über dem Gewitter zu sein.
Dort unten in Italien sind die berühmten Ruinen von Rom, die der junge Graf als Teil seiner Lektion über die Antike besuchen muss, weiß Burnet. Auch Burnet selbst bleibt nicht unberührt angesichts der Pracht von Roms zerstörten Tempeln und den vergoldeten, weinenden Heiligen in den Nischen der Kirchen. Aber dort oben ist etwas, das er später beschreiben wird als »diese ungeheuren Gebirgsformen« zwischen dem gigantischen Geröll der Alpen, das für Burnet letztendlich viel beeindruckender und überwältigender ist als die Ruinen von Rom. Obwohl Burnet die Berge schon wegen seines Alters als feindlich und abweisend empfinden muss, fühlt er sich auf seltsame Weise von ihnen angezogen. »Sie haben etwas Erhabenes und Würdevolles«, schrieb er nach der Überquerung des Simplon-Passes,
etwas, das den Geist zu großen Gedanken und Leidenschaft inspiriert […]. Wie all jene Dinge, die zu groß sind, um sie begreifen zu können, erfüllen und überfluten sie den Geist durch ihr Übermaß und versetzen ihn in einen angenehmen Zustand von Benommenheit und Vorstellungskraft.
Während seines zehnjährigen Aufenthalts auf dem Kontinent hat Thomas Burnet zusammen mit verschiedenen jungen Zöglingen mehrmals die Alpen und den Apennin überquert. Der mehrmalige Anblick dieser »wilden, großen, unverdauten Haufen aus Steinen und Erde« ließ in Burnet den Wunsch reifen, den Ursprung dieser fremden Landschaft verstehen zu können. Warum sind diese Felsen so weit verstreut? Und warum hatten die Berge so eine starke seelische Wirkung auf ihn? Die Berge beschäftigten Burnets Fantasie und seine Forscherinstinkte so stark, dass er befand, sich nicht mehr wohlfühlen zu können, bevor er nicht eine akzeptable Erklärung dafür gefunden habe, »wie es zu diesem Durcheinander in der Natur gekommen ist«.
Und so begann Burnet an seinem kunstvollen, apokalyptischen Meisterwerk zu arbeiten, dem ersten Buch, das den Bergen, den zeitlosesten aller Objekte, eine Vergangenheit zuschrieb. Burnet schrieb in einer Zeit, die man in Europa als bedrohlich empfand. In den Jahren 1680 und 1682 wurden ungewöhnlich grelle Kometen am Himmel beobachtet. Edmond Halley hatte bei seinen Himmelsbeobachtungen von der Spitze eines Vulkans seinen eigenen glühenden Boten ausgemacht, ihn nach sich selbst benannt und seine Rückkehr im Jahre 1759 korrekt vorausgesagt. In ganz Europa wurden Tausende von Flugblättern gedruckt, die bevorstehende Katastrophen für die zivilisierten Länder ankündigten: den Tod von Königen, die Ernte zerstörende Stürme, Dürrekatastrophen, Schiffsuntergänge, Pest und Erdbeben. In dieser von Anzeichen und Omen gesättigten Atmosphäre erschien 1681 Thomas Burnets The Sacred Theory of the Earth, das zuerst in Latein in einer bescheidenen Auflage von 25 Exemplaren erschien und eine kleine, kecke Widmung an den König trug, die auf die Dummheit seiner Majestät verwies. Burnets Buch befasste sich nicht mit zukünftigen Katastrophen, sondern mit dem größten Unglück aller Zeiten, der Sintflut. Sein Buch erschütterte den biblisch-orthodoxen Glauben an das seit Urzeiten unveränderte Antlitz der Erde, und es prägte entscheidend die Art und Weise, wie man sich damals die Berge vorstellte und sie wahrnahm. So verdanken wir es zum Teil Burnets jahrzehntelangem Nachdenken über Zerstörung, dass wir uns heute überhaupt vorstellen können, dass Landschaften eine Vergangenheit haben, eine eigene, lange Entwicklungsgeschichte.
Vor Burnet fehlte den Vorstellungen von der Erde eine vierte Dimension, die Zeit. Was, so dachte man, könnte denn beständiger sein als die Berge, und was könnte länger existieren als sie? Sie wurden von Gott in ihrer gegenwärtigen Form geschaffen und würden nun für immer und ewig so bleiben. Vor dem 18. Jahrhundert bestimmte die biblische Erzählung der Schöpfungsgeschichte, wie man sich die Vergangenheit der Erde vorzustellen hatte, und laut Bibel war die Erde erst vor relativ kurzer Zeit entstanden. Im 17. Jahrhundert gab es mehrere geniale Versuche, aus den in der Bibel enthaltenen Informationen ein Ursprungsdatum der Erde zu berechnen. Der bekannteste Versuch stammte von James Ussher, dem Erzbischof von Armagh, dessen zweifellos gewissenhafte Berechnung zum Ergebnis hatte, dass die Geburtsstunde der Erde am Montag, den 26. Oktober im Jahre 4004 vor Christus um 9 Uhr morgens war. Usshers Chronologie für die Erschaffung der Erde stammt aus dem Jahre 1650 und wurde als Fußnote noch in den englischen Bibeln des frühen 19. Jahrhunderts abgedruckt.
Daher war zu Burnets Zeit die orthodoxe christliche Vorstellung fest verankert, dass die Erde keine Geschichte habe. Man glaubte damals, dass sie nicht älter als 6000 Jahre und in dieser Zeit nicht erkennbar gealtert sei. Keine Landschaft besaß eine interessante Vergangenheit, denn die Erdoberfläche hatte immer gleich ausgesehen. Berge waren wie alles auf der Welt in jener ersten Woche der fieberhaften Schöpfung entstanden, die in der Genesis beschrieben wird. Sie wurden am dritten Tag geschaffen, also am selben Tag, an dem die Polarzonen vereist und die Tropen aufgeheizt wurden. Seither hatte sich ihr Erscheinungsbild kaum verändert, abgesehen vom kosmetischen Effekt des Flechtenwuchses und einer leichten Verwitterung. Sogar die Sintflut hatten sie ohne Folgen überstanden.
Das entsprach der damaligen allgemeinen Sichtweise. Thomas Burnet war jedoch überzeugt davon, dass der Bibeltext über die Schöpfungsgeschichte, so wie er damals verstanden wurde, das Erscheinungsbild der Welt nicht erklären konnte. Vor allem beschäftigte Burnet die Strömungstheorie der Sintflut. Er wollte wissen, wo auf der Erde denn das Wasser zu finden sein sollte für eine Sintflut, die so hoch war, dass sie, wie die Bibel beschrieb, die »höchsten Berggipfel bedecken konnte«.
Burnet berechnete, dass für eine globale Überschwemmung dieser Tiefe das Wasser »von acht Ozeanen« erforderlich gewesen wäre. Die in der Genesis beschriebenen vierzig Regentage hätten aber höchstens für einen Ozean gereicht. Nicht einmal genügend Flüssigkeit, um auch nur die Füße der meisten Berge zu benetzen. »Wohin sollen wir denn gehen, um mehr als sieben Ozeane mit Wasser zu finden, die wir noch brauchen«, fragte Burnet. Er kam zu dem Schluss, dass es, wenn es nicht genügend Wasser gegeben hatte, weniger Erde gegeben haben musste. So entwickelte er seine Theorie vom »Mundane Egg«, dem Weltenei. Demnach war die Erde sofort nach ihrer Erschaffung ein ovaler Kugelkörper mit gleichmäßigen Formen gewesen, also ein Ei. Es war makellos in seiner Erscheinung und gleichmäßig in seiner Beschaffenheit, ohne Hügel oder Täler, die seine liebliche Form unterbrochen hätten. Unter der porzellanähnlichen Oberfläche verbarg sich jedoch eine komplizierte Innenarchitektur. Das »Eigelb« im Herzen der Erde war mit Feuer gefüllt und umgeben von mehreren Ringen, die in einander steckten wie die verschiedenen Puppen einer russischen Matrjoschka. Und das »Eiweiß,« Burnet war beharrlich in der Anwendung seiner Metaphern – war demnach ein mit Wasser gefüllter Abgrund, auf dem die Erdkruste trieb. So war die Burnetsche Erde beschaffen.
Burnet führte weiter aus, dass die Oberfläche des jungen Globus bei seiner Geburt zwar makellos gewesen sei, aber nicht unantastbar. Im Laufe der Jahre wurde die Kruste von der Sonneneinstrahlung ausgetrocknet und bekam Risse und Brüche. Von unten begann das Wasser immer stärker gegen die geschwächte Kruste zu drücken, bis es dann, dem Willen des Schöpfers entsprechend, zu »dieser großen, fatalen Überschwemmung« kam, der Sintflut. Die inneren Wassermassen und Feuerschlote brachen schließlich die Erdkruste auf. Einzelne Abschnitte der Kruste fielen in den frisch aufgerissenen Abgrund und die aufbrausenden Fluten überschwemmten die restlichen Landmassen. Sie bildeten einen »großen, ohne Grenzen oder Ufer in der Luft kreisenden Ozean«, wie Burnet auf anschauliche Weise beschrieb. Die physikalischen Bestandteile der Kruste, eine Mischung aus Fels und Erde, wurden weggeschwemmt. Und als sich die Wassermassen wieder zurückzogen, hinterließen sie Chaos. In Burnets Worten: »[E]ine Welt, die in ihrem Schutt lag.«
Burnets Theorie bedeutete nichts anderes, als dass der Globus, so wie er und seine Zeitgenossen ihn kannten, nichts anderes war als »das Bild oder Abbild eines großen Untergangs« und ein sehr schlechtes Abbild noch dazu. Als Bestrafung für die Gottlosigkeit der menschlichen Rasse hatte Gott mit einem einzigen Schlag »den Rahmen der alten Welt gesprengt und auf deren Ruinen eine neue entstehen lassen, die wir nun bewohnen«. Die Berge, die chaotischsten und charismatischsten aller Landschaftsformen, waren also nicht ursprünglich von Gott erschaffen worden. Sie waren nur die Überbleibsel nach dem Rückzug der Flut, nämlich Fragmente der Erdkruste, die von den kolossalen Kräften der Flut herumgewirbelt und aufeinander getürmt worden waren. Die Berge waren folglich nichts anderes als gigantische Andenken an die menschliche Sündhaftigkeit.
Die Illustration zeigt drei aufeinanderfolgende Stadien des Absinkens der Erdkruste in den Abgrund aus Wasser [1]. Das untere und letzte Bild zeigt die Entstehung der Berge [2] und Inseln [3].
Die englische Übersetzung von Burnets Buch im Jahre 1684 löste eine ganze Reihe hastiger Veröffentlichungen aus. Viele waren irritiert von seiner Annahme, dass die Erde in ihrem gegenwärtigen Zustand nicht vollkommen sei, und auch davon, dass er die konventionelle Interpretation der Heiligen Schrift infrage stellte. Sie versuchten, seine ehrwürdige Theorie zu widerlegen. Die Kontroverse führte dazu, dass sich Burnets Ideen und die Gegenargumente in intellektuellen Kreisen rasch verbreiteten. Sowohl die Verteidiger als auch die Kritiker sprachen nur noch von der »Theorie«, wenn sie sich auf The Sacred Theory of the Earth bezogen, und bei nicht genauer erläuterten Bezügen zum »Theoretiker« war stets Burnet gemeint. Stephen Jay Gould, der amerikanische Wissenschaftler, Autor und Humanist, geht davon aus, dass The Sacred Theory das am weitesten verbreitete und meistgelesene Geologiebuch des 17. Jahrhunderts war.
So kam es, dass zum ersten Mal die intellektuelle Vorstellungskraft gefragt war beim Postulieren von Thesen über die Vergangenheit der wilden Landschaften der Erde. Durch die Burnet-Kontroverse wurde die Aufmerksamkeit auf das Erscheinungsbild der Berge gelenkt. Jetzt waren sie nicht mehr nur Tapete oder Hintergrund, sondern Objekte, die verdienten, dass man sie genauer betrachtete. Wichtig ist dabei auch, dass Burnet damals dafür sorgte, dass seine Nachfolger die Berge als furchtbar und aufregend zugleich wahrnahmen: Samuel Taylor Coleridge wurde beispielsweise von Burnets Prosa so aufgewühlt, dass er vorhatte The Sacred Theory in Blankverse zu übertragen. Und die Theorien des Erhabenen von Joseph Addison und Edmund Burke waren ebenfalls von Burnets Werk geprägt. Burnet sah und vermittelte das Großartige einer Berglandschaft und legte damit den Grundstein für eine ganz neue Betrachtungsweise der Berge.
Frontispiz zur zweiten Auflage von Burnets The Sacred Theory of the Earth (1691). Die sieben Erdkugeln stehen – chronologisch im Uhrzeigersinn – für die Stadien der Erdgeschichte, so wie sie in Burnets Buch beschrieben werden.
Doch Burnet hatte wegen seiner Brillanz auch zu leiden. Cambridge hatte einen Cordon Sanitaire, einen Sperrgürtel, aufgebaut, um das Eindringen von schädlichen oder gegenläufigen Ideen zu verhindern. Burnet hatte aber mit der Infragestellung der Heiligen Schrift diese Sicherheitszone durchbrochen. Nach der Glorious Revolution (1686–1688), jenen Vorgängen, die zur Absetzung von König James II. und zur Krönung von William III. und Mary II. einschließlich der Verabschiedung der Bill of Rights führten, wurde Burnet gezwungen, seine Ämter am Hof niederzulegen und wurde bei der Vergabe des Amtes des Erzbischofs von Canterbury übergangen. Seine Reputation als Autor war aber nachhaltiger als seine vagen Verdienste als anglikanischer Geistlicher. Mit seiner These, das Antlitz der Erde müsse nicht immer gleich ausgesehen haben, löste Burnet die noch heute anhaltende Erforschung der Erdgeschichte aus. Im Vorwort seines Buches brüstet er sich damit, dass er »eine Welt wieder hervorgeholt habe, die seit Tausenden von Jahren in Vergessenheit geraten war!«. Er hatte allen Grund, sich damit zu brüsten, denn Burnet war der erste geologische Zeitreisende – ein Eroberer des entlegensten aller Länder: der fernen Vergangenheit.