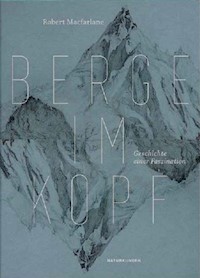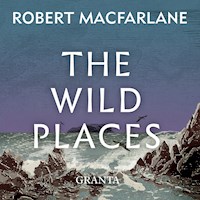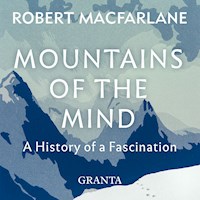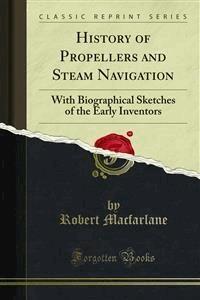11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis
In einer großartigen Entdeckungsreise nimmt uns der vielfach ausgezeichnete britische Autor Robert Macfarlane mit in die dunkle, überraschende Welt unter der Erde. Er führt uns in Höhlenlandschaften in England und Slowenien, zu einem unterirdischen Fluss in Italien, in den Untergrund von Paris, die schwindende Gletscherwelt Grönlands und, zuletzt, in einen Stollen für Atomabfälle, der die nächsten 100.000 Jahre überdauern soll. Sein Buch ist viel mehr als eine fantastische Natur- und Landschaftsgeschichte: Eindringlich schildert er das Wechselspiel zwischen Mensch, Natur und Landschaft – nicht zuletzt als Mahnung, was wir durch unsere Eingriffe zu verlieren drohen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 626
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über das Buch
»Der Weg ins Unterland führt durch den gespaltenen Stamm einer alten Esche.«
In einer großartigen Entdeckungsreise nimmt uns der vielfach ausgezeichnete britische Naturschriftsteller Robert Macfarlane mit in die dunkle Welt unter der Erde – von Höhlen in England und Slowenien bis zum Untergrund von Paris, von Stollen in Finnland bis zur schwindenden Gletscherwelt Grönlands. Eindringlich beschreibt er das Wechselspiel zwischen Mensch, Natur und Landschaft – nicht zuletzt als Mahnung, was wir durch unsere Eingriffe zu verlieren drohen. Sein Buch ist große Natur- und Menschheitsgeschichte in einem.
Über Autor und Übersetzer
Robert Macfarlane, geboren 1976 in Nottinghamshire, ist einer der bedeutendsten und einflussreichsten Naturschriftsteller der Gegenwart. In seinen mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Büchern wie Berge im Kopf, Alte Wege und Karte der Wildnis (AS Verlag, Matthes & Seitz) schreibt er in einer selten einfühlend-poetischen und zugleich präzisen Sprache über Landschaften und Orte, über die Natur und unsere Beziehung zu ihr. Er ist Fellow der Royal Society of Literature und Gründungsmitglied der Naturschutzorganisation Action for Conservation.
Die Übersetzer Andreas Jandl und Frank Sievers haben schon mehrere Bücher Robert Macfarlanes ins Deutsche übertragen. Für ihre Übersetzung von John Alec Bakers Der Wanderfalke erhielten sie den Christoph-Martin-Wieland-Übersetzerpreis.
»Robert Macfarlane zaubert mit Worten. Wie ein Sog ziehen uns seine Sätze tiefer und tiefer ins Buch.« Andrea Wulf, Autorin von Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
ROBERT MACFARLANE
IM UNTERLAND
EINE ENTDECKUNGSREISE IN DIE WELT UNTER DER ERDE
Aus dem Englischenvon Andreas Jandl und Frank Sievers
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel Underland. A Deep Time Journey bei Hamish Hamilton/Penguin Random House UK.
Die Arbeit der Übersetzer am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Copyright © 2019 Robert Macfarlane
Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Anneke Lubkowitz, Berlin
Bildbearbeitung: Helio Repro, München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagabbildung: © Stanley Donwood, Nether, 2013 (Ausschnitt)
Vorsatzabbildung: © Tim Gainey/Alamy
Satz: Mediengestaltung Vornehm GmbH, MünchenISBN 978-3-328-60113-5V005www.penguin-verlag.de
Ist es dunkel dort untenWo das Gras wächst durchs Haar?Ist es dunkel dort im Unter-Land von Null?
Helen Adam, »Down There in the Dark« (»Dort unten im Dunkel«), 1952
Der Hohlraum wandert zur Oberfläche hinauf …
Advances in Geophysics, 2016
Inhalt
ERSTEKAMMER
1 Abstieg
ERSTERTEIL
2 Begräbnis
3 Dunkle Materie
4 Unterholz
ZWEITEKAMMER
ZWEITERTEIL
5 Unsichtbare Städte
6 Sternenlose Flüsse
7 Hohles Land
DRITTEKAMMER
DRITTERTEIL
8 Rote Tänzer
9 Die Kante
10 Das Blau der Zeit
11 Schmelzwasser
12 Das Versteck
13 Aufstieg
Dank
Anmerkungen
Ausgewählte Literatur
Register
ERSTE KAMMER
Der Weg ins Unterland führt durch den gespaltenen Stamm einer alten Esche.
Spätsommerliche Hitzewelle, schwere Luft. Bienen brummen behäbig über Graswiesen. Gold reifen Getreides, Grün frischer Heureihen, Schwarz der Krähen auf Stoppelfeldern. Irgendwo unten, wo der Boden sich absenkt, brennt ungesehen ein Feuer, eine Säule aus Rauch. Ein Kind wirft Steine in einen Metalleimer, Stein für Stein, klong, klong, klong.
Den Feldweg entlang, vorbei an einem Hügel im Osten, gezeichnet von neun runden Hügelgräbern, wie Wirbel eines Rückgrats. In einer Wolke schimmernder Fliegen drei Pferde, stockstill bis auf das Schweifschlagen, Kopfschütteln.
Über den Tritt in der Kalksteinmauer, am Bach entlang zur überwucherten Senke, aus der sich die alte Esche erhebt. Die Krone schwingt sich himmelwärts ins Wetter. Die moosigen Äste hängen tief. Die Wurzeln reichen weit nach unten.
Rauchschwalben jagen flatterfähnchenhaft über Wiesen. Auf halber Höhe kreuzen die Mehlschwalben. Ein Schwan fliegt weit oben auf knarrenden Flügeln nach Süden. Diese Oberwelt ist wunderschön.
Wo der Eschenstamm ins Erdreich übergeht, teilt sich die Borke zu einem schrundigen Spalt, gerade groß genug, dass man ins Innere des Baumes steigen kann – und hinab ins hohle Dunkel darunter fällt. Die Ränder glatt gerieben von den Menschen, die schon hier hineingekrochen und durch die alte Esche ins Unterland gelangt sind.
Unterhalb der Esche entfaltet sich ein Labyrinth.
Hinab durchs Wurzelwerk in einen steinernen Gang, weiter steil nach unten. Die Farben verdämmern ins Graue, Braune, Schwarz. Kalte Luft drängt vorbei. Die Decke ist fester Fels, massive Materie. Die Oberwelt kaum vorstellbar.
Der Gang fächert aus; ein Irrgarten. Seitengänge kriechen davon. Die Richtung ist schwer zu halten. Der Raum benimmt sich sonderbar – ebenso die Zeit. Im Unterland verhält sie sich anders. Verdickt sich, staut sich, fließt, rauscht, verlangsamt sich.
Der Gang macht eine Biegung, eine zweite, verjüngt sich – und weitet sich dann überraschend. Eintritt in eine Kammer. Dröhnen, das widerhallt. Die Wände scheinen auf den ersten Blick nackt, doch dann geschieht etwas Erstaunliches. Szenen aus dem Unterland steigen auf, aus unterschiedlichen Zeiten, erscheinen auf dem glatten Fels, fern, doch in ihrem Echo verbunden.
Und in einer Höhle in einer verkarsteten Felswand atmet eine Gestalt einen Mundvoll Ockerpulver ein, hält die Luft an, legt die linke Hand an die Höhlenwand – mit gespreizten Fingern, die Innenfläche am kalten Stein – und bläst das Rot gegen den Handrücken. Das Pulver zerstiebt, die Hand löst sich vom Fels, es bleibt ein gespenstischer Abdruck: Der Stein hat die Farbe des Pulvers angenommen. Die Hand wird verschoben, mehr Pulver geblasen, ein weiterer Umriss. Kalkspat wächst über die Abdrücke und versiegelt sie. Sie überdauern 35 000 Jahre. Wofür stehen sie? Freude? Gefahr? Kunst? Das Leben in Dunkelheit?
In Nordeuropa wird vor sechstausend Jahren eine junge Frau – die bei der Geburt mit ihrem Kind verstarb – behutsam in ein flaches Sandgrab gelegt. Neben ihr ein weißer Schwanenflügel. In dessen Federmulde ruht der Leichnam ihres Sohnes, der im Tod zweifach gehalten wird – von Schwanenfedern und Mutterarm. Ein Erdhügel wird über den dreien aufgeschüttet: über der Frau, dem Baby, dem zarten weißen Flügel.
Dreihundert Jahre vor der Gründung des Römischen Reiches vollendet ein Kunstschmied auf einer Insel im Mittelmeer die Arbeit an einer kleinen runden Münze. Darauf zu sehen ein rechteckiges Labyrinth mit einem Eingang am oberen Rand und einem verschlungenen Weg zu seiner Mitte. Die Wände sind wie der Rand der Münze leicht erhöht und blank gerieben. In die Mitte des Labyrinths eingeprägt ist ein winziges Wesen mit Stierkopf und Menschenbeinen: der Minotaurus, der im Dunkeln erwartet, was kommen mag.
Sechshundert Jahre später sitzt eine junge Frau in Ägypten Porträt für einen Maler. Für die Sitzung hat sie sich in feine Kleider gehüllt. Sie hat breite dunkle Augenbrauen, große dunkle, fast schwarze Augen. Ihre schwarzen Haare werden von einem geschwungenen Metallreif gehalten, den eine Goldperle ziert. Am Hals ein goldener Schal, an der Brust eine goldene Brosche. Der Maler vermischt heißes Bienenwachs mit Farbpigmenten und Blattgold, das er auf eine Holzplatte aufträgt. Er malt das Totenbild der jungen Frau. Nach ihrem Tod wird es in die Tuchbahnen der balsamierten Leiche gewickelt, um das tatsächliche Gesicht der Mumie zu ersetzen. Mag auch ihr Körper vergehen, ihr Porträt bleibt von den Jahren unberührt. Es ist gut, derlei Dinge frühzeitig zu tun, in noch strahlender Blüte. Der Leichnam wird in die am Rand einer tiefen Wüstensenke angelegte Totenstadt gebracht und unweit eines Gewölbes mit den mumifizierten Überresten von über einer Million Ibissen in eine unterirdische Kammer mit kalksteinverkleideten Wänden, ziegelbedecktem Boden sowie – zur Abwehr gegen Grabräuber – einer Decke aus Platten festen Quarzits gebettet.
Im späten 19. Jahrhundert kriechen unter einem Hochplateau in Südafrika Bergleute durch kilometerlange enge Tunnel, die tiefer in den Untergrund reichen als an irgendeiner anderen Stelle des Planeten, um in Körben das Erz aus einer verborgenen Goldmine zu fördern. Manche dieser Männer, zu Tausenden zum Arbeiten hergekommen, werden bald bei Steinschlägen und Unfällen ihr Leben lassen. Viele mehr werden an Staublunge sterben, da sie Jahr um Jahr in der tödlichen Dunkelheit dort unten den Steinstaub einatmen. Für die Unternehmen, denen die Mine gehört, und die Märkte, die sie beliefert, sind menschliche Körper leicht ersetzbar: nichts als kleine, ungelernte Förderwerkzeuge, schnell ausgetauscht, wenn sie nicht mehr funktionieren. Das geförderte Erz wird gebrochen und das Gold in Schmelzverfahren extrahiert, bevor sich die Gesellschafter in fernen Ländern die Taschen damit füllen.
In einer Hanghöhle in den Ausläufern des indischen Himalajas kurz nach der Teilung Indiens meditiert eine junge Frau sechzehn Stunden am Tag, fünfundsiebzig Tage lang, in fast völliger Dunkelheit. Sie sitzt still, nur ihr Mund bewegt sich beim Murmeln der Mantras. Sie verlässt die Höhle meist nur bei Nacht und sieht, wenn keine Wolken da sind, über den Himmel verschüttet die Milchstraße. Sie lebt von Wasser, das sie mit den Händen aus dem heiligen Fluss schöpft, von wilden Beeren und Früchten aus der umliegenden Gegend. Mantras, Einsamkeit und Dunkelheit schenken ihr Erlebnisse und Empfindungen, die ihr neu sind, und sie merkt, dass ihre Wahrnehmung sich wandelt. Nach diesem Aufenthalt in ihrem unterirdischen Rückzugsraum fühlt sie sich weit wie der Himmel, alt wie die Berge, gestaltlos wie das Sternenlicht.
Vor dreißig Jahren lösen ein Junge und sein Vater im Fußboden des Hauses, das sie bald verlassen müssen, mit der spitzen Seite ihres Hammers eine Diele. Sie haben aus einem Marmeladenglas eine Zeitkapsel gebaut. Dorthinein hat der Junge Gegenstände und Mitteilungen gelegt. Das Druckgussmodell eines Bombenfliegers. Den Umriss seiner linken Hand, in roter Tinte auf weißem Papier. Eine Beschreibung von sich selbst, für den etwaigen Finder – Ziemlich groß für mein Alter, sehr blond, fast weißhaarig. Größte Angst: Atomkrieg –, mit Bleistift auf eine herausgerissene Notizbuchseite geschrieben. Eine stehengebliebene Uhr mit leuchtendem Ziffernblatt und Leuchtzeigern, die er gern mit den Händen umschließt, um die Zahlen schimmern zu sehen. Er streut eine Handvoll Reis ins Glasgefäß, der die Feuchtigkeit aufnehmen soll, dann verschraubt er den Blechdeckel so fest er kann, legt die Kapsel in ihr Versteck und nagelt die Diele wieder an.
Tief in einem erloschenen Vulkan wird ein Tunnelnetz gebohrt, durch das die Ghost Dance, eine tektonische Verwerfung, verläuft. Zugangsstollen neigen sich durch schräge Schichten Tuffstein in die ebenerdige Endlagerzone, die in Deponiestollen aufgeteilt ist. Diese Korridore sind die letzte Ruhestätte für hochradioaktive Abfälle: strahlende Uranoxid-Tabletten in Behältern aus Stahl, die wiederum in Behältern aus Kupfer stecken und über der »Geistertanz«-Bruchlinie die nächsten Millionen Jahre ihre Halbwertszeiten aushauchen. Bei so langfristiger Toxizität müssen die Menschen zur Planung eines sicheren Endlagers überlegen, wie sie den Verwahrort und die Gefährlichkeit des radioaktiven Mülls der fernen Zukunft mitteilen können. Der Risikostoff wird nicht nur die Verursacher überleben, sondern vielleicht die ganze Verursacherspezies. Wie kann man diesen Ort markieren? Wie den zukünftigen Besuchern dieser steinernen Sarkophage mitteilen, dass darin nichts Kostbares liegt, sondern etwas furchtbar Schädliches, das niemals aufgestört werden darf?
Und dann sitzen auf einem schlammigen Felsvorsprung in einer verzweigten Tropfsteinhöhle, vier Kilometer tief im Berg, in völliger Dunkelheit, von einer Sturzflut eingesperrt zwölf Jungen mit ihrem Fußballtrainer und warten, Tag um Tag, versuchen, ihre Akkus zu schonen, und beobachten, ob das Wasser steigt oder sinkt – und ob jemand sie durch irgendein Wunder retten kommt. Stunde um Stunde atmen sie den Sauerstoff in der Höhle, sodass das Kohlendioxid in ihrer Atemluft immer mehr wird. Über dem Berg ziehen weitere Monsunwolken auf, drohen mit noch mehr Regen. Vor dem Berg versammeln sich Tausende Retter aus insgesamt sechs Ländern. Anfangs wissen sie nicht, ob die Jungen überhaupt noch leben. Dann finden sie Handabdrücke aus Schlamm, an Felswänden drei Kilometer tief im Berg. Es besteht Hoffnung. Taucher arbeiten sich durch die vollgelaufenen Gänge vor. Neun Tage nachdem sie in den Berg gegangen sind, hören die Jungen aus dem fließenden Wasser unter ihrem Felsvorsprung Geräusche. Sehen Lichter. Blasen steigen auf. Die Lichter kommen näher. Ein Mann steckt den Kopf aus dem Wasser. Die Jungen und ihr Trainer blinzeln im Strahl seiner Stirnlampe. Ein Junge hebt grüßend die Hand, der Taucher grüßt zurück. »Wie viele seid ihr?«, fragt der Taucher. »Dreizehn«, lautet die Antwort. »Es kommen noch mehr von uns«, sagt der Taucher.
So ziehen die Szenen aus dem Unterland auf den Wänden dieser unwirklichen Traumkammer vorüber, tief unten im Labyrinth unter der gespaltenen Esche. Und stets sind es die drei gleichen Aufgaben, die das Unterland für alle Kulturen und Epochen erfüllt: Es soll Kostbares schützen, Wertvolles hervorbringen, Schädliches entsorgen.
Schützen (Erinnerungen, wertvolle Stoffe, Nachrichten, gefährdetes Leben).
Hervorbringen (Informationen, Reichtum, Metaphern, Mineralien, Visionen).
Entsorgen (Abfall, Traumata, Gift, Geheimnisse).
Seit jeher vertrauen wir dem Unterland an, was wir fürchten und loswerden wollen und was wir lieben und bewahren wollen.
1 Abstieg
Wir wissen so wenig über die Welt unter unseren Füßen. Schauen wir in einer wolkenlosen Nacht nach oben, so sehen wir das Licht von Sternen, die Billiarden Kilometer entfernt sind. Wir können die Ränder der Asteroidenkrater auf dem Mond erkennen. Schauen wir nach unten, sehen wir kaum mehr als Gras, Erde, Asphalt. Selten habe ich mich der menschlichen Sphäre ferner gefühlt als neun Meter unter ihr, gefangen im schimmernden Schlund einer Schichtfläche aus Kalk, die sich in Urzeiten auf dem Grund eines ehemaligen Meeres gebildet hatte.
Das Unterland kann Geheimnisse sicher bewahren. Erst in den letzten zwanzig Jahren ist es Forstökologen gelungen, die Netzwerke der Mykorrhizapilze nachzuvollziehen, die sich durch den Waldboden bohren und die einzelnen Bäume zu kommunizierenden Wäldern verbinden – wie sie es seit Hunderten Jahrmillionen tun. Kürzlich wurde in der chinesischen Provinz Chongqing ein 2013 entdecktes Höhlennetzwerk erforscht, das sein eigenes Wetter macht: Kumuluswolken, die sich in einer riesigen zentralen Halle türmen, kühler Nebel, der fernab vom Licht der Sonne durch große Wolkenkammern zieht. In Norditalien seilte ich mich gut dreihundert Meter unter der Erdoberfläche in eine gewaltige steinerne Rotunde ab, die ein unterirdischer Fluss aus dem Fels geschnitten und mit Dünen aus schwarzem Sand gefüllt hatte. Wie ich über diese Dünen stapfte, kam ich mir vor wie in einer windfreien Wüste auf einem lichtlosen Planeten.
Warum in die Tiefe steigen? Eine solche Bewegung geht gegen den Strich, gegen die Vernunft und den Willen. Wer bewusst etwas im Unterland lagert, will es fast immer dem Blick der anderen entziehen. Wer etwas aus dem Unterland an die Oberfläche befördern will, muss sich auf anstrengende Arbeit gefasst machen. Weil sie so schwer zugänglich ist, war die Unterwelt lange Zeit ein Symbol für alles, was nicht offen gesagt oder gesehen werden darf: Verlust, Trauer, die Abgründe des Geistes und die – wie Elaine Scarry sagt – »tiefgründige unterirdische Tatsache« des körperlichen Schmerzes.
Rund um unterirdische Räume rankt sich eine Kulturgeschichte der Abscheu, die das Unterirdische mit dem »scheußlichen Dunkel im Inneren der Welt« verbindet, wie Cormac McCarthy es formuliert. Angst und Ekel sind die üblichen Reaktionen auf eine solche Umgebung; Dreck, Vergänglichkeit und brutal harte Arbeit das, was man am häufigsten damit verbindet. Klaustrophobie ist sicher die schwerwiegendste aller verbreiteten Phobien. Mir ist schon oft aufgefallen, dass die Klaustrophobie – mehr noch als der Schwindel – ihre beängstigende Kraft selbst dann behält, wenn man sie in der Erzählung oder Beschreibung nur indirekt erlebt. Hören wir Geschichten vom Eingeschlossensein unter der Erde, rutschen wir unruhig hin und her, treten einen Schritt zurück, schauen zum Licht – als könnten allein die Worte uns einkerkern.
Ich erinnere mich noch, dass ich als Zehnjähriger in Alan Garners Roman Der Zauberstein von Brisingamen las, wie sich zwei Kinder aus einer gefährlichen Situation in einen Minengang retten, der zum Abbau der Sandsteinvorkommen des Alderley Edge in Cheshire dient. Tief im Stein sind die Stollen so eng, dass die beiden fast stecken bleiben:
Sie lagen lang ausgestreckt und Wände, Boden und Decke umschlossen sie wie eine zweite Haut. Die Köpfe hatten sie zur Seite gedreht, da durch die niedrige Decke in jeder anderen Lage der Mund in den Sand gepresst wurde und sie nicht atmen konnten. Die einzige Möglichkeit voranzukommen bestand darin, sich mit den Fingerspitzen vorwärts zu ziehen und mit den Zehen abzustoßen, denn es war unmöglich, die Beine auch nur ein wenig zu beugen, und jede Bewegung der Ellenbogen zwängte automatisch die Arme unter ihre Körper. […] Colin war drei Zentimeter größer als seine Schwester, und das war katastrophal. Seine Fersen verkanteten sich an der Decke: Er konnte sich weder nach oben noch nach unten bewegen, und die scharfe Felskante grub sich in seine Schienbeine, bis er vor Schmerz aufschrie. Aber bewegen konnte er sich nicht …
Diese Stelle nahm mich so sehr gefangen, dass mir der Atem stockte. Und wenn ich sie heute lese, kommen mir wieder dieselben Gefühle. Doch die brenzlige Lage im Buch übte auch – und übt immer noch – einen starken Sog auf mich aus. Colin konnte sich nicht mehr bewegen und ich nicht mehr aufhören zu lesen.
Die Abscheu vor dem Unterland steckt auch verborgen in unserer Sprache. In vielen Metaphern, die wir täglich benutzen, wird die Höhe gefeiert und die Tiefe verachtet. Etwas »Erhebendes« ist angenehmer, als »niedergeschlagen« oder »am Boden« zu sein. »Katastrophe« heißt buchstäblich »Wendung nach unten«, »Kataklysmus« steht für »Gewalt nach unten«. Auch in landläufigen Betrachtungsweisen und deren Darstellungsformen findet sich die Ablehnung der Tiefe. In seinem Buch Vertical beschreibt Stephen Graham die Vorherrschaft einer »tradierten Flachheit« in Geografie und Kartografie und die »vornehmlich horizontale Weltsicht«, die daraus entspringt. Es falle uns schwer, die »unbeirrt flache Sichtweise« abzulegen, an die wir uns gewöhnt haben – worin Graham sowohl ein politisches als auch ein perzeptorisches Versäumnis sieht, da uns auf diese Weise jede Kenntnis des verborgenen Systems aus Gewinnung, Ausbeutung und Entsorgung fehle, das die oberirdische Welt in sich trage.
Tatsächlich wenden wir uns aus vielerlei Gründen von dem ab, was unter uns verborgen liegt. Dabei müssen wir heute mehr denn je das Unterland verstehen. »Zwingen Sie sich, flacher zu sehen«, befiehlt Georges Perec in Träume von Räumen. »Zwingen Sie sich, tiefer zu schauen«, würde ich sagen. Das Unterland ist elementar für die materiellen Strukturen unserer heutigen Existenz ebenso wie für unsere Erinnerungen, Mythen und Metaphern. Auf dieses Terrain verlassen wir uns täglich und werden täglich von ihm geformt. Dennoch sind wir kaum gewillt, die Gegenwart des Unterlands in unserem Leben oder die verstörenden Vorstellungen, die wir von ihm haben, genauer zu beleuchten. Unsere »flache Sichtweise« erscheint mir zunehmend unangemessen für die tiefen Welten, die wir bewohnen, und für das Langzeiterbe, das wir hinterlassen werden. Wir leben gegenwärtig im Anthropozän, einer Epoche großer und oftmals beängstigender Veränderungen von planetarem Ausmaß, in der das Wort »Krise« nicht für eine permanent aufgeschobene künftige Apokalypse steht, sondern für eine andauernde Gegebenheit, die die Schwächsten am stärksten zu spüren bekommen. Die Zeit ist weitreichend aus den Fugen geraten – wie auch der Raum. Vergrabenes, das in der Erde hätte bleiben sollen, kehrt ungebeten an die Oberfläche zurück. Bekommen wir solche Ausgeburten der Erde zu Gesicht, können wir nicht einfach wegsehen, zu fesselnd ist der Anblick der obszönen Intrusion.
In der Arktis entweichen durch kürzlich geöffnete »Fenster« im schmelzenden Permafrost uralte Methanvorkommen. Milzbrandsporen werden von Rentierleichen freigesetzt, die im einst gefrorenen Erdboden begraben lagen, jetzt aber Wärme und Erosion ausgesetzt sind. In den ostsibirischen Wäldern gähnt ein Krater im aufweichenden Boden, der Zehntausende Bäume schluckt und eine 200 000 Jahre alte Erdschicht freilegt: Die hier heimischen Jakuten nennen ihn eine »Tür zur Unterwelt«. Die schwindenden Gletscher im Himalaja und in den Alpen geben Leichen frei, die vor Jahrzehnten vom Eis verschlungen wurden. In ganz Großbritannien wurden durch die jüngsten Hitzewellen für Beobachter aus der Luft die Spuren alter Bauten als Bewuchsmerkmale auf den Feldern erkennbar – römische Wachtürme, neolithische Einhegungen: Dürre als Röntgenstrahl, der die unterirdische Vergangenheit des Landes als minder fruchtbare Muster ans Tageslicht zurückbefördert. In Tschechien sank der Wasserpegel der Elbe so tief, dass »Hungersteine« zum Vorschein kamen, behauene Steinblöcke, die seit Jahrhunderten an Dürren erinnern und vor ihren Folgen warnen. Auf einem Hungerstein steht in deutscher Sprache: »Wenn du mich siehst, dann weine.« Im Nordwesten Grönlands hat sich ein vor fünfzig Jahren unter einer Eisschicht versunkener Militärstützpunkt aus dem Kalten Krieg, in dem Hunderttausende Liter Chemieabfälle lagern, langsam hinauf ans Licht bewegt. »Das Problem«, schreibt die Archäologin Þóra Pétursdóttir, »besteht nicht darin, dass Dinge in tiefe Schichten versinken – sondern dass sie dort überdauern, uns überleben und mit einer Wucht wieder nach oben kommen, mit der niemand gerechnet hätte … eine dunkle Truppe ›schlafender Riesen‹«, die aus den Tiefen der Zeit geweckt wurden.
Die geologische Zeit – die »tiefe Zeit«, wie sie im Englischen genannt wird – ist die Zeitrechnung des Unterlands. Mit der geologischen Zeit reicht die Erdgeschichte schwindelerregend tief von der Gegenwart hinab in die Vergangenheit. Geologische Zeit misst sich in Einheiten, die uns kurzlebige Menschen Demut lehren: Epochen und Äonen anstelle von Minuten und Jahren. Geologische Zeit steckt in Steinen, im Eis, in Stalaktiten, Ablagerungen auf dem Meeresboden und den Verschiebungen tektonischer Platten. Geologische Zeit öffnet sich zur Zukunft wie zur Vergangenheit. Wenn die Sonne in fünf Milliarden Jahren ihren Brennstoff verbraucht haben wird, dann wird es bei uns dunkel. Wir stehen mit den Zehen und mit den Fersen an einem Abgrund.
Einen gefährlichen Trost spendet uns der Blick in die Tiefe der geologischen Zeit. Es lockt ein ethisches Lotosessen. Was macht es schon aus, wie wir uns verhalten, wenn der Homo sapiensohnehin mit dem nächsten geologischen Augenschlag wieder von der Erde verschwinden wird? Aus der Perspektive von Wüsten und Ozeanen erscheint alle menschliche Moral absurd – wir sind zur Bedeutungslosigkeit verurteilt. Werte zu verteidigen scheint sinnlos. Eine eindimensionale Ontologie verleitet uns zu der Deutung: Angesichts der drohenden Zerstörung ist alles Leben gleichermaßen unbedeutend. Wenn Tier- und Pflanzenarten oder ein ganzes Ökosystem aussterben und verschwinden, ist das gemessen an den Zyklen von Auslöschung und Erneuerung eines Planeten kaum von Belang.
Derlei trägen Gedanken sollten wir widerstehen; tatsächlich sollten wir genau für das Gegenteil kämpfen – die geologische Zeit als radikale Perspektive spornt uns zum Handeln an, nicht zur Apathie. Denn in geologischen Zeiträumen zu denken kann uns Anregung sein, der unruhigen Gegenwart nicht zu entfliehen, sondern sie neu zu denken; als ein Gegengewicht zu kurzsichtiger Gier und Rage – mit den älteren und langsameren Geschichten vom Erschaffen und Zerstören. Bestenfalls könnte uns ein Bewusstsein für die geologischen Zeitspannen dabei helfen, uns als Teil eines großen Netzwerks zu begreifen, in dem wir schenken, erben und weitervererben, das sich über Jahrmillionen in die Vergangenheit und Zukunft erstreckt, um zu bedenken, was wir den nachfolgenden Wesen und Epochen hinterlassen wollen.
In den Dimensionen der geologischen Zeit werden Dinge lebendig, die unbelebt schienen. Neue Verantwortung springt in Geist und Auge. Ein wohlwollendes Miteinander liegt nahe – auch mit der fernen Zukunft. Die Welt wird wieder merkwürdig lebhaft und vielseitig. Eis atmet. Gestein hat Gezeiten. Berge folgen Ebbe und Flut. Felsen pulsieren. Wir leben auf einer ruhelosen Erde.
~
Die ältesten Geschichten über das Unterland erzählen von gefährlichen Fahrten in die Dunkelheit, um Personen oder Gegenstände aus dem Totenreich zurückzuholen. Eine Variante des um 2100 v. Chr. in sumerischer Sprache verfassten Gilgamesch-Epos berichtet von einer solchen Fahrt in die Tiefe, die Gilgameschs Diener Enkidu im Auftrag seines Meisters in die »Unterwelt« antritt, um dort nach einem verlorenen Gegenstand zu suchen. Enkidu segelt durch Stürme mit Hagelkörnern, die ihn wie »Hämmer« treffen, sein Boot bebt von der Wucht der Wellen, die ihn wie »Schildkröten« oder »Löwen« mit ihren »Köpfen« rammen, und trotz allem gelangt er schließlich in die Unterwelt. Dort aber wird er umgehend eingesperrt – nur um gleich darauf von dem jungen Krieger Utu befreit zu werden, der ihn in einer aufsteigenden Brise durch ein Loch wieder nach oben bringt. Oben im Sonnenschein umarmen und küssen sich Enkidu und Gilgamesch und sprechen stundenlang. Enkidu konnte den verlorenen Gegenstand nicht finden, hat aber wertvolle Neuigkeiten über verschwundene Menschen mitgebracht. »Hast du meine kleinen tot geborenen Kinder gesehen, die nie das Leben kannten?«, fragt Gilgamesch händeringend. »Ich habe sie gesehen«, antwortet Enkidu.
Ähnliche Geschichten finden sich in allen Mythologien. In der klassischen Literatur gibt es zahlreiche Belege für eine solche katabasis (das Hinabgehen in die Unterwelt) und nekyia (die Befragung von Geistern, Göttern oder Toten zur irdischen Zukunft), darunter auch Orpheus’ Versuch, seine geliebte Eurydike aus dem Hades zurückzuholen, oder Aeneas’ Reise, die er – geführt von der Sibylle und geschützt durch den goldenen Zweig – begeht, um den Schatten seines Vaters um Rat zu fragen. Die Rettung der thailändischen Fußballspieler, die vor nicht langer Zeit in einer überschwemmten Höhle feststeckten, war eine moderne katabasis: Die Nachricht erlangte auch deshalb weltweite Aufmerksamkeit, weil sie die Kraft eines Mythos besaß.
All diese Erzählungen tragen in sich ein scheinbares Paradox: dass die Dunkelheit ein Medium des Sehens sein könnte und dass sich die Dinge in der Tiefe vielmehr offenbaren denn verlieren. Sogar das im Englischen viel gebrauchte Verb für »verstehen« – to understand – trägt in sich den alten Bedeutungsaspekt »unter etwas gehen, um es in seiner Gänze zu erfassen«. Und auch das deutsche Verb »entdecken« heißt »durch Ausgraben offenlegen«, »hinabgehen und etwas ans Licht bringen« beziehungsweise »etwas aus der Tiefe holen«. Hier sehen wir uralte Verbindungen. Die erste bekannte Höhlenmalerei in Europa – die Darstellung von Leitern, Punkten und Handumrissen an den Wänden spanischer Höhlen – wird auf ein Alter von 65 000 Jahren geschätzt, also 20 000 Jahre vor dem Zeitpunkt, als der Homo sapiens vermutlich aus Afrika nach Europa kam. Diese Bilder stammen von Neandertalern. Schon lange bevor der anatomisch moderne Mensch das heutige Spanien besiedelte, »haben Menschen Fahrten in die Dunkelheit unternommen«, schreibt ein die Kunstwerke datierender Archäologe.
Im Unterland erzählt von solchen Fahrten in die Dunkelheit und von Expeditionen in die Tiefe auf der Suche nach Wissen. Die Themen reichen von der Dunklen Materie, die bei der Entstehung des Universums gebildet wurde, bis zu den atomaren Aussichten des vor uns liegenden Anthropozäns. Auf dieser Reise durch die Erdgeschichte ist die Linie, entlang derer sich die Geschichte zwischen diesen beiden weit entfernten Punkten entfaltet, die stetig fortschreitende Gegenwart. Und passend zum Thema zieht sich durch die Kapitel ein weites unterirdisches Netzwerk aus Echos, Mustern und Verbindungen.
Seit nunmehr fünfzehn Jahren schreibe ich über die Beziehungen zwischen Landschaften und dem Inneren des Menschen. Aus dem anfänglichen Wunsch, ein persönliches Rätsel zu erhellen – warum mich als junger Mann die Berge so sehr anzogen, dass ich manchmal bereit gewesen wäre, aus Liebe zu ihnen zu sterben – , hat sich ein Werk entwickelt, das in fünf Büchern und annähernd zweitausend Seiten die Tiefen der Erdgeschichte kartografiert. Von den eisigen Gipfeln der höchsten Berge der Welt folgte ich einer abwärtsgerichteten Bahn bis hinab zum zwingenden Endpunkt, der Erforschung aller unterirdischen Ebenen und Geschosse. »Der Abstieg beginnt/als der Aufstieg begann«, schreibt William Carlos Williams in einem späten Gedicht. Ich musste erst in die zweite Lebenshälfte kommen, um halbwegs zu verstehen, was Williams damit meint. Im Unterland habe ich Dinge gesehen, die ich nie vergessen möchte – und Dinge, die ich lieber nie gesehen hätte. Dieses Buch, das mir zuerst als das am wenigsten menschliche erschien, entpuppte sich zu meiner Überraschung als das geselligste. Stand bislang im Zentrum vieler meiner Texte der Fuß eines Wanderers, der sich im Gehen hebt und senkt, so ist es auf diesen Seiten die geöffnete, sich ausstreckende Hand, die grüßt, tröstet und markiert.
Eine Zeit lang hat mich auch die Vision der Samen fasziniert, die die Unterwelt als identische Umkehrung der menschenbewohnten Sphäre sehen, unterhalb der Spiegelachse der Erdoberfläche, sodass »die Füße der Toten, die kopfüber laufen müssen, die Fußsohlen der aufrecht gehenden Lebenden berühren«. Mich rührt die Nähe, die sich aus dieser Stellung ergibt. Die Lebenden und die Toten stehen Sohle an Sohle. Betrachte ich die Fotografien der frühen Handabdrücke an den Wänden der Höhlen in Maltravieso, Lascaux und Sulawesi, stelle ich mir vor, wie ich meine Hand auf die Umrisse der Hand ihrer unbekannten Schöpfer lege. Und wie ich die Wärme einer Handfläche spüre, die durch den kalten Stein gegen meine drückt, sodass wir uns Fingerspitze an Fingerspitze durch die Zeit berühren.
~
Kurz bevor ich mit den hier berichteten Reisen begann, bekam ich zwei Gegenstände geschenkt. An jeden war eine Bitte geknüpft, und ich sollte die Gegenstände nur annehmen, wenn ich zustimmte, beide Bitten zu erfüllen.
Der erste Gegenstand ist ein doppelwandiges Bronzekästchen in der Größe eines Schwaneneis, das schwer in der Hand liegt. Es ist ein Miniatursarkophag, und was er enthält, ist toxisch. Ihr Schöpfer schrieb sich die schlimmen Dinge von der Seele, die ihn verfolgten: alles, was er hasste, fürchtete und verloren hatte, das Leid, das er anderen und andere ihm zugefügt hatten. Er verbrannte das Papier und verbarg die Asche im Kästchen. Dann überzog er das Kästchen mit einer zweiten Bronzeschicht, um es noch stabiler zu machen. Während des Gießens bekam die äußere Bronzeschicht Scharten und Krusten, sodass sie wie die Oberfläche eines Planeten oder das Wetter über einem solchen aussah. Als Nächstes schlug er vier Eisennägel durch die Mitte des Kästchens, kürzte die Enden bündig und feilte sie flach. Es ist ein außergewöhnlich kraftvolles Objekt, das die kultische Energie in sich trägt, die ihm seine Herstellungsweise eingeschrieben hat. Es hätte zu jedem Zeitpunkt in den letzten 2500 Jahren hergestellt werden können, stammt aber aus jüngster Zeit.
Ich bekam das Kästchen unter der Bedingung, dass ich es an der tiefsten und sichersten Stelle im Unterland verbergen sollte, die ich finden könne – damit es niemals wieder an die Oberfläche zurückkehrte.
Das zweite Objekt ist eine aus Walknochen geschnitzte Eule. Sie ist ein Talisman und steht für etwas Magisches. Der Minkwal, aus dem die Eule gemacht ist, wurde tot an die Küste einer Hebrideninsel geschwemmt. Querschnitte einer Rippe wurden glatt geschliffen, bis sie knapp eineinhalb Zentimeter dick und knapp fünfzehn Zentimeter lang waren. In einen dieser Querschnitte wurden mit einer Klinge vier Kerben geschnitten: zwei für die Augen, zwei für die angedeuteten Flügel. Es ist ein außergewöhnlich schönes, von eiszeitlicher Einfachheit geprägtes Objekt. Es hätte zu jedem Zeitpunkt in den letzten 20 000 Jahren hergestellt werden können, stammt aber aus jüngster Zeit.
Ich bekam die Eule unter der Bedingung, dass ich sie unter der Erdoberfläche immer bei mir tragen sollte, damit ich durch sie im Dunkeln besser sähe.
ERSTER TEIL
Sichtbar Großbritannien
2 Begräbnis
Mendip Hills, Somerset
Die Knochen eines Kindes liegen in der Dunkelheit auf einem Vorsprung aus Kalkstein. Seit über 10 000 Jahren hat kein Sonnenlicht das Kind gesehen. In dieser Zeit hat Kalkspat, der wie Silberlack den Fels hinabgeflossen ist, die Leiche in einen Kokon eingehüllt.
Im Januar 1797 gehen zwei Männer in den Mendip Hills von Somerset auf Kaninchenjagd. In einer Schlucht scheuchen sie ein Kaninchen auf. Es rennt davon und schlüpft in einen Findlingshaufen. Die Männer haben Hunger; sie wollen das Kaninchen kriegen. Also schieben sie ein paar Steine beiseite – und »sehen voller Verwunderung einen unterirdischen Gang«. Sie betreten den steil in die Kalksteinböschung führenden Tunnel, der in eine »große, imposante Höhle mündet, deren Decke und Seitenwände eigentümlich abgerieben und blankgescheuert sind«.
Die Wintersonne folgt ihnen in den Gang und erhellt den Hohlraum. Jetzt sehen sie, dass es ein Beinhaus ist. Auf dem Boden und an den Wänden zu ihrer Linken liegen Gebeine und vollständige Skelette, »wild durcheinander und fast schon versteinert«. Die Überreste glänzen von Kalzit, auf einigen Knochen häuft sich roter Ockerstaub. Ein einzelner großer Stalaktit hängt von der Decke, und wenn man ihn anschlägt, tönt es glockenhaft durch die Höhle. Inzwischen hat der Stalaktit bereits den Höhlenboden erreicht und angefangen, eines der Skelette zu überwachsen; einen Schädel, einen Oberschenkelknochen und zwei Zähne mit noch intaktem Zahnschmelz hat er schon verschlungen.
Ebenfalls in der Höhle liegen die Überreste mehrerer Tiere: die Zähne eines Braunbären, eine Speerspitze aus Rothirschgeweih und die Knochen von Luchs, Fuchs, Wildkatze und Wolf. Auch Votivgaben finden sich hier: eine Halskette aus den Gehäusen von sechzehn Strandschnecken, derart aufgereiht, dass beim Tragen der Kette die Spitzen ihrer Häuser nach außen zeigen; und ein Nest aus sieben Stücken fossiler Ammoniten, deren rundes Ende außen blank gerieben war.
Wie später festgestellt wurde, sind die menschlichen Leichen über 10 000 Jahre alt, neben Erwachsenen liegen Kinder und Kleinkinder. Alle weisen Anzeichen chronischer Mangelernährung auf. Die Erwachsenen waren gerade einmal 1,50 Meter groß. Die Backenzähne der Kinder kaum abgenutzt. Im Laufe der Forschung wurde klar, dass diese mysteriöse Höhle – heute als Aveline’s Hole bekannt – in der Mittelsteinzeit etwa einhundert Jahre lang als Friedhof benutzt wurde. Damals war noch sehr viel Wasser in Gletschern gebunden. Der Meeresspiegel lag deutlich tiefer als heute. Der Bristolkanal und große Teile der Nordsee existierten noch nicht, sodass man von den Mendip Hills trockenen Fußes ins nördlich gelegene Wales oder nach Osten über das Doggerland nach Frankreich und in die Niederlande laufen konnte.
Die Entdeckung von Aveline’s Hole legt nahe, dass sich in diesem Gebiet eine Gruppe nomadischer Jäger und Sammler für zwei oder drei Generationen niedergelassen und die Höhle als Grabstätte benutzt hat. Diese Menschen – deren Leben kurz und unvorstellbar hart war, weil sie wenig Nahrung und daher wenig Energie hatten – scheuten weder Mühe noch Sorgfalt, um die Leichen der Toten an diese schwer zugängliche Stelle im Hang zu bringen, den Eingang der Höhle für jedes Begräbnis neu zu öffnen, sie in die Kammer zu legen, ihnen bedeutungsvolle Gegenstände und die Knochen von Tieren beizugeben und zuletzt den Eingang wieder zu verschließen.
Diese umherziehenden, hungrigen Menschen wünschten sich einen sicheren Ort für ihre Toten, an den sie immer wieder zurückkehren konnten. In Großbritannien ist aus den darauffolgenden 4000 Jahren kein vergleichbarer Friedhof bekannt.
Wir sind zu den Toten oft liebevoller als zu den Lebenden, obwohl die Lebenden unsere Liebe viel mehr brauchen.
~
»Die Mendips sind Bergbauland«, sagt Sean. »Und Höhlenland. Vor allem aber Begräbnisland. Es gibt hier Hunderte von Hügelgräbern aus der Bronzezeit, die zum Teil mit anderen Begräbnisstätten und Henges zu weitläufigen rituellen Anlagen verbunden sind. In einem Hügelgrab hat ein Antiquar, ein gewisser Skinner, einen Bernstein mit einer eingeschlossenen Biene gefunden, bei der man sogar noch die Härchen auf den Beinen erkennen kann.«
Spätnachmittag, Frühherbst, unzumutbare Hitze. Flirrende Luft, brennend heiße Autotüren. Aber im Haus von Sean und Jane Borodale, im Schatten eines stillen Seitenarms des Nettlebridge Valley, ist es kühl wie in einer Vorratskammer. Auf der Veranda wanken Türme aus Brettspielen. Davor gedeihen Pflanztöpfe mit Minze, Thymian und Rosmarin. In die Schwelle der Eingangstür wurde ein großer Ammonit eingesetzt, der vom jahrzehntelangen Betreten blank geschliffen ist. Und im Garten hängen an den ausgestreckten Flügeln eines hoch aufragenden Totempfahls die abgezogenen Häute zweier Männer.
»Das sind unsere Schlatze«, sagt Sean und weist vage zu den Höhlenanzügen. »Um genau zu sein, sind es Chemieschutzanzüge. Die habe ich aus Osteuropa. Für uns ideal. Wirst schon sehen.«
Sean, Jane und ihre beiden Jungs wohnen in diesem Haus schon seit Jahren wie im Märchen. Die vormalige Besitzerin hat darin spiritistische Sitzungen abgehalten, um mit den Toten im Jenseits zu sprechen. Nach Westen zieht sich ein runzliges Feld den Steilhang hinauf, bis es in den Eschenwäldern auf dem langen Grat verschwindet. Ein Bach plätschert den Hang hinab, am Haus vorbei.
Ich bin in die Mendip Hills gekommen, um zu lernen, wie man im Dunkeln sieht. Sean kennt die Hügellandschaft in- und auswendig, auf wie unter der Erde. Er ist Imker, Höhlenkletterer, Wanderer und ein beachtenswerter Dichter. Ein schwarzgelockter, freundlicher Mann. Über Jahre hat er eine lange Serie von Gedichten oder Erdgesängen verfasst, die aus dem Unterland der Mendip Hills kommen – und teils dort aufgeschrieben wurden: in den Bleiminen, den Eisenhütten, den Kalksteinbrüchen, den zahlreichen Grabhöhlen, den Bunkern aus dem Kalten Krieg und den unzähligen, kilometerlangen natürlichen Höhlen und Tunneln, die den Untergrund durchziehen. Sean fesseln die großen Mythen vom Abstieg in die Unterwelt – von Dante und Vergil, Persephone und Demeter, Eurydike, Orpheus und Aristaios, dem Bienenzüchter – sowie die aus Dunkelheit und Blindheit erwachsenden seherischen Fähigkeiten. Seine Gedichte über das Unterland wirken auf mich erdverhaftet und überirdisch zugleich. In ihnen erhält die geologische Zeit eine Stimme, wird die Erde aufgewühlt, spricht der Stein. Und auch die Toten holt der Dichter kurzzeitig zurück ins Leben.
Die Mendip Hills erheben sich südlich von Bristol und westlich von Bath. Von ihrem südlichen Rand kann man an klaren Tagen über das wasserreiche Tiefland der Somerset Levels bis zum Glastonbury Tor sehen. Von Osten nach Westen erstrecken sich die Mendip Hills über fast fünfzig Kilometer, bis sie am Bristolkanal ins Meer abfallen. Ihre Geologie ist komplex, zumeist aber handelt es sich um Kalksteingebirge – und Kalksteinland, wie Arthur Conan Doyle schrieb, ist »hohl. Könnten Sie mit irgendeinem gigantischen Hammer draufschlagen, es würde dröhnen wie eine Trommel oder womöglich komplett einstürzen und irgendeinen riesigen unterirdischen See freilegen«.
Die bemerkenswerteste Eigenschaft von Kalkstein ist seine Wasserlöslichkeit. Der Regen nimmt Kohlendioxid aus der Luft auf, sodass Kohlensäure entsteht – nur schwach konzentriert, aber doch sauer genug, um Kalkstein mit der Zeit zu zersetzen und abzutragen. Es entstehen Spalte, sogenannte Kluft- und Flachkarren, sowie verborgene Labyrinthe aus Gräben und Kammern. Wasserläufe bearbeiten den Stein mit ihrer Kraft weiter. Thermalwasser fräst auf seinem Weg nach oben neue Formen in den Fels. Kalksteinlandschaften bergen viele verborgene Orte. Wie Lungen haben sie ein verblüffendes Volumen. Die Tore zu ihrem weitläufigen Unterland sind Erdfälle, Karsttrichter oder Schwinden, wo Wasserläufe in ihrem eigenen Bett versinken. Tim Robinson, der große Autor und Kartograf des irischen Westens, weiß, wie trügerisch Kalkstein ist. Nachdem er über vierzig Jahre lang auf ihm gelebt und ihn auf Karten verzeichnet hat, zieht er den Schluss: »Ich traue dem Boden keinen Zollbreit.«
»Komm, ich zeig dir den Garten«, sagt Sean.
Das zum Haus gehörige Land fällt zum Hauptstrom im Tal ab. Wir bleiben an dessen Ufer stehen. Das Wasser ist so klar, dass man es fast nicht sieht. Kleine Forellen wedeln durch die Strömung.
»Das Wasser versteinert alles«, sagt Sean. »Es enthält so viel Kalziumkarbonat, dass alle Blätter und Zweige, die hineinfallen, eine weiße Steinkruste kriegen.«
Grünschwarze Seejungfern tanzen auf der Strömung. Blutdürstige Bremsen schwirren umher.
»Schau mal«, sagt Sean und zeigt nach oben. Wo der unterste Ast einer alten Erle in den Stamm übergeht, ragt das Ende einer krummen Klinge heraus. Der Rest ist unter der Rinde verborgen.
»Das ist eine Sense. Die hat jemand vor Jahrzehnten hier aufgehängt und dann vergessen. Der Baum hat die Klinge verschlungen, während der hölzerne Sensenstiel einfach verfault ist.«
Im Gemüsegarten stehen im Schutz einer Schwarzdornhecke zwei burgunderrote Bienenkörbe. Schräg aufgestellte Anflugbretter führen zu dunklen Öffnungen. Bienen landen auf den Brettern, krabbeln in die Körbe, schwärmen wieder aus.
Wohin ich schaue, sehe ich Ausgrabungen und Verschüttungen. Dachsbauten, Maulwurfshügel, Bienentunnel, die umwachsene Sense, die Bienenkörbe, die Stolleneingänge der Minen. Sogar das in den Dolomithang gebaute Haus ist zur Hälfte eine Höhle.
»Erst als ich die Mendips von unten erkundet habe, habe ich sie wirklich verstanden«, sagt Sean. »An fast allem hier ist in irgendeiner Weise die Unterwelt beteiligt: Steinbruch, Bergbau, Höhlenkletterei. Bleiabbau zur Bronzezeit. Kohleabbau durch die Römer. Riesige Steinbrüche mit einer spiralförmigen Abfahrt bis ganz nach unten in die enge Mitte – eine Art industriell genutzter Trasse in Dantes Inferno –, über die die Laster den Kalksteinschotter holen. Und Basaltschotter, der Füllmaterial beim Straßenbau ist.«
Eine Libelle raschelt vorbei.
»Dann die Grabstätten – meistens Hügelgräber aus der Bronzezeit, aber auch Hünenbetten aus der Jungsteinzeit und natürlich Aveline’s Hole aus der Mittelsteinzeit. Dazu die Grabstätten aus dem Mittelalter und der früheren Neuzeit und unsere heutigen, stetig wachsenden Friedhöfe. In dieser Gegend werden seit über 10 000 Jahren Menschen begraben. Seit Langem vertrauen wir dieser Landschaft Dinge an und entnehmen ihr andere.«
~
»Mensch – human – zu sein heißt vor allem, dass man begräbt«, erklärt Robert Pogue Harrison in Die Herrschaft des Todes, seiner Studie zu Begräbnispraktiken, wobei er kühn auf Vico zurückgreift, der meinte, humanitas komme im Lateinischen »zunächst und eigentümlich« von humando, was »beerdigen, Beerdigung« bedeutet und wiederum von humus stammt, »Erde« oder »Boden«.
Gewiss sind wir ebenso sehr eine begrabende wie eine erbauende Spezies – genau wie unsere Vorfahren. In dem südafrikanischen Höhlensystem Rising Star hat ein von sechs Frauen angeführtes Team aus Paläoarchäologen im Kalkstein versteinerte Knochenteile gefunden, die mutmaßlich zu einem bislang unbekannten frühen Verwandten von uns gehören, dem Homo naledi. Die in zwei tiefen Höhlen gefundene dunkle Materie legt nahe, dass Homo naledi bemerkenswerterweise schon vor 300 000 Jahren seine Toten unter die Erde gebracht hat.
Durch das Begräbnis wird der menschliche Körper wieder zu einem Teil der Erde, und die »Beerdigung« wird in vielen Liturgien mit dem bekannten »Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub« eingeleitet. So wie wir Lebenden einen Ort zum Wohnen brauchen, gehört ein besonderer Ruheort für die Toten zu unserer Gedenkkultur. Die Grabkammer, der Grabstein, der Hügel, auf dem die Asche verstreut wird, der Steinhaufen: Orte, an denen die Lebenden ihren Verlust betrauern und Frieden damit finden können. Wer nicht weiß, wo sich der Leichnam eines geliebten Menschen befindet, leidet unter einer heillosen Trauer – zerstörerisch und zersetzend.
Wir übergeben die Toten und ihre Überreste der Erde zur sicheren Verwahrung. Etwas zu begraben heißt, es zu bewahren – als Erinnerung, als Materie – , denn im Unterland verhält sich die Zeit anders, kann sie sich verlangsamen oder gar stehenbleiben. In seiner tiefgründigen Meditation Urnenbestattung über Beerdigungen und Geschichte aus dem Jahr 1658 beschreibt Thomas Browne einen Fund, den er in den 1650er-Jahren in einem sandigen Feld bei Walsingham machte: »zwischen vierzig und fünffzig Urnen … nicht einen Meter tief, nicht weit von einander entfernt«. Jede Urne enthielt bis zu einem Kilogramm menschlicher Gebeine und Asche, dazu Opfergaben: »Theile kleiner Schachteln oder fein gearbeitete Kämme, die Griffe kleiner Bronzwerkzeuge, Bronzzangen, und einmal eine Art Opal«. Browne nennt die dunklen Innenräume dieser vergrabenen Urnen »Konservatorien« – sie konservieren, schützen vor den »durchdringenden Atomen der Lufft«, die die überirdische Welt zerfressen. Die Urne ist für ihn eine helle Kammer der Erinnerung, sicher verborgen »in der Thiefe der Erde«.
Gerade Kalkstein ist seit Urzeiten Begräbnisgrund – weil er weltweit so häufig vorkommt, weil durch seine schnelle Erosion viele natürliche Grüfte entstehen und weil Kalkstein geologisch gesehen selbst ein Friedhof ist. Er besteht zumeist aus toten Meeresorganismen – Crinoiden und Coccolithophoriden, Ammoniten, Belemniten und Foraminiferen – , die in den einstigen Meeren starben und sich dann zu Zigtausenden zusammengepresst auf dem Meeresboden ablagerten. Sie hatten Skelette und Gehäuse aus Kalziumkarbonat, dem mineralischen Anteil des Wassers, den sie in filigrane Architektur verwandelten. Insofern lässt sich Kalkstein auch als Phase eines dynamischen Erdzyklus sehen, in dem Mineral zu Tier zu Stein wird; und dieser Stein liefert geologische Zeitalter später das Kalziumkarbonat, aus dem neue Organismen ihre Körper bauen, sodass der Zyklus in fortdauernder Bewegung bleibt.
Dieser Reigen von Leben und Tod, aus dem Kalkstein entsteht, macht ihn für mich zum lebendigsten und bemerkenswertesten Stein überhaupt – und in den Bestattungen der Menschen, die wir ihm anvertrauen, schwingt manchmal ein Echo der vielfältigen Arten mit, aus denen er besteht.
Vor circa 27 000 Jahren wurden auf einem Kalksteinhügel über der Donau im heutigen Österreich zwei tot geborene Babys Seite an Seite in ein frisch gegrabenes rundes Loch gelegt. Sie waren in Tierhäute gewickelt, die Aushebung wurde mit rotem Ocker aufgefüllt, dem gelbe Elfenbeinperlen beigemischt waren. Dann wurde ein Schutzdach errichtet, um die Leichen vor der erdrückenden Umarmung der Erde zu bewahren: das Schulterblatt eines Wollhaarmammuts, als knöchernes Leichentuch auf Stoßzähne gebockt.
Vor 12 000 Jahren bekam eine etwa vierzigjährige Frau in einer Kalksteinhöhle über dem Fluss Hilazon im Norden des heutigen Israel ein Grab hergerichtet. In den Boden der Höhle wurde ein ovales Loch gegraben, die Seiten verkleidete man mit Kalksteinplatten. Schließlich wurde der Leichnam nach Norden hin zusammengekauert in das Grab gebettet. Darüber wurden zwei Steinmarder drapiert, deren braun-cremefarbenes Fell im spärlichen Licht schimmerte: einer auf der oberen, einer auf der unteren Körperhälfte. Auf ihre Schulter kam der Vorderlauf eines Wildschweins. Zwischen ihre Füße ein menschlicher Fuß. Dann wurden auf dem gesamten Leichnam sechsundachtzig geschwärzte Schildkrötenpanzer verteilt. An ihrem Steißbein der Schwanz eines Auerochsen niedergelegt. Und zuoberst ein Steinadlerflügel über ihr ausgebreitet. Nun war sie vollends in ein wundersames Mischwesen verwandelt – die Vereinigung verschiedenster Wesen. Abschließend kam eine große Kalksteinplatte auf das Loch, um das Vielgeschöpf in seiner Grabkammer einzuschließen.
Auf einer freiliegenden Kalksteinfläche in der Nähe des Dorfes Stoney Littleton in Somerset wurde vor 5500 Jahren ein Steingrab errichtet. Es blieb dauerhaft in der Landschaft präsent als flaches, grasüberwachsenes Grab am Hang eines Hügels, der einladende Eingang mit dem markanten Türsturz aus einer großen waagerechten Steinplatte und den beiden senkrechten Platten als Zargen an den Seiten. In der westlichen Zarge der Abdruck eines dreißig Zentimeter hohen Ammoniten.
Ganze zehntausend Jahre lang – angefangen bei den ersten, von den Kaninchenjägern entdeckten Überresten der nomadischen Jäger und Sammler – haben Menschen ihre Toten im Kalksteinhochland der Mendip Hills begraben. Allein hier finden sich an die vierhundert Rundhügel aus der Bronzezeit zwischen 2500 und 750 v. Chr. Die meisten davon liegen nah beieinander und enthielten – bis sie Plünderern oder Pflügen zum Opfer fielen – jeweils eine Leiche und deren Grabbeigaben. Meist wurden die Toten in einer Steinkiste oder Kragenurne unter die Erdkuppe gebettet. Als Grabbeigaben fanden sich getöpferte Becher, Flintpfeilspitzen mit Widerhaken, ein Dolch aus Bronze, Nadeln mit Bernsteinköpfen und Perlen aus Gagat und Schiefer. Dass sie in die Gräber gelegt wurden, deutet auf den in vielen Kulturen verbreiteten Glauben hin, es folge für den Toten eine Reise in ein Jenseits, auf der noch irdische Dinge vonnöten seien.
~
Sean und ich gehen zum Haus zurück, treten über den Ammoniten in der Türschwelle und gelangen in die weißwandige Küche. Ich bin erleichtert, nach der Hitze im Garten wieder im kühlen Haus zu sein. Jane begrüßt mich lächelnd.
»Heute ist ein guter Tag für einen Besuch bei uns«, sagt sie. »Im Sommer ist das Haus ein Traum. Aber in den anderen drei Jahreszeiten, wenn der Nordwind durchs Tal bläst, zum einen Giebel rein, zum anderen wieder raus, kriegt man es einfach nicht warm. Und das Licht ist schnell weg. Im Winter liegen wir hier schon am frühen Nachmittag im Schatten, und es ist dunkel und kalt.«
An diesem Nachmittag sitzen und reden wir und trinken Tee. Auf dem Tisch steht ein nach russischer Art verzierter blau-weißer Porzellanteller, auf dem ein Dampfzug aus einem Tunnel auf winterliche Felder fährt. Neben den Gleisen gehen zwei Bauern, die Reisig auf dem Rücken tragen, während der Zug einen Hahnschweif aus Dampf hinter sich herzieht, der in den blauen Dämmerhimmel aufsteigt, bevor er sich hinab in den Tunnel senkt.
In einer Ecke des Zimmers spielen die beiden Jungen von Jane und Sean, Louis und Orlando, auf dem Computer Minecraft. Ich gehe zu ihnen. Sie graben schwer und hacken sich durch bis auf den Fels, um wertvolle Mineralien zu finden.
»Wir brauchen nicht Redstone, wir brauchen Obsidian«, sagt Louis.
»Wir wollen den Enderdrachen killen!«, sagt Orlando.
»Wir bauen ein Portal zum Nether!«, sagt Louis.
»Los, runter in die Höhle«, sagt Sean.
~
Satt schimmernd wie Bernstein ergießt sich im Westen das Abendlicht übers Land.
Über den Zauntritt, durch das Feld mit gelbem Greiskraut, über ein weiteres Feld, zu dem Loch im Gras, dem kopfstehenden Kegel, an der bauchigsten Stelle zwanzig Meter breit. Pferde in Fliegenwolken.
Die abfallenden Seiten des Erdfalls üppig besetzt mit schmalblättrigen Weidenröschen. Der Bauch verbuscht mit altem Holunder. Als wir uns nähern, poltern zwei Ringeltauben davon. Am tiefsten Punkt des Kessels öffnet sich ein Eingang ins Unterland der Mendip Hills.
Ein kleines Blockhaus steht auf dem dunklen Kalksteinschlund. Obwohl ich schon in viele Höhlen gestiegen bin, fällt mir plötzlich das Schlucken schwer, als hätte ich einen Kiesel im Hals. Mein Kopf ein Bienenschwarm. Sean ist seelenruhig, will schnell nach unten.
Der Einstieg ist mühsam – wir zwängen und winden uns in die Tiefe, bis ich jäh in einen Raum falle, der rundum geschlossen scheint, eine zylindrische Zelle. In der Dunkelheit weiten sich unsere Pupillen zu Brunnenschächten, bis wir die Strahler einschalten. Sean geht vor, liegt schon am Boden und schiebt sich, Kopf voran, am dunklen Boden in einen schmalen Spalt. Langsam verschwinden seine strampelnden Beine, und als ich nichts mehr von ihm sehe, mache auch ich mich auf den Weg. Das Gesicht in feuchten Kies gepresst, winde ich mich voran, der Fels wird zur Hand, die erst meinen Schädel zu Boden drückt, dann den Rücken, schließlich kurz den ganzen Körper im Griff hat – dann stehe ich auf der anderen Seite des Gangs neben Sean vor einer dreieinhalb Meter breiten Öffnung, durch die seit Jahrtausenden ein Wasserfall fließt und einen schmalen tiefen Tunnel in den Stein schneidet. Wir klettern nach unten, das Gesicht am feuchten Fels, an dem die Füße abrutschen, erst ich, dann Sean. Der Tunnel macht eine Kurve, dann noch eine – bis er sich plötzlich grandios weitet.
Der Raum lässt uns den Atem stocken. Wir fahren mit den Strahlern über Dach und Wände, ermessen seine Größe. Der schmale Einstieg, durch den wir uns gequetscht haben, ist zu einer Schlucht ausgewachsen, die vom Wasser über unermesslich lange Zeit in den Fels gegraben wurde. Die Schluchtwände sind weit geschwungene Kalksteinbögen, in deren Grau der Kalkspat aufblitzt.
Wir steigen weiter hinab. Schlängeln uns an Steinblöcken groß wie Autos vorbei, die von der Decke ins Flussbett gefallen sind. Es wird steiler. Über uns leuchten vereinzelte Sterne: Stalaktitenbläschen, die das Licht unserer Lampen auffangen und bündeln. Dann, plötzlich, gehen von beiden Seiten der Schlucht Steinlawinen ab, auf uns herunterkrachende Wellen von Geröll und Felsgestein – die sonderbarerweise in ihrer Bewegung eingefroren sind und über unsere Köpfe geneigt verharren. Ich sehe, dass Kalkspat die Brocken zusammenhält. Zeit kann trügen.
Bewegungen, die seit Tausenden von Jahren still stehen, sehen aus, als könnten sie jederzeit weitergehen. Meine Nerven kitzeln, während ich mich unter den stehenden Steinwellen entlanghangele. Jede Positionsänderung des Körpers fühlt sich ruckhaft an, riskant.
Über uns auf der Erdoberfläche wedeln Pferde die Fliegen fort, wimmeln Raupen über Greiskraut, senkt sich die Sonne zur Dämmerung. Menschen fahren mit offenem Fenster und laufendem Radio von der Arbeit nach Hause.
Unter alledem gehen Sean und ich durch zwei weitere Steinbögen hindurch. Der Fels in der Schlucht wird rutschiger. Wir ahnen, dass sich bald ein großes Loch unter uns auftun wird. Ich fühle mich wie Wasser, das in die Tiefe gezogen wird, als könnte ich den Hang hinab und über die unsichtbare Kante fließen. Die Akustik ändert sich; das Echo nimmt zu. Alarmiert bleiben wir stehen. Vor unseren Füßen wird die Schlucht zum Abgrund, dessen Boden wir nicht sehen.
»Das könnte der Nether sein, Sean«, sage ich.
»Komm, wir machen eine Pause«, sagt er.
Wir setzen uns auf zwei Steinblöcke und schalten die Stirnlampen aus. Das Nachleben des Lichts, das Nachglühen der Lampen, die Geistergestalten auf der Netzhaut: Farne und Blätter. Dann stellt sich langsam Dunkelheit ein, bis ich meine Hand, selbst wenn ich sie direkt vor die Augen halte, nur noch am Widerhall und dem warmen Atem auf der Innenfläche erkenne. Zwischen Sean und mich ist ein schwerer schwarzer Vorhang gefallen und zur Steinwand verhärtet, sodass jeder bald in seinem eigenen Unterland sitzt.
Wir stellen uns Stein meist als leblose Masse vor, verhärtete Stetigkeit. Doch hier in diesem Spalt erscheint er mir eher wie eine Flüssigkeit, die im Fließen nur kurz innehält. In geologischen Zeiträumen faltet sich Stein zu Schichten, strömt Lava, treiben Platten dahin, fließen wie Kies. In diesen Zeiträumen bewegt sich der Fels, setzt Masse an und erhebt sich vom Meeresboden zum Gipfel. Auch die Grenzen zwischen Leben und Nicht-Leben verschwimmen hier unten. Ich denke an die in Aveline’s Hole entdeckten kalkspatglänzenden Knochen, wild durcheinander und fast schon versteinert … Ich nehme die Eule aus Walknochen, fahre über die Blindenschrift auf ihrem Rücken, die Bögen ihrer Flügel und denke daran, wie sie sich von den gestrandeten Rippen eines Wals in die Lüfte erhoben hat. Auch wir sind teils mineralische Wesen – unsere Zähne Korallen, unsere Knochen Steine – , und es gibt nicht nur die Geologie des Landes, sondern auch des Körpers. Dank der Mineralisierung – der Fähigkeit, Kalzium in Knochen zu verwandeln – können wir aufrecht gehen, sind wir Wirbeltiere, bilden Schädel aus, die unser Gehirn schirmen und schützen.
Sean knipst sein Licht wieder an. Grelle, Zwinkern. Wieder der Abgrund vor unseren Füßen, in den das Wasser läuft. Vielleicht gelangen wir auf unserer Erkundung später noch zum Landebecken des Wasserfalls, weshalb wir beschließen, ein Seil anzubinden und hinunterzulassen, um von unten wieder hochklettern zu können. Wir suchen uns einen großen Felsblock und werfen die Mitte des Seils darüber; dann schlägt Sean mit der Handkante einen Keil zwischen Wand und Stein, damit das Seil nicht über den Felsblock rutscht, wenn Zug darauf kommt. Ich schieße das Seil zu Rollen auf, verknote die Enden und werfe die Rollen nach zwei Probeschwüngen – eins, zwei, hopp! – hinunter ins Loch.
Zischen, Surren, im Licht zuckende Schlangen, das gegen den Stein peitschende Seil.
»Jetzt«, sagt Sean, »müssen wir nur noch runter und an die Stelle da unten kommen. Auf den Karten, die ich gesehen habe, ist hier links über uns ein kleiner Gang. Hoffentlich der richtige.«
Wir entfernen uns vom Rand des Abgrunds, gehen durch die bauchige Schlucht wieder nach oben, zurück durch den Geisterstrom und suchen die linke Wand mit unseren Lampen ab. Wir entdecken drei kleinere Gänge. Probieren sie nacheinander aus.
Der erste lässt uns durch seine Windungen schlingern, bis er in einem Bogen zurück an ein breites Fenster mit Blick auf den Wasserfall führt, unter dem der Fels unbesteigbar abfällt. Der zweite wird zu einem engen Spalt, durch den wir uns stellenweise gerade noch hindurchquetschen können, bis er in einer Sackgasse endet. Der dritte führt uns weit weg von der Haupthöhle, mit vielen Abzweigungen, deren Abfolge wir als Gedächtnisstütze vor uns hinmurmeln – erste links, zweite rechts, dritte rechts – , um nötigenfalls den Rückweg zu finden – und es ist nötig.
Jetzt bleibt nur noch eine Möglichkeit: eine kleine Öffnung nahe der Höhlendecke, zu der wir im Quergang über feuchte Sinterstufen klettern müssen. Hoch über dem Schluchtbett schieben wir uns an der steilen Wand vorsichtig bis an die Sinterstufen heran. Ein beängstigender Übergang. Wir können uns zwar aneinanderseilen, aber nirgends den Sicherungsmann sichern: Ein Fehltritt, und wir gehen beide ab.
Diese Kaskade aus Sinterstufen ist ein bizarres Gebilde. Sinter sind Ablagerungen von Kalkspat, der sich aus dem mineralisch gesättigten Wasser absetzt, das hier die Wände der Kalksteinhöhle herunterläuft. Man kann sich Sinter wie weißes Kerzenwachs vorstellen, das im Fließen aushärtet; allerdings über Zeitspannen, die mit der Brenndauer von Kerzen wenig gemein haben. Während seines langsamen Wachstums bildet er kunstvolle Rüschen und Wulste – wie schrundige Elefantenhaut oder faltige Strümpfe. Sinter ist schön anzusehen, aber schwer zu greifen.
Beim Höhlenklettern sterben nur selten Menschen, doch kann es verdammt schwierig sein, jemanden mit gebrochenem Bein aus einer tiefen Spalte heraufzuholen. Von diesen Stufen zu rutschen brächte uns vielleicht nicht den Tod, aber sicher einen doppelten Beinbruch. Fast sieben Meter. Dennoch wissen wir, dass dieser Weg der richtige ist, weil Seans Stirnlampe knapp unter der Decke eine frühere Spur von Füßen erspäht hat, die den Kalkspat zu dünnen Pfefferminztafeln zertreten haben.
Kleine Sorgenteufel zwicken mich in den Bauch, als wir uns auf den Stufen vorsichtig vorantasten. Gleichmäßige Schritte, jeder Tritt ein Test, als liefe man über ein Hochseil aus nassem Stein, leicht vorgebeugt, um auf dem schmalen Sims mit den Fingerspitzen die Balance zu halten, langsam, schön langsam … dann ist Sean drüben und ich bin drüben und wir lachen erleichtert. Hier, im Tunneleingang unter der Höhlendecke, eröffnet sich uns ein ganz neuer Teil des Irrgartens.
Wir lassen uns von der Schwerkraft leiten und nehmen bei jeder Gabelung des Tunnels den Weg nach unten, bis uns das Echo verrät, dass wir uns einem größeren Raum nähern – und tatsächlich führt uns der Gang an den Wasserfall, wo auch das von uns hinabgeworfene Seil baumelt.
Aber es läuft nicht frei. Es hat sich hinter dem Felsblock verklemmt und ist als Sicherungsseil kaum zu verwenden. Wir können uns beim Hinaufklettern lediglich anbinden, ein Stück klettern, wieder losbinden, etwas weiter oben wieder anbinden, und so weiter. Immerhin bietet es etwas Schutz vor einem Sturz; besser als nichts. Ich gehe voran. Der Fels ist feucht; es gibt einige schwierige Stellen. Ich bin froh, dass wir das Seil haben. Sean folgt mir, und als wir endlich oben angekommen sind, legen wir eine Pause ein, um Kraft für den Rückweg zu schöpfen. Ich friere, Dunkelheit, Nässe und Fels haben mich völlig ausgekühlt.
Die Schlucht hinauf, durch den Einstieg, das enge Loch, Geruch von Grün, der in die Nase steigt, hinauf in den holunderbewachsenen kopfstehenden Kegel, hinauf auf die Ebene der Felder, der Pferde, der herumjagenden Schwalben, aus dem Karbon ins Anthropozän.
Sonnenuntergang am Horizont. Pupillen nadelstichklein. Die Farben grotesk, wunderschön. Das Blau ist durch und durch blau, das Grün tiefgrün. Wir sind wie auf Drogen von den Farben, dem wilden Rauschen des Windes, dem letzten Sonnenlicht, durch das die flinken Schwalben gleiten, dem riesigen Gewölbe des Himmels und seinen wallenden Wolken.
Immer noch blinzelnd laufen wir in unseren orangenen Schutzanzügen zur Landstraße. Im glänzenden Land Rover fährt eine Familie vorbei, die Kinder auf der Rückbank verdrehen die Köpfe nach den Aliens, die wie vom Himmel gefallen scheinen, in Wahrheit aber tief aus der Erde kommen.
~
Die schlimmste Episode der britischen Höhlenkletterei ist die Geschichte des zwanzigjährigen Philosophiestudenten Neil Moss aus Oxford. Ich habe Menschen im Peak District getroffen, die selbst sechzig Jahre später nicht darüber sprechen wollen.
Am Morgen des 22. März 1959, einem Sonntag, machte sich Moss mit einer achtköpfigen Truppe auf zu einem Erkundungsgang in einen abgelegenen Abschnitt der Peak Cavern, eines Höhlensystems bei Castleton in Derbyshire. Die ersten achthundert Meter ist die Peak Cavern eine öffentlich zugängliche Schauhöhle, die seit Anfang des 19. Jahrhunderts Touristen und Einheimische besuchen, um Chören zu lauschen, die auf der Orchestra, einer natürlichen Kalksteinempore hoch oben in der Haupthöhle, Konzerte geben.
Doch dahinter ist die Peak Cavern deutlich schwieriger. Die Höhlendecke wird so niedrig, dass nur ein feuchter Kriechstollen bleibt, Mucky Ducks genannt, der bei starkem Regen mit Wasser vollläuft. Nach der »schlammigen Duckstrecke« kommt ein langer, niedriger Gang, die Pickering’s Passage, der wiederum in einen rechtwinklig abknickenden Gang führt, an dessen Eingang ein steinernes Augenloch wacht, durch das sich ein Mensch gerade so hindurchzwängen kann. Dahinter liegt ein hüfttiefer See und hinter dem See eine schmale Kammer, von der ein ellenbreiter Schacht weiter nach unten führt. Diesen wollte die Gruppe erkunden, um möglichst noch tiefer in das Gängelabyrinth unter dem White Peak zu gelangen.
Moss, ein hochgewachsener, schlanker junger Mann, sollte vorangehen. Man ließ eine Höhlenleiter aus extra leichtem Magnesium in den Schacht hinab, dann stieg Moss selbst hinein. Fast fünf Meter fiel der Schacht senkrecht nach unten, dann wurde er enger und wand sich, um nach einer scharfen Beuge wieder senkrecht abzufallen. Unter einigen Schwierigkeiten gelangte Moss durch die scharfe Beuge bis zum darunterliegenden Abschnitt – wo allerdings Steine den Schacht versperrten. Hier war das Ende.
Zwar spürte Moss, dass sich die Steine unter seinen Füßen bewegen ließen, aber noch tiefer zu kommen schien ihm unmöglich. Also machte er sich auf den Rückweg. Doch kurz vor der scharfen Beuge glitt Moss von der Leiter ab, rutschte ein Stück nach unten und steckte plötzlich fest.
Im engen Schacht konnte er seine Knie nicht ausreichend anwinkeln, um die Füße wieder auf die Sprossen zu setzen, die zu allem Übel schlammverschmiert waren. Seine Arme wurden von den Schachtwänden fest an den Körper gepresst, seine Hände tasteten am glatten Kalkstein vergeblich nach Halt. Zudem schien sich die Leiter im Schacht verschoben zu haben, womöglich da sich die losen Steine zu seinen Füßen bewegt hatten, was den Aufstieg noch schwieriger machte. Das Gestein hatte Moss fest im Griff – und wurde mit jeder Bewegung unentrinnbarer.
»Ich stecke fest«, rief er seinen Freunden zu, die zwölf Meter über ihm in der Kammer warteten. »Ich kann mich nicht mehr bewegen.«
Seine Freunde meinten, sie könnten das Problem lösen, indem sie ihm ein Seil hinunterwarfen und ihn daran aus der Klemme zogen. Allerdings hatten sie nur eine dünne Handleine dabei und kein Sicherungsseil. Sie ließen die Leine hinab, und irgendwie gelang es Moss, sie sich um den Körper zu legen. Doch als ihn seine Freunde hochziehen wollten, riss die Leine. Erneutes Hinablassen und Befestigen. Wieder riss die Leine. Und wieder. An der Leiter selbst konnte man nicht ziehen, da Moss dadurch womöglich noch fester eingeklemmt worden wäre.
Panik stieg in ihm auf. Mit jeder Regung sackte er ein Stückchen tiefer in den Schacht. Ja, er steckte tatsächlich fest – und ihm ging langsam die Luft aus. Mit jedem Atemzug verbrauchte er etwas vom begrenzten Sauerstoffvorrat im Schacht, sodass der Kohlendioxidgehalt der Luft stieg. Und da Kohlendioxid schwerer ist als Sauerstoff, füllte sich der Schacht von unten langsam damit an. Die Luft wurde immer schlechter, erst im Schacht, dann auch oben in der Kammer.
Inzwischen hatte man oben Hilfe geholt, und es begann einer der bis dato größten Rettungsversuche in der Geschichte der Höhlenkletterei. Die BBC