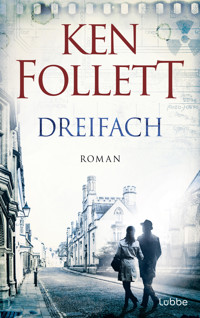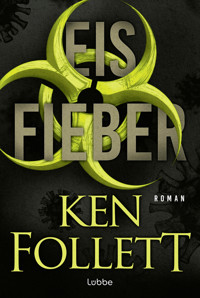9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein kleines, verschwiegenes Tal in Kalifornien. Hier lebt seit den sechziger Jahren eine Hippie-Kommune. Nun aber soll ihr Dorf einem Stausee weichen. Doch die "Kinder von Eden" wollen sich nicht aus ihrem Paradies vertreiben lassen und greifen in ihrer Not zu einem wahnwitzigen Plan: Sie drohen der Regierung, ein Erdbeben stattfinden zu lassen, das entsetzliche Folgen haben wird. Niemand nimmt ihre Ankündigung ernst. Nur die junge FBI-Agentin Judy Maddox , die bereits auf der Abschußliste ihrer Vorgesetzten steht, hat ihre Zweifel und versucht, die Katastrophe zu verhindern. Aber dann überschlagen sich die Ereignisse ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 711
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
[Inhalt]
Über das Buch
Titel
Prolog
Erster Teil · VIER WOCHEN
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Zweiter Teil · SIEBEN TAGE
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Dritter Teil · ACHTUNDVIERZIG STUNDEN
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Epilog
Danksagung
Über den Autor
Hat es dir gefallen?
[Impressum]
Über das Buch
Wie weit darf man gehen, um ein Paradies zu retten?
Ein kleines, verschwiegenes Tal in Kalifornien. Hier lebt seit den Sechzigerjahren eine friedliche Hippie-Kommune, die ihren Lebensunterhalt mithilfe von Landwirtschaft und Weinbau verdient. Nun aber soll ihr Dorf einem Stausee für ein Wasserkraftwerk weichen. In ihrer Not greifen die »Kinder von Eden« zu einem wahnwitzigen Plan. Sie drohen der Regierung: Wenn ihr uns nicht in Frieden hier leben lasst, werden wir die Erde zum Beben bringen. Niemand nimmt ihre Ankündigung ernst. Nur Judy Maddox, eine junge FBI-Agentin, die bereits auf der Abschussliste ihrer Vorgesetzten steht, hat ihre Zweifel. Auch sie weiß, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber unmöglich ist es nicht …
PROLOG
Wenn er sich schlafen legt, sieht er stets diese Landschaft vor sich: Ein Kiefernwald bedeckt die Hügel, dicht und dick wie der Pelz auf dem Rücken eines Bären. In der klaren Bergluft ist der Himmel so blau, dass jeder Blick hinauf in den Augen wehtut. Weitab von der Straße liegt ein verstecktes Tal. Seine Flanken sind steil, und auf seinem Grund fließt ein kühler Bach. Hier, an einer sonnigen, nach Süden geneigten Stelle, uneinsehbar für Fremde, ist der Hang gerodet und mit Reben bepflanzt. Sie stehen ordentlich in Reih und Glied.
Wenn er nur daran denkt, wie schön das alles ist, bricht es ihm schier das Herz.
Männer, Frauen und Kinder gehen langsam durch den Weinberg und pflegen die Reben – seine Freunde, die Frauen, die er liebt, seine Familie. Eine der Frauen lacht. Sie ist groß und hat langes, dunkles Haar. Ihr fühlt er sich besonders verbunden. Sie wirft den Kopf zurück, öffnet weit den Mund, und ihre klare, helle Stimme schwebt übers Tal wie Vogelgesang. Mehrere Männer murmeln leise ein Mantra bei der Arbeit. Sie bitten die Götter des Tals und der Reben um eine gute Ernte. Ein paar gewaltige Baumstümpfe erinnern noch an die Knochenarbeit, mit der sie vor fünfundzwanzig Jahren diesen Ort geschaffen haben. Der Boden ist steinig, aber das ist gut so, denn die Steine speichern die Sonnenglut und schützen die Wurzeln der Reben vor dem tödlichen Frost.
Jenseits des Weinbergs steht eine Ansammlung von Holzhäusern, schmucklos, aber solide gebaut und wetterfest. Aus dem Kamin des Küchengebäudes steigt Rauch auf. Auf einer Lichtung zeigt eine Frau einem Jungen, wie man Fässer baut.
Dieser Ort ist heilig.
Geschützt durch Gebete und seine versteckte Lage, ist er rein geblieben, und die Menschen, die hier leben, sind frei, während die Welt außerhalb des Tals in Korruption und Heuchelei, in Habgier und Schmutz versinkt.
Doch mit einem Mal wandelt sich das Bild.
Irgendetwas ist mit dem kalten, schnell fließenden Bach geschehen. Mäanderte er eben noch durchs Tal, so ist sein Plätschern plötzlich verstummt, seine Strömung jäh gebremst. Wo einst weiße Wasser schäumten, steht jetzt ein dunkler Teich. Das Ufer wirkt unbewegt, doch wenn er den Blick abwendet und es erneut betrachtet, erkennt er, dass der Teich rasch größer wird. Schon bald sieht er sich gezwungen zurückzuweichen, den Hang hinauf.
Er begreift nicht, warum die anderen die steigende Flut missachten. Der schwarze Teich erreicht die erste Rebenreihe, doch sie arbeiten unverdrossen weiter, obwohl ihre Füße bereits im Wasser stehen. Die Häuser werden vom Wasser erst eingeschlossen, dann überflutet. Das Feuer im Küchengebäude erlischt. Leere Fässer dümpeln auf dem entstehenden See und schwimmen langsam davon. Warum laufen meine Freunde nicht weg, fragt er sich. Panik schnürt seine Kehle ein und droht ihn zu ersticken.
Nun ist der Himmel düster von eisengrauen Wolken, und ein kalter Wind zerrt an den Kleidern der Menschen. Doch noch immer gehen sie ihrer Arbeit im Weinberg nach, bücken sich, richten sich wieder auf, lächeln einander zu und unterhalten sich mit leiser Stimme, als wäre nichts geschehen. Er ist der Einzige, der sieht, in welcher Gefahr sie schweben, und er erkennt, dass er etwas tun muss, wenn er ein, zwei oder sogar drei Kinder vor dem Ertrinken retten will. Er will zu seiner Tochter laufen, merkt aber, dass seine Füße im Schlamm stecken und ihn festhalten. Er kann sich nicht mehr bewegen. Die Angst droht ihn zu überwältigen.
Unaufhaltsam steigt das Wasser im Weinberg. Schon reicht es den arbeitenden Männern und Frauen bis zu den Knien, schon schwappt es ihnen um die Taillen, schon stehen sie bis zum Hals in der Flut. Er versucht, ihnen zuzurufen. Er liebt diese Menschen. Los, tut was, möchte er brüllen, bringt euch in Sicherheit, sonst müsst ihr in ein paar Sekunden sterben … Doch obwohl er den Mund aufreißt und seine Kehle schmerzt vor Anstrengung, bringt er keinen Ton heraus. Seine Angst verwandelt sich in reines Entsetzen.
Wasser dringt in seinen offenen Mund und wird ihn allmählich ersticken.
In diesem Augenblick wacht er auf.
Erster Teil VIER WOCHEN
KAPITEL 1
Ein Mann namens Priest zog sich seinen Cowboyhut in die Stirn und spähte über die flache, staubtrockene Halbwüste im Süden von Texas.
In alle Himmelsrichtungen erstreckte sich Gestrüpp: stumpf grüne, niedrige, dornenreiche Mesquitesträucher und Salbeigewächse. Unmittelbar vor Priest hatten Bulldozer eine etwa drei Meter breite, schnurgerade Schneise durchs Gebüsch gefräst. Senderos nannten die spanischstämmigen Fahrer diese Pfade, an deren Rändern – in Abständen von jeweils exakt fünfzig Yards – bonbonrosafarbene Markierungsfähnchen an kurzen Drahtständern flatterten. Ein Lastwagen rollte im Schritttempo über den sendero.
Diesen Lastwagen musste Priest stehlen.
Sein erstes Auto hatte er im Alter von elf Jahren geklaut, einen brandneuen, schneeweißen 1961er Lincoln Continental. Der Wagen stand vor dem Roxy Theater am South Broadway in Los Angeles, und die Schlüssel lagen im Handschuhfach. Priest, der damals noch Ricky hieß, konnte kaum übers Lenkrad gucken und hätte sich vor Angst fast in die Hosen gemacht – aber er hatte es geschafft, den Wagen zu Jimmy »Pigface« Riley zu kutschieren, der zehn Querstraßen weiter auf ihn wartete, und ihm stolz die Schlüssel präsentiert. Jimmy hatte ihm fünf Dollar gegeben, war sofort mit seiner Freundin zu einer Spritztour aufgebrochen – und fuhr den Wagen auf dem Pacific Coast Highway zu Schrott. Ricky aber wurde nach seiner Tat in die Pigface Gang aufgenommen.
Bei dem Laster auf dem sendero ging es jedoch nicht um einen beliebigen fahrbaren Untersatz.
Priest sah, wie das schwere Aggregat auf der Ladefläche hinter der Fahrerkabine langsam eine etwa vier Quadratmeter große, massive Stahlplatte auf den Boden herabsenkte. Nach einer kurzen Pause vernahm er ein tiefes Dröhnen. Die Platte begann, rhythmisch auf die Erde zu hämmern, und um den Laster herum wirbelten Staubwolken auf. Priest spürte, wie der Boden unter seinen Füßen zitterte.
Das Gerät war ein seismischer Vibrator, der dazu diente, Schockwellen durch die Erdkruste zu jagen. Priest, der – außer als Autodieb – nie eine richtige Ausbildung genossen hatte, war trotz dieses Mankos ein kluger Kopf, der es bisher noch mit jedem aufgenommen hatte. Er hatte sofort begriffen, wie der Vibrator funktionierte. Das Prinzip entsprach der Radartechnik. Die Schockwellen wurden an markanten Gesteinsgrenzen im Erdinnern reflektiert und wieder an die Oberfläche zurückgeworfen, wo man sie mit Sensoren – so genannten Geophonen – aufzeichnete.
Priest gehörte zur Geophon-Crew. Die Männer hatten auf einer Fläche von einer Quadratmeile schon über tausend Geophone in genau berechneten Abständen installiert. Jedes Mal wenn der Vibrator die Erde erschütterte, wurden die reflektierten Schwingungen von den Sensoren aufgefangen und von einem Messtechniker aufgezeichnet. Der Mann arbeitete in einem Anhänger, den alle nur »die Hundehütte« nannten. Sämtliche Daten würden später an einen Großrechner in Houston überspielt und dort zu einem dreidimensionalen Datenkomplex zusammengefügt, der die Gesteinsstruktur unter der Erdoberfläche darstellte. So aufbereitet, würde das Datenmaterial schließlich an eine Ölgesellschaft verkauft werden.
Der Ton der Schwingungen nahm zu an Höhe und Stärke und erinnerte nun an die mächtigen Maschinen eines Ozeandampfers, der langsam Fahrt aufnimmt. Dann brach das Geräusch abrupt ab. Die Augen zusammengekniffen vor dem wabernden Staub, rannte Priest über den sendero auf den Laster zu, öffnete die Tür und kletterte in die Kabine. Hinter dem Steuer saß ein etwa dreißigjähriger, untersetzter Mann mit schwarzen Haaren. »Hallo, Mario«, sagte Priest und rutschte auf den Beifahrersitz.
»Hallo, Ricky.«
Richard Granger lautete der Name auf Priests Führerschein der Klasse B. Der Schein war gefälscht, der Name jedoch echt.
Priest hielt eine Stange Marlboro in der Hand, Marios Marke, und warf sie aufs Armaturenbrett. »Hier, ich hab dir was mitgebracht.«
»Hey, Mann, du brauchst mir doch keine Zigaretten zu kaufen!«
»Ich schnorr doch dauernd welche bei dir.« Er griff nach dem offenen Päckchen, das ebenfalls auf dem Armaturenbrett lag, schüttelte eine Zigarette heraus und steckte sie sich in den Mund.
Mario lächelte. »Und warum kaufst du dir nicht deine eigenen?«
»Wer? Ich? Mensch, ich kann mir das Rauchen doch gar nicht leisten!«
»Du bist vielleicht ein Spinner, Mann.« Mario lachte.
Priest zündete sich seine Zigarette an. Kontakte zu knüpfen und sich bei anderen beliebt zu machen war ihm immer leicht gefallen. Auf den Straßen, in denen er aufgewachsen war, schlugen einen die Kerle zusammen, wenn sie einen nicht mochten, und er war als Junge ziemlich klein gewesen. Kein Wunder, dass er schon recht früh ein intuitives Gespür dafür entwickelt hatte, was andere von ihm erwarteten – Respekt, Zuneigung, Humor oder irgendetwas anderes in dieser Preislage –, verbunden mit der Angewohnheit, ihnen möglichst schnell alles recht zu machen. In der Ölbranche war es der Humor, der die Männer zusammenhielt – normalerweise spöttischer, manchmal hintersinniger und oftmals zotiger Humor.
Obwohl Priest erst seit zwei Wochen dabei war, hatte er sich schon das Vertrauen seiner Kollegen erworben. Dagegen wusste er immer noch nicht, wie er den seismischen Vibrator stehlen sollte. Nur eines war klar: Es musste in den nächsten Stunden geschehen, denn morgen würde das Fahrzeug an einen anderen Standort überführt werden – und der lag ein paar hundert Meilen weit weg bei Clovis in New Mexico.
Priest hatte nur einen vagen Plan: Er wollte sich von Mario mitnehmen lassen. Die Fahrt würde zwei oder drei Tage dauern – der Achtzehntonner brachte es auf dem Highway auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von kaum mehr als 45 Meilen in der Stunde. Irgendwo auf der Strecke wollte er Mario betrunken machen und dann mit dem Laster abhauen. Er hatte gehofft, ihm würde noch etwas Besseres einfallen, doch bislang hatte ihn seine Fantasie im Stich gelassen.
»Mein Wagen ist am Verrecken«, sagte er. »Kannst du mich morgen bis San Antonio mitnehmen?«
Mario war überrascht. »Du kommst nicht mit nach Clovis?«
»Nö.« Mit einer Handbewegung verwies Priest auf die öde Landschaft um sie herum. »Schau dir das doch mal an«, sagte er. »Texas ist so herrlich, Mann, da will ich gar nicht weg.«
Mario zuckte mit den Schultern. Leute, die ständig auf Achse waren, gab es in diesem Gewerbe genug. »Klar nehm ich dich mit«, sagte er. Das verstieß zwar gegen die Vorschriften, hinderte jedoch keinen Fahrer daran, es immer wieder zu tun. »Warte an der Deponie auf mich.«
Priest nickte. Die Mülldeponie war ein trostloses Loch, angefüllt mit rostzerfressenen Pickups, zertrümmerten Fernsehapparaten und wurmzerfressenen Matratzen, und befand sich am Rande von Shiloh, der nächstgelegenen Stadt. Kein Mensch würde sehen, wie Mario ihn dort zusteigen ließ – höchstens ein paar Kids, die mit ihren Zweiundzwanziger-Flinten auf Schlangenjagd waren. »Um wie viel Uhr?«
»So um sechs rum.«
»Ich bring uns Kaffee mit.«
Priest brauchte diesen Laster. Er hatte das Gefühl, sein ganzes Leben hinge davon ab. Es juckte ihn in den Fingern, Mario auf der Stelle zu packen, aus der Kabine zu schmeißen und mit der Karre abzuhauen. Aber das war natürlich Unfug. Zum einen war Mario fast zwanzig Jahre jünger als er selber und würde sich vielleicht nicht so ohne weiteres an die Luft setzen lassen. Und zum anderen kam es darauf an, dass der Diebstahl mehrere Tage lang unbemerkt blieb. Priest musste das Fahrzeug nach Kalifornien bringen und dort verstecken, bevor die Polizei im ganzen Land nach einem gestohlenen seismischen Vibrator Ausschau hielt.
Das Funkgerät piepte. Das hieß, dass der Messtechniker in der Hundehütte die Daten der letzten Vibration überprüft und für einwandfrei befunden hatte. Mario zog die Bodenplatte hoch, legte den ersten Gang ein, fuhr an und hielt fünfzig Yards weiter direkt neben dem nächsten rosafarbenen Markierungsfähnchen wieder an. Dort senkte er die Platte auf den Erdboden und gab per Funksignal durch, dass er wieder bereit war. Priest sah ihm aufmerksam zu und prägte sich die Reihenfolge ein, in der Mario Hebel und Schalter bediente. Das tat er nicht zum ersten Mal. Wenn er später etwas vergaß, würde niemand da sein, den er um Anweisungen bitten konnte.
Sie warteten auf das Signal aus der Hundehütte, das die nächste Vibration in Gang setzen würde. Zwar waren auch die Fahrer in der Lage, die Erschütterungen auszulösen, doch behielten sich die meisten Messtechniker das Kommando selber vor und starteten den Vorgang per Fernsteuerung. Priest zog ein letztes Mal an seiner Zigarette und warf die Kippe aus dem Fenster. Mario hatte Priests Wagen entdeckt, der ein paar hundert Meter weiter auf der zweispurigen Asphaltpiste parkte, und deutete mit einem Kopfnicken darauf. »Deine Frau?«
Priest sah auf. Star war aus dem verdreckten hellblauen Honda Civic ausgestiegen, lehnte an der Motorhaube und fächelte sich mit ihrem Strohhut Luft zu. »Yeah«, sagte er.
»Ich zeig dir mal was.« Mario zog ein altes Lederportmonee aus der Tasche seiner Jeans, nahm ein Foto heraus und reichte es Priest. »Das ist Isabella«, sagte er stolz.
Priests Blick fiel auf eine hübsche junge Mexikanerin in den Zwanzigern. Sie trug ein gelbes Kleid und ein gelbes Haarband. Auf der Hüfte trug sie ein Baby; neben ihr stand schüchtern ein dunkelhaariger Junge. »Deine Kinder?«
Mario nickte. »Ross und Betty.«
Priest verkniff sich ein Lächeln über die englischen Vornamen. »Sehen gut aus, deine Kids.« Er dachte an seine eigenen Kinder, und um ein Haar hätte er Mario von ihnen erzählt. Gerade noch rechtzeitig widerstand er dem Impuls und fragte: »Wo wohnen sie?«
»In El Paso.«
In Priests Gehirn keimte eine Idee. »Siehst du deine Familie oft?«
Mario schüttelte den Kopf. »Ich schufte und schufte, Mann. Spar jeden Cent, damit ich ’n Haus für sie kaufen kann. Ein schönes Haus mit ’ner großen Küche und ’nem Swimmingpool im Garten. Sie haben’s verdient.«
Die Idee blühte auf. Priest unterdrückte seine Erregung und fuhr im lockeren Gesprächston fort: »Ja, ja. ’n schönes Haus für ’ne schöne Familie, stimmt’s?«
»Genau. Das hab ich vor.«
Wieder piepte das Funkgerät, und der Laster fing an zu zittern. Der Lärm war wie Donnergrollen, wenn auch nicht so unregelmäßig. Er begann mit einem tiefen Basston, der allmählich höher wurde. Nach genau vierzehn Sekunden war alles vorüber.
In der folgenden Stille schnippte Priest mit den Fingern: »Hör mal, ich hab da ’ne Idee … Aber nee, vielleicht doch nicht.«
»Was’n?«
»Nee, ich glaub, das klappt nicht.«
»Ja, was’n nu, Mann? Was?«
»Na ja, ich dachte eben … Du hast ’ne bildhübsche Frau und süße Kids – irgendwie ist das nicht richtig, dass du sie nicht öfter siehst.«
»Und das soll deine Idee sein?«
»Nein. Ich dachte mir Folgendes: Den Laster könnte doch eigentlich ich nach New Mexico fahren, und du fliegst unterdessen heim zu deiner Familie.« Lass dir bloß nicht anmerken, wie wichtig dir das ist, hielt Priest sich insgeheim vor und fügte laut hinzu: »Aber es wird sowieso nicht klappen.« In seiner Stimme schwang ein »Na und wenn schon« mit.
»Stimmt, Mann. Das geht nicht.«
»Wahrscheinlich nicht. Aber wart mal. Wenn wir morgen ganz früh losziehen und zusammen nach San Antonio fahren, könnte ich dich dort am Flughafen absetzen. Gegen Mittag wärst du dann in El Paso, schätze ich. Da kannst du mit deinen Kindern spielen, deine Frau zum Essen ausführen, zu Hause übernachten und am nächsten Tag wieder zurückfliegen. Ich könnte dich am Flughafen in Lubbock wieder abholen … Wie weit ist es von Clovis nach Lubbock?«
»So um die achtzig, neunzig Meilen.«
»Wir könnten noch am selben Abend oder spätestens am nächsten Morgen in Clovis sein. Kein Aas würde mitkriegen, dass du gar nicht die ganze Strecke gefahren bist.«
»Aber du willst doch nach San Antonio.«
Verdammt! Daran hatte er gar nicht mehr gedacht. Priest ließ sich rasch eine Begründung einfallen. »Aber ich war noch nie in Lubbock«, sagte er leichthin. »Und da wurde immerhin Buddy Holly geboren.«
»Was is’n das für ein Kerl?«
»I love you, Peggy Sue …«, sang Priest. »Als du auf die Welt kamst, war Buddy Holly schon tot, Mario. Ich mochte ihn mehr als Elvis. Aber frag mich jetzt bloß nicht, wer Elvis war.«
»Und du würdest die ganze Strecke fahren? Bloß meinetwegen?«
War das Misstrauen? Oder war Mario nur dankbar? Priest hätte es nur allzu gern gewusst. »Na klar«, sagte er. »Solange ich deine Marlboros rauchen kann.«
Mario schüttelte verblüfft den Kopf. »Du bist ’n Pfundskerl, Ricky. Aber ich weiß nicht so recht …«
Also kein Misstrauen. Aber Mario war vorsichtig und würde sich wahrscheinlich kaum zu einer Entscheidung drängen lassen. Priest verbarg seine Frustration hinter oberflächlicher Lässigkeit. »Denk halt drüber nach«, sagte er.
»Wenn was schief geht, bin ich meinen Job los. Das will ich nicht.«
»Da hast du Recht.« Priest hielt seine Ungeduld in Schach. »Wir können ja später noch mal drüber reden, okay? Kommst du heute Abend in die Bar?«
»Ja, sicher.«
»Da kannst du mir dann ja Bescheid sagen, oder?«
»Okay, das lässt sich machen.«
Aus dem Funkgerät ertönte das Alles-Klar-Signal. Mario legte den Hebel um, der die Stahlplatte vom Boden hievte.
»Ich muss jetzt wieder zur Geophon-Crew«, sagte Priest. »Wir müssen noch ein paar Meilen Kabel einsammeln, bevor’s dunkel wird.« Er gab Mario das Familienfoto zurück und öffnete die Tür. »Ich sag dir eins, Mann: Wenn ich so ein verdammt hübsches Mädchen hätte, würde ich nie mehr auch nur aus dem Haus gehen.« Er grinste, sprang hinaus und warf die Tür hinter sich zu.
Der Lastwagen fuhr an und rollte zum nächsten Fähnchen.
Priest machte sich auf den Weg. Bei jedem Schritt auf dem sendero wirbelten seine Cowboystiefel Staubwölkchen auf. Weiter vorn, dort, wo sein Wagen stand, sah er Star rastlos und sichtlich beunruhigt auf und ab gehen.
Vor vielen Jahren war sie einmal eine Berühmtheit gewesen, wenn auch nur kurzfristig. Zur Blütezeit der Hippie-Kultur hatte sie in Haight-Ashbury gelebt, einem Stadtteil von San Francisco. Persönlich kannte Priest sie damals noch nicht – Ende der Sechzigerjahre war er gerade damit beschäftigt gewesen, seine erste Million zu verdienen. Aber er kannte die Geschichten, die sich um sie rankten. Star war damals eine strahlende Schönheit gewesen, groß und schwarzhaarig, die Figur kurvenreich und wohlproportioniert wie eine Sanduhr. Sie hatte eine Schallplatte herausgebracht, auf der sie zu der psychedelischen Musik einer Band namens Raining Fresh Daisies Gedichte rezitierte. Das Album war ein kleiner Hit gewesen – und Star war eine Zeit lang in aller Munde.
Was sie jedoch zur Legende gemacht hatte, war etwas anderes: ihr unersättlicher sexueller Appetit. Sie trieb es mit jedem, der gerade ihre Fantasie erregte – mit neugierigen Zwölfjährigen und verblüfften Männern in den Sechzigern, mit jungen Männern, die sich für schwul hielten, und Mädchen, die gar nicht wussten, dass sie lesbisch waren, mit Freunden, die sie seit Jahren kannte, und Fremden, die sie sich von der Straße holte.
Doch das war inzwischen schon lange her. In ein paar Wochen würde sie ihren fünfzigsten Geburtstag feiern. Ihr Haar war von grauen Strähnen durchzogen und ihre Figur noch immer üppig, wenn sie auch dem Vergleich mit dem Stundenglas nicht mehr standhielt: Mittlerweile wog Star achtzig Kilo, verfügte aber immer noch über außergewöhnliche sexuelle Anziehungskraft. Wenn sie eine Bar betrat, drehten sich alle Männer nach ihr um.
Selbst jetzt, besorgt und verschwitzt, wie sie war, wirkte ihr rastloses Hin und Her neben dem billigen alten Wagen sexy und das Gewoge ihres Körpers unter dem dünnen Baumwollkleid wie eine einzige Einladung. Priest hätte sie am liebsten auf der Stelle vernascht.
»Na, wie sieht’s aus?«, fragte sie, kaum dass er in Hörweite kam.
Priest war ein Optimist. »Ganz gut«, sagte er.
»Das klingt schlecht«, erwiderte Star skeptisch. Sie kannte ihn zu gut, um alles, was er sagte, für bare Münze zu nehmen.
Priest berichtete ihr von dem Angebot, das er Mario gemacht hatte. »Das Beste daran ist, dass am Ende er die Suppe auslöffeln muss«, schloss er.
»Wieso?«
»Denk doch mal drüber nach: Er kommt nach Lubbock und sucht mich. Ich bin aber nicht da, genauso wenig wie der Laster. Da geht ihm langsam auf, dass man ihn übers Ohr gehauen hat. Was macht er nun? Glaubst du vielleicht, er schlägt sich nach Clovis durch und erzählt in der Firma, dass ihm der Truck geklaut wurde? Kann ich mir nicht vorstellen. Denn im günstigsten Fall wird er bloß rausgeschmissen, im schlimmsten handelt er sich eine Anzeige wegen Lastwagendiebstahls ein und landet im Knast. Jede Wette also, dass er sich gar nicht erst in Clovis blicken lässt. Er wird sich ins nächstbeste Flugzeug setzen, das ihn wieder nach El Paso bringt. Dort packt er seine Frau und seine Kinder ins Auto und verschwindet auf Nimmerwiedersehn. Und dann sind die Bullen natürlich überzeugt, dass er den Brummi gestohlen hat. Ricky Granger dagegen gerät nicht einmal unter Verdacht.«
Star runzelte die Brauen. »Der Plan ist super, aber wird Mario den Köder annehmen?«
»Ich glaub schon.«
Ihre Besorgnis wuchs. Sie schlug mit der flachen Hand auf das staubige Autodach und sagte: »Verdammt! Wir brauchen diesen Laster unbedingt!«
Priest war ebenso besorgt wie sie, überspielte das aber mit übertriebener Selbstsicherheit. »Wir kriegen ihn. Wenn nicht auf diese Weise, dann eben auf eine andere.«
Star setzte ihren Strohhut auf, lehnte sich wieder an den Wagen und schloss die Augen. »Hoffentlich hast du Recht.«
Er streichelte ihre Wange. »Kann ich Sie irgendwohin mitnehmen, Gnädigste?«
»Ja, bitte. Bringen Sie mich in mein klimatisiertes Hotelzimmer.«
»Das kostet aber was.«
Star riss in gespielter Unschuld die Augen auf. »Muss ich dafür was Schlimmes tun, der Herr?«
Seine Hand glitt in ihren Ausschnitt. »Jawohl.«
»O jemine!«, sagte sie und hob den Rock ihres Kleids bis über die Taille.
Sie trug keine Unterwäsche.
Priest grinste und knöpfte sich seine Levi’s auf.
»Was wird Mario denken, wenn er uns so sieht?«, fragte sie.
»Neidisch wird er sein«, sagte Priest, während er in sie eindrang. Sie waren fast gleich groß und fanden mit einer Leichtigkeit zusammen, die lange Übung verriet.
Star küsste ihn auf den Mund.
Wenig später hörte er, wie sich ein Auto auf der Straße näherte. Sie blickten beide auf, ließen sich aber ansonsten nicht stören. Ein Pickup mit drei Landarbeitern auf dem Vordersitz fuhr vorbei. Die Männer sahen, was los war, und grölten und johlten durchs offene Fenster.
Star winkte ihnen zu und rief: »Hallo, Jungs!«
Priest musste so heftig lachen, dass er kam.
Vor genau drei Wochen hatte die Krise ihre letzte, entscheidende Phase erreicht.
Sie hatten gerade an dem langen Tisch im Küchengebäude gesessen und ihr Mittagessen verzehrt, einen würzigen Linseneintopf mit Gemüseeinlage und frischem, ofenwarmem Brot. Da betrat Paul Beale den Raum, in der Hand einen Briefumschlag.
Paul füllte den Wein, den Priests Kommune produzierte, in Flaschen ab – doch das war nicht seine einzige Zuständigkeit. Paul hielt Verbindung nach draußen und sorgte dafür, dass die Kommunarden zwar Kontakt mit dem Rest der Welt halten, sich aber gleichzeitig von ihm abschotten konnten. Der kahlköpfige, bärtige Mann war seit den frühen Sechzigern mit Priest befreundet. Zu jener Zeit waren sie halbwüchsige Gangster gewesen, die in den Slums von L. A. besoffene Penner ausgeraubt hatten.
Priest nahm an, dass Paul den Brief am Morgen in Napa erhalten hatte und sofort zu ihnen gefahren war. Was in dem Brief stand, konnte er sich ebenfalls denken, doch ließ er erst einmal Paul zu Worte kommen.
»Vom Liegenschaftsamt der Regierung«, sagte Paul. »Adressiert an Stella Higgins.« Er reichte das Schreiben Star, die Priest gegenüber an der Schmalseite des Tisches saß. Stella Higgins war ihr richtiger Name – jener, unter dem sie im Herbst 1969 diese Parzelle Staatsland vom Innenministerium gepachtet hatte.
Die Gespräche am Tisch erstarben. Selbst die Kinder hielten plötzlich den Mund; sie spürten die Atmosphäre aus Furcht und Bestürzung.
Star riss den Umschlag auf und entnahm ihm den einzelnen Briefbogen. Mit einem Blick überflog sie den Inhalt des Schreibens. »Am 7. Juni«, sagte sie.
»Fünf Wochen und zwei Tage, von heute an«, sagte Priest. Solche Rechenergebnisse flogen ihm automatisch zu.
Mehrere Leute am Tisch stöhnten verzweifelt auf. Eine Frau namens Song begann leise zu weinen. Eines von Priests Kindern, der zehnjährige Ringo, fragte: »Warum, Star? Warum nur?«
Priests Blick glitt zu Melanie, dem neuesten Mitglied der Gruppe. Sie war eine hoch gewachsene, schmale Frau von achtundzwanzig Jahren, bildhübsch, mit blasser Haut, langem, paprikarotem Haar und der Figur eines Models. Dusty, ihr fünfjähriger Sohn, saß neben ihr. »Was?«, fragte sie, und Entsetzen lag in ihrer Stimme. »Was hat das zu bedeuten?«
Alle hatten sie gewusst, was auf sie zukam, aber da sie es einfach zu deprimierend fanden, darüber zu reden, hatte sich niemand von ihnen bemüßigt gefühlt, Melanie aufzuklären.
»Wir werden das Tal hier verlassen müssen, Melanie«, sagte Priest. »Es tut mir Leid.«
Star las vor: »›Die oben erwähnte Parzelle ist nach dem 7. Juni dieses Jahres nicht mehr zur Besiedlung geeignet, da Gefahr für Leib und Leben entstehen wird. Wir sehen uns daher gezwungen, die Pacht gemäß § 9 Absatz B Ziffer 2 Ihres Vertrags zu kündigen.‹«
Melanie sprang auf. Ihre weiße Haut war gerötet, ihr hübsches Gesicht wutverzerrt. »Nein!«, schrie sie. »Nein! Das können die mir nicht antun – ich habe euch doch gerade erst gefunden! Ich glaube das nicht. Das ist eine Lüge!« In ihrer Wut wandte sie sich gegen Paul. »Du Lügner!«, brüllte sie. »Du gottverdammter Lügner!«
Ihr Kind fing an zu weinen.
»Komm, reg dich ab!«, erwiderte Paul empört. »Ich bin hier doch bloß der beknackte Briefträger!«
Plötzlich schrie alles wild durcheinander.
Mit drei, vier langen Schritten war Priest bei Melanie. Er nahm sie in den Arm und flüsterte ihr ins Ohr: »Du machst Dusty Angst! Setz dich wieder. Ich verstehe ja, dass du wütend bist. Das sind wir alle. Wir schäumen vor Wut.«
»Sag mir, dass das nicht wahr ist«, bat Melanie.
Mit sanftem Nachdruck schob Priest sie auf ihren Stuhl. »Doch, Melanie, es ist wahr«, sagte er. »Es ist wirklich wahr.«
Er wartete ab, bis sich alle einigermaßen beruhigt hatten; erst dann ergriff er wieder das Wort: »Los, Leute«, sagte er. »Machen wir uns an den Abwasch und dann wieder an die Arbeit.«
»Warum sollten wir?«, wollte Dale wissen. Er war der Winzer. Er gehörte nicht zu den Gründern der Kommune, sondern war erst in den Achtzigerjahren, desillusioniert von der alles beherrschenden Kommerzialisierung, zu ihnen gestoßen und nach Priest und Star zur wichtigsten Person der Gruppe geworden. »Zur Weinlese sind wir doch schon gar nicht mehr hier«, fuhr er fort. »In fünf Wochen müssen wir weg. Was sollen wir da noch arbeiten?«
Priest fixierte ihn mit seinem hypnotisch-starren Blick, dem nur äußerst willensstarke Menschen standzuhalten vermochten. Er wartete geduldig, bis absolute Stille herrschte. Dann sagte er: »Weil manchmal ein Wunder geschieht.«
Eine Verordnung des Stadtrats untersagte in der texanischen Gemeinde Shiloh den Verkauf alkoholischer Getränke, doch gleich hinter der Stadtgrenze gab es eine Bar namens Doodlebug, die billiges Bier vom Fass, Kellnerinnen in engen Bluejeans und Cowboystiefeln sowie eine Country-und-Western-Band zu bieten hatte.
Priest kam allein. Er wollte nicht, dass Star hier auftauchte und man sich später womöglich an ihr Gesicht erinnerte. Am liebsten wäre ihm gewesen, sie hätte ihn gar nicht erst nach Texas begleitet – aber er brauchte jemanden, der ihm half, den seismischen Vibrator heimzubringen. Sie würden Tag und Nacht durchfahren, sich gegenseitig am Steuer ablösen und notfalls mit Aufputschmitteln wach halten. Sie wollten unbedingt zu Hause sein, bevor der Lastwagen vermisst wurde.
Er bereute seinen Leichtsinn vom Nachmittag. Mario hatte Star zwar nur aus einer viertel Meile Entfernung gesehen und die Landarbeiter im Pickup bloß im Vorbeifahren, doch Star war eine auffällige Erscheinung. Vermutlich würde jeder dieser Zeugen eine grob umrissene Personenbeschreibung von ihr geben können: eine große Weiße, stämmig, mit langen, dunklen Haaren …
Priest hatte, bevor er nach Shiloh kam, sein Äußeres verändert. Er hatte sich einen buschigen Vollbart und einen Schnäuzer wachsen lassen und sein langes Haar zu einem strammen Zopf gebunden, den er unter den Hut steckte.
Sollte jedoch alles nach Plan laufen, würde kein Mensch je danach fragen, wie er und Star aussahen.
Als er das Doodlebug betrat, war Mario schon da. Er saß an einem Tisch mit fünf oder sechs Männern aus der Geophon-Crew sowie mit Larry Petersen, dem Projektleiter.
Priest wollte sich unter keinen Umständen anmerken lassen, dass er wie auf heißen Kohlen saß. Er bestellte sich daher zunächst ein Lone-Star-Bier, unterhielt sich, wobei er gelegentlich einen Schluck aus der Flasche nahm, mit dem Mädchen am Tresen und gesellte sich erst eine Weile später zu den anderen am Tisch.
Lenny, ein Mann mit schütterem Haar und roter Nase, hatte Priest am Wochenende vor vierzehn Tagen den Job gegeben. Priest hatte einen Abend mit den anderen von der Crew in der Bar verbracht, nur wenig getrunken und sich als recht umgänglich erwiesen. Er hatte ein paar Brocken Fachjargon aufgeschnappt und laut über Lennys Witze gelacht. Am nächsten Morgen war er zu Lenny in den Bürocontainer gegangen und hatte ihn um einen Job gebeten. »Ich stell dich auf Probe ein«, hatte Lenny gesagt.
Das war alles, was Priest brauchte.
Er arbeitete hart, begriff schnell und kam mit den Kollegen gut zurecht. Nach ein paar Tagen gehörte er dazu.
Als er sich zu den anderen an den Tisch setzte, bemerkte Lenny in seinem schleppenden texanischen Tonfall: »Dann kommst du also nicht mit uns nach Clovis, Ricky, he?«
»Nein, Lenny«, antwortete Priest. »Mir gefällt das Wetter hier viel zu gut. Ich will nicht weg.«
»Na ja. Ich will dir eigentlich auch nur ganz ehrlich sagen, dass es mir ein Privileg und ein besonderes Vergnügen gewesen ist, deine Bekanntschaft gemacht zu haben – auch wenn sie nur von kurzer Dauer war.«
Die anderen grinsten. Dieses Wortgeklingel war typisch. Erwartungsvoll blickten sie Priest an und harrten seiner Replik.
Er setzte ein feierliches Gesicht auf und sagte: »Lenny, du bist immer so lieb und nett zu mir gewesen, dass ich dir noch ein Mal, ein einziges Mal noch, die Frage stellen möchte: Willst du mich heiraten?«
Alles lachte. Mario klopfte Priest auf den Rücken.
Lenny setzte eine betrübte Miene auf und erwiderte: »Du weißt doch, dass ich dich nicht heiraten kann, Ricky. Ich habe dir doch schon gesagt, warum.« Er legte eine effektvolle Pause ein, und die anderen beugten sich vor, als könnte ihnen sonst die Pointe entgehen. »Ich bin lesbisch.«
Nun brüllten die Männer vor Lachen. Priest gab sich mit einem reumütigen Lächeln geschlagen und bestellte einen Krug Bier für den Tisch.
Das Gespräch wandte sich dem Baseballspiel zu. Die meisten Männer mochten die Houston Astros; nur Lenny, der aus Arlington stammte, war Anhänger der Texas Rangers. Priest interessierte sich nicht für Sport. Ungeduldig wartend saß er da und ließ nur ab und zu eine neutrale Bemerkung fallen. Die Männer waren in bester Stimmung. Der Job war rechtzeitig abgeschlossen, sie hatten alle gut verdient, und außerdem war Freitagabend. Priest nippte an seinem Bier. Er trank niemals viel, weil er es hasste, seine Selbstbeherrschung zu verlieren. Er beobachtete, wie sich Mario allmählich voll laufen ließ. Als Tammy, die Kellnerin, den nächsten Krug brachte, starrte Mario sehnsüchtig auf ihre Brüste unter dem karierten Hemd. Träum nur schön weiter, Mario. Morgen Abend kannst du schon bei deiner Frau im Bett liegen.
Nach ungefähr einer Stunde verschwand Mario Richtung Herrentoilette.
Priest folgte ihm. Verdammte Warterei. Ich muss jetzt Nägel mit Köpfen machen.
Er stellte sich ans Pissoir neben Mario und sagte: »Schätze, Tammy trägt heute Abend schwarze Unterwäsche.«
»Woher willst du denn das wissen?«
»Als sie sich über den Tisch beugte, bekam ich ’n kleinen Einblick. Ich mag Spitzen-BHs.«
Mario seufzte.
»Gefallen dir Frauen in schwarzer Unterwäsche?«, fuhr Priest fort.
»Ich steh auf Rot«, erwiderte Mario im Brustton der Überzeugung.
»Ja, rot ist auch schön. Wenn eine Frau rote Unterwäsche anzieht, ist sie richtig scharf auf dich. Heißt es jedenfalls.«
»Wirklich?« Marios nach Bier riechender Atem ging ein wenig schneller.
»Ja, das hab ich irgendwo mal gehört.« Priest knöpfte sich die Hose zu. »Hör mal, ich muss jetzt gehen. Die Meine erwartet mich im Motel.«
Mario grinste und wischte sich den Schweiß aus der Stirn. »Ich hab euch zwei heute Nachmittag gesehen, Mann, o Mann …«
Priest schüttelte in gespieltem Bedauern den Kopf. »Das ist meine Schwäche. Ich kann bei einem hübschen Gesicht einfach nicht Nein sagen.«
»Mensch, ihr habt es doch wirklich getan – mitten auf der Straße!«
»Na ja, wenn du deine Frau eine Zeit lang nicht gesehen hast, dann wird sie zappelig, dann braucht sie’s, verstehst du?« Komm schon, Mario, das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl …
»Yeah, ich weiß. Übrigens, was morgen betrifft …«
Priest hielt den Atem an.
»Also, wenn du noch zu deinem Vorschlag stehst …«
Ja! Ja!
»Dann ist alles geritzt.«
Priest widerstand der Versuchung, ihm um den Hals zu fallen.
»Du willst doch noch, oder?«, fragte Mario besorgt.
»Klar doch.« Priest legte den Arm um Marios Schultern. Gemeinsam verließen sie den Toilettenraum. »Wozu hat man denn Kumpels, he?«
»Danke dir, Mann.« Mario standen die Tränen in den Augen. »Bist ein toller Hecht, Ricky.«
Sie wuschen ihre Keramikschüsseln und Holzlöffel in einer großen Wanne mit warmem Wasser und trockneten das Geschirr mit einem Handtuch ab, das einst ein altes Arbeitshemd gewesen war. Melanie sagte zu Priest: »Dann fangen wir eben noch einmal irgendwo anders an! Besorgen uns ein Stück Land, errichten ein paar Blockhütten, pflanzen Rebstöcke und machen Wein. Warum nicht? So habt ihr doch vor all diesen Jahren auch angefangen.«
»Stimmt«, sagte Priest, stellte seine Schüssel in ein Regal und warf seinen Löffel in den Kasten. Einen Moment lang fühlte er sich wieder jung, stark wie ein Pferd, berstend vor Energie und felsenfest davon überzeugt, jede Aufgabe lösen zu können, die ihm das Leben stellte, komme, was da wolle. Er erinnerte sich an die einzigartigen Gerüche jener Zeit: frisch gesägtes Holz; Stars junger Körper, schweißüberströmt beim Umgraben; der charakteristische Duft von Marihuana, das sie auf einer Waldlichtung anbauten; das betörend süße Aroma der gepressten Trauben … Dann holte ihn die Gegenwart wieder ein, und er setzte sich an den Tisch.
»Ja, vor all diesen Jahren«, wiederholte er. »Für ’n Appel und ’n Ei haben wir damals dieses Stück Land von der Regierung gepachtet. Und danach hat man uns einfach vergessen.«
»Neunundzwanzig Jahre lang keine einzige Pachterhöhung«, ergänzte Star.
Priest fuhr fort: »Den Wald haben wir mit Hilfe von dreißig oder vierzig Jugendlichen gerodet, die damals bereit waren, zwölf bis vierzehn Stunden täglich ohne Bezahlung zu arbeiten. Richtige Idealisten waren das.«
Paul Beale grinste. »Mir tut der Rücken heute noch weh, wenn ich nur daran denke.«
»Unsere Reben bekamen wir ebenfalls umsonst – von einem freundlichen Winzer aus dem Napa Valley, der junge Leute zu konstruktiver Arbeit anspornen wollte. Sie sollten nicht den ganzen Tag nur herumsitzen und sich bekiffen.«
»Der alte Raymond Delavalle«, sagte Paul. »Ist inzwischen längst tot, Gott hab ihn selig.«
»Vor allem aber waren wir damals bereit, hart an der Armutsgrenze zu leben, und wir konnten es auch. Wir waren halb verhungert, pennten auf dem nackten Boden, die Schuhe waren voller Löcher … Fünf lange Jahre hat’s gedauert, bis wir den ersten verkaufbaren Wein hatten.«
Star nahm ein herumkrabbelndes Baby vom Boden auf, wischte ihm die Nase ab und sagte: »Außerdem hatten wir noch keine Kinder, um die wir uns hätten Sorgen machen müssen.«
»Genau«, stimmte Priest zu. »Wenn sich all diese Voraussetzungen noch einmal wiederholen ließen, könnten wir noch mal von vorn anfangen.«
Melanie gab sich noch nicht zufrieden. »Es muss doch irgendeinen Ausweg geben!«
»Den gibt’s auch«, sagte Priest. »Paul ist darauf gekommen.«
Paul nickte. »Ihr könntet eine Firma gründen. Geht zur Bank, borgt euch eine Viertelmillion Dollar, stellt Arbeitskräfte ein und verwandelt euch in typische kapitalistische Geizhälse, die nur noch ihre Profite im Kopf haben.«
»Das wäre die Kapitulation«, sagte Priest.
Es war noch dunkel, als Priest und Star am frühen Samstagmorgen in Shiloh aufstanden. Priest holte Kaffee in dem kleinen Restaurant neben ihrem Motel. Als er zurückkam, studierte Star im Licht der Leselampe einen Autoatlas. »Du müsstest Mario so zwischen halb zehn und zehn am internationalen Flughafen von San Antonio absetzen können und danach über die Interstate 10 aus der Stadt raus«, sagte sie.
Priest würdigte den Atlas keines Blickes. Karten verwirrten ihn nur. Er konnte sich an die Hinweisschilder zum Highway I-10 halten. »Wo treffen wir uns dann?«, fragte er.
Star rechnete nach. »Ich müsste ungefähr eine Stunde Vorsprung vor dir haben.« Sie legte ihren Finger auf einen bestimmten Punkt auf der Karte. »Etwa fünfzehn Meilen vom Flughafen entfernt liegt ein Nest namens Leon Springs. Ich parke so, dass du mich nicht übersehen kannst.«
»Klingt gut.«
Sie waren beide nervös und aufgeregt. Der Diebstahl des Lasters war nur der erste Schritt in ihrem Plan, wenngleich ein ganz entscheidender. Alles Weitere hing davon ab.
Star störte sich noch an ein paar praktischen Einzelheiten. »Was machen wir mit dem Honda?«
Priest hatte den Wagen drei Wochen zuvor für tausend Dollar bar auf die Hand erworben. »Leicht verkäuflich ist der nicht mehr«, sagte er. »Bei einem Gebrauchtwagenhändler kriegen wir vielleicht noch fünfhundert dafür. Wenn nicht, lassen wir ihn einfach irgendwo abseits vom Highway im Wald stehen.«
»Können wir uns das leisten?«
»Geld macht dich arm.« Priest zitierte eines der Fünf Paradoxa des Gurus Baghram, nach dessen Regeln sie lebten.
Priest wusste bis auf den letzten Cent genau, wie viel Geld ihnen zur Verfügung stand, doch behielt er sein Wissen für sich. Die meisten Kommunarden wussten nicht einmal, dass es ein Bankkonto gab. Und kein Mensch in der ganzen Welt ahnte etwas von Priests Notgroschen – zehntausend Dollar in Zwanzigern, mit Klebeband im Resonanzkörper einer ramponierten Akustikgitarre befestigt, die in Priests Hütte an einem Nagel hing.
Star zuckte mit den Schultern. »Darüber hab ich mir fünfundzwanzig Jahre lang keine Gedanken gemacht – da werd ich nicht ausgerechnet jetzt damit anfangen.« Sie nahm ihre Lesebrille ab.
Priest lächelte sie an. »Siehst richtig süß aus mit deiner Brille.«
Star sah ihn von der Seite an und stellte eine Frage, die ihn überraschte: »Freust du dich schon auf Melanie?«
Priest und Melanie waren Geliebte.
Er ergriff Stars Hand. »Ja, natürlich«, sagte er.
»Ich sehe dich gerne mit ihr zusammen. Sie macht dich glücklich.«
Eine plötzliche Erinnerung an Melanie schoss Priest durch den Kopf: Sie lag auf dem Bauch in seinem Bett und schlief. Die Strahlen der tief stehenden Morgensonne fielen durchs Hüttenfenster. Er selbst saß am Tisch, nippte an einer Tasse Kaffee und beobachtete die junge Frau. Er freute sich am Anblick ihrer feinen weißen Haut, der perfekten Kurve ihres Pos, ihres langen roten Haars, zerzaust und breit gefächert. Jeden Augenblick würde ihr der Kaffeeduft in die Nase steigen; sie würde sich umdrehen und die Augen öffnen, und dann würde er, Priest, wieder zu ihr ins Bett steigen und sie lieben. Doch fürs Erste schwelgte er noch in Vorfreude und malte sich aus, wie er sie berühren und erregen wollte. Er genoss den kostbaren Augenblick wie ein Glas guten Weins.
Die Vision verblasste. Er war wieder in einem billigen Motel in Texas und sah Star vor sich, ihr neunundvierzigjähriges Gesicht. »Du bläst doch nicht Trübsal wegen Melanie, oder?«, fragte er sie.
»Die Ehe ist die größte Treulosigkeit«, sagte sie und zitierte damit ein weiteres der Fünf Paradoxa.
Priest nickte. Treue hatten sie nie voneinander verlangt. In der Anfangszeit war es Star gewesen, die für den Gedanken, sich auf einen einzigen Liebhaber zu beschränken, nur Verachtung übrig hatte. Später, nach ihrem dreißigsten Geburtstag, wurde sie allmählich ruhiger. Priest hatte ihre Toleranz auf die Probe gestellt, indem er reihenweise anderen Mädchen vor ihren Augen den Hof gemacht hatte. Beide glaubten sie nach wie vor an die freie Liebe – Tatsache war aber, dass seit einigen Jahren weder er noch sie sich entsprechend verhalten hatten.
Melanie war für Star demnach eine Art Schock gewesen, aber das war ganz gut so. Ihre Beziehung zu Priest war ohnehin zu gefestigt. Priest mochte es nicht, wenn jemand vorhersagen konnte, was er vorhatte. Ja, er liebte Star, doch die schlecht verhohlene Sorge in ihren Augen erzeugte in ihm das angenehme Gefühl, das Heft in der Hand zu haben.
Star spielte mit ihrem Kaffeebecher aus Styropor. »Ich frage mich nur, was Flower davon hält«, sagte sie. Flower war ihre gemeinsame Tochter und mit dreizehn das älteste Kind in der Kommune.
»Sie ist nicht in einer Kernfamilie aufgewachsen«, erwiderte Priest. »Wir haben sie nicht zur Sklavin bürgerlicher Konventionen erzogen. Das ist doch Sinn und Zweck einer Kommune.«
»Ja, schon«, stimmte Star ihm zu, aber es reichte ihr nicht. »Ich möchte nur nicht, dass sie dich verliert, das ist alles.«
Er streichelte ihre Hand. »Keine Angst, das wird nicht passieren.«
Sie drückte seine Finger. »Danke.«
»Wir müssen gehen«, sagte er und stand auf.
Ihre Habseligkeiten steckten in drei Einkaufsbeuteln aus Plastik. Priest trug sie hinaus zu ihrem Honda. Star folgte ihm.
Die Rechnung hatten sie bereits am Vorabend beglichen. Jetzt war das Büro geschlossen, und niemand beobachtete sie, als Star sich ans Steuer setzte und sie im fahlen Morgenlicht davonfuhren.
Shiloh bestand aus einer Straße und einer Querstraße. Dort, wo sich die beiden kreuzten, standen die einzigen Verkehrsampeln. An einem Samstagmorgen um diese Zeit waren noch kaum andere Fahrzeuge unterwegs. Star fuhr unbekümmert bei Rot über die Ampel, und wenig später hatten sie die Stadt auch schon hinter sich gelassen. Kurz vor sechs erreichten sie die Müllkippe.
Sie wurde von keinem Hinweisschild angekündigt, von keinem Zaun oder Tor begrenzt. Es gab lediglich einen Zufahrtsweg, erkennbar an den von Lastwagenreifen niedergewalzten Sträuchern. Star folgte dem Pfad über einen flachen Hügel. Die Kippe lag in einer Senke, die von der Straße aus nicht einsehbar war. Neben einem schwelenden Müllhaufen brachte Star den Wagen zum Stehen. Von Mario und dem seismischen Vibrator war weit und breit nichts zu sehen.
Priest spürte, dass Star noch immer beunruhigt war. Ich muss sie aufbauen, dachte er besorgt. Sie darf nicht abgelenkt sein – ausgerechnet heute! Wenn etwas schief geht, muss sie voll bei der Sache sein, voll konzentriert …
»Flower wird mich nicht verlieren«, sagte er.
»Das ist gut«, erwiderte sie zaghaft.
»Wir bleiben zusammen, wir drei. Weißt du, warum?«
»Sag’s mir.«
»Weil wir uns lieben.«
Er sah, wie Erleichterung die nervöse Spannung aus ihrem Gesicht vertrieb. Sie kämpfte mit den Tränen. »Danke«, sagte sie.
Seine Sicherheit kehrte zurück. Er hatte Star gegeben, was sie brauchte. Von jetzt an war sie wieder okay.
Er küsste sie. »Mario wird jeden Augenblick hier sein. Fahr jetzt los. Sieh zu, dass du vorankommst.«
»Soll ich nicht warten, bis er da ist?«
»Er soll dich nicht zu deutlich sehen. Wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt. Ich möchte nicht, dass er dich identifizieren kann.«
»Okay.«
Priest stieg aus.
»He!«, rief Star ihm nach. »Vergiss Marios Frühstück nicht!« Sie reichte ihm eine Papiertüte.
»Dank dir!« Er nahm die Tüte und warf die Wagentür zu.
Star wendete in einem weiten Kreis und fuhr so schnell davon, dass die Reifen eine Wolke texanischen Wüstenstaubs aufwirbelten.
Priest sah sich um. Es verblüffte ihn, dass ein Nest wie Shiloh so viel Müll produzieren konnte. Sein Blick schweifte über verbogene Fahrräder, fast neuwertige Kinderwagen, fleckige Sofas, altmodische Kühlschränke und mindestens zehn Einkaufswagen aus Supermärkten. Und überall Verpackungsmüll: Kartons von Stereoanlagen, federleichte Polysterolverpackungen, die wie abstrakte Skulpturen aussahen, Papiersäcke und Plastikbehälter aller Art, die vormals Substanzen enthalten hatten, welche Priest niemals benutzte: Klarspüler, Feuchtigkeitscreme, Haarpflegemittel, Weichspüler, Toner für Fax- und Kopiergeräte. Ein Märchenschloss aus rosa Plastik fiel ihm auf, wahrscheinlich ein Kinderspielzeug, und er staunte über die verschwenderische Opulenz der ausgefeilten Konstruktion.
Im Silver River Valley gab es nie viel Abfall. Sie benutzten weder Kinderwagen noch Kühlschränke und kauften nur sehr selten verpackte Waren. Die Kinder schufen sich mit Hilfe der Fantasie ihre Märchenschlösser selbst – in Bäumen, Fässern oder Holzstapeln.
Noch dunstverschleiert schob sich die rote Sonnenscheibe über den Hügelkamm und warf Priests langen Schatten über ein rostiges Bettgestell. Er musste an die Sonnenaufgänge über den Schneegipfeln der Sierra Nevada denken, und unvermittelt überkam ihn schmerzvolle Sehnsucht nach der kühlen, reinen Luft der Berge.
Bald, bald …
Zu seinen Füßen schimmerte etwas auf: Ein funkelnder Metallgegenstand steckte, zur Hälfte vergraben, im Boden. Aus reiner Langeweile scharrte Priest mit der Stiefelspitze die trockene Erde beiseite, bückte sich und hob den Gegenstand auf. Es war eine schwere Stillson-Rohrzange. Sie sah funkelnagelneu aus. Ihre Größe schien zur Ausrüstung des seismischen Vibrators zu passen. Vielleicht kann Mario das Ding brauchen, dachte Priest, ehe ihm einfiel, dass der Laster mit Sicherheit über einen Werkzeugkasten verfügte, in dem für jede einzelne Schraube und Mutter der richtige Schlüssel lag. Was sollte Mario da noch mit einer Rohrzange von der Müllkippe anfangen? Wegwerfgesellschaft!
Priest ließ das Werkzeug wieder fallen.
Er hörte Fahrgeräusche, aber sie klangen nicht nach einem großen Lkw. Er blickte auf. Sekunden später kam ein brauner Pickup über die Kuppe und holperte über den unebenen Pfad. Es war ein Dodge Ram mit einer gesprungenen Windschutzscheibe – Marios Privatwagen. Was hatte das zu bedeuten? Priest schwante Übles. Mario hätte am Steuer des Lastwagens erscheinen, sein eigener Wagen von einem Kollegen nach Norden gefahren werden sollen. Oder hatte Mario beschlossen, den Wagen an Ort und Stelle zu verhökern und sich in Clovis einen neuen zu kaufen? Irgendetwas war schief gelaufen. »Scheiße!«, sagte Priest. »Scheiße!«
Als Mario anhielt und ausstieg, unterdrückte er seine Wut und Frustration jedoch, reichte ihm die Tüte und sagte: »Ich hab dir Frühstück mitgebracht. Was ist denn los?«
Mario ließ die Tüte ungeöffnet und schüttelte traurig den Kopf. »Ich kann’s nicht, Mann. Ich kann’s einfach nicht.«
Scheiße.
»Ich finde dein Angebot echt toll, Ricky«, fuhr Mario fort. »Aber ich kann es trotzdem nicht annehmen.«
Was ist denn bloß in den gefahren?
Priest biss die Zähne zusammen und erwiderte in einem Ton, als ginge ihn die Sache gar nichts an: »Warum hast du es dir anders überlegt, Kumpel? Was ist passiert?«
»Als du gestern Abend weg bist, aus der Bar, mein ich, Mann, da hat Lenny mir eine lange Rede gehalten – wie teuer der Laster ist und dass ich ja keinen mitnehmen soll, auch keinen Anhalter, und dass er mir total vertraut und so.«
Das kann ich mir vorstellen! Lenny, sturzbesoffen und rührselig … Hat dich wahrscheinlich fast zum Flennen gebracht, Mario, du hirnverbrannter Trottel.
»Du weißt doch, wie’s ist, Ricky. Kein schlechter Job – harte Maloche und lange Arbeitszeit, aber die Kohle stimmt. Ich will den Job nicht verlieren.«
»Schon gut, Kumpel«, sagte Priest mit gezwungener Lässigkeit, »solange du mich wenigstens bis San Antonio mitnimmst.« Und ich denk mir unterwegs was aus.
Mario schüttelte den Kopf. »Nee, lieber nicht, nach allem, was Lenny gesagt hat. Nee, ich nehm niemanden mit, nicht in dem Laster. Deshalb bin ich ja mit meinem eigenen Wagen gekommen, damit ich dich in die Stadt zurückbringen kann.«
Und was soll ich jetzt tun, um Himmels willen?
»Was … äh, was meinst du, Ricky, he? Kommste mit?«
Und wie geht’s dann weiter?
Priest hatte sich in Gedanken ein Luftschloss gebaut, das sich nun in der sanften Brise von Marios schlechtem Gewissen auflöste wie eine Rauchwolke. Geschlagene zwei Wochen hatte er in dieser heißen, staubigen Steppe ausgeharrt und seine Zeit mit einem ebenso dämlichen wie unnützen Job vertan. Hunderte von Dollars hatte er für Flugtickets, Motelrechnungen und ekelhaftes Fastfood ausgegeben – alles umsonst.
Zeit, noch einmal von vorn anzufangen, hatte er nicht.
Ihm blieben nur noch zwei Wochen und ein Tag.
Mario runzelte die Stirn. »Komm jetzt, Mann, gehen wir.«
»Ich weigere mich, hier alles aufzugeben«, hatte Star an jenem Tag, da der Brief eintraf, zu Priest gesagt. Sie saß neben ihm auf einem Teppich aus Kiefernnadeln am Rande des Weinbergs; es war die Zeit der Nachmittagsruhe. Sie tranken kühles Wasser und aßen Rosinen, die aus Trauben der letzten Lese hergestellt waren. »Das hier ist nicht irgendein Weingut, nicht irgendein Tal, nicht irgendeine Kommune. Das hier ist mein ganzes Leben. Wir sind vor all diesen Jahren hierher gezogen, weil wir der Meinung waren, dass die Gesellschaft, die unsere Eltern geschaffen hatten, total verkorkst, vergiftet und korrupt war. Und wir hatten Recht, verdammt noch mal!« Sie ließ ihrem Zorn freien Lauf, ihr Gesicht rötete sich, und Priest gestand sich ein, dass sie – immer noch – sehr schön war. »Sieh dir doch bloß an, was in der Welt da draußen los ist!«, fuhr sie mit erhobener Stimme fort. »Gewalt, Gemeinheit und Umweltverschmutzung; Präsidenten, die lügen und Gesetze brechen; Unruhen, Verbrechen und Armut. Wir haben hier die ganze Zeit über in Frieden und Harmonie gelebt, Jahr um Jahr, ohne Geld, ohne sexuelle Eifersucht, ohne konformistische Regeln. All You Need is Love war unsere Devise, und man hat uns naiv genannt – aber wir hatten doch Recht und alle anderen nicht! Wir wissen, wie man leben muss, wir haben es doch bewiesen.« Sie sprach jetzt sehr präzise, und ihre Worte verrieten ihre Herkunft aus altem Geldadel. Ihr Vater entstammte einer wohlhabenden Familie, hatte jedoch sein ganzes Berufsleben als Arzt in einem Slum verbracht. Star hatte seinen Idealismus geerbt. »Ich werde alles tun, was zur Rettung unserer Heimat und unseres Lebensstils erforderlich ist«, sagte sie. »Ich will, dass unsere Kinder hier weiterleben können, und dafür bin ich sogar bereit, zu sterben.« Ihre Stimme wurde leiser, doch ihre Worte waren klar, und ihre Entschlossenheit gnadenlos. »Und ich gehe dafür über Leichen. Hast du mich verstanden, Priest? Ich bin zu allem bereit.«
»Hörst du mir überhaupt zu, Mann?«, fragte Mario. »Soll ich dich in die Stadt bringen, oder willst du hier bleiben?«
»Doch, doch …«, erwiderte Priest. Und ob ich mitkomme, du feiges Miststück, du Hosenscheißer, du abscheulicher …
Mario drehte sich um.
Priests Blick fiel auf die große Rohrzange, die er ein paar Minuten zuvor hatte fallen lassen.
Und auf einmal hatte er einen Plan.
Mario ging auf seinen Wagen zu; es waren kaum mehr als drei Schritte. Priest bückte sich und hob die Rohrzange auf.
Sie war aus Stahl, ungefähr fünfundvierzig Zentimeter lang und wog vielleicht vier Pfund. Am schwersten war der Kopf mit den justierbaren Zangen für große Sechskantmuttern.
Priest blickte an Mario vorbei auf den Weg, der zur Hauptstraße führte. Weit und breit war kein Mensch zu sehen.
Keine Zeugen.
Als Mario die Tür seines Pickups erreichte, trat Priest einen Schritt vor.
Eine verwirrende Vision überkam ihn: Er sah ein Foto von einer jungen, hübschen Mexikanerin im gelben Kleid. Sie trug ein Kind im Arm, ein zweites stand neben ihr. Für Sekundenbruchteile spürte Priest das niederschmetternde Leid, das er über diese junge Familie bringen würde, und schwankte in seiner Entschlossenheit.
Doch dann verblasste die Vision und wich einer schlimmeren: Da war ein Teich, dessen schwarzer Wasserspiegel unaufhaltsam stieg. Schon umschloss er den Weinberg mit den liebevoll gehegten Reben, und alle Männer, Frauen und Kinder, die dort arbeiteten, kamen in seinen Fluten um.
Priest hob die Rohrzange über seinen Kopf und stürzte sich auf Mario.
Der Lkw-Fahrer war gerade dabei, die Wagentür zu öffnen. Irgendetwas musste er aus dem Augenwinkel bemerkt haben, denn er stieß, als Priest fast über ihm war, unvermittelt einen Angstschrei aus, riss die Tür weit auf und wehrte dadurch die Attacke ab.
Priest krachte gegen die Wagentür, die sofort zurückschnellte und Mario zur Seite warf. Beide Männer stolperten. Mario verlor das Gleichgewicht und fiel neben dem Pickup auf die Knie, das Gesicht zum Wagen. Seine Baseballkappe mit dem Logo der Houston Astros landete auf dem Boden. Priest prallte mit dem Hinterteil auf die harte Erde. Die Rohrzange entglitt ihm, knallte auf eine große Coke-Flasche aus Plastik und blieb einen Meter weiter auf dem Boden liegen.
Mario rang nach Luft: »Du wahnsinniger …« Er rappelte sich halbwegs auf, suchte Halt, um seinen schweren Körper hochzuhieven, fand mit der linken Hand den Türrahmen und wollte sich daran hochziehen. Priest, noch immer auf dem Boden sitzend, holte aus und trat, so fest er konnte, mit der Hacke gegen die Tür. Sie quetschte Mario die Finger ein, bevor sie zurückschnellte. Mario schrie auf vor Schmerzen, sackte wieder zusammen, fing sich mit dem Knie ab und krachte gegen die Flanke des Wagens.
Priest sprang auf.
Die Rohrzange schimmerte silbrig in der Morgensonne. Er riss sie an sich. Dann sah er Mario an, und Wut und Hass wallten in ihm auf: Dieser Kerl hatte seine sorgfältig ausgetüftelten Pläne durchkreuzt und bedrohte nun das Leben, für das er, Priest, sich entschieden hatte. Er trat auf ihn zu und hob die Waffe.
Mario wandte sich ihm halb zu. Grenzenlose Verwirrung prägte sein junges Gesicht, als verstünde er absolut nicht, was vor sich ging. Er öffnete den Mund und stammelte: »Ricky …?« Im gleichen Augenblick sauste die Rohrzange auf ihn herab.
Es gab ein grässliches Geräusch, als das schwere Ende die Schädeldecke traf. Marios volles, dunkles Haar bot keinen Schutz. Seine Kopfhaut platzte auf, seine Schädeldecke zerbarst, und die Mordwaffe drang in die weiche Hirnmasse ein.
Aber er war noch nicht tot.
Priest bekam es mit der Angst zu tun.
Mario starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Seine Miene spiegelte unverändert wider, wie grenzenlos verwirrt und verraten er sich fühlte. Offenbar versuchte er den Satz, den er begonnen hatte, zu Ende zu bringen. Er hob die Hand, als wolle er sich zu Wort melden.
Entsetzt trat Priest einen Schritt zurück. »Nein!«, sagte er.
»Mann!«, brachte Mario heraus.
Priest spürte, wie ihn Panik ergriff. Wieder hob er die Rohrzange. »Verreck endlich, du Arschloch!«, brüllte er und schlug zu.
Diesmal sank der Stahl noch tiefer in Marios Hirn. Als Priest ihn wieder herauszog, kam es ihm vor, als zerre er ihn aus weichem Schlamm. Beim Anblick der lebendigen grauen Masse, die an den verstellbaren Zangen klebte, wurde ihm speiübel. Sein Magen revoltierte. Er schluckte hart, und ihn schwindelte.
Mario kippte langsam hintüber und blieb reglos neben dem Hinterrad liegen. Seine Arme wurden schlaff, sein Unterkiefer sackte herab, aber noch immer war Leben in ihm. Unverwandt starrten sich die beiden Männer in die Augen. Blut quoll aus Marios Schädel und rann über sein Gesicht in den offenen Kragen seines karierten Hemds. Sein stierer Blick war Priest unerträglich. »Stirb!«, flehte er. »Um Gottes willen, so stirb doch endlich, Mario, bitte!«
Nichts geschah.
Priest wich zurück. Marios Augen schienen eine Bitte auszusprechen: Komm, gib mir den Rest … Doch Priest vermochte nicht noch einmal zuzuschlagen. Es widersprach aller Logik – aber er konnte die Rohrzange einfach nicht mehr heben.
Da rührte Mario sich. Sein Mund klappte auf, sein Körper wurde starr, und seiner Kehle entrang sich erstickt ein Schrei der Agonie.
Priests Blockade löste sich. Auch er schrie. Dann stürzte er sich auf Mario und schlug wie wild auf ihn ein, immer auf dieselbe Stelle. Angst und Entsetzen vernebelten ihm den Blick, sodass er sein Opfer kaum noch wahrnahm.
Das Schreien hörte auf, der Anfall war vorüber.
Priest richtete sich auf, trat einen Schritt zurück und ließ die Rohrzange fallen.
Marios Leiche sackte langsam zur Seite, bis der blutige Trümmerhaufen, der einst sein Kopf gewesen war, auf dem Boden aufschlug. Graue Hirnmasse sickerte in die trockene Erde.
Priest fiel auf die Knie und schloss die Augen. »Lieber Gott, Allmächtiger, vergib mir«, sagte er.
Zitternd kniete er da. Er wagte es nicht, seine Augen wieder zu öffnen, weil er fürchtete, er könne Marios Seele gen Himmel fahren sehen.
Um seinen Geist zu beruhigen, rezitierte er sein Mantra: Ley, tor, pur-doy-kor … Es hatte keinen tieferen Sinn – und genau deshalb wirkte es beruhigend, wenn man sich fest darauf konzentrierte. Der Rhythmus war der gleiche wie der eines Kinderverses aus Priests Jugend:
Eins, zwei, drei-vier-fünf,
ein Storch geht in die Sümpf.
Sechs, sieben, acht-neun-zehn,
siehst ihn morgen noch dort stehn.
Wenn er sein Mantra vor sich hin murmelte, glitt er oftmals in den Kindervers über. Der funktionierte ebenso gut.
Während die vertrauten Silben ihn allmählich zur Ruhe kommen ließen, stellte er sich vor, wie der Atem in seine Nasenlöcher schlüpfte, durch die Luftwege in die Mundhöhle gelangte, die Kehle hinabsank und den Brustkorb dehnte, bis er schließlich die feinsten Verästelungen seiner Lunge durchdrang und die Rückreise antrat: Lunge, Hals, Mund, Nase, Nasenlöcher und zurück in die Luft. Wenn Priest sich voll auf seinen Atemweg konzentrierte, drang nichts Störendes in seine Gedanken: keine Visionen, keine Albträume, keine Erinnerungen.
Wenige Minuten später stand er auf, kühl bis ans Herz, mit entschlossener Miene. Er hatte sich von jeglicher Emotion befreit, verspürte weder Reue noch Mitleid. Der Mord gehörte der Vergangenheit an, und Mario war nur noch ein Stück totes Fleisch, das er loswerden musste.
Er hob seinen Cowboyhut auf, streifte den Schmutz ab und setzte ihn sich auf den Kopf.
Der Werkzeugkasten des Pickups steckte hinter dem Fahrersitz. Priest holte einen Schraubenzieher heraus, entfernte damit die beiden Kennzeichen und begrub sie weit draußen auf der Müllkippe unter einem schwelenden Haufen Unrat. Dann legte er den Schraubenzieher wieder in den Werkzeugkasten.
Er beugte sich über die Leiche und griff mit der rechten Hand nach dem Gürtel von Marios Jeans. Mit der Linken packte er eine Faustvoll von dem karierten Hemd. Dann hob er den Körper hoch und stöhnte auf, als er das Gewicht im Rücken spürte: Mario war schwer.
Die Tür des Pickups stand offen. Priest schwenkte die Leiche ein paar Mal vor und zurück, um Schwung zu gewinnen, und warf sie dann mit großer Kraftanstrengung in die Fahrerkabine. Sie kam quer über der Sitzbank zu liegen; die Stiefel ragten zur Tür heraus, der bluttriefende Kopf hing in den Fußraum des Beifahrersitzes.
Die Rohrzange warf Priest der Leiche hinterher.
Nun wollte er Benzin aus dem Wagentank zapfen. Dazu brauchte er ein langes, schmales Stück Schlauch.
Er öffnete die Motorhaube, suchte die Scheibenwaschanlage und riss den biegsamen Plastikschlauch ab, der den Wassertank mit den Düsen vor der Windschutzscheibe verband. Dann holte er sich die große Coke-Flasche, die ihm zuvor aufgefallen war, ging um den Wagen herum, schraubte den Tankdeckel ab, führte den Schlauch ein, saugte, bis ihm Benzin in den Mund lief, und steckte schließlich schnell das Schlauchende in die Flasche, die sich langsam mit Benzin füllte.
Als Priest schließlich mit der vollen Flasche zur Wagentür ging und den Inhalt über Marios Leiche goss, rann weiterhin Benzin durch den Schlauch auf den Boden.
In diesem Augenblick hörte er ein Auto näher kommen.
Priests Blick fiel auf die benzingetränkte Leiche. Wenn jetzt wer kam, hatte er keine Chance mehr: Seine Schuld ließ sich weder mit Worten noch mit Taten aus der Welt räumen.
Um seine starre Ruhe war es geschehen. Er fing an zu zittern. Die Plastikflasche entglitt seinen Fingern, und er kauerte sich auf den Boden wie ein furchtsames Kind. Bebend vor Angst starrte er auf den Pfad, der zur Straße führte. War irgendein Frühaufsteher auf dem Weg zur Müllkippe, um eine kaputte Geschirrspülmaschine loszuwerden? Ging es um ein Puppenhaus aus Plastik, für das die Kids inzwischen zu alt geworden waren? Oder sollten die altmodischen Anzüge eines verstorbenen Großvaters entsorgt werden? Das Motorengeräusch kam unaufhaltsam näher. Priest schloss die Augen.
Ley, tor, pur-doy-kor …
Das Geräusch entfernte sich. Das Fahrzeug war an der Abzweigung zur Müllkippe vorbeigefahren. Ganz normaler Straßenverkehr, sonst nichts.
Priest kam sich vor wie ein Idiot. Als er aufstand, gewann er seine Fassung wieder. Ley, tor, pur-doy-kor …
Doch der Schreck steckte ihm noch in den Gliedern, und er beeilte sich nun.
Ein zweites Mal ließ er die Coke-Flasche voll laufen und verteilte das Benzin im gesamten Innenraum des Wagens, auch auf der Sitzbank mit ihrem Plastikbezug. Mit dem Rest des Benzins goss er eine Spur über den Boden zum rückwärtigen Ende des Pickups; die letzten Tropfen verspritzte er neben dem Tankdeckel. Er warf die Flasche in die Fahrerkabine und trat ein paar Schritte zurück.
Da entdeckte er Marios Houston-Astros-Mütze, die auf dem Boden lag. Er hob sie auf und warf sie zu der Leiche in den Wagen.
Jetzt zog er eine Streichholzschachtel aus der Hosentasche, steckte eines der Hölzchen an und setzte damit die ganze Schachtel in Brand. Er warf sie in die Kabine des Pickups und brachte sich in Sicherheit.