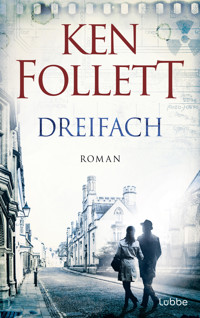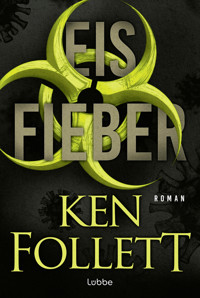7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie ist schön, sie ist mutig, und sie hat einen tollkühnen Plan: Felicity Clairet, genannt "die Leopardin", britische Agentin im besetzten Frankreich. Um ihr Ziel zu erreichen, muss sie ein Team zusammenstellen, das nur aus Frauen besteht. Dabei kann sie nicht wählerisch sein. Denn für ihr Vorhaben bleiben ihr genau zehn Tage Zeit. Und der Feind ist der Leopardin bereits auf der Spur...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 716
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Erster Tag – Sonntag, 28. Mai 1944
Zweiter Tag – Montag, 29. Mai 1944
Dritter Tag – Dienstag, 30. Mai 1944
Vierter Tag – Mittwoch, 31. Mai 1944
Fünfter Tag – Donnerstag, 1. Juni 1944
Sechster Tag – Freitag, 2. Juni 1944
Siebter Tag – Sonnabend, 3. Juni 1944
Achter Tag – Sonntag, 4. Juni 1944
Neunter Tag – Montag, 5. Juni 1944
Letzter Tag – Dienstag, 6. Juni 1944
Ein Jahr später – Mittwoch, 6. Juni 1945
Aus der offiziellen Geschichtsschreibung
Danksagung
Über den Autor
Impressum
Über dieses Buch
Mai 1944. Die Invasion der Alliierten in der Normandie steht unmittelbar bevor. Felicity Clairet, genannt »die Leopardin«, ist als britische Agentin im besetzten Frankreich aktiv. Sie hat einen tollkühnen Plan. Doch um ihr Ziel zu erreichen, muss sie ein Team zusammenstellen, das nur aus Frauen besteht. Dabei kann sie nicht wählerisch sein. Denn für ihr Vorhaben bleiben ihr genau zehn Tage Zeit. Und der Feind ist der Leopardin bereits auf der Spur …
KEN FOLLETT
DIELEOPARDIN
ROMAN
Aus dem Englischen von Till R. Lohmeyer und Christel Rost
Fünfzig Frauen wurden im Zweiten Weltkrieg von der Special Operations Executive als Geheimagentinnen nach Frankreich geschickt. Sechsunddreißig von ihnen überlebten den Krieg, die anderen vierzehn gaben ihr Leben.
Ihnen allen ist dieses Buchgewidmet.
+++ erster tag +++sonntag, 28. mai 1944
Eine Minute vor der Explosion lag tiefer Friede über dem Stadtplatz von Sainte-Cécile. Der Abend war warm, und eine windlose Luftschicht hatte sich wie eine Decke über den Ort gelegt. Die Kirchenglocke läutete träge und rief ohne große Begeisterung die Gläubigen zum Gottesdienst.
Für Felicity Clairet klang es wie ein Countdown.
Der Platz wurde beherrscht von dem Schloss aus dem siebzehnten Jahrhundert, einer kleinen Versailles-Kopie mit einem großen vorgebauten Portal und Seitenflügeln, die im Neunzig-Grad-Winkel abknickten und sich nach hinten verjüngten. Über dem Wohntrakt aus Erdgeschoss und erstem Stock wölbte sich ein hohes Dach mit Bogenfenstern in den Erkern.
Felicity, die immer nur Flick genannt wurde, liebte Frankreich. Die eleganten Häuser gefielen ihr ebenso wie das milde Klima, die ausgedehnten Mahlzeiten und die gebildeten, kultivierten Menschen. Sie liebte die französische Malerei, die französische Literatur und die schicke französische Mode. Besucher fanden die Franzosen nicht selten unfreundlich, doch Flick, die seit ihrem sechsten Lebensjahr die Landessprache beherrschte, ging überall als Einheimische durch.
Es erbitterte sie, dass das alte, ihr so vertraute Frankreich nicht mehr existierte. Für ausgedehnte Mahlzeiten gab es nicht mehr genug Lebensmittel, die Gemälde waren von den Nazis gestohlen worden, und schöne Kleider trugen nur noch Huren. Flick selber hatte sich dem Stil der Zeit angepasst und trug ein unförmiges Gewand, dessen Farben durchs viele Waschen längst ausgebleicht waren. Von ganzem Herzen sehnte sie den Tag herbei, an dem das wahre Frankreich wieder erstehen würde, und wenn sie und einige Gleichgesinnte ihren Auftrag erfüllten, dann war dieser Tag vielleicht gar nicht mehr so fern.
Ob sie selbst ihn aber noch erleben würde, das stand in den Sternen. Es war nicht einmal sicher, dass sie die nächsten Minuten überlebte. Felicity war kein Mensch, der sich fatalistisch in sein Schicksal ergab – sie wollte leben! Hunderterlei Dinge hatte sie vor, wenn dieser Krieg endlich zu Ende ging. Sie wollte ihre Doktorarbeit abschließen, ein Kind bekommen, eine Reise nach New York machen, sich einen eigenen Sportwagen leisten und am Strand von Cannes Champagner trinken. Doch wenn sie schon sterben musste, dann gab sie sich auch damit zufrieden, ihre letzten Augenblicke auf einem vom Sonnenlicht überfluteten Platz zu verbringen, vor sich ein wunderschönes altes Gebäude – und in ihren Ohren den sanften, singenden Klang der französischen Sprache.
Das Schloss war einst als Wohnstatt für die Provinz-Aristokratie errichtet worden, doch hatte der letzte Comte de Sainte-Cécile 1793 seinen Kopf unter der Guillotine verloren. Und da es im Weinland, im Herzen der Champagne, lag, waren die Ziergärten längst in Weingärten umgewandelt worden. Inzwischen war im Château eine wichtige Fernmeldezentrale untergebracht, da der zuständige Minister aus Sainte-Cécile stammte.
Als die Deutschen gekommen waren, hatten sie die Zentrale erweitert, um eine Verbindung zwischen dem französischen Fernmeldesystem und der neu eingerichteten Telegrafenleitung nach Deutschland zu schaffen. Außerdem hatten sie das regionale Hauptquartier der Gestapo im Schloss eingerichtet – im Erdgeschoss und im ersten Stock lagen die Büros, im Keller die Zellen für Gefangene.
Vor vier Wochen erst hatten die Alliierten das Schloss bombardiert. Gezielte Bombenangriffe dieser Art waren etwas Neues. Die schweren viermotorigen Lancester-Bomber und die Fliegenden Festungen, die Nacht für Nacht über Europa hinwegdröhnten, waren nicht eben sehr präzise – manchmal verfehlten sie sogar eine komplette Stadt. Ganz anders dagegen die jüngste Jagdbombergeneration, die Lightnings und Thunderbolts. Sie flogen bei Tageslicht an und attackierten kleinere, ausgewählte Ziele – eine Brücke, einen Bahnhof oder dergleichen. Deshalb bestand der Westflügel des Schlosses nur noch aus einem Haufen unregelmäßig behauener roter Ziegel aus dem 17. Jahrhundert und weißer Quadersteine.
Dennoch hatte sich der Angriff als Fehlschlag erwiesen, denn die Deutschen hatten die Schäden binnen kürzester Zeit reparieren können. Die Telefonvermittlung war nur so lange ausgefallen, bis die neuen Anlagen installiert waren. Die automatischen Verbindungen und die für Ferngespräche notwendigen Verstärker waren im Keller untergebracht, und der war nahezu unbeschädigt geblieben.
Und deshalb war Flick gekommen.
Das Schloss lag auf der Nordseite des Platzes und war mit einer hohen Mauer aus Steinpfeilern und schmiedeeisernen Gittern umgeben, die von uniformierten Posten bewacht wurde. Auf der Ostseite des Platzes stand eine kleine mittelalterliche Kirche, deren uralte Holztüren geöffnet waren, um die Sommerluft und die allmählich eintrudelnde Gemeinde einzulassen. Der Kirche gegenüber, auf der Westseite des Platzes, befand sich das Rathaus; dort regierte ein ultrakonservativer Bürgermeister, dem man nur selten einmal eine Meinungsverschiedenheit mit den Nazi-Besatzern nachsagen konnte. Den südlichen Abschluss des Platzes bildete eine Ladenzeile mit einem Straßencafé, dem Café des Sports. Dort saß Flick im Freien und wartete auf den letzten Glockenschlag. Vor ihr auf dem Tisch stand ein Glas Wein aus der Region, schlank und leicht, wie er für die Gegend typisch war. Sie hatte noch nicht einmal daran genippt.
Felicity Clairet war Offizier der britischen Armee im Range eines Majors. Offiziell gehörte sie zur First Aid Nursing Yeomanry, einer ausschließlich aus Frauen bestehenden Sanitätseinheit, die geradezu zwangsläufig die FANYs genannt wurden. Aber das war nur Flicks Tarnung. In Wirklichkeit arbeitete sie für eine geheime Organisation, die so genannte Special Operations Executive (SOE), die für Sabotageaktionen hinter den feindlichen Linien zuständig war. Mit ihren achtundzwanzig Jahren gehörte Flick bereits zu den dienstältesten Agentinnen, und sie spürte nicht zum ersten Mal die Nähe des Todes. Doch obwohl sie längst gelernt hatte, mit diesem Gefühl zu leben und mit ihren Ängsten umzugehen, war ihr beim Anblick der Stahlhelme und großkalibrigen Waffen der Wachtposten vor dem Schloss, als lege sich eine eiskalte Hand auf ihr Herz.
Noch vor drei Jahren war es ihr höchster Ehrgeiz gewesen, einmal als Professorin für französische Literatur an einer britischen Universität zu unterrichten. Sie wollte ihren Studenten die Kraft eines Victor Hugo, den Esprit eines Gustave Flaubert, die Leidenschaft eines Émile Zola nahe bringen. Doch dann hatte sie einen Job im Kriegsministerium angenommen und Dokumente aus dem Französischen übersetzt – bis sie eines Tages zu einem mysteriösen Gespräch in ein Hotelzimmer bestellt und gefragt worden war, ob sie bereit sei, einen gefährlichen Auftrag zu übernehmen.
Ohne viel darüber nachzudenken, hatte sie zugesagt. Es herrschte Krieg, und all ihre männlichen Freunde und Kommilitonen aus Oxford riskierten Tag für Tag ihr Leben – warum sollte sie da abseits stehen? Zwei Tage nach Weihnachten 1941 hatte sie mit der Ausbildung bei der SOE begonnen.
Sechs Monate später war sie Kurier und übermittelte Botschaften vom Hauptquartier der SOE – 64 Baker Street, London – an verschiedene Résistance-Gruppen im besetzten Frankreich. Funkgeräte waren in jenen Tagen noch selten, und Leute, die damit umgehen konnten, noch seltener. Felicity wurde wiederholt mit dem Fallschirm über Frankreich abgesetzt, mischte sich mit ihren falschen Papieren unters Volk, nahm Kontakt zur Résistance auf, übermittelte Befehle, notierte Antworten, Beschwerden und Wünsche nach Waffen und Munition. Am Ende ihrer Mission wurde sie jeweils von einem Kleinflugzeug – meistens einer dreisitzigen Westland Lysander – abgeholt, das auf einem fünfhundert Meter langen Grasstreifen starten und landen konnte.
Der Kuriertätigkeit waren anspruchsvollere Aufgaben gefolgt: Inzwischen war sie mit der Planung und Ausführung von Sabotageakten betraut. Die meisten SOE-Mitarbeiter waren Offiziere, und in der Theorie ging man davon aus, dass die jeweiligen örtlichen Résistance-Gruppen ihre »Untergebenen« waren. In der Praxis jedoch bewegte sich die Résistance außerhalb militärischer Befehlsstrukturen, und jeder Agent musste sich erst einmal die Kooperationsbereitschaft der Gruppen verdienen, indem er Härte, Sachkenntnis und Autorität bewies.
Die Arbeit war gefährlich. Flick hatte ihre Ausbildung gemeinsam mit sechs Männern und drei Frauen absolviert – jetzt, zwei Jahre später, war sie die Letzte, die noch im Einsatz war. Von zweien wusste man, dass sie tot waren: Einen hatte die Milice, die verhasste französische Sicherheitspolizei, erschossen; der andere war umgekommen, weil sein Fallschirm sich nicht geöffnet hatte. Die anderen sechs waren nach ihrer Gefangennahme verhört und gefoltert worden und schließlich in irgendwelchen Lagern in Deutschland verschwunden. Flick hatte überlebt, weil sie skrupellos, reaktionsschnell und bis an die Grenze zum Verfolgungswahn auf Sicherheit bedacht war.
Neben Felicity saß Michel – ihr Ehemann und Anführer einer Résistance-Zelle mit dem Decknamen Bollinger, die in der fünfzehn Kilometer entfernten Kathedralenstadt Reims beheimatet war. Obwohl es auch für Michel in wenigen Minuten um Leben und Tod gehen würde, hatte er sich lässig in seinem Stuhl zurückgelehnt, den rechten Knöchel aufs linke Knie gelegt, und in der Hand hielt er ein Glas mit blassem, verwässertem Kriegsbier.
Felicity war Studentin an der Sorbonne gewesen und saß gerade an ihrer Dissertation über die Moral in den Werken Molières – eine Arbeit, die sie bei Kriegsausbruch unterbrach –, als Michels unbekümmertes Lächeln ihr Herz gewonnen hatte. Dem jungen, immer etwas zerzaust wirkenden Philosophiedozenten las in jenen Tagen eine ganze Heerschar glühender Verehrer unter den Studenten jedes Wort von den Lippen ab.
Michel war noch immer der attraktivste Mann, dem Flick je begegnet war – groß und schlank, mit einer Vorliebe für die lässige Eleganz zerknitterter Anzüge und ausgewaschener blauer Hemden. Seine Haare waren nach wie vor eine Spur zu lang, und seine Schlafzimmerstimme sowie der durchdringende Blick seiner blauen Augen vermittelten einem Mädchen das Gefühl, sie sei die einzige Frau auf der Welt.
Der aktuelle Auftrag war für Felicity eine willkommene Gelegenheit gewesen, ein paar Tage bei ihrem Mann zu verbringen, doch war ihre Begegnung nicht sehr glücklich verlaufen. Obwohl sie sich nicht direkt gestritten hatten, empfand sie Michels Zuneigung als halbherzig, so als spiele er ihr nur etwas vor. Das hatte sie gekränkt. Instinktiv spürte sie, dass er sich für eine andere interessierte. Er war erst fünfunddreißig, und sein etwas ungehobelter Charme verfing noch immer bei jungen Frauen. Dass sie seit ihrer Hochzeit des Krieges wegen mehr Zeit getrennt als miteinander verbracht hatten, machte die Sache nicht besser. In Frankreich gibt es viele willige Mädchen und Frauen, dachte Felicity missmutig, sowohl innerhalb der Résistance wie außerhalb.
Sie liebte Michel noch immer, allerdings anders als früher. Sie betete ihn nicht mehr an wie noch in ihren Flitterwochen, und sie hatte auch nicht mehr den glühenden Wunsch, ihr ganzes Leben allein seinem Glück zu widmen. Der Morgennebel romantischer Liebe war verflogen, und im klaren Licht des Ehealltags erkannte sie, dass Michel eitel, selbstverliebt und unzuverlässig war. Und trotzdem: Wenn er sich dazu herabließ, ihr seine volle Aufmerksamkeit zu schenken, hatte sie noch immer das Gefühl, einzigartig, schön und geliebt zu sein.
Sein Charme ließ auch Männer nicht ungerührt. Michel war ein hervorragender Menschenführer, voller Mut und Charisma. Er hatte mit Flick gemeinsam den Schlachtplan entwickelt: Sie wollten das Schloss von zwei Seiten angreifen und dadurch die Verteidiger aufspalten. Auf dem Schlosshof würden sie sich dann wieder sammeln, mit vereinten Kräften den Keller stürmen und dort den Raum mit den wichtigsten Installationen in die Luft jagen.
Antoinette Dupert, der Chefin der aus lauter einheimischen Frauen bestehenden Putztruppe, die jeden Abend im Schloss sauber machte, verdankten sie den Plan des Gebäudes. Madame Dupert war überdies Michels Tante. Die Arbeit des Reinigungstrupps begann um 19 Uhr, zur Zeit des Abendläutens. Felicity sah, wie die ersten Frauen den Wachhabenden am schmiedeeisernen Tor ihre Sonderpassierscheine präsentierten. Antoinettes Skizze zeigte den Eingang zum Keller, enthielt aber keine weiteren Details, denn der Keller war Sperrzone; er durfte nur von Deutschen betreten werden und wurde von Soldaten gereinigt.
Michels Angriffsplan beruhte auf Informationen des britischen Geheimdiensts MI6, aus denen hervorging, dass das Schloss von einer Einheit der Waffen-SS bewacht wurde. Es handelte sich um sechsunddreißig Mann, die in drei Schichten zu je zwölf ihren Dienst verrichteten. Die Gestapo-Beamten im Gebäude waren keine Kampftruppen, und die meisten von ihnen trugen nicht einmal Waffen. Die Bollinger-Gruppe hatte fünfzehn Mann für den Angriff zusammentrommeln können, die inzwischen ihre Positionen eingenommen hatten – teils unter den Kirchgängern, teils als sonntägliche Spaziergänger auf dem Platz verteilt. Ihre Waffen verbargen sie unter ihren Kleidern, in Taschen oder Beuteln. Wenn die Informationen des MI6 stimmten, würden die Angreifer in der Überzahl sein.
Felicity hegte trotzdem Bedenken. Düstere Ahnungen plagten sie. Sie hatte Antoinette von der Schätzung des MI6 erzählt. Antoinette hatte die Stirn gerunzelt und geantwortet: »Nach meinem Eindruck sind es mehr.« Michels Tante war nicht auf den Kopf gefallen. Ehedem Sekretärin des Champagnerproduzenten Joseph Laperrière, die ihre Stellung verloren hatte, als nach der deutschen Besetzung die Gewinne drastisch zurückgingen und die Frau des Chefs den Sekretärinnenposten übernahm, stand sie mit beiden Beinen im Leben. Gut möglich, dass sie mit ihrer Beobachtung Recht hatte.
Michel war es nicht gelungen, den Widerspruch zwischen der MI6-Schätzung und Antoinettes Vermutung aufzuklären. Er lebte in Reims, und weder er selbst noch irgendein anderes Mitglied seiner Gruppe kannte sich in Sainte-Cécile aus. Für weitere Aufklärungsarbeit hatte die Zeit nicht gereicht. Wenn der Feind in Überzahl ist, sieht es schlecht aus für uns, dachte Felicity in banger Erwartung. Gegen disziplinierte deutsche Truppen haben wir kaum eine Chance.
Sie sah hinaus auf den Platz, suchte die Mitkämpfer. Als harmlose Spaziergänger getarnt, waren sie darauf gefasst, in Kürze zu töten oder getötet zu werden. Vor dem Schaufenster eines Kurzwarenladens stand Geneviève, eine hoch gewachsene junge Frau von zwanzig Jahren, und betrachtete einen Ballen mattgrünen Stoffs. Unter ihrem leichten Sommermantel trug sie eine Sten-Maschinenpistole, die bei der Résistance sehr beliebt war, weil sie in drei Teile zerlegt und deshalb in kleinen Taschen transportiert werden konnte. Gut möglich, dass Geneviève jenes Mädchen war, auf das Michel ein Auge geworfen hatte … Dennoch schauderte Felicity bei dem Gedanken, dass die junge Frau in ein paar Sekunden von Kugeln durchsiebt werden könnte. Über das Kopfsteinpflaster des Platzes schlenderte Bertrand auf die Kirche zu. Mit seinen siebzehn Jahren war er noch jünger als Geneviève. Der blonde Junge mit der entschlossenen Miene trug eine zusammengefaltete Zeitung unter dem Arm, in der sich ein halbautomatischer Colt, Kaliber .45, verbarg. Die Alliierten hatten Tausende von Colts per Fallschirm abgeworfen. Wegen seiner Jugend hatte Flick Bertrand anfangs von der Teilnahme an dem Überfall ausgeschlossen, auf sein inständiges Bitten hin, und weil sie jeden verfügbaren Mann brauchten, dann aber doch nachgegeben. Sie hoffte, sein etwas prahlerisches jugendliches Draufgängertum würde nicht gleich nach dem ersten Schuss verfliegen. Am Kirchenportal lungerte Albert herum und tat so, als wolle er erst noch seine Zigarette zu Ende rauchen, bevor er hineinging. Alberts Frau hatte an diesem Morgen ihr erstes Kind geboren, ein Mädchen – ein zusätzlicher Grund für Albert, am Leben zu bleiben. Er trug einen Leinensack bei sich, der aussah, als wäre er mit Kartoffeln gefüllt. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch um Handgranaten vom Typ Mills Nr. 36, Mark I.
Alles auf dem Platz wirkte vollkommen normal – nur eines nicht: Neben der Kirche parkte ein sehr großer, starker Sportwagen. Es war ein in Frankreich gebauter Hispano-Suiza 68 bis mit einem V12-Flugzeugmotor, eines der schnellsten Autos der Welt. Der himmelblau lackierte Wagen hatte einen hohen, arrogant wirkenden silbernen Kühlergrill, auf dem als Markenzeichen der fliegende Storch prangte.
Vor einer halben Stunde war er eingetroffen. Der Fahrer, ein gut aussehender Mann von etwa vierzig Jahren, trug einen eleganten Zivilanzug, musste aber ein deutscher Offizier sein. Niemand sonst hätte die Kühnheit besessen, mit einem solchen Fahrzeug zu protzen. Seine Begleiterin, eine große, auffallend schöne Rothaarige in einem grünen Seidenkleid und hochhackigen Wildlederschuhen, war derart perfekt nach der neuesten Mode gekleidet, dass sie nur Französin sein konnte. Der Mann hatte ein Stativ aufgestellt und fotografierte das Schloss. Die Frau trug einen trotzigen Blick zur Schau, als wisse sie, dass die ärmlich gekleideten Einwohner der Stadt, die sie auf dem Weg zur Kirche ungläubig anstarrten, sie in Gedanken als Hure beschimpften.
Es war erst ein paar Minuten her, dass der Mann Flick einen furchtbaren Schreck eingejagt hatte, weil er sie bat, ihn und seine Freundin vor dem Hintergrund des Schlosses zu fotografieren. Er war sehr höflich gewesen, hatte aufmunternd gelächelt, und seinem Französisch war nur ein ganz leichter deutscher Akzent anzumerken gewesen. Die Ablenkung in einem entscheidenden Augenblick war absolut zum Verrücktwerden – doch Flick hatte gespürt, dass eine Weigerung erst recht zu Schwierigkeiten führen konnte, zumal sie sich als Einheimische ausgab, die gerade nichts Besseres zu tun hatte, als in einem Straßencafé herumzusitzen. Also hatte sie reagiert, wie die meisten Franzosen unter diesen Umständen reagiert hätten, und mit kühlem, unbeteiligtem Blick den Wunsch des Deutschen erfüllt.
Es war eine geradezu absurde Szene: hinter der Kamera eine Agentin des britischen Geheimdiensts, vor ihr, sie anlächelnd, der deutsche Offizier mit seinem Flittchen, und als Geräuschkulisse die Kirchenglocken, die die letzten Sekunden vor der Bombenexplosion einläuteten. Der Offizier hatte sich schließlich bei ihr bedankt und gefragt, ob er sie zu einem Glas Wein einladen dürfe, was Flick strikt abgelehnt hatte: Eine junge Französin, die sich von einem Deutschen einladen ließ, musste darauf gefasst sein, als Besatzerflittchen bezeichnet zu werden. Der Deutsche hatte verständnisvoll genickt, worauf Flick zu ihrem Mann zurückgekehrt war.
Der Offizier befand sich offensichtlich nicht im Dienst und trug anscheinend auch keine Waffe. Obwohl er also keine Gefahr darstellte, empfand Flick seine Gegenwart als beunruhigend und zerbrach sich in den letzten ruhigen Sekunden den Kopf darüber, was es mit dieser Unruhe auf sich haben mochte. Am Ende kam sie zu der Erkenntnis, dass sie einfach nicht glauben konnte, dass der Mann tatsächlich nur ein Tourist war. Sein Verhalten verriet hoch gespannte Wachsamkeit, und die passte nicht zu jemandem, der lediglich die Schönheit der historischen Architektur in sich aufnehmen wollte. Die Frau an seiner Seite mochte genau das sein, wofür man sie hielt – er aber war etwas anderes.
Nur was? Ehe Flick sich weitere Gedanken darüber machen konnte, verklang der letzte Glockenschlag.
Michel leerte sein Glas und wischte sich mit dem Handrücken den Mund ab.
Flick und Michel erhoben sich. Ostentativ ruhig schlenderten sie auf den Eingang des Cafés zu, blieben in der Tür stehen und suchten auf diese Weise unauffällig Deckung.
Dieter Franck war das Mädchen an dem Cafétisch im selben Moment aufgefallen, als der Wagen auf den Platz rollte. Schöne Frauen fielen ihm immer auf, und diese hier erkannte er sofort als reine Verkörperung der Erotik. Blassblond war sie und hatte hellgrüne Augen – und wahrscheinlich floss sogar deutsches Blut in ihren Adern, was hier im Nordosten Frankreichs, so nahe an der Grenze, nichts Ungewöhnliches gewesen wäre. Ihr kleiner, schlanker Körper war in ein sackartiges Kleid gehüllt, doch trug sie dazu ein lebhaft gelbes Halstuch aus billiger Baumwolle, das in seinen Augen ein bezaubernd französisches Stilgefühl verriet. Als er sie schließlich angesprochen hatte, war ihm jener Anflug von Furcht nicht entgangen, wie er für die meisten Franzosen typisch war, die von einem deutschen Besatzer angesprochen wurden, doch dann, unmittelbar danach, legte sich eine nur schlecht verhüllte Verachtung über ihre hübschen Züge, die sofort seine Neugier erweckte.
Sie befand sich in Begleitung eines attraktiven Mannes, der kein besonderes Interesse an ihr zeigte – vermutlich war es ihr Ehemann. Nur weil er mit ihr ins Gespräch kommen wollte, hatte Franck sie gebeten, ihn mit Stéphanie zusammen zu fotografieren. Daheim in Köln hatte er eine Frau und zwei niedliche Kinder, und in Paris teilte er seine Wohnung mit Stéphanie, doch hinderte ihn das nicht daran, mit anderen Mädchen anzubandeln. Mit schönen Frauen verhielt es sich wie mit den großartigen Bildern der französischen Impressionisten, die er sammelte: Man konnte nicht genug von ihnen bekommen.
Die Französinnen waren die schönsten Frauen der Welt. Aber in Frankreich war überhaupt alles schön: die Brücken, die Boulevards, die Möbel, sogar das Porzellan. Franck liebte die Pariser Nachtclubs, Champagner, Gänseleberpastete und warme Baguettes. Krawatten und Hemden kaufte er gerne bei Charvet, dem legendären chemisier gegenüber dem Ritz. Er hätte bis ans Ende seiner Tage glücklich und zufrieden in Paris leben können.
Woher diese Vorliebe kam, wusste er nicht. Sein Vater war Professor für Musik – die einzige Kunst, in der die Deutschen und nicht die Franzosen die unbestrittenen Meister waren. Ihm jedoch war das trockene Akademikerleben des Vaters unerträglich langweilig vorgekommen, weshalb er zum Entsetzen seiner Eltern das Studium an den Nagel gehängt hatte und zur Polizei gegangen war. 1939 war Franck Abteilungsleiter bei der Kölner Kriminalpolizei. Als im Mai 1940 die Panzer des Generals Heinz Guderian bei Sedan die Meuse überquerten und in einem triumphalen Vormarsch innerhalb nur einer Woche bis zur Küste des Ärmelkanals vorstießen, bewarb er sich spontan um eine seinen Fähigkeiten entsprechende Aufgabe bei der Wehrmacht. Dank seiner Berufserfahrungen als Polizist wurde er sofort genommen und bei der Auslandsaufklärung eingesetzt. Er sprach fließend Französisch und hinreichend Englisch, weshalb man ihn unter anderem mit Vernehmungen von Gefangenen betraute. Er hatte ein Talent dafür, Informationen zu beschaffen, mit deren Hilfe Schlachten gewonnen werden konnten – das bereitete ihm eine tiefe innere Befriedigung. Seine erfolgreiche Arbeit war in Nordafrika sogar Rommel aufgefallen.
Erwies es sich als notwendig, war Dieter Franck auch zu radikalen Mitteln bereit, wenngleich er lieber mit subtileren Methoden überzeugte, und auf diese Weise war er auch an Stéphanie geraten. Die selbstsichere, sinnliche und kluge Frau hatte in Paris einen Laden besessen, in dem todschicke Damenhüte zu obszön hohen Preisen verkauft wurden. Wegen ihrer jüdischen Großmutter hatte sie jedoch den Laden verloren und bereits ein halbes Jahr in einem französischen Gefängnis zugebracht. Sie befand sich auf dem Weg in ein deutsches Konzentrationslager, als Franck sie rettete.
Er hätte sie vergewaltigen können, und Stéphanie hatte sicher auch damit gerechnet. Niemand hätte dagegen protestiert, geschweige denn den Täter bestraft. Doch Franck hatte ihr zu essen gegeben, sie neu eingekleidet und ihr das freie Schlafzimmer in seiner Wohnung überlassen. Er behandelte sie mit liebevoller Zuneigung, bis er sie eines Tages nach einem Abendessen mit foie de veau und einer Flasche La Tache auf der Couch vor einem prasselnden Kohlefeuer nach allen Regeln der Kunst verführte.
Heute war Stéphanie allerdings Teil seiner Tarnung. Er arbeitete wieder für Rommel, Generalfeldmarschall Erwin Rommel, den »Wüstenfuchs«, der mittlerweile als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B für die Verteidigung Nordfrankreichs zuständig war. Die deutsche Aufklärung rechnete noch in diesem Sommer mit einer Invasion der Alliierten. Da Rommel nicht genügend Soldaten hatte, um die Hunderte von Kilometern lange, leicht verwundbare Küste zu schützen, verfolgte er eine riskante Strategie der flexiblen Reaktion: Seine Streitkräfte waren einige Kilometer weit hinter der Küste im Landesinnern stationiert und darauf eingerichtet, im Notfall sofort an die Brennpunkte des Geschehens verlegt zu werden.
Den Engländern war das bekannt – auch sie hatten ihre Aufklärung. Ihre Antwort bestand darin, durch die Zerstörung der Infrastruktur die deutsche Reaktion zu verzögern. Tag und Nacht bombardierten britische und amerikanische Flugzeuge Eisenbahntrassen, Brücken, Tunnel, Bahnhöfe und Rangieranlagen, und die Résistance jagte Kraftwerke und Fabriken in die Luft, brachte Züge zum Entgleisen, kappte Telefonleitungen und schickte halbwüchsige Mädchen aus, Sand in die Öltanks von Panzern und Lastwagen zu schütten.
Francks Aufgabe bestand darin, die wichtigsten potenziellen Ziele im Nachschub- und Etappenbereich zu erkennen und festzustellen, inwieweit sie durch Anschläge der Résistance gefährdet waren. In den vergangenen Monaten war er vom Hauptquartier in Paris aus kreuz und quer durch Nordfrankreich gereist, hatte müde Posten angebrüllt, schlafmützigen Hauptleuten die Hölle heiß gemacht und dafür gesorgt, dass die Sicherheitsvorkehrungen an Stellwerken, Lokschuppen, Fahrzeugparks und Kontrolltürmen auf Flugplätzen erheblich verstärkt wurden. Heute stattete er einer Fernmeldezentrale von überragender strategischer Bedeutung einen unangemeldeten Besuch ab. Sämtliche Telefonleitungen zwischen dem Oberkommando der Wehrmacht in Berlin und den deutschen Truppen im Norden Frankreichs liefen durch dieses Gebäude, darunter auch die Fernschreibverbindungen, jener Übertragungsweg, über den inzwischen die meisten Befehle erteilt wurden. Eine Zerstörung dieser Zentrale hätte das deutsche Nachrichtennetz zusammenbrechen lassen.
Den Alliierten war dies offenbar bekannt. Mehrfach hatten sie versucht, das Gebäude zu bombardieren, doch das Glück war den Deutschen hold geblieben. Das galt auch für einen möglichen Anschlag. Denn obwohl das Schloss ein ideales Ziel der Résistance darstellte, erwiesen sich die Sicherheitsvorkehrungen nach Francks Einschätzung als äußerst lax. Vermutlich hing es damit zusammen, dass auch die Gestapo hier ein Büro unterhielt. In der Geheimen Staatspolizei gab es viele, die ihre Karriere weniger ihrer Intelligenz und ihren Fähigkeiten verdankten als ihrer nationalsozialistischen Gesinnung und Führertreue. Seit einer halben Stunde fotografierte Franck das Gelände – und sein Zorn auf die verantwortlichen Sicherheitskräfte, die von ihm einfach keine Notiz nahmen, wuchs und wuchs.
Dann jedoch – gerade waren die Kirchenglocken verklungen – schritt ein Offizier in Majorsuniform durch das hohe schmiedeeiserne Tor, kam auf ihn zu und schrie in schlechtem Französisch: »Geben Sie mir sofort Ihre Kamera!«
Dieter Franck wandte sich ab und tat so, als habe er nichts gehört.
»Es ist streng verboten, das Château zu fotografieren, Sie Kretin!«, brüllte der Mann. »Sehen Sie denn nicht, dass es sich um eine militärische Einrichtung handelt?«
Franck drehte sich langsam um und antwortete ruhig auf Deutsch: »Hat verdammt lange gedauert, bis Sie mich bemerkt haben.«
Das saß. Zivilisten hatten normalerweise Angst vor der Gestapo. »Was wollen Sie damit sagen?«, fragte der Mann mit deutlich gebremster Aggressivität.
Franck sah auf seine Uhr. »Ich bin seit zweiunddreißig Minuten hier. In dieser Zeit hätte ich Dutzende von Aufnahmen machen und längst wieder verschwinden können. Sind Sie hier für die Sicherheit verantwortlich?«
»Wer sind Sie?«
»Major Dieter Franck aus dem persönlichen Stab von Generalfeldmarschall Rommel.«
»Franck?«, rief der Mann. »Ich erinnere mich …«
Franck sah sich sein Gegenüber genauer an. Dann dämmerte es ihm. »Mein Gott«, sagte er. »Willi Weber.«
»Sturmbannführer Weber, mit Verlaub.« Wie die meisten höheren Gestapo-Beamten verfügte auch Weber über einen Rang bei der SS, der seiner Meinung nach angesehener war als sein Dienstgrad bei der Polizei.
»Mich laust der Affe«, sagte Franck und dachte: Kein Wunder, dass die Sicherheitsvorkehrungen hier zu wünschen übrig lassen.
Weber und Franck waren beide in den Zwanzigerjahren in Köln in den Polizeidienst eingetreten. Franck erwies sich als Überflieger, Willi Weber als Versager. Weber neidete Franck den Erfolg und schrieb ihn dessen privilegierter Herkunft zu (so privilegiert war Franck gar nicht, aber für Weber, den Sohn eines Schauermanns, stellte es sich so dar).
Willi Weber war schließlich entlassen worden, und jetzt fielen Dieter Franck die näheren Umstände wieder ein: Bei einem Verkehrsunfall hatte sich eine Gruppe von Schaulustigen versammelt. Weber war in Panik geraten und hatte einen Schuss abgefeuert; ein Gaffer war getötet worden.
Seit fünfzehn Jahren hatte Franck den Mann nicht mehr gesehen. Aber er konnte sich gut vorstellen, wie sich dessen Karriere inzwischen entwickelt hatte: Eintritt in die NSDAP, freiwillige Einsätze im organisatorischen Bereich, Antrag auf Aufnahme in die Gestapo unter Hinweis auf seine Ausbildung bei der Polizei, rascher Aufstieg im Kreis der verbitterten Minderbegabten.
»Was tun Sie hier?«, wollte Weber wissen.
»Ich überprüfe im Auftrag des Generalfeldmarschalls die Sicherheitsvorkehrungen.«
»Die sind in bester Ordnung«, fauchte Weber.
»Für eine Wurstfabrik vielleicht. Sehen Sie sich das doch mal an.« Franck deutete auf den Stadtplatz. »Angenommen, diese Leute dort sind von der Résistance? Die schalten doch Ihre Wachen, wenn’s drauf ankommt, innerhalb von ein paar Sekunden aus.« Er machte Weber auf eine hoch gewachsene junge Frau aufmerksam, die über ihrem Kleid einen hellen Sommermantel trug. »Angenommen, die Frau da versteckt eine Waffe unter ihrem Mantel … Was tun Sie, wenn …?«
Er unterbrach sich.
Er spürte in diesem Augenblick, dass er nicht nur ein Fantasie-Szenario beschrieb. Im Unterbewusstsein war ihm aufgefallen, dass sich einige Personen auf dem Platz zu einem Überfall formierten. Die kleine Blonde und ihr Mann hatten im Café Deckung gesucht. Die beiden Männer im Portal der Kirche standen hinter zwei Säulen. Die große junge Frau im Sommermantel, die eben noch die Auslage eines Geschäfts betrachtet hatte, hielt sich nun im Schatten von Francks Wagen auf. Als er sie ansah, klappte plötzlich ihr Mantel auf, und Franck musste entsetzt erkennen, dass seine Vision Prophezeiung gewesen war: Die Frau verbarg unter dem Mantel eine Maschinenpistole mit Gitterrahmen, genau das Modell, das die Résistance bevorzugte.
»Mein Gott«, sagte er und griff in seine Jacketttasche. Doch im selben Moment fiel ihm ein, dass er gar keine Waffe bei sich trug.
Wo war Stéphanie? Er sah sich um. Es fehlte nicht viel, und der Schock hätte ihn in Panik verfallen lassen. Doch Stéphanie stand hinter ihm und wartete geduldig auf das Ende seiner Auseinandersetzung mit Weber.
»Hinlegen!«, brüllte er sie an.
Im selben Augenblick knallte es auch schon.
Flick stand auf Zehenspitzen im Eingang des Café des Sports und spähte Michel über die Schulter. Ihr Herz schlug heftig, ihre Aufmerksamkeit war geschärft, die Muskeln vor Tatendrang gespannt, doch ihr Kopf war kühl, als flösse Eiswasser durch ihr Hirn. Mit kühler Distanz beobachtete sie die Szenerie und kalkulierte ihre Chancen.
Acht Posten waren zu sehen: Zwei am Tor kontrollierten Passierscheine, zwei weitere standen gleich hinter dem Tor, ein drittes Paar patrouillierte hinter dem schmiedeeisernen Zaun, und ein viertes stand am oberen Ende der kurzen Treppe, die zum großen Schlossportal hinaufführte. Michels Kerntruppe würde jedoch das Tor umgehen.
Die lange Nordwand der Kirche war in die den Schlosspark umgebende Mauer integriert, und das nördliche Querschiff ragte ein paar Meter in den Parkplatz hinein, der einst ein Teil des Ziergartens gewesen war. Zuzeiten des Ancien Régime pflegte der Schlossherr die Kirche durch einen Privateingang zu betreten, eine kleine Tür in der Mauer des Querschiffs, die vor mittlerweile mehr als hundert Jahren mit Brettern vernagelt und überputzt worden war. An diesem Sachverhalt hatte sich bis heute nichts geändert.
Vor einer Stunde jedoch hatte Gaston Lefèvre, ein Rentner und ehemaliger Steinbrucharbeiter, die leere Kirche betreten und am Fuß des blockierten Durchgangs mit großer Sorgfalt vier halbpfundschwere Stangen gelben Plastiksprengstoffs deponiert, sie mit Zündern versehen und miteinander verbunden, sodass sie gleichzeitig explodieren würden. Dazu hatte er eine Fünf-Sekunden-Lunte montiert, die durch einen Schalter per Daumendruck gezündet wurde, zur Tarnung schließlich alles mit Asche aus seinem Küchenherd überschmiert und zu guter Letzt noch eine alte Holzbank über die Bombe geschoben. Zufrieden mit seinem Werk kniete er nieder, um zu beten.
Als die Kirchenglocken vor ein paar Sekunden verstummt waren, hatte Lefèvre sich von seiner Kirchenbank erhoben, war durchs Hauptschiff ins Querschiff gegangen, hatte den Schalter betätigt und schnell hinter der Ecke Deckung gesucht. Die Detonation schüttelte den Staub von Jahrhunderten von den gotischen Bögen, doch da sich während der Gottesdienste niemand im Querschiff aufhielt, gab es keine Verletzten.
Nach dem Explosionsknall herrschte für einen beklemmend langen Augenblick Stille auf dem Platz. Alle Anwesenden erstarrten: die Wachen vor den Toren, die Patrouille am Zaun, der Gestapo-Major ebenso wie der gut gekleidete deutsche Zivilist mit seiner feudalen Begleiterin. Flick, vor banger Erwartung aufs Höchste angespannt, blickte über den Platz und durch das schmiedeeiserne Gatter in den Schlosspark. Auf dem Abstellplatz für die Fahrzeuge war als Relikt aus dem 17. Jahrhundert, der Entstehungszeit des Gartens, ein steinerner Brunnen übrig geblieben. Wo einst Wasserfontänen gesprudelt hatten, tummelten sich nur noch drei bemooste Putten über einem ausgetrockneten Marmorbecken. Drum herum standen ein Lastwagen, ein Panzerspähwagen, eine Mercedes-Limousine im graugrünen Anstrich der deutschen Wehrmacht sowie zwei schwarze Citroëns mit Vorderradantrieb vom Typ Traction Avant – das Lieblingsgefährt der Gestapo in Frankreich. Ein Soldat war gerade dabei, einen der Citroëns aufzutanken; die Zapfsäule stand völlig deplatziert direkt vor einem der hohen Fenster des Schlosses. Sekundenlang rührte sich gar nichts. Flick wartete mit angehaltenem Atem.
Unter den Gottesdienstbesuchern in der Kirche befanden sich zehn Bewaffnete. Der Pfarrer, der kein Sympathisant der Résistance und infolgedessen nicht vorgewarnt war, musste sich über den unerwarteten Andrang zu der normalerweise nicht sehr beliebten Abendandacht gefreut haben. Möglich, dass er sich gewundert hatte, dass so viele Gläubige im Mantel erschienen waren, obwohl es doch eigentlich ein warmer Tag war, doch nach vier Jahren der Entbehrung trugen viele Menschen manchmal etwas merkwürdige Kleidung. Ein Mann, der im Regenmantel in die Kirche ging, besaß vielleicht kein Jackett. Inzwischen war der Herr Pfarrer im Bilde – wenigstens hoffte Flick das –, denn in diesem Augenblick, so war es geplant, sollten die zehn von ihren Sitzen aufspringen, ihre Waffen ziehen und durch das neue Loch in der Mauer auf das Schlossgelände stürmen.
Und da waren sie auch schon. Stolz und Angst ließen Flicks Herz höher schlagen, als sie die Männer hinter der Kirche hervorkommen sah – eine bunt zusammengewürfelte Truppe mit alten Mützen und ausgetretenen Schuhen. Sie rannten über den Parkplatz auf den Haupteingang des Schlosses zu, ihre Füße stampften durch den Staub, ihre Hände umklammerten die Waffen – ein Sammelsurium aus Pistolen, Revolvern, Flinten. Sogar eine Maschinenpistole war dabei. Sie hatten noch keinen Schuss abgegeben, da sie vor Beginn des Angriffs so nahe wie möglich an das Gebäude heranwollten.
Michel sah das gleiche Bild und gab ein Geräusch von sich, das irgendwo zwischen Grunzen und Seufzen anzusiedeln war. Flick spürte, dass ihn die gleichen Gefühle bewegten wie sie, die gleiche Mischung aus Stolz auf die Tapferkeit der Truppe und die Angst um das Leben jedes Einzelnen. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, die Wachen abzulenken. Michel hob sein Gewehr, ein Lee-Enfield No. 4 Mark I. Da viele dieser Waffen in Kanada hergestellt wurden, war es in der Résistance unter dem Namen »Canadian rifle« bekannt. Michel zielte, zog den Abzugshebel bis zum Druckpunkt und feuerte. Mit geübtem Griff entriegelte er das Schloss und schob es schnell wieder vor, sodass die Waffe sofort wieder schussbereit war.
Der Gewehrschuss beendete die Schreckensstarre auf dem Platz. Einer der Wachsoldaten am Tor stieß einen Schrei aus und brach zusammen – ein Anblick, der Flick mit wilder Genugtuung erfüllte: Einer weniger, der auf unsere Kameraden schießen kann, dachte sie. Michels Schuss war das Zeichen für alle anderen, nun ihrerseits das Feuer zu eröffnen. Die beiden Schüsse, die der junge Bertrand vom Kirchenportal aus abgab, krachten wie Knallfrösche. Da die Distanz zu den Wachtposten für einen sicheren Pistolenschuss zu groß war, verfehlte er sein Ziel. Albert, der neben ihm stand, zog eine Handgranate ab und schleuderte sie hoch über den Zaun. Sie explodierte zwischen den Weinstöcken innerhalb des Schlossgeländes und wirbelte Äste und Blattwerk auf, blieb aber sonst wirkungslos. Flick hätte die beiden am liebsten vor Wut angebrüllt: »Hört auf mit der sinnlosen Knallerei, ihr verratet doch nur eure Position!« Doch zur Zurückhaltung nach Beginn eines Schusswechsels waren nur die besten, perfekt ausgebildeten Soldaten imstande. Hinter dem Sportwagen eröffnete nun auch Geneviève das Feuer, und das ohrenbetäubende Rattern ihrer Sten-MP hallte über den Platz. Ihre Attacke war erfolgreicher: Ein zweiter Posten fiel.
Jetzt endlich reagierten die Deutschen. Die Wachen gingen hinter den Steinsäulen in Deckung oder warfen sich flach auf den Boden und brachten ihre Gewehre in Anschlag. Der Gestapo-Major fingerte seine Pistole aus dem Holster. Die Rothaarige drehte sich um und rannte davon, doch ihre kessen Schuhe rutschten auf dem Kopfsteinpflaster, sodass sie stürzte. Ihr Begleiter warf sich auf sie und schützte sie mit seinem Körper – er ist also tatsächlich Soldat, dachte Flick, denn ein Zivilist dürfte kaum wissen, dass es sicherer ist, sich auf den Boden zu werfen anstatt davonzurennen.
Die Wachen eröffneten das Feuer, und unmittelbar darauf wurde Albert getroffen. Flick sah, wie er taumelte, die Hand um seinen Hals gekrampft. Eine Handgranate, die er gerade hatte werfen wollen, fiel ihm aus der Hand. Dann erwischte ihn eine zweite Salve, diesmal genau in die Stirn. Wie ein Stein stürzte er zu Boden. Für einen Augenblick überfiel Flick tiefe Traurigkeit bei dem Gedanken, dass das heute früh auf die Welt gekommene Baby nun ohne Vater aufwachsen musste.
Neben Albert sah Bertrand die Eierhandgranate über die altersschiefe Steintreppe des Kirchenportals kullern und versuchte sich mit einem Satz ins Innere des Gebäudes in Sicherheit zu bringen, als die Granate explodierte. Flick wartete, ob Bertrand wieder auftauchte, doch das war nicht der Fall. Sie wusste nicht, ob er tot, verwundet oder bloß benommen war. Die Ungewissheit war schwer zu ertragen.
Der Stoßtrupp aus der Kirche hatte auf dem Parkplatz innegehalten und eröffnete nun das Feuer auf die letzten sechs Wachtposten. Die vier Soldaten in der Nähe des Tors gerieten somit ins Kreuzfeuer und wurden binnen weniger Sekunden ausgeschaltet. Es blieben jetzt nur noch die beiden auf der Schlosstreppe. Michels Plan geht auf, dachte Flick und schöpfte Hoffnung.
Doch dann änderte sich die Situation schlagartig. Die feindlichen Soldaten innerhalb des Gebäudes hatten die Schrecksekunde überwunden, ihre Waffen an sich gerissen und Tür- und Fensteröffnungen besetzt. Jetzt griffen sie in den Kampf ein. Alles hing davon ab, wie viele Gegner es waren.
Ein Kugelhagel prasselte auf die Angreifer herab, und Flick hörte auf zu zählen. Offenbar gab es wesentlich mehr Waffen im Schloss, als sie gedacht hatten, und so, wie es aussah, wurde aus mindestens zwölf Türen und Fenstern geschossen. Der Stoßtrupp aus der Kirche, der laut Plan bereits innerhalb des Gebäudes hätte sein sollen, zog sich zurück und suchte hinter den Fahrzeugen auf dem Parkplatz Deckung. Der MI6 hatte sich geirrt, Antoinette nicht. Zwölf bewaffnete Verteidiger hatte der Geheimdienst geschätzt. Doch obwohl die Résistance mit Sicherheit sechs Mann ausgeschaltet hatte, schossen noch mindestens vierzehn zurück.
Flick fluchte aus tiefster Seele. Einen Kampf wie diesen konnte eine Widerstandsgruppe nur mit einem plötzlichen Gewaltschlag gewinnen. Überstand der Feind den Überraschungscoup, wurde es brenzlig. Mit jeder weiteren Sekunde, die vorübertickte, fielen militärische Ausbildung und Disziplin mehr ins Gewicht, und bei längeren Auseinandersetzungen behielten reguläre Truppen am Ende immer die Oberhand.
Im Obergeschoss des Châteaus wurde ein hohes Fenster von innen aufgebrochen. Ein Maschinengewehr erschien und begann sofort zu feuern. Aufgrund seiner hohen Position verursachte es ein furchtbares Blutbad unter den Résistance-Kämpfern auf dem Parkplatz. Flick wurde übel, als sie sah, wie einer der Männer nach dem anderen umfiel und dann neben dem trockenen Brunnenbecken in seinem Blut lag. Binnen kürzester Zeit waren nur noch zwei oder drei auf den Beinen und gaben noch Schüsse ab.
Es ist alles vorbei, dachte sie verzweifelt. Wir sind klar in der Unterzahl und haben verloren. Der säuerliche Geschmack der Niederlage stieg ihr in die Kehle.
Michel hatte die Maschinengewehrstellung unter Feuer genommen. Jetzt sagte er: »Von hier unten können wir das MG--Nest da oben nicht ausschalten!« Sein Blick schweifte über den Platz, suchte auf Hausdächern, am Glockenturm und im Obergeschoss des Rathauses nach geeigneten Stellungen. »Vom Büro des Bürgermeisters aus hätte ich freies Schussfeld.«
»Warte!« Flicks Mund war trocken. Sosehr sie es wollte – sie konnte ihn nicht davon abhalten, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Aber sie konnte das Risiko verringern. »Geneviève!«, brüllte sie, so laut sie konnte.
Geneviève drehte sich um und sah sie an.
»Gib Michel Feuerschutz!«
Geneviève nickte heftig, sprang aus ihrer Deckung hinter dem Sportwagen hervor und feuerte unablässig auf die Schlossfenster.
»Danke«, sagte Michel zu Flick, verließ seinerseits die Deckung und rannte quer über den Platz auf das Rathaus zu.
Geneviève lief auf das Portal der Kirche zu. Ihr Feuer lenkte die Männer im Schloss ab und gab Michel die Chance, unverletzt den Platz zu überqueren. Doch plötzlich blitzte es links von Flick auf, und als sie sich umsah, erkannte sie den Gestapo-Major. Er stand rücklings an die Rathausmauer gepresst und richtete seine Pistole auf Michel.
Mit einer Handfeuerwaffe ein bewegliches Objekt zu treffen war nicht leicht, es sei denn, man kam nahe genug heran. Aber der Kerl kann auch einfach Glück haben, dachte Flick voller Angst. Ihr Befehl lautete, den Angriff zu beobachten und danach Bericht zu erstatten, sich jedoch keinesfalls selber an den Kampfhandlungen zu beteiligen. Jetzt allerdings pfiff sie darauf. In ihrer Schultertasche befand sich ihre eigene Waffe, ein 9mm Browning Automatic. Diese Pistole war ihr lieber als der bei der SOE gebräuchliche Colt, weil sie dreizehn Schuss im Magazin hatte anstatt nur sieben und mit der gleichen 9mm-Parabellum-Munition geladen werden konnte wie die Sten-MP.
Flick riss die Waffe aus der Umhängetasche, entsicherte sie, spannte den Hahn, streckte den Arm aus und feuerte zwei hastige Schüsse auf den Major ab.
Sie verfehlte ihn, aber die Kugeln fetzten neben seinem Gesicht Steinsplitter aus der Mauer, sodass er unwillkürlich zusammenfuhr.
Michel rannte weiter.
Der Gestapo-Major hatte sich sofort wieder unter Kontrolle und hob erneut die Waffe.
Je näher Michel seinem Ziel kam, desto kürzer wurde die Schussdistanz. Michel feuerte sein Gewehr auf den Gestapo-Mann ab, doch der Schuss ging weit daneben. Der Deutsche behielt einen kühlen Kopf und feuerte zurück. Diesmal wurde Michel getroffen und brach in die Knie. Flick stieß einen Angstschrei aus.
Michel versuchte, wieder auf die Beine zu kommen, und brach erneut zusammen. Flick zwang sich zur Ruhe und dachte fieberhaft nach. Michel lebte noch. Geneviève hatte das Portal der Kirche erreicht und zog mit ihrem MP-Feuer nach wie vor die Aufmerksamkeit der Feinde im Schloss auf sich. Dadurch bot sich Flick die Chance, Michel zu retten. Auch das war befehlswidrig, doch kein Befehl der Welt würde sie dazu bringen, ihren Ehemann dort auf dem Boden liegen und verbluten zu lassen – ganz abgesehen davon, dass man ihn, wenn er dort liegen blieb, verhaften und brutal in die Mangel nehmen würde. Als Anführer der Bollinger-Gruppe kannte Michel sämtliche Namen, Adressen und Codewörter. Seine Verhaftung wäre eine Katastrophe.
Ihr blieb gar nichts anderes übrig.
Sie gab einen weiteren Schuss auf den Gestapo-Mann ab, und wieder ging die Kugel fehl, aber sie blieb am Drücker, feuerte wieder und wieder auf ihn, sodass er gezwungen war, sich an der Mauer entlang weiter zurückzuziehen und nach Deckung Ausschau zu halten.
Flick stürmte aus der Bar auf den Platz hinaus. Am Rande ihres Blickfelds nahm sie wahr, dass der Sportwagenfahrer noch immer über seiner Freundin lag, um sie vor dem Kugelhagel zu schützen. Sie hatte ihn völlig vergessen, und ihr war klar, dass er sie, wenn er bewaffnet war, ohne weiteres hätte erschießen können. Doch die Kugeln blieben aus.
Sie erreichte den auf dem Boden liegenden Michel, ging neben ihm auf die Knie, sah sich noch einmal nach dem Rathaus um und gab zwei weitere Schüsse auf den Gestapo-Major ab, um ihn nicht auf dumme Gedanken kommen zu lassen. Dann wandte sie sich ihrem Mann zu.
Zu ihrer großen Erleichterung sah sie, dass seine Augen offen waren und dass er atmete. Allem Anschein nach hatte er eine blutende Wunde an der linken Gesäßhälfte. »Du hast ’ne Kugel im Hintern«, sagte sie auf Englisch.
»Tut verdammt weh«, erwiderte er auf Französisch.
Flick sah sich wieder nach dem Gestapo-Mann um. Der hatte sich zirka zwanzig Meter weiter zurückgezogen und versuchte gerade, die schmale Straße zu überqueren, um in einem Ladeneingang Deckung zu suchen. Diesmal nahm sich Flick ein paar Sekunden Zeit und zielte genauer. Viermal drückte sie ab. Das Schaufenster zerbarst in tausend Stücke, und der Major taumelte rückwärts und stürzte zu Boden.
Auf Französisch sagte sie zu Michel: »Versuch aufzustehen!« Er rollte sich auf die Seite, stöhnte vor Schmerzen und schaffte es auf ein Knie, konnte aber das verwundete Bein nicht bewegen. »Nun mach schon!«, sagte Flick rau. »Wenn du hier bleibst, bist du ein toter Mann.« Sie packte ihn vorne am Hemd und zog ihn unter Aufbietung aller Kräfte hoch. Michel stand auf seinem gesunden Bein, konnte aber sein eigenes Gewicht nicht tragen und stützte sich daher schwer auf sie.
Flick erkannte, dass er nicht gehen konnte, und sie stöhnte verzweifelt auf. Als sie sich umsah, merkte sie, dass der Major im Begriff war, sich wieder aufzurappeln. Er hatte Blut im Gesicht, schien aber ansonsten nicht ernsthaft verletzt zu sein. Wahrscheinlich hatte er nur ein paar oberflächliche Kratzer von umherfliegenden Glassplittern abbekommen und war durchaus noch in der Lage, zu schießen.
Es gab nur eine einzige Chance: Sie musste Michel aus der Gefahrenzone tragen.
Sie beugte sich zu ihm nieder, packte ihn bei den Hüften und legte ihn sich über die Schulter – der klassische Bergungsgriff der Feuerwehr. Michel war groß und dünn – so wie die meisten Franzosen in diesen Tagen. Trotzdem hatte Flick das Gefühl, sie müsse jeden Augenblick unter seinem Gewicht zusammenbrechen. Sie geriet ins Taumeln, ihr wurde schwindelig – aber sie blieb auf den Beinen.
Nach kurzem Zögern trat sie einen Schritt vor.
Und dann schleppte sie sich mit ihrer Last über das Kopfsteinpflaster. Sie dachte, der Gestapo-Major hätte sie neuerlich ins Visier genommen, doch war sie sich dessen nicht sicher, weil zwischen Geneviève und den paar noch lebenden Résistance-Kämpfern auf der einen sowie den Verteidigern des Schlosses auf der anderen Seite noch immer ein wilder Schusswechsel tobte. Die Furcht, jederzeit getroffen werden zu können, setzte neue Kräfte in Flick frei. Sie begann sogar geduckt zu rennen. Ihr Ziel war die Straße auf der Südseite des Platzes, der nächste Fluchtweg. Sie lief an dem Deutschen vorbei, der auf seiner rothaarigen Flamme lag. Für Sekundenbruchteile trafen sich ihre Blicke, und Flick nahm zu ihrer Überraschung eine Mischung aus Verblüffung und widerwilliger Anerkennung in seiner Miene wahr. Dann stieß sie so heftig gegen einen Tisch des Cafés, dass er umfiel. Auch sie selbst wäre um ein Haar gestürzt, doch im nächsten Moment hatte sie sich wieder gefangen und rannte weiter. Eine Kugel traf das Fenster des Cafés, und Flick sah noch die Bruchlinien, die sich wie ein Spinnennetz über das Glas zogen. Eine Sekunde später war sie um die Ecke und somit dem Blickfeld des Gestapo-Majors entschwunden. Überstanden, dachte sie dankbar. Wir sind beide noch am Leben – wenigstens in den nächsten Minuten.
Sie hatte noch nicht darüber nachgedacht, wohin sie sich wenden sollte, wenn sie das unmittelbare Schlachtfeld erst einmal hinter sich gebracht hatte. Ein paar Straßen weiter standen zwei Fluchtwagen bereit – aber so weit konnte sie Michel nicht tragen. In der Straße allerdings, in der sie sich jetzt befanden, wohnte Antoinette Dupert. Antoinette war kein Mitglied der Résistance, sympathisierte aber doch so sehr mit der Widerstandsbewegung, dass sie Michel sogar einen Plan des Schlosses beschafft hatte. Außerdem war Michel ihr Neffe, weshalb sie ihn gewiss nicht zurückweisen würde.
Ganz abgesehen davon blieb Flick gar keine Alternative.
Antoinette wohnte im Erdgeschoss eines Hauses mit einem Vorgarten. Nur ein paar Meter vom Stadtplatz entfernt erreichte Flick das offen stehende Tor, schwankte unter dem Torbogen hindurch, stieß eine Tür auf und ließ Michel auf die Fliesen gleiten.
Keuchend vor Anstrengung hämmerte sie mit den Fäusten an Antoinettes Tür.
Eine verängstigte Stimme meldete sich: »Was ist los?« Antoinette fürchtete sich offenbar vor der Schießerei und wollte die Tür nicht aufmachen.
»Schnell, schnell!«, rief Flick atemlos, aber doch nicht zu laut, weil sie damit rechnen musste, dass sich unter den anderen Hausbewohnern auch Nazi-Sympathisanten befanden.
Die Tür blieb verschlossen, doch Antoinettes Stimme kam näher. »Wer ist da?«
Flick vermied es instinktiv, einen Namen zu nennen. »Ihr Neffe ist verletzt«, erwiderte sie.
Jetzt endlich wurde die Tür geöffnet, und Antoinette, eine Frau von etwa fünfzig Jahren, stand in kerzengerader Haltung vor ihr. Sie trug ein Baumwollkleid, das einmal sehr chic gewesen und inzwischen verblichen, dabei aber picobello gebügelt war. Ihr Gesicht war blass vor Angst. »Michel!«, sagte sie und kniete neben ihm nieder. »Ist es schlimm?«
»Es tut höllisch weh, bringt mich aber nicht um«, antwortete Michel mit zusammengebissenen Zähnen.
»Armer Kerl!« Mit zärtlicher Geste strich sie ihm das Haar aus der schweißbedeckten Stirn.
»Wir müssen ihn reinschaffen«, sagte Flick ungeduldig.
Sie packte Michel an den Armen, und Antoinette hob ihn an den Knien hoch. Er ächzte vor Schmerz. Gemeinsam schleppten sie ihn ins Wohnzimmer und legten ihn auf ein ausgeblichenes, mit Samt bezogenes Sofa.
»Kümmern Sie sich um ihn, während ich den Wagen hole«, sagte Flick und lief wieder auf die Straße hinaus.
Es fielen nur noch wenige Schüsse. Ihr blieb nicht viel Zeit. Sie rannte los, die Straße entlang, dann bog sie zweimal um die Ecke.
Vor einer geschlossenen Bäckerei parkten zwei Fahrzeuge mit laufenden Motoren: ein rostiger Renault und ein Lieferwagen, auf dessen einer Seite ein Firmenschild mit der kaum noch lesbaren Aufschrift Blanchisserie Bisset angebracht war. Den Lieferwagen hatten sie sich von Bertrands Vater geliehen, der für die von den Deutschen benutzten Hotels die Wäsche wusch und daher Anspruch auf Benzin hatte. Der Renault war am Vormittag in Châlons gestohlen worden; Michel hatte die Nummernschilder ausgewechselt. Flick entschloss sich für den Pkw. Der Lieferwagen, dachte sie, bleibt besser denen vorbehalten, die das Gemetzel vor dem Schloss überlebt haben.
Zu dem Fahrer des Wäschereiwagens sagte sie: »Warten Sie noch fünf Minuten, dann verschwinden Sie.« Dann lief sie zu dem Pkw, ließ sich auf den Beifahrersitz fallen und sagte: »Fahr los!«
Am Steuer des Renaults saß Gilberte, eine Neunzehnjährige mit langen, dunklen Haaren. Hübsch, aber doof. Flick hatte keine Ahnung, warum sie bei der Résistance war – ein typisches Mitglied der Widerstandsbewegung war sie jedenfalls nicht. Anstatt loszufahren, fragte sie zurück: »Wohin?«
»Ich sag’s dir schon – aber jetzt fahr endlich, um Himmels willen!«
Gilberte legte den ersten Gang ein und fuhr los.
»Erste links, dann die nächste rechts«, sagte Flick.
In den folgenden zwei Minuten, in denen sie zur Untätigkeit verdammt war, kam Flick erstmals das volle Ausmaß ihrer Niederlage zu Bewusstsein. Die Bollinger-Gruppe war weitgehend ausgelöscht. Albert und viele andere waren tot; Geneviève, Bertrand und wer sonst vielleicht noch am Leben geblieben war – sie alle würden vermutlich gefoltert werden.
Und es war alles umsonst gewesen. Die Fernmeldezentrale war unversehrt geblieben, die deutschen Nachrichtenverbindungen funktionierten genauso gut wie vorher. Flick kam sich unnütz und überflüssig vor. Was war nur schief gegangen? War es ein Fehler gewesen, eine bewachte militärische Einrichtung frontal anzugreifen? Nicht unbedingt – der Plan hätte funktionieren können, wenn der MI6 präzisere Informationen geliefert hätte. Trotzdem wäre die Chance, an die entscheidenden technischen Installationen heranzukommen, größer gewesen, wenn sich die Résistance mit irgendwelchen Tricks in das Gebäude eingeschlichen hätte.
Gilberte hielt vor dem Gartentor. »Wende inzwischen«, sagte Flick und sprang hinaus.
Michel lag bäuchlings auf Antoinettes Sofa und bot mit seinen heruntergezogenen Hosen einen würdelosen Anblick. Antoinette kniete neben ihm, in der Hand ein blutiges Handtuch. Sie trug jetzt eine Brille und betrachtete Michels Kehrseite. »Die Blutung hat nachgelassen«, sagte sie, »aber die Kugel steckt noch immer in der Wunde.«
Auf dem Boden neben dem Sofa stand ihre Handtasche, deren Inhalt sie offenbar bei der Suche nach ihrer Brille auf ein Beistelltischchen gekippt hatte. Flick fiel eine Art Ausweis ins Auge. Er steckte in einer kleinen Hülle aus Pappe und war abgestempelt. Ein Foto von Antoinette war eingeklebt, der Text mit Schreibmaschine getippt. Es handelte sich um den Passierschein, der Antoinette das Betreten des Schlosses gestattete. Eine vage Idee schoss Flick durch den Kopf.
»Draußen wartet ein Wagen«, sagte sie.
Antoinette betrachtete noch immer die Wunde. »Eigentlich ist er nicht transportfähig.«
»Wenn er hier bleibt, bringen die Boches ihn um.« Wie beiläufig nahm Flick den Passierschein in die Hand und fragte dabei Michel: »Wie geht es dir?«
»Ich kann jetzt vielleicht gehen«, sagte er. »Der Schmerz ist nicht mehr ganz so schlimm.«
Flick ließ den Passierschein in ihre Tasche gleiten, ohne dass Antoinette davon etwas mitbekam. »Helfen Sie mir, ihn aufzurichten«, forderte Flick sie auf.
Die beiden Frauen stellten Michel auf die Füße. Antoinette zog ihm die blauen Leinenhosen hoch und schnallte den abgetragenen Ledergürtel zu.
»Bleiben Sie im Haus«, sagte Flick zu Antoinette. »Ich möchte nicht, dass Sie mit uns zusammen gesehen werden.« Sie hatte noch nicht weiter über ihren Einfall nachgedacht, doch eines wusste sie jetzt schon: Wenn auch nur die Spur eines Verdachts auf Antoinette und ihre Reinigungskolonne fiel, war alles für die Katz.
Michel legte ihr einen Arm um die Schulter, stützte sich schwer auf sie und humpelte mit ihrer Hilfe hinaus auf die Straße. Bis sie den Renault erreichten, hatte der Schmerz ihm alle Farbe aus dem Gesicht getrieben. Gilberte starrte ihnen voller Entsetzen durch die Windschutzscheibe entgegen. »Steig aus und mach die verdammte Tür auf, du Tranfunzel!«, fauchte Flick. Gilberte sprang aus dem Wagen und riss die Tür zum Fond auf. Mit vereinten Kräften gelang es ihnen, Michel auf den Rücksitz zu verfrachten.
Dann ließen sie sich auf die Vordersitze fallen. »Und jetzt weg von hier«, sagte Flick.
Dieter Franck war entsetzt und zutiefst bestürzt. Als die Schießerei allmählich abebbte und sein Herzschlag sich wieder normalisierte, begann er über das soeben Erlebte nachzudenken. Einen so gut geplanten und überlegt durchgeführten Anschlag hätte er der Résistance nicht zugetraut. Nach allem, was er in den vergangenen Monaten in Erfahrung gebracht hatte, hielt er sie für unfähig, mehr als nur ganz banale Überfälle zu verüben. Allerdings war dies der erste Anschlag, den er persönlich miterlebt hatte. An Waffen und Munition fehlte es diesen Widerstandskämpfern – ganz im Gegensatz zur deutschen Wehrmacht – gewiss nicht! Am schlimmsten aber war: Die Angreifer waren verdammt couragiert gewesen. Beeindruckend dieser Mann mit dem Gewehr, der plötzlich über den Platz gerannt war, aber auch die junge Frau mit der Sten-MP, die ihm Feuerschutz gegeben hatte, und ganz besonders die kleine Blonde, die den verwundeten Schützen geborgen und aus der Gefahrenzone geschleppt hatte – einen Mann, der gut fünfzehn Zentimeter größer war als sie! Solche Leute stellten zweifellos eine ernste, wachsende Bedrohung für die Besatzungstruppen dar und waren von anderem Kaliber als die Kriminellen, mit denen es Franck vor dem Krieg als Polizist in Köln zu tun gehabt hatte. Kriminelle waren dumm, faul, feige und brutal. Diese französischen Widerständler waren echte Kämpfer.
Doch dank ihrer Niederlage eröffnete sich ihm nun eine Chance, wie er sie nicht alle Tage bekam.
Als er sicher war, dass keine Schüsse mehr fallen würden, rappelte er sich auf und half auch Stéphanie wieder auf die Füße. Ihre Wangen waren gerötet, und ihr Atem ging schwer. Sie hielt seine Hände und sah ihm ins Gesicht. »Du hast mich beschützt«, sagte sie, und Tränen stiegen ihr in die Augen. »Du hast mich mit deinem Körper abgeschirmt.«
Er wischte Straßenstaub von ihrer Hüfte. Seine Ritterlichkeit überraschte ihn selbst. Er hatte rein instinktiv gehandelt. Wenn er genauer darüber nachdachte, kamen ihm durchaus Zweifel, ob er tatsächlich bereit gewesen wäre, sein Leben für Stéphanie zu opfern. Er versuchte, die Sache leichthin abzutun. »Einem so vollendeten Körper sollte kein Schaden zugefügt werden«, sagte er.
Stéphanie fing an zu weinen.
Er nahm sie an der Hand und führte sie über den Platz zum Tor. »Gehen wir rein«, sagte er. »Da kannst du dich für ein Weilchen setzen.« Sie betraten das Schlossgelände. Ein Loch in der Kirchenmauer fiel Franck ins Auge. Jetzt wusste er, wie der Stoßtrupp hereingekommen war.
Die Männer von der Waffen-SS hatten das Château inzwischen verlassen und waren gerade dabei, die Angreifer zu entwaffnen. Franck sah sich die verbliebenen Widerstandskämpfer genau an. Die meisten waren tot, einige nur verwundet, ein oder zwei schienen sich unverletzt ergeben zu haben. Immerhin: ein paar, die man verhören konnte.
Bisher war seine Arbeit defensiv angelegt gewesen. Er hatte nicht viel mehr tun können, als die Sicherheitsvorkehrungen bei bestimmten Schlüsseleinrichtungen zu verstärken. Zwar gab es hie und da einen Gefangenen zu verhören, doch war dabei bisher kaum etwas herausgekommen. Aber mehrere Gefangene, die offensichtlich alle ein und derselben gut organisierten Zelle angehörten – das war schon etwas anderes.
Jetzt kann ich vielleicht endlich mal in die Offensive gehen, dachte er in gespannter Erwartung.
»He, Sie da!«, rief er einem SS-Mann zu. »Holen Sie einen Arzt für die Gefangenen! Ich will sie verhören. Und sorgen Sie dafür, dass sie am Leben bleiben, alle!«
Obwohl Dieter Franck keine Uniform trug, schloss der SS--Mann aus seinem Auftreten, dass er einen höheren Offizier vor sich hatte, und sagte: »Jawohl. Wird gemacht.«
Franck führte Stéphanie die Treppe hinauf und durch den prunkvollen Eingang in die große Empfangshalle. Ein atemberaubender Anblick bot sich ihnen: Der Boden bestand aus rosa Marmor, die hohen Fenster waren mit erlesenen Vorhängen versehen, die Wände mit Stukkaturen etruskischer Motive in matten Grün- und Rosatönen verziert, die Decke schmückten aufgemalte Engel, die schon etwas verblasst waren. Früher waren die Räume sicher fantastisch möbliert, dachte Franck: kleine Tischchen oder Konsolen unter hohen Spiegeln, Kredenzen mit Messingbeschlägen, zierliche Stühle mit vergoldeten Beinen, Ölgemälde, riesige Vasen, Marmorstatuetten … Von all der Pracht war natürlich nichts übrig geblieben. Stattdessen reihenweise Schalttafeln, und vor jeder stand ein Stuhl. Das Kabelknäuel auf dem Boden sah aus wie ein Schlangennest.
Die Telefonistinnen und Funker schienen im hinteren Teil des Schlossparks Zuflucht gesucht zu haben. Nun, da die Schießerei vorüber war, standen einige von ihnen vor den verglasten Türen und waren sich offenbar noch nicht schlüssig, ob sie das Gebäude schon wieder gefahrlos betreten konnten. Manche trugen noch ihre Kopfhörer oder Brustmikrofone. Franck setzte Stéphanie an eines der Schaltbretter und winkte eine Telefonistin mittleren Alters herbei. »Madame«, sagte er in höflichem, aber bestimmtem Ton auf Französisch, »bitte bringen Sie der Dame eine Tasse heißen Kaffee.«
Die Frau kam, warf Stéphanie einen hasserfüllten Blick zu und sagte: »Sehr wohl, der Herr.«
»Und einen Cognac bitte. Sie steht unter Schock.«
»Cognac gibt’s keinen.«
Natürlich gab es Cognac – nur hatte sie keine Lust, der Geliebten eines Deutschen einen zu bringen. Franck wollte sich in diesem Punkt auf keinen Streit einlassen. »Dann eben nur Kaffee«, sagte er. »Aber ein bisschen dalli, sonst gibt’s Ärger.«
Er tätschelte Stéphanie die Schulter und ließ sie allein. Durch hohe Doppeltüren betrat er den Ostflügel, wo sich nach dem Vorbild von Versailles ein Salon an den anderen reihte. Alle Räume steckten voller Schalttafeln, nur wirkten diese hier mehr für die Dauer installiert, und die zu Bündeln zusammengefassten Kabel waren in ordentlichen, mit Holz verkleideten Schächten verlegt, die durch Löcher im Fußboden in den darunter liegenden Keller führten. Franck folgerte, dass es sich bei der Unordnung in der Empfangshalle um Notfallmaßnahmen handeln musste, die nach der Bombardierung des Westflügels erfolgt waren. Einige Fenster waren zur Vorbeugung gegen mögliche Luftangriffe dauerhaft verdunkelt, bei anderen jedoch waren die schweren Vorhänge aufgezogen. Franck nahm an, dass die Frauen nicht gerne in permanenter Dunkelheit arbeiteten.
Am Ende des Ostflügels kam Franck zu einem Treppenhaus und ging hinab in den Keller. Am Fuß der Treppe befand sich eine Stahltür, gleich dahinter standen ein kleiner Schreibtisch und ein Stuhl, auf dem normalerweise vermutlich ein Wachtposten saß. Wahrscheinlich hatte er seinen Platz verlassen, um in das Gefecht einzugreifen. Wie dem auch sein mochte – Franck konnte den Keller unkontrolliert betreten und registrierte in Gedanken einen weiteren Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften.
Hier unten sah es anders aus als in den repräsentativen Räumlichkeiten der Hauptgeschosse. Die Erbauer des Schlosses hatten hier Küchen- und Vorratsräume sowie Quartiere für das vielköpfige Personal vorgesehen, das vor dreihundert Jahren im Dienste der Schlossherren stand. Die Decken waren niedrig, die Wände kahl, der Fußboden bestand aus einfachen Steinfliesen oder sogar nur aus gestampfter Erde. Franck setzte seinen Weg durch einen breiten Korridor fort. Obwohl jede Tür mit einer Dienststellenbezeichnung in gestochener deutscher Schrift gekennzeichnet war, warf er überall kurz einen Blick hinein. Links von ihm, zur Vorderseite des Gebäudes hin, war die komplizierte Technik einer großen Fernmeldezentrale untergebracht: ein Generator, riesige Batterien, mehrere Zimmer mit unzähligen unübersichtlichen Kabelsträngen. Auf der rechten Seite waren die Räume der Gestapo: ein Fotolabor, ein großer Abhörraum zur Überwachung des Funkverkehrs der Résistance sowie mehrere Haftzellen mit Gucklöchern in den Türen. Der Keller war bombensicher: Die Fenster waren verrammelt, die Wände mit Sandsäcken gesichert und die Decken mit Stahlbeton verstärkt. All dies diente eindeutig dem Zweck, die Ausschaltung des Telefonnetzes durch die Bomber der Alliierten zu verhindern.