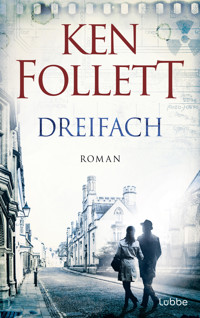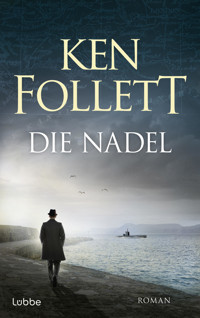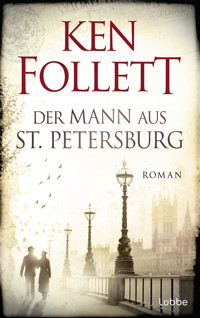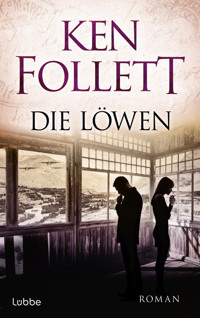Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die junge Engländerin Dee und ihr amerikanischer Freund Mike stoßen in Paris auf die Spur eines verschwundenen Meisterwerkes - ein Bild des berühmten Malers Amedeo Modigliani. Aber es machen noch andere Jagd auf die kostbare Beute, und sie schrecken vor nichts zurück. Diebstahl, Betrug und vielleicht Mord sind im Spiel. Und keiner weiß: Gibt es den Modigliani wirklich? Und wenn ja, ist er echt?
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:4 Std. 42 min
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
Teil Eins – Grundieren der Leinwand
1
2
3
4
5
Teil Zwei – Die Landschaft
6
7
8
9
10
Teil Drei – Figuren im Vordergrund
11
12
13
14
15
Teil Vier – Der Firnis
16
17
18
19
20
KEN FOLLETT
Der Modigliani Skandal
Aus dem Englischenvon Günter Panske
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der Originalausgabe: The Modigliani Scandal
© 1976 by Zachary Stone
© für die Einleitung 1976 by Holland Copyright Corporation
© der Originalausgabe 1976 by Collins & Sons & Co. Ltd.
© 1988 für die deutschsprachige Ausgabe by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München, unter Verwendung von Motiven von © shutterstock: javarman| isaravut | Undrey | Aleshyn_Andrei; © getty-images: Steve Fleming
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0350-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
VORWORT
IN EINEM MODERNEN Thriller rettet der Held gewöhnlich die Welt. Traditionelle Abenteuergeschichten sind da bescheidener: Der Protagonist rettet sein eigenes Leben und vielleicht noch das eines treuen Freundes oder einer betörenden Schönen. In weniger sensationellen Romanen – in jenen normalen, gut erzählten Geschichten, die über ein Jahrhundert lang die gängige Kost der Leser waren – steht zwar weniger auf dem Spiel, aber auch dort sind es die Anstrengungen, Kämpfe und Entschlüsse der handelnden Person, die auf dramatische Weise über ihr – oder sein – Schicksal entscheiden.
Ich glaube nicht, daß das im wirklichen Leben so ist. Hier entscheiden im allgemeinen Umstände, über die wir keinerlei Kontrolle haben, ob wir leben oder sterben, glücklich oder unglücklich werden, Reichtümer besitzen oder alles verlieren. Die meisten reichen Menschen erben ihr Geld. Die meisten wohlgenährten Menschen hatten einfach das Glück, in wohlhabenden Ländern zur Welt zu kommen. Die meisten glücklichen Menschen wachsen in liebevollen Familien auf, und die meisten unglücklichen Menschen hatten verrückte Eltern.
Ich bin kein Fatalist, und ich glaube auch nicht, daß alles im Leben blinder Zufall ist. Auch wenn wir unser Leben nicht so kontrollieren, wie ein Schachspieler seine Figuren kontrolliert, so ist das Leben doch kein Roulette. Wie meist ist die Wahrheit kompliziert. Zwar sind es Mechanismen, die wir nicht beherrschen – und manchmal nicht einmal verstehen –, welche das Schicksal eines Menschen bestimmen, doch können die Entscheidungen, die er trifft, Folgen haben, wenn auch vielleicht nicht die von ihm erwarteten.
In Der Modigliani Skandal versuchte ich, eine neue Art von Roman zu schreiben: einen Roman, in welchem die individuelle Freiheit einem stärkeren Gesamtmechanismus auf vielfältigste Weise untergeordnet bleibt. Dieses unbescheidene Projekt zu realisieren ist mir nicht gelungen. Möglicherweise kann ein solcher Roman überhaupt nicht geschrieben werden: Mag’s im Leben auch nicht um individuelle Entscheidungen gehen, so vielleicht doch in der Literatur.
Was ich schließlich zu Papier brachte, war ein Krimi eher heiteren Charakters, in dem eine Anzahl von – meist jungen – Menschen allerlei Wagnisse unternimmt, von denen keins so ganz den erwarteten Ausgang nimmt. Die Kritiker priesen den Roman als munter, sprudelnd, beschwingt, leicht, überschäumend und – abermals – leicht. Ich war darüber enttäuscht, daß sie meine ernsten Intentionen nicht bemerkt hatten.
Inzwischen betrachte ich das Buch nicht länger als Fehlschlag. Es hat etwas Überschäumend-Durcheinandersprudelndes, und das nicht zu seinem Nachteil. Die Tatsache, daß es so ganz anders ist als das Buch, das ich eigentlich schreiben wollte, hätte mich nicht verwundern sollen – ist doch gerade dies ein Beweis für meine Behauptung.
Ken Follett, 1985
TEIL EINS
Grundieren der Leinwand
»Man heiratet die Kunst nicht. Man nimmt sie.«
Edgar Degas, Impressionist, Maler
1
DER BÄCKER KRATZTE sich mit mehlbestäubtem Zeigefinger am Schnurrbart, so daß sich seine schwarzen Haare grau färbten und er plötzlich zehn Jahre älter aussah. In den Regalen rings um ihn stapelten sich frische, krustige Brote, und der vertraute Geruch füllte seine Nasenlöcher und ließ seine Brust anschwellen in ruhig-zufriedenem Stolz. Es war ein neuer Schub Brot, der zweite an diesem Morgen: Das Geschäft ging gut, weil das Wetter schön war. Wenn die Sonne schien, zog es die Pariser Hausfrauen unwiderstehlich zu seinem Laden, zu seinem ausgezeichneten Brot.
Er blickte durch das Ladenfenster hinaus, seine Augen blinzelten im blendend hellen Licht. Ein hübsches Mädchen überquerte die Straße. Der Bäcker lauschte: Von hinten erklang die schrille Stimme seiner Frau, die einen Lehrling herunterputzte. Das würde noch minutenlang so gehen, wie stets – also war er vor ihr sicher, und so gönnte er sich ein paar lüsterne Blicke auf das hübsche Mädchen.
Es trug ein dünnes ärmelloses Sommerkleid, das nicht gerade billig zu sein schien; allerdings kannte sich der Bäcker in solchen Dingen wenig aus. Anmutig bauschte sich der Rock in halber Höhe ihrer Oberschenkel, was ihre schlanken, nackten Beine besonders zur Geltung brachte und lohnende Blicke auf weibliche Unterwäsche verhieß – eine unerfüllte Hoffnung.
Für meinen Geschmack ist sie allzu schlank, befand er, während sie näher kam. Ihr Brüste waren sehr klein – trotz ihrer langen, selbstsicheren Schritte hüpften sie kein bißchen. Selbst nach seiner zwanzigjährigen Ehe mit Jeanne-Marie zog der Bäcker ihre großen, wenn auch etwas schlaffen Brüste entschieden vor.
Das Mädchen betrat den Laden, und der Bäcker sah, daß sie keine Schönheit war. Ihr Gesicht war lang und dünn, ihr Mund wirkte klein und eher spröde, und ihre Schneidezähne standen ein wenig vor. Sie hatte braunes Haar, doch war die oberste Schicht von der Sonne ausgeblichen.
Sie wählte eine der Baguettes auf dem Ladentisch aus, prüfte die Kruste mit ihren langen Händen und nickte zufrieden. Nein, keine Schönheit, dachte der Bäcker, jedoch unbedingt begehrenswert.
Sie hatte einen Teint wie Milch und Blut, und ihre Haut wirkte weich und glatt. Was indes die Blicke auf sie lenkte, war ihre Haltung: selbstsicher, selbstbewußt. Diese verriet der Welt, daß die junge Frau genau das tat, was sie tun wollte, und nichts sonst. Der Bäcker verbot sich solche Spitzfindigkeiten: Sie war sexy, und das war alles.
Er bewegte die Schultern, um das Hemd zu lockern, das ihm am schweißnassen Rücken klebte. »Chaud, hein?« sagte er.
Das Mädchen entnahm ihrer Börse ein paar Münzen, um das Brot zu bezahlen. Sie lächelte über seine Bemerkung, und plötzlich war sie schön. »Le soleil? Je l’aime«, sagte sie und ging zur Ladentür. »Merci!« fügte sie hinzu.
Der Bäcker glaubte, einen Akzent herauszuhören – einen englischen Akzent. Aber vielleicht bildete er sich das nur ein, weil das irgendwie zu ihrem Teint paßte. Während sie die Straße überquerte, starrte er auf ihr Hinterteil, fasziniert von der Muskelbewegung unter dem Baumwollstoff. Wahrscheinlich kehrte sie jetzt zurück in die Wohnung irgendeines jungen, wildmähnigen Musikers, der nach einer Nacht voller Ausschweifungen noch immer im Bett lag.
Die schrille Stimme von Jeanne-Marie näherte sich und ließ die Phantasien des Bäckers in tausend Stücke springen. Er seufzte tief und warf die Münzen in die Ladenkasse.
Dee Sleign mußte unwillkürlich lächeln, als sie die Bäckerei verließ. Die Legende entsprach der Wahrheit: Franzosen waren sinnlicher als Engländer. Der Bäcker hatte sie mit unverhohlen lüsternen Blicken betrachtet, die Augen präzise auf ihr Becken gerichtet. Ein englischer Bäcker würde äußerstenfalls verstohlen nach ihren Brüsten gespäht haben.
Sie kippte ihren Kopf ein wenig in den Nacken und strich sich das Haar hinter die Ohren zurück, um die warme Sonne auf ihrem Gesicht zu fühlen. Einfach wunderbar, dieses Leben, dieser Sommer in Paris. Keine Arbeit, kein Examen, keine Vorlesungen. Statt dessen: mit Mike schlafen, spät aufstehen; guter Kaffee und frisches Brot zum Frühstück; ausgiebig Zeit, um Bücher zu lesen und Gemälde zu betrachten; Abende mit interessanten, exzentrischen Menschen.
Bald würde es damit vorbei sein. Bald schon würde sie sich entscheiden müssen, welchen Weg sie für ihr künftiges Leben einschlagen wollte. Momentan jedoch befand sie sich in einer Art von privatem Zwischenreich: Sie konnte die Dinge, die sie mochte, genießen, ohne in das Joch eines strikten Tagesablaufs eingespannt zu sein.
Sie bog um eine Straßenecke und betrat ein kleines, unauffälliges Wohnhaus. Als sie an der Loge mit dem winzigen Fenster vorbeiging, ertönte die schrille Stimme der Concierge.
»Mademoiselle!«
Die grauhaarige Frau sprach jede Silbe deutlich aus und verstand es, dem Wort einen anklagenden Klang zu geben: Sie verkündete der Welt die skandalöse Tatsache, daß Dee mit dem Mann, dem die Wohnung gehörte, nicht verheiratet war. Dee mußte wieder lächeln. Eine Liebesaffäre in Paris ohne eine moralinsaure Concierge – da hätte irgendwas gefehlt.
»Télégramme«, sagte die Frau. Sie legte einen Umschlag auf das Fensterbrett und zog sich wieder in ihre düstere, nach Katzen riechende Loge zurück: schob gleichsam eine Trennwand zwischen sich und dieses junge Mädchen mit der lockeren Moral und dem dubiosen Telegramm.
Dee nahm den Umschlag und lief die Treppe hinauf. Das Telegramm war an sie gerichtet, und sie wußte, was es enthielt.
Sie betrat die Wohnung und legte in der kleinen Küche das Brot und das Telegramm auf den Tisch. Dann schüttete sie Kaffeebohnen in eine elektrische Kaffeemühle und drückte auf den Knopf; die Maschine setzte sich in Bewegung und begann knirschend, die braunschwarzen Bohnen zu mahlen.
Wie zur Antwort surrte plötzlich Mikes elektrischer Rasierapparat. Mitunter war die Aussicht auf eine Tasse Kaffee das einzige, was ihn aus dem Bett locken konnte. Dee brühte eine ganze Kanne auf und schnitt die frischen Baguetten in Scheiben.
Mikes Wohnung war klein und recht altmodisch und unattraktiv möbliert. Er hatte sich etwas Besseres gewünscht und hätte sich das zweifellos auch leisten können. Dee jedoch hatte darauf bestanden, daß sie sich von Hotels und vornehmen Wohnvierteln fernhielten. Sie wollte den Sommer mit Franzosen verbringen, nicht mit dem internationalen Jetset; und sie hatte ihren Kopf durchgesetzt.
Das Surren des Rasierers verstummte, und Dee füllte zwei Kaffeetassen.
Während sie die Tassen auf den runden Holztisch stellte, kam Mike herein. Er trug seine ausgeblichenen, geflickten Jeans und ein blaues, am Halse offenes Baumwollhemd, das den Blick freigab auf ein Büschel schwarzer Haare und ein Medaillon an einer kurzen Silberkette.
»Guten Morgen, Liebling«, sagte er. Er kam um den Tisch herum und küßte sie. Sie schlang die Arme um seine Taille, zog ihn dicht an sich und küßte ihn leidenschaftlich.
»Wow! Ganz schön wild für den frühen Morgen«, sagte er und bedachte sie mit einem breiten kalifornischen Lächeln, während er Platz nahm.
Dee betrachtete den Mann, der jetzt behaglich seinen Kaffee schlürfte; und unwillkürlich fragte sie sich, ob sie sich wünschte, ihr ganzes Leben mit ihm zu verbringen. Seit einem Jahr hatte sie ein Verhältnis mit ihm, und sie begann, sich daran zu gewöhnen. Sie mochte seinen Zynismus, seinen Sinn für Humor, seine irgendwie »freibeuterische« Art.
Beide interessierten sie sich bis zur Besessenheit für Kunst; allerdings richtete sich sein Interesse auf das Geld, das mit Hilfe der Kunst zu machen war, während Dee sich gefesselt fühlte vom Warum und Wofür des schöpferischen Prozesses. Beide stimulierten einander, im Bett ebenso wie außerhalb: Sie bildeten ein gutes Team.
Mike stand auf, goß Kaffee nach und steckte für beide Zigaretten an. »Du bist so still«, sagte er in seinem breiten Amerikanisch. »Denkst du an die Prüfungsergebnisse? Die müßten doch langsam fällig sein.«
»Sie sind heute gekommen«, erwiderte sie. »Aber ich habe das Telegramm noch nicht geöffnet.«
»Was? He, nun mach schon, ich will wissen, wie du abgeschnitten hast.«
»Meinetwegen.« Sie holte den Umschlag und setzte sich wieder, bevor sie ihn mit dem Daumen aufriß. Sie entfaltete das Papier, das der Umschlag enthielt, warf einen Blick darauf und sah dann Mike mit strahlendem Lächeln an.
»Mein Gott, ich habe eine Eins gekriegt«, sagte sie.
Aufgeregt sprang er hoch und schrie: »Yippee! Ich hab’s gewußt! Du bist ein Genie!« Ausgelassen führte er eine Art Solo-Squaredance auf, wobei er unablässig »Yee-hah« rief und die Klänge einer Stahlgitarre zu imitieren versuchte. Mit einer imaginären Partnerin hüpfte er in der Küche umher.
Dee schüttelte sich vor Gelächter. »Du bist doch der kindischste Fast-Vierziger, der mir je über den Weg gelaufen ist«, sagte sie atemlos. Mike verbeugte sich vor einem imaginären, wild applaudierenden Publikum und nahm wieder Platz.
Er sagte: »So. Was bedeutet dies für deine Zukunft?«
Dee wurde wieder ernst. »Es bedeutet, daß ich meinen Ph. D. machen kann, meinen Doktor.«
»Was, noch mehr akademische Grade? Du hast jetzt deinen Bachelor of Arts in Kunstgeschichte – außer deinem Diplom in Zeichnen, Malen und Bildhauerei. Wär’s nicht langsam an der Zeit, daß du aufhörst, so eine Art Berufsstudent zu sein?«
»Weshalb sollte ich? Studieren ist mein Hobby – und wenn man bereit ist, mich für den Rest meines Lebens fürs Studium zu bezahlen, warum sollte ich das nicht tun?«
»Die werden dir nicht viel zahlen«
»Das stimmt.« Dee sah nachdenklich aus. »Und ich würde gern ein Vermögen machen, irgendwie. Aber ich hab ja noch viel Zeit. Ich bin doch erst fünfundzwanzig.«
Mike streckte seinen Arm über den Tisch und griff nach ihrer Hand. »Wie wär’s, wenn du für mich arbeiten würdest? Ich zahle dir ein Vermögen – du wärst es wert.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich möchte nicht auf deinem Rücken reiten. Ich möchte es allein schaffen.«
»Aber vorn reitest du sehr gern auf mir«, sagte er mit einem Grinsen.
Sie lächelte entzückt. »Kannst drauf wetten«, sagte sie, seinen amerikanischen Akzent imitierend. Dann zog sie ihre Hand zurück. »Nein, ich werde meine Dissertation schreiben. Falls sie veröffentlicht wird, könnte ich dadurch sogar etwas Geld verdienen.«
»Wie lautet das Thema?«
»Nun, ich habe mit mehreren geliebäugelt. Das lohnendste scheint mir die Beziehung zwischen Kunst und Drogen zu sein.«
»Trendgemäß.«
»Und originell. Ich glaube, ich könnte zeigen, daß Drogenmißbrauch meist gut für die Kunst und schlecht für den Künstler ist.«
»Ein hübsches Paradox. Wo willst du anfangen?«
»Hier. In Paris. In den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts hat man in der Künstlergemeinde Pot geraucht. Nur nannten die das damals Haschisch.«
Mike nickte. »Würdest du ein wenig Hilfe von mir annehmen, gleich am Anfang?«
Dee griff nach den Zigaretten und nahm eine. »Sicher«, sagte sie.
Quer über den Tisch hielt er ihr sein Feuerzeug hin. »Ich kenne einen alten Mann, mit dem du sprechen solltest. War hier vor dem Ersten Weltkrieg mit einem halben Dutzend der Meister befreundet. Ein paarmal hat er mich auf die Spur von Bildern gebracht. Er war so eine Art Gelegenheitskrimineller, hat aber auch jungen Malern Prostituierte als Modelle verschafft – und noch so manches andere. Ist schon ziemlich alt. Aber er erinnert sich.«
*
In der winzigen Wohnstube roch es übel. Der Fischgeruch vom Laden darunter schien alles zu durchdringen; er fraß sich gleichsam durch die kahlen Fußbodenbretter und ätzte sich ein in das zerstoßene Mobiliar, in die Wäsche auf dem Bett in der Ecke, in die verblichenen Vorhänge an dem einzigen kleinen Fenster. Der Rauch aus der Pfeife des alten Mannes konnte den Fischgeruch nicht überdecken; und geprägt war das Ganze von der Atmosphäre eines Zimmers, das nur selten gesäubert wird.
An den Wänden jedoch hing ein Vermögen in Form postimpressionistischer Gemälde.
»Sämtlich Geschenke der Künstler an mich«, erklärte der alte Mann mit unverkennbarem Stolz. Dee mußte sich konzentrieren, um sein Pariser Französisch zu verstehen. »Die konnten ja nie ihre Schulden bezahlen. Ich nahm die Gemälde, weil ich wußte, daß sie niemals das Geld haben würden. Damals haben mir die Bilder nie gefallen. Jetzt verstehe ich, warum die so gemalt haben, und es gefällt mir. Außerdem bringen die Bilder Erinnerungen zurück.«
Der Alte war kahlköpfig, seine Gesichtshaut schlaff und bleich. Er war kleinwüchsig und konnte nur mit Mühe gehen; doch in seinen kleinen schwarzen Augen blitzte mitunter so etwas wie Enthusiasmus auf. Unverkennbar fühlte er sich verjüngt durch die Gegenwart dieser hübschen Engländerin, die so ausgezeichnet Französisch sprach und ihn anlächelte, als sei er wieder ein junger Mann.
»Werden Sie nicht von Leuten belästigt, die Ihnen die Bilder abkaufen wollen?« fragte Dee.
»Jetzt nicht mehr. Ich bin immer bereit, sie auszuleihen, gegen Gebühr.« Er zwinkerte. »Dafür kann ich mir dann Tabak kaufen«, fügte er hinzu und hob seine Pfeife, als wolle er einen Toast ausbringen.
Plötzlich wurde Dee bewußt, daß da noch ein Geruch war außer dem des Tabaks: dem Gemisch in der Pfeife des Alten war Cannabis beigemengt. Sie nickte kundig.
»Möchten Sie was davon? Ich habe Zigarettenpapier«, bot er ihr an.
»Gerne.«
Er reichte ihr eine Tabaksdose, etwas Zigarettenpapier und einen kleinen harzartigen Klumpen, und sie begann, sich einen Joint zu rollen.
»Ach, ihr jungen Mädchen«, sagte der Alte grübelnd. »Drogen sind für euch wirklich schlecht. Ich sollte die Jugend nicht verderben. Da, ich hab’s mein ganzes Leben getan, und jetzt bin ich zu alt, um’s zu ändern.«
»Sie haben’s damit zu einem langen Leben gebracht«, sagte Dee.
»Wahr, sehr wahr. Ich werde dieses Jahr neunundachtzig, wenn ich mich nicht irre. Siebzig Jahre lang habe ich tagtäglich meinen Spezialtabak geraucht, außer im Gefängnis natürlich.«
Dee fuhr mit der Zunge über das gummierte Papier, und der Joint war fertig. Sie zündete ihn mit einem winzigen goldenen Feuerzeug an und inhalierte. »Haben die Maler viel Haschisch konsumiert?« fragte sie.
»O ja. Ich habe an dem Zeug ein Vermögen verdient. Manche gaben ihr ganzes Geld dafür aus.« Er blickte zu einer Bleistiftskizze an der Wand, einem flüchtig hingeworfenen Frauenkopf: ein ovales Gesicht und eine lange, dünne Nase. »Dedo war der Schlimmste«, fügte er mit einem verträumten Lächeln hinzu.
Dee entzifferte die Signatur auf der Zeichnung. »Modigliani?«
»Ja.« Die Augen des alten Mannes sahen jetzt nur die Vergangenheit, und er sprach wie zu sich selbst. »Er trug immer eine braune Kordjacke und einen großen Schlapphut aus Filz. Und er pflegte zu sagen, daß Kunst wie Haschisch sein sollte: Sie sollte Menschen die Schönheit in Dingen zeigen, die Schönheit, die sie normalerweise nicht sehen könnten. Er trank auch, und zwar um die Häßlichkeit in Dingen zu sehen. Aber Haschisch liebte er. Es war traurig, daß er sich deshalb solche Gewissensbisse machte. Er muß wohl sehr streng erzogen worden sein. Auch war seine Gesundheit nicht allzu stabil, so daß er sich wegen der Drogen Sorgen machte. Er machte sich Sorgen und gebrauchte sie trotzdem.«
Der alte Mann lächelte und nickte; er schien seinen Erinnerungen gleichsam zuzustimmen.
»Er wohnte im Impasse Falguière. Bettelarm war er, und mit der Zeit war er richtig ausgemergelt. Ich erinnere mich, wie er die Ägyptische Abteilung im Louvre besuchte – als er zurückkam, erklärte er, das sei die einzige wirklich sehenswerte Abteilung!«
Der Alte lachte zufrieden. »Ein melancholischer Mensch, o ja«, fuhr er fort, und seine Stimme klang jetzt ernster. »Immer trug er Les Chants de Maldoror in einer Tasche mit sich: Er konnte viele französische Gedichte rezitieren. Gegen Ende seines Lebens kam der Kubismus in Mode. Doch so was war und blieb ihm fremd. Hat ihn möglicherweise sogar umgebracht.«
Dee sprach sehr sachte; sie wollte die Erinnerungen des alten Mannes in die gewünschte Richtung lenken, ohne daß sein Gedankengang plötzlich abbrach. »Hat Dedo jemals gemalt, während er high war?«
Der Alte lachte unbeschwert. »O ja«, sagte er. »Wenn er sich im Rausch befand, malte er sehr schnell, während er unentwegt rief, daß dies sein Meisterstück werden würde, sein chef-d’œvre; daß ganz Paris endlich begreifen würde, was malen eigentlich bedeutete. Er wählte die leuchtendsten Farben aus und warf sie auf die Leinwand. Wenn seine Freunde ihm sagten, es sei ein schlechtes Bild, einfach abscheulich, so erwiderte er, sie sollten verschwinden, sie seien zu dumm, um zu begreifen, daß dies die Malerei des 20. Jahrhunderts sei. Aber wenn er dann wieder bei sich war, gab er ihnen recht und schleuderte das Bild in eine Ecke.« Der Alte zog an seiner Pfeife, bemerkte, daß sie ausgegangen war, und suchte nach Streichhölzern.
Dee beugte sich auf ihrem Stuhl vor; den Joint zwischen ihren Fingern hatte sie vergessen. Ihre Stimme klang drängend, fast beschwörend.
Sie fragte: »Was ist aus jenen Bildern geworden?«
Heftig sog er, bis die Pfeife wieder zu qualmen begann, allmählich glitt er wieder in seinen traumähnlichen Zustand zurück. »Armer Dedo«, sagte er. »Konnte die Miete nicht bezahlen. Wußte nicht, wohin er sich wenden sollte. Der Wirt gab ihm zur Räumung eine Frist von vierundzwanzig Stunden. Dedo versuchte, ein paar Bilder zu verkaufen, aber die wenigen Leute, die sehen konnten, wie gut sie waren, hatten nicht mehr Geld als er selbst.
Er mußte zu einem der anderen ziehen – zu wem, weiß ich nicht mehr. Da war kaum Platz für Dedo, von seinen Gemälden ganz zu schweigen. Jene, die er mochte, lieh er nahen Freunden. Den Rest«, der alte Mann ächzte, als sei die Erinnerung plötzlich zu schmerzhaft. »Ich kann jetzt noch sehen, wie er sie in eine Schubkarre lud und dann mit ihnen die Straße entlangfuhr. Er fuhr in einen Hof, stapelte sie in der Mitte auf einen Haufen und zündete sie an. ›Was kann ich sonst tun?‹ sagte er immer wieder. Ich hätte ihm Geld leihen können, aber er schuldete mir schon zu viel. Trotzdem – als er da so stand und zusah, wie seine Bilder verbrannten, da wünschte ich, ich hätt’s getan. Aber ich war nun mal nie ein Heiliger, in meiner Jugend so wenig wie in meinem Alter.«
»Sämtliche Haschisch-Bilder sind in dem Feuer verbrannt?« fragte Dee fast flüsternd.
»Ja«, sagte der Alte. »Praktisch alle.«
»Praktisch? Hat er ein paar zurückbehalten?«
»Nein, er hat keins behalten. Aber er hatte irgendwem einige gegeben – ich hatte es vergessen, doch unser Gespräch bringt’s wieder zurück. Da war ein Priester, in seiner Heimatstadt, der sich für orientalische Drogen interessierte. Warum weiß ich nicht mehr – war’s ihr medizinischer Wert, ihre spirituelle Wirkung? Irgendwas in der Art. Dedo beichtete dem Geistlichen seine Sucht und erhielt die Absolution. Dann erklärte der Priester, er würde gern die Bilder sehen, die unter dem Einfluß von Haschisch entstanden seien. Dedo schickte ihm ein Gemälde – nur ein einziges, jetzt weiß ich’s wieder.«
Der Joint verbrannte Dee die Finger, und sie ließ ihn in einen Aschenbecher fallen. Der Alte war wieder mit dem Entzünden seiner Pfeife beschäftigt, und Dee erhob sich.
»Vielen Dank, daß Sie so nett waren, mit mir zu sprechen«, sagte sie.
»Mmm.« Der alte Mann war mit seinen Gedanken noch halb in der Vergangenheit. »Hoffentlich hilft Ihnen das bei Ihrer Dissertation«, sagte er.
»Das tut es ganz bestimmt«, versicherte sie. Einem Impuls folgend, beugte sie sich über den Alten auf seinem Stuhl und küßte ihn auf den kahlen Schädel. »Sie sind sehr liebenswürdig gewesen.«
Seine Augen glitzerten. »Es ist lange her, daß mich ein hübsches Mädchen geküßt hat«, sagte er.
»Von alldem, was Sie mir gesagt haben, ist das das einzige, was ich Ihnen nicht glaube«, erwiderte Dee. Sie lächelte ihn wieder an und ging dann durch die Tür hinaus.
Während sie die Straße entlangschritt, mußte sie sich zusammennehmen, um nicht laut zu jubeln. Was für ein Glücksfall! Und das, bevor sie mit der Arbeit überhaupt richtig angefangen hatte! Sie brannte darauf, jemandem davon zu erzählen. Dann fiel ihr plötzlich ein – Mike war fort: für ein paar Tage nach London geflogen. Wem konnte sie sich nur mitteilen?
Spontan kaufte sie in einem Café eine Postkarte. Dann setzte sie sich mit einem Glas Wein an einen Tisch und begann zu schreiben. Das Bild auf der Karte zeigte das Café und eine Ansicht der Straße, in der es sich befand.
Sie nippte an ihrem vin ordinaire, noch nicht ganz sicher, an wen sie ihre Zeilen richten sollte. Eigentlich hätte sie ihre Familie über das Prüfungsergebnis ins Bild setzen müssen. Ihre Mutter würde sich auf ihre ein wenig zerstreute Art erfreut zeigen; in Wirklichkeit wünschte sie sich ihre Tochter als Mitglied jener sterbenden Gesellschaft von Ballbesuchern und Dressurreitern. Den Triumph einer Einser-Benotung würde sie nicht wirklich zu schätzen wissen. Wer aber sonst?
Plötzlich begriff sie, wer sich am meisten für sie freuen würde.
Sie schrieb:
Lieber Onkel Charles, glaub’s oder glaub’s nicht, ich habe eine Eins bekommen!! Noch unglaublicher ist, daß ich jetzt einem verlorenen Modigliani auf der Spur bin!!!
Liebe GrüßeD.
Sie kaufte eine Briefmarke für die Postkarte und warf sie auf dem Rückweg zu Mikes Appartement in einen Briefkasten.
2
ALLER GLANZ SCHEINT aus dem Leben entschwunden, dachte Charles Lampeth, während er es sich auf dem Queen-Anne-Stuhl bequem machte. In diesem Haus, dem Haus seines Freundes, hatten einmal Partys und Bälle stattgefunden, wie man sie heutzutage nur noch in teuren historischen Filmen sah. Wenigstens zwei Premierminister hatten in diesem Raum mit der langen Eichentafel und den stilgemäß getäfelten Wänden diniert. Aber der Raum, das Haus wie auch Lord Cardwell, der Besitzer, gehörten praktisch gleichermaßen einer vergangenen Zeit an.
Lampeth entnahm dem Kistchen, das ihm der Butler darbot, eine Zigarre und ließ sich von dem Bediensteten Feuer geben. Ein Schluck Brandy – von einem bemerkenswert alten Jahrgang – komplettierte sein Wohlbefinden. Das Essen war hervorragend gewesen, die Ehefrauen der beiden Herren hatten sich alter Tradition gemäß zurückgezogen, nunmehr konnte man sich einem Gespräch überlassen.
Der Butler entzündete Lord Cardwells Zigarre und entfernte sich. Eine Weile schmauchten die beiden Männer zufrieden vor sich hin. Sie waren schon so lange miteinander befreundet, daß einem Schweigen zwischen ihnen nichts Peinliches anhaftete. Schließlich war es Cardwell, der sprach.
»Was macht der Kunstmarkt?« fragte er.
Lampeth lächelte zufrieden. »Da herrscht Hochkonjunktur wie seit Jahr und Tag.«
»Ich habe die wirtschaftliche Seite des Kunstmarktes nie begriffen«, sagte Cardwell. »Wie erklärt sich der Boom?«
»Das ist eine komplexe Angelegenheit, wie sich denken läßt«, erwiderte Lampeth. »Angefangen hat’s wohl damit, daß die Amerikaner unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg kunstbewußt wurden. Es war der Mechanismus von Angebot und Nachfrage: Die Preise für die alten Meister gingen raketengleich in die Höhe. Und da es nicht genügend alte Meister gab, um den Bedarf zu decken, richteten die Leute ihr Interesse auf die Modernen.«
Cardwell unterbrach ihn: »Und genau zu diesem Zeitpunkt bist du eingestiegen.«
Lampeth nickte und nippte genießerisch an seinem Brandy. »Als ich unmittelbar nach dem Krieg meine erste Galerie eröffnete, hatte man die größte Mühe, irgendein Bild zu verkaufen, das nach 1900 gemalt worden war. Aber wir waren hartnäckig. Ein paar Leute mochten die Bilder, allmählich stiegen die Preise, und dann traten die Investoren in Aktion. Prompt kletterten die Impressionisten himmelhoch.«
»Ein Haufen Leute hat dabei eine Menge Geld gemacht«, warf Cardwell ein.
»Weniger als man glaubt«, sagte Lampeth. Er schob eine Hand unter sein Doppelkinn, um seine Fliege zu lockern. »Es ist ähnlich wie bei Pferdewetten. Setzt man auf einen fast sicheren Sieger, so stellt sich heraus, daß das auch fast alle anderen getan haben, also springt kaum etwas dabei heraus. Und will man an einem zukunftsträchtigen Vollblüter einen hochkarätigen Anteil erwerben, so muß man dafür so viel auf den Tisch blättern, daß man bei einem Verkauf nur einen geringen Profit macht.
Ähnlich verhält es sich mit Gemälden: Kaufe einen Velasquez, und du wirst garantiert einen Gewinn erzielen. Allerdings ist die Kaufsumme so hoch, daß du mehrere Jahre warten mußt, um einen fünfzigprozentigen Profit zu machen. Die einzigen Leute, die dabei ein Vermögen gewonnen haben, sind jene, die sich die Bilder aus reiner Liebhaberei gekauft hatten und ihren guten Geschmack bestätigt sahen, als der Wert ihrer Sammlungen raketenhaft in die Höhe schnellte. Leute wie du selbst.«
Cardwell nickte, und die wenigen weißen Haarsträhnen auf seinem Kopf bewegten sich leicht. Er zog sich am Ende seiner langen Nase. »Wie hoch schätzt du den derzeitigen Wert meiner Sammlung?«
»Tja, mein Gott.« Lampeth krauste die Stirn und zog seine schwarzen Augenbrauen zusammen. »Das käme nicht zuletzt auf den Verkaufsmodus an. Für eine genaue Wertbestimmung würden Experten eine Woche brauchen.«
»Ein ungefährer Schätzwert würde mir für den Augenblick genügen. Du kennst die Bilder – hast die meisten ja selbst für mich erworben.«
»Gewiß.« Lampeth ließ die zwanzig oder dreißig Gemälde, die sich im Haus befanden, vor seinem inneren Auge Revue passieren – taxierte sie grob, kalkulierte den ungefähren Gesamtbetrag.
»Müßte sich etwa auf eine Million Pfund belaufen«, sagte er schließlich.
Cardwell nickte wieder. »Das entspricht der Summe, die ich selbst veranschlagt habe«, sagte er. »Charlie, ich brauche eine Million Pfund.«
»Guter Gott!« Lampeth setzte sich kerzengerade auf. »Du denkst doch nicht im Ernst daran, deine Sammlung zu verkaufen.«
»Ich fürchte, daß mir keine andere Wahl bleibt«, sagte Cardwell traurig. »Ich hatte gehofft, die Kollektion der Öffentlichkeit hinterlassen zu können, doch die Realitäten des Geschäftslebens haben nun mal Vorrang. Die Firma befindet sich in einer sehr angespannten Lage und benötigt innerhalb der nächsten zwölf Monate eine sehr kräftige Kapitalspritze, wenn sie nicht in Konkurs gehen soll. Du weißt ja, daß ich seit Jahren Teile unseres Grundbesitzes verkauft habe, um flüssig zu bleiben.« Er hob sein Brandyglas und trank einen Schluck.
»Die jungen Haudegen sitzen mir jetzt unmittelbar im Nacken«, fuhr er fort. »Neue Besen fegen durch die Finanzwelt. Unsere Methoden sind überholt. Ich werde ausscheiden, sobald das Unternehmen wieder so erstarkt ist, daß die Führung in andere Hände gelegt werden kann. Soll sich doch einer der jungen Recken seine Sporen verdienen.«
Der Unterton tiefer Resignation, den er aus diesen Worten heraushörte, erzürnte Lampeth. »Junge Recken«, sagte er verächtlich, »deren Zeit wird schon noch kommen.«
Cardwell lachte. »Aber, aber, Charlie. Weißt du, mein Vater war seinerzeit entsetzt, als ich ihm meine Ansicht verkündete, ›in die City zu gehen‹. Ich erinnere mich, wie er zu mir sagte: ›Aber du wirst doch den Titel erben!‹ – als sei das für mich eine Art Tabu, persönlich Geldgeschäfte zu machen. Und du – was hat dein Vater gesagt, als du eine Kunstgalerie eröffnet hast?«
Lampeth ließ ein zögerndes Lächeln sehen. »Er fand, für den Sohn eines Soldaten sei das eine abgeschmackte Beschäftigung.«
»Du siehst also, daß die Welt den jungen Recken gehört. Verkaufe meine Bilder für mich, Charlie.«
»Um Höchstpreise zu erzielen, müßte man die Gemälde als Einzelstücke verkaufen.«
»Du bist der Experte. Irgendwelche Sentimentalitäten meinerseits waren verfehlt.«
»Einige sollte man jedoch unbedingt für eine Ausstellung beisammenhalten. Mal sehen: ein Renoir, zwei Degas, ein paar Pisarros, drei Modiglianis … muß mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Der Cézanne gehört natürlich auf eine Auktion.«
Cardwell erhob sich, ein großer Mann von fast einsneunzig. »Nun, halten wir uns nicht länger mit der Leiche auf. Stoßen wir lieber zu den Ladys, wie?«
Die Belgrave Art Gallery machte den Eindruck eines gehobenen Provinzmuseums. Die kirchenähnliche Stille schien mit Händen greifbar, als Lampeth eintrat und mit seinen schwarzen Schuhen lautlos über den einfachen olivgrünen Teppich schritt. Um zehn Uhr hatte die Galerie gerade erst geöffnet, und Kunden waren noch nicht zu sehen. Dennoch hielten sich drei Assistenten in schwarzer, gestreifter Kleidung im Empfangsbereich auf.
Lampeth nickte ihnen zu und schritt durch die zu ebener Erde gelegene Galerie, wobei er sein kundiges Auge über die Bilder an den Wänden gleiten ließ. Unpassenderweise hatte man einen modernen Abstrakten neben einen Primitiven gehängt, und Lampeth machte sich eine Gedankennotiz: Das mußte schleunigst geändert werden. Preise fanden sich an den Bildern nicht – eine wohlüberlegte Taktik. Auf diese Weise wurde möglichen Käufern das Gefühl vermittelt, bei der bloßen Erwähnung von Geld würden die elegant gekleideten Assistenten mißbilligend die Stirn runzeln. Wer hierher kam – diese Suggestion drängte sich der Kundschaft automatisch auf –, für den war Geld ein ebenso untergeordnetes Detail wie das Datum auf dem Scheck. Folglich gaben die Leute mehr aus, als sie eigentlich wollten. Charles Lampeth war in erster Linie Geschäftsmann – und erst in zweiter Kunstliebhaber.
Er stieg die breite Treppe zur ersten Etage empor und erblickte in der Glasscheibe eines Bilderrahmens sein Spiegelbild. Der Knoten seiner Krawatte war klein, sein Hemdkragen frisch gestärkt, sein Savile-Row-Anzug saß tadellos. Schade, daß er übergewichtig war; trotzdem machte er für sein Alter eine ausgezeichnete Figur. Unwillkürlich straffte er die Schultern.
Er machte sich eine weitere Gedankennotiz: In jenen Bilderrahmen gehörte nichtreflektierendes Glas. Unter der Scheibe befand sich eine Federzeichnung – wer immer das arrangiert haben mochte, hatte einen Fehler gemacht.
Er betrat sein Büro, wo er seinen Regenschirm an den Kleiderständer hängte. Dann ging er zum Fenster und blickte hinaus auf die Regent Street und steckte sich eine Zigarre an, die erste an diesem Tag. Er beobachtete den Verkehr und stellte eine Liste all dessen zusammen, was es für ihn bis zum ersten Gin Tonic um fünf Uhr nachmittags zu erledigen galt.
Er drehte sich um, als Stephen Willow, sein Juniorpartner, eintrat. »Morgen, Willow«, sagte er und setzte sich an seinen Schreibtisch.
Willow erwiderte: »Morgen, Lampeth.« Trotz ihrer nunmehr sechs- oder siebenjährigen Zusammenarbeit sprachen sie einander noch immer mit dem Nachnamen an. Lampeth war an einer Zusammenarbeit sehr interessiert gewesen, um geschäftlich zu expandieren: Willow hatte eine eigene kleine Galerie aufbauen können, denn er pflegte intensive Beziehungen zu einem halben Dutzend junger Künstler, die sich sämtlich als »Treffer« erwiesen. Lampeth hatte seinerseits damals das Gefühl gehabt, daß seine Belgrave Art Gallery ein wenig hinter dem Markt her hinkte, und die Verbindung mit Willow bot ihm die Chance, rasch mit der zeitgenössischen Szene gleichzuziehen. Die Partnerschaft klappte ausgezeichnet. Obwohl zwischen den beiden Männern ein Altersunterschied von zehn oder fünfzehn Jahren bestand, besaßen beide ganz ähnliche Qualitäten: in ihrem Kunstgeschmack ebenso wie in ihrem Geschäftssinn.
Der jüngere Mann legte einen Hefter auf den Tisch und lehnte die angebotene Zigarre ab. »Wir müssen über Peter Usher sprechen«, sagte er.
»Ah, ja. Irgendwas stimmt da nicht.«
»Wir übernahmen ihn, als die Sixty-Nine Gallery pleite ging«, begann Willow. »Er hatte sich dort ein Jahr lang gut verkauft – pro Bild eintausend. Die meisten anderen erzielten mit ihren Bildern höchstens fünfhundert. Seit er zu uns kam, hat er nur ein paar verkauft.«
»In welche Preiskategorie haben wir ihn getan?«
»In die gleiche, in der er bei der Sixty-Nine war.«
»Die haben vielleicht mit Tricks gearbeitet«, sagte Lampeth.
»Das fürchte ich auch. Eine verdächtig hohe Anzahl von Bildern erschien, kurz nachdem man sie verkauft hatte, wieder auf dem Markt.«
Lampeth nickte. Es war in der Kunstwelt ein offenes Geheimnis, daß Händler mitunter ihre eigenen Bilder kauften, um die Nachfrage nach einem jungen Künstler zu stimulieren.
Lampeth sagte: »Im übrigen glaube ich, daß wir sowieso nicht die richtige Galerie für Usher sind.« Er sah, wie sein Partner die Augenbrauen hob, und fügte hinzu: »Soll keine Kritik sein, Willow – damals sah’s aus, als könnte man ihn groß rausbringen. Aber er ist nun mal ziemlich avantgardistisch, und wahrscheinlich hat ihm die Verbindung mit einer Galerie wie der unseren eher geschadet. Doch ist das jetzt alles Vergangenheit. Ich halte ihn nach wie vor für einen bemerkenswert guten jungen Maler, und wir sind es ihm schuldig, uns für ihn einzusetzen.«
Willow entschied sich im nachhinein doch noch für eine Zigarre, die er dem Kästchen auf Lampeths Schreibtisch entnahm. »Ja, das entspricht meinen eigenen Überlegungen. Ich habe ihn ein bißchen wegen einer möglichen Ausstellung ausgehorcht: Er sagte, er verfüge über genügend neue Arbeiten, um eine zu veranstalten.«
»Gut. Im New Room vielleicht?«
Die Galerie war zu groß, um sie ausschließlich dem Werk eines einzelnen lebenden Künstlers verfügbar zu machen; deshalb wurden Ein-Mann-Ausstellungen in kleineren Galerien oder nur in einem Teil der großen Galerie in der Regent Street veranstaltet.
»Ideal.«
Lampeth grübelte: »Ich frage mich allerdings nach wie vor, ob wir ihm nicht einen Gefallen erweisen würden, wenn wir ihn woanders hingehen ließen.«
»Vielleicht, nur würde das die Öffentlichkeit falsch verstehen.«
»Das stimmt allerdings.«
»Soll ich ihm dann mitteilen, daß die Sache läuft?«
»Nein, noch nicht. Es ist sehr gut möglich, daß etwas wesentlich Größeres auf uns zukommt. Lord Cardwell hat mich gestern abend zum Dinner eingeladen. Er möchte seine Sammlung veräußern.«
»Ihr Götter – der arme Kerl. Das ist eine enorme Aufgabe für uns.«
»Ja, und wir werden sehr behutsam vorgehen müssen. Ich denke noch immer darüber nach. Halten wir uns vorerst alles für diese Möglichkeit offen.«
Willow blickte aus dem Augenwinkel zum Fenster – ein Zeichen, daß er sein Gedächtnis anstrengte, wie Lampeth wußte. »Besitzt Cardwell nicht zwei oder drei Modiglianis?« fragte er schließlich.
»Das ist richtig.« Willows Kenntnisse waren für Lampeth nicht weiter überraschend: Es gehörte ganz einfach zum Beruf eines Kunsthändlers, daß er von Hunderten von Gemälden wußte, wo sie sich befanden, wem sie gehörten und was sie wert waren.
»Interessant«, fuhr Willow fort. »Als ich gestern nachmittag allein hier war, kam noch eine Meldung aus Bonn, derzufolge eine Sammlung von Modiglianis Skizzen auf dem Markt ist.«
»Was für Skizzen?«
»Bleistiftskizzen für Skulpturen. Natürlich sind sie noch nicht auf dem offenen Markt. Wir können sie haben, wenn wir wollen.«
»Gut. Wir werden sie auf jeden Fall kaufen – bei Modigliani scheint mir eine Wertsteigerung fällig. Er ist eine Zeitlang unterbewertet worden, weil er sich nicht so leicht in eine Kategorie einordnen läßt.«
Willow erhob sich. »Ich werde mich mit meinem Kontaktmann in Verbindung setzen und ihm Auftrag zum Kauf erteilen. Und falls Usher anfragen sollte, werde ich ihn hinhalten.«
»Ja. So schonend wie möglich.«
Willow ging hinaus, und Lampeth zog einen Drahtbehälter mit der morgendlichen Post näher zu sich heran. Er nahm ein – für ihn bereits aufgetrenntes – Kuvert in die Hand, als sein Blick plötzlich auf eine darunterliegende Postkarte fiel. Er legte das Kuvert beiseite, griff nach der Postkarte. Die Vorderseite zeigte das Bild einer Straße – in Paris vermutlich. Er drehte die Karte um, las die Zeilen und mußte unwillkürlich lächeln über diese atemlose Prosa und den Wald von Ausrufungszeichen.
Dann lehnte er sich zurück und überlegte. Seine Nichte verstand es, sich weiblich-überdreht zu geben; doch besaß sie in Wirklichkeit einen kühlen Verstand und eine erstaunliche Entschlußkraft. Gewöhnlich meinte sie, was sie sagte, mochte sie auch wie ein Backfisch aus den zwanziger Jahren klingen.
Lampeth kümmerte sich nicht um den Rest seiner Post, sondern steckte die Karte in die Innentasche seines Jacketts, nahm seinen Regenschirm und ging hinaus.
*
Alles an der Agentur wirkte diskret – selbst der Eingang. Er war so klug angelegt, daß ein im Taxi vorfahrender Besucher nicht von der Straße aus gesehen werden konnte, wenn er aus dem Fahrzeug stieg, um durch die Tür an der Seite des Portico einzutreten.
Das Personal ähnelte mit seinen höflichen Manieren und der fast schon devoten Diskretion dem der Galerie – wenngleich die Gründe dafür anders gelagert waren. Erkundigte man sich ohne Umschweife, welche Art Service die Agentur denn leiste, so erhielt man die gemurmelte Antwort, sie betreibe Nachforschungen im Auftrag ihrer Klienten. Und genauso wie die Assistenten der Belgrave Art Gallery niemals das Wort Geld erwähnten, erwähnten die Angestellten der Agentur niemals das Wort Detektiv.
Lampeth konnte sich auch nicht erinnern, hier jemals einen gesehen zu haben. Mr. Lipseys Detektive kannten ihre Auftraggeber in der Regel gar nicht, so daß die Diskretion mit großer Sicherheit gewahrt blieb – und auf Diskretion wurde noch größerer Wert gelegt als auf den erfolgreichen Abschluß einer Operation.
Lampeth wurde, obwohl er erst zwei- oder dreimal hier gewesen war, sofort wiedererkannt. Irgend jemand nahm seinen Regenschirm entgegen, und man führte ihn ins Büro von Mr. Lipsey, einem kleinen, sorgfältig gekleideten Mann mit glattem schwarzem Haar, der in seinem Verhalten etwas von der ernsten, traurig-diskreten Art eines amtlichen Leichenbeschauers hatte.
Er wechselte mit Lampeth einen Händedruck und wies auf einen Stuhl. Sein Büro glich eher dem eines Notars mit seinem dunklen Mobiliar, zahllosen Fächern anstelle von Aktenschränken und einem Wandtresor. Sein Schreibtisch wirkte überladen, jedoch wohlgeordnet, mit Reihen präzise ausgerichteter Bleistifte, säuberlich aufgeschichteten Papierstapeln und einem elektronischen Taschenrechner.
Der Taschenrechner erinnerte Lampeth daran, daß sich die Agentur hauptsächlich mit Nachforschungen bei vermuteten Betrugsfällen befaßte. Doch übernahm sie auch das Aufspüren von Personen und – für Lampeth – Bildern. Die Agentur ließ sich ihre Dienste teuer bezahlen, worin Lampeth eine Art Gütesiegel sah.
»Ein Glas Sherry?« frage Lipsey.
»Gerne.« Während Lipsey ihm aus einer Karaffe ein Glas vollschenkte, zog Lampeth die Postkarte hervor. Dann nahm er das dargebotene Glas und reichte Lipsey gleichzeitig die Karte. Lipsey setzte sich, stellte seinen Sherry auf den Schreibtisch, ohne davon zu trinken, und studierte die Karte.
Eine Minute später sagte er: »Ich nehme an, daß wir das Bild für Sie finden sollen.«
»Ja.«
»Hmm. Haben Sie die Adresse Ihrer Nichte in Paris?«
»Nein, aber meine Schwester – ihre Mutter – wird die Adresse wissen. Ich werde sie Ihnen besorgen. Allerdings wird Delia, wenn ich sie richtig kenne, Paris inzwischen verlassen haben – auf der Suche nach dem Modigliani. Es sei denn, das Bild befindet sich in Paris.«
»Nun – dann bleiben uns wohl nur ihre dortigen Freunde. Und dieses Bild. Wäre es möglich, daß sie, um es mal so zu nennen, die Spur dieses großen Fundes irgendwo in der Nähe des Cafes aufgenommen hat.«
»Das ist sehr wahrscheinlich«, sagte Lampeth. »Gut getippt. Sie ist ein impulsives Mädchen.«
»Diesen Eindruck gewinnt man aufgrund ihres – äh – Stils. Aber wie veranschlagen Sie die Chancen? Was, wenn es nur blinder Alarm ist?«
Lampeth hob die Schultern. »Eine solche Möglichkeit ist bei der Suche nach Bildern immer gegeben. Lassen Sie sich durch Delias Stil bloß nicht zu falschen Schlußfolgerungen führen – sie hat sich gerade eine Eins in Kunstgeschichte erworben, und sie ist eine sehr gescheite fünfundzwanzigjährige Dame. Wäre sie bereit, für mich zu arbeiten, so würde ich ihr auf der Stelle einen Job geben – schon damit keiner meiner Konkurrenten sie angeln kann.«
»Und die Chancen?«
»Fifty-fifty. Nein, besser – siebzig-dreißig. Zu Ihren Gunsten.«
»Gut. Glücklicherweise habe ich den richtigen Mann für diese Aufgabe gerade verfügbar. Wir können die Sache sofort in Angriff nehmen.«
Lampeth stand auf, zögerte, zog die Stirn kraus: Er schien nicht recht zu wissen, wie er ausdrücken sollte, was er Lipsey sagen wollte. Dieser wartete geduldig.
»Also – es ist wichtig, daß das Mädchen nicht erfährt, daß ich die Nachforschungen in Gang gesetzt habe, verstehen Sie?«
»Natürlich«, erwiderte Lipsey verbindlich. »Das ist doch selbstverständlich.«
*
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: