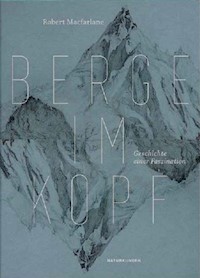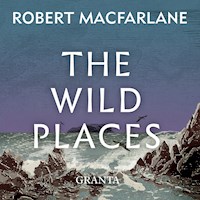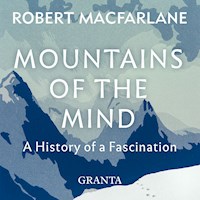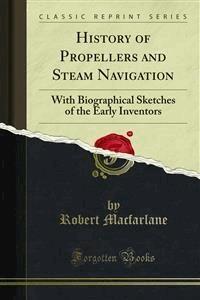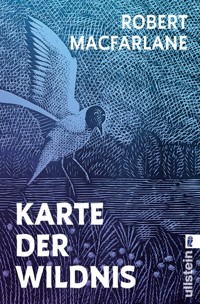
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wo gibt es heute noch Wildnis? Robert Macfarlanes Suche nach den letzten unberührten Flecken Natur wird zum lebendigen Streifzug. Er entdeckt abgelegene Inseln und verborgene Gebirge, durchwandert unwegsame Moore und undurchdringliche Wälder. Er schwimmt in brandender See und in stehenden Gewässern, erklimmt windumtoste Gipfel, schläft in Sandkuhlen. Und er begibt sich auf die Spuren derjenigen, die diese Orte vor ihm aufsuchten: Pilger und Philosophen, Forscher und Literaten. Eine sprachmächtige Einladung zum Staunen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Karte der Wildnis
ROBERT MACFARLANE, 1976 in Nottinghamshire geboren, lehrt Literaturwissenschaft in Cambridge, ist Essayist und Kritiker und gilt als wichtigster britischer Autor des Nature Writing. Er ist Fellow der britischen Royal Society of Literature und Gründungsmitglied der Naturschutzorganisation Action for Conservation.Bei Ullstein sind bislang Karte der Wildnis undAlte Wege erschienen.
Wo gibt es heute noch Wildnis? Robert Macfarlanes Suche nach den letzten unberührten Flecken Natur wird zum lebendigen Streifzug. Er entdeckt abgelegene Inseln und verborgene Gebirge, durchwandert unwegsame Moore und undurchdringliche Wälder. Er schwimmt in brandender See und in stehenden Gewässern, erklimmt windumtoste Gipfel, schläft in Sandkuhlen. Und er begibt sich auf die Spuren derjenigen, die diese Orte vor ihm aufsuchten: Pilger und Philosophen, Forscher und Literaten. Eine sprachmächtige Einladung zum Staunen.
Robert Macfarlane
Karte der Wildnis
Aus dem Englischen von
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Juli 2024Copyright © der deutschen Ausgabe 2024 Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinCopyright © der englischen Originalausgabe 2007, The Wild Places, by Robert Macfarlane; Granta BooksCopyright © Fotografien im Innenteil: John Beatty, Rosamund Macfarlane, John MacfarlaneTypographie: Pauline Altmann, Berlin, durchgesehen von Judith SchalanskyDie deutsche Ausgabe dieses Buches erschien zuerst in der Reihe Naturkunden, herausgegeben von Judith Schalansky bei Matthes & Seitz.Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenTitelabbildung: © The Gamborg Collection / Bridgeman ImagesAutorenfoto: © Angus MuirE-Book-Konvertierung powered by PepyrusAlle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN 978-3-8437-3505-6
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Karte der Wildnis
1 Buchenhain
2 Insel
3 Tal
4 Moor
5 Wald
6 Flussmündung
7 Kap
8 Gipfel
9 Grab
10 Berggrat
11 Hohlweg
12 Sturmstrand
13 Salzmarsch
14 Felssäule
15 Buchenhain
Verwendete Literatur
Weiterführende Literatur
Danksagung
Leseprobe: Alte Wege
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Karte der Wildnis
Karte der Wildnis
1 Buchenhain
Wind zog auf, und ich beschloss, in den Wald zu gehen. Südlich der Stadt, eine Meile von meinem Haus entfernt liegt er: ein schmaler, namenloser Buchenhain, dichtgedrängt auf einem flachen Hügel. Zu Fuß folgte ich den Straßen, die aus der Stadt führten, und dann, zwischen Hecken aus Weißdorn und Haselnuss, den Wegen entlang der Feldkanten.
Über den Bäumen zankten sich Saatkrähen in der Luft. Der Himmel war von strahlend kaltem Blau, das an den Rändern milchig auslief. Schon aus fünfhundert Metern hörte ich die Bäume im Wind; wie leises Meerestosen. Ein gewaltiges Gemisch aus Rauschen und Reiben – Blatt an Blatt, Zweig an Zweig.
Ich betrat den Wald an seinem südlichen Zipfel. Abgebrochene Zweige und Bucheckern fielen aus den wogenden Wipfeln und prasselten auf den kupferroten Laubboden. In hellen Clustern fiel Sonnenlicht ein. Ich ging den Wald hügelauf, bis ich auf halber Höhe an seiner Nordkante an meinen Baum gelangte: eine große, grauborkige Buche, deren Äste so stehen, dass man leicht hinaufklettern kann.
Ich hatte diesen Baum schon oft bestiegen, alle seine Eigenheiten waren mir vertraut. Am unteren Stamm warf und buchtete sich die Rinde wie ein faltiger Elefantenfuß. In vielleicht dreieinhalb Metern Höhe bog sich ein Ast zu einem scharfen Haken; darüber hatte sich ein vor Jahren in den Stamm geritztes ›H‹ mit dem Wachstum des Baumes aufgeplustert; noch etwas höher prangte der verwachsene Stumpf eines abgebrochenen Asts.
In zehn Metern Höhe, nahe dem Wipfel, wo die weichere Rinde der Buche silbern schimmert, erreichte ich den ›Ausguck‹, wie ich ihn nannte: einen gegabelten Seitenast, der direkt unter einer krummen Stelle aus dem Stamm wächst. Ich hatte herausgefunden, dass ich dort, indem ich den Rücken gegen diese Krümmung lehnte und die Füße auf die Gabelenden stellte, einen bequemen Sitz hatte. Wenn ich ein paar Minuten reglos saß, kam es vor, dass die Leute unter mir vorbeigingen, ohne mich zu bemerken. Menschen denken im Allgemeinen nicht, dass Männer in Bäumen sitzen. Verharrte ich noch länger, kehrten die Vögel zurück. Vögel denken im Allgemeinen auch nicht, dass Männer in Bäumen sitzen. Amseln wühlten sich durchs Laub; Zaunkönige schwirrten so schnell von Zweig zu Zweig, dass es aussah, als würden sie dort hingebeamt; auch ein Rebhuhn wagte sich vorsichtig aus seinem Versteck.
Ich versuchte, auf meiner Warte die Balance zu finden. Denn noch bewegte sich der Baum unter meinem Gewicht und meinen Bewegungen, vom Wind weiter verstärkt, so dass der Wipfel der Buche in knarrenden Bögen von fünf bis zehn Grad hin und her schwankte. An diesem Tag glich mein Ausguck weniger einem Hochsitz im Wald als dem Lug auf einem Schiffsmast bei stürmischer See.
Aus dieser Höhe lag das Land unter mir ausgebreitet wie eine Karte. Ich sah noch andere versprenkelte Wäldchen, von denen ich einige mit Namen kannte: Mag’s Hill Wood, Nine Wells Wood, Wormwood. Im Westen lag hinter gerippten Feldern eine Hauptverkehrsstraße, über die die Autos brummten. Geradewegs im Norden stand das Krankenhaus, dessen dreischlotige Verbrennungsanlage meinen Hügelbaum weit überragte. Über dem Flugfeld am Stadtrand ging eine dickbauchige Hercules in den Sinkflug. Im Osten sah ich über einem Grünstreifen einen Turmfalken durch den scharfen Wind gleiten, mit zitternden Flügeln und seinen gleich einem Spielkartenblatt gespreizten Schwanzfedern.
Vor etwa drei Jahren hatte ich damit begonnen, auf Bäume zu klettern. Oder vielmehr erneut damit begonnen; denn an meiner Schule hatte es einen Wald zum Spielen gegeben. Wir waren auf die verschiedenen Bäume gestiegen, hatten ihnen Namen gegeben (›Skorpion‹, ›Große Eiche‹ wie bei Robin Hood, ›Pegasus‹) und sie nach ausgefeilten Regeln und mit unbedingter Treue umkämpft. Mein Vater hatte meinem Bruder und mir im Garten ein Baumhaus gebaut, das wir jahrelang gegen die Angriffe der Piraten verteidigten. Nun, mit Ende Zwanzig fing ich also wieder an, auf Bäume zu klettern. Einfach nur zum Spaß: ohne Seile, ohne Gefahr.
Durch das Klettern hatte ich allmählich gelernt, einzelne Baumarten zu unterscheiden. Ich mochte die schlanke Biegsamkeit der Silberbirke, der Erle und des jungen Kirschbaums. Kiefern hingegen – mit ihren brüchigen Zweigen, der schuppigen Rinde – mied ich, ebenso Platanen. Und ich fand heraus, dass die Rosskastanie mit ihrem astlosen Unterstamm, den stacheligen Früchten und der ungeheuerlichen Krone für den Baumkletterer sowohl Herausforderung als auch großer Anreiz war.
Ich durchforschte sämtliche Literatur über das Bäumeklettern: es gab nicht viel, aber sehr Aufregendes. John Muir hatte bei einem Orkan in Kalifornien eine dreißig Meter hohe Douglasfichte erklommen und von dort über einen Wald geblickt, »während die gesamte Masse ihres bebenden Laubwerks zu einer einzigen fortwährenden Lohe weißen Sonnenfeuers entzündet war«. Italo Calvino hatte sein zauberhaftes Buch vom Baron auf den Bäumen verfasst, dessen junger Held Cosimo in jugendlicher Verärgerung auf einen Baum des bewaldeten Anwesens seines Vaters klettert und sich schwört, nie wieder auf den Boden zurückzukehren. Er hält sein aufbegehrendes Gelöbnis, richtet sich unter dem Blätterdach auf Dauer ein, bewegt sich kilometerweit durch die Wipfel von Oliven, Kirschen, Ulmen und Steineichen, und am Ende heiratet er sogar in einer Baumkrone. Dann gab es die Jungen in B.B.s Im Schatten der Eule, die sich lieber im Wald versteckten, als in ihr englisches Internat zurückzugehen, und die zu guter Letzt eine Waldföhre bestiegen, um an das mit Buchenblättern ausgepolsterte Nest eines Wespenbussards zu gelangen. Und natürlich das berühmte Duo aus Pu der Bär und Christopher Robin: Pu, der mit seinem himmelblauen Ballon hinauf an den Wipfel der Eiche flog, um Honig aus dem Bienenstock zu stibitzen. Und Christopher Robin, der mit seinem Korkengewehr bereitstand, um Pus Ballon abzuschießen, sobald der Honig stibitzt war.
Ich entdeckte auch bewundernswerte zeitgenössische Vertreter ernsthaft betriebener Baumkletterei; vor allem jene Wissenschaftler, die in Oregon und Kalifornien die Mammutbäume erforschen: Sequoia sempervirens, die riesige Küsten-Sequoie, kann über einhundert Meter hoch werden. Der ausgewachsene Baum verdankt den Großteil seiner Höhe dem fast astlosen Stamm, auf dem die breite, vielschichtige Krone sitzt. Die Forscher haben außergewöhnliche Techniken entwickelt, um die Mammutbäume zu besteigen. Mit Pfeil und Bogen schießen sie eine Zugschnur über einen kräftigen Ast in der Krone. Dann ziehen sie an dieser Schnur ein Kletterseil in die Höhe und sichern es. In der Krone angelangt, können sie sich dank ihrer Behändigkeit sicher und fast frei bewegen, wie moderne SpiderMans. Dort oben in den Lüften entdeckten sie ein verlorenes Königreich, ein bemerkenswertes und bislang unerforschtes Ökosystem.
Meine Buche hatte derlei Besonderheiten nicht, sie war weder schwer zu erklimmen, noch hielt sie im Wipfel biologische Entdeckungen bereit – und Honig gab es dort schon gar nicht. Aber sie bot mir einen ausgezeichneten Ort, um nachzudenken. Einen Ruheplatz, einen Horst. Ich mochte meine Buche sehr, auch wenn sie – wie soll ich sagen – keine Vorstellung von mir hatte. Ich war schon oft auf sie hinaufgeklettert: im ersten Morgenlicht, in der Abenddämmerung, bei strahlendem Mondschein. Im Winter hatte ich das steinkalte Holz mit der Hand vom Schnee befreit und in den Ästen der benachbarten Bäume die schwarzen Krähennester gesehen. Im Frühsommer konnte ich von dort oben die schillernde Landschaft betrachten, wenn Hitzeschlieren die Luft durchzogen und man das verschlafene Tuckern eines Traktors vernahm. Und auch bei schwerem Regen hatte ich schon hier oben gesessen, wenn das Wasser in Schnüren vom Himmel fiel, die man mit bloßem Auge erkennen konnte. Auf den Baum zu klettern verschaffte mir einen Perspektivwechsel, so unbedeutend er auch scheinen mochte; ich schaute hinunter auf die Stadt, der ich sonst auf Augenhöhe begegnete. Höchste Befreiung. Vor allem aber konnte ich mich hier oben allen Ansprüchen der Stadt entziehen.
Jeder, der in der Stadt lebt, kennt das Gefühl, schon viel zu lange dort gewesen zu sein. Die Spuren, die die Häuserschluchten in uns ziehen, das Gefühl, etwas hält uns fest, der sehnsuchtsvolle Wunsch, anderes zu sehen als ständig Glas, Ziegel, Beton und Asphalt. Ich wohne in Cambridge, inmitten einer Region, die extrem dicht besiedelt ist und in der intensivste Landwirtschaft betrieben wird. Eine seltsam gewählte Heimat für einen Menschen, der die Berge und die Wildnis liebt. Cambridge ist aber vermutlich in Stunden und Minuten genauso weit entfernt von ›unberührter Wildnis‹ wie jeder andere Fleck in Europa. Mich drängt es in diese Ferne. Doch gute Gründe halten mich: meine Familie, meine Arbeit, meine Liebe zu dieser Stadt, die Art und Weise, wie der Stein ihrer alten Gemäuer das Licht in sich einsaugt. Ich habe, mit Unterbrechungen, nun zehn Jahre in Cambridge verbracht und glaube, dass es für die nächsten Jahre so bleiben wird. Und solange ich hier lebe, wird es mich – das weiß ich – immer und immer wieder in die Wildnis ziehen.
Ich könnte nicht genau sagen, wann meine Leidenschaft für das Wilde auf kam, nur dass es so war, und dass mein Verlangen danach niemals nachlassen wird. Wenn ich als Kind etwas darüber las, riefen die Worte stets Bilder von Weite, von entlegenen, gestaltlosen Orten in mir hervor. Einsame Inseln weit vor der Atlantikküste. Grenzenlose Wälder und blaues Schneelicht über von Wolfsspuren durchkreuzten Verwehungen. Bitter-frostige Gipfel und Bergkessel mit tiefen Seen. Diese Vorstellung von Wildnis trug ich stets in mir: Orte irgendwo weit im Norden, winterlich, unermesslich, fernab, urwüchsig, die dem Reisenden mit ihrer Rauheit alles abverlangten. Der Schritt in eine solche Wildnis war für mich der Schritt hinaus aus der Menschheitsgeschichte.
Der Buchenhain konnte mein Verlangen nach Wildnis nicht stillen. Man hörte das Dröhnen der nahen Straßen, das Rauschen und Hupen der Hochgeschwindigkeitszüge auf dem Weg nach Westen. Die umliegenden Felder waren zur Ertragsmaximierung mit Dünger und Herbiziden behandelt. Die Hecken beliebte Ziele für urbane Selbstentsorger. Über Nacht wuchsen hier die Müllhaufen: Bauschutt, aufgequollenes Sperrholz, zerfledderte Zeitungen. Einmal hingen sogar ein Büstenhalter und ein Spitzenhöschen in den Dornen, wie übergroße Speiballen von Würger-Vögeln. Wohl wieder urbane Selbstentsorger, dachte ich, und keine plötzlich entbrannte Leidenschaft am Straßenrand, denn wer baut sich schon in einer Weißdornhecke sein Liebesnest?
Bereits Wochen vor dem Sturm beschlich mich das Gefühl, ich müsste fortgehen, raus aus dem Ascheschatten der Verbrennungsanlage, aus dem Ereignishorizont der städtischen Umgehungsstraße. Als ich an diesem Tag von meinem Ausguck auf die Straßen, das Krankenhaus und die zwischen den Feldern eingepferchten Wälder schaute, verspürte ich das dringende Bedürfnis, Cambridge zu verlassen und an einen entlegenen Ort zu gehen, wo klares Sternenlicht vom Himmel fiel und der Wind aus sechsunddreißig Richtungen wehte und nichts oder wenigstens so gut wie nichts auf menschliches Leben hinwies. Weit oben im Norden oder Westen, dort hatte in meiner Vorstellung die Wildnis überlebt, falls es sie überhaupt noch irgendwo gab.
Ein ums andere Mal ist die Wildnis in Großbritannien und Irland bereits für tot erklärt worden. »Nach zwei Weltkriegen wurde nach Reglementierung verlangt«, schrieb E. M. Forster 1964. »Auch die Wissenschaft trug ihren Teil bei, und so wurde im Handumdrehen die gesamte Wildnis dieser Inseln, die nie besonders raumgreifend war, zertrampelt, verbaut, überwacht. Heute gibt es keinen Wald und keinen Gipfel mehr, der einem als Rückzugsort dienen könnte, keine Höhle, in der man sich verbergen kann, kein verlassenes Tal.« Jonathan Raban zufolge fand die Vernichtung der Wildnis sogar noch früher statt: »Seit den 1860er Jahren war Großbritannien so dicht bevölkert, landwirtschaftlich so intensiv genutzt, so sehr industrialisiert und verstädtert, dass man nirgends wirklich allein sein konnte und es nirgends mehr Platz für Abenteuer gab – mit Ausnahme der Meere.« John Fowles zog 1985 finster das unerbittliche Fazit: »Wir stehen kurz davor, große Teile unserer alten Landschaft zu verlieren. Unvorstellbare Gräueltaten haben wir unserem Land zugefügt. Es gibt nur wenige Orte entlang der Küsten und auf den höchsten Bergen, an denen der alte Reichtum der Natur noch nicht gefährdet ist.« Fünf Jahre später beschrieb der amerikanische Autor William Least Heat-Moon die britische Landschaft als den »aufgeräumten Garten eines Spielzeugreichs, in dem es fast keine echte Wildnis mehr gibt und auch keinerlei Erinnerung daran. Die Wälder gleichen denaturierten Pflanzungen. Wie weit nur sind die Engländer, ja die Europäer, von der Wildnis entfernt. Das ist der Unterschied zwischen ihnen und uns.« Immer wieder dieselbe Missbilligung, dieselbe Klage.
Zahlreiche Beweise decken diese Nachrufe auf die Wildnis. Vor allem im vergangenen Jahrhundert wurden die britischen und irischen Landschaften und Meere von so mancher Katastrophe heimgesucht. Die Schadensstatistiken sind bekannt und werden oft zitiert, heute aber eher als Elegie, und nicht mehr als Protest. In England wurden zwischen 1930 und 1990 mehr als die Hälfte der alten Waldbestände gerodet oder durch Pflanzungen von Nadelbäumen ersetzt. Die Hecken wurden in ihrer Gesamtlänge um die Hälfte gestutzt. Fast alle Wiesen im Tiefland zerpflügt, bebaut oder überteert. Drei Viertel des Heidelands in Ackerfläche oder Bauland umgewandelt. Überall in Großbritannien und Irland hat man Steine aus seltenen Kalksteinwegen herausgebrochen und als Material für Steingärten verkauft, hat man jahrtausendealte Torfmoore ausgebaggert und trockengelegt. Dutzende Tierund Pflanzenarten starben aus oder sind akut gefährdet.
In Großbritannien leben heute über dreiundsechzig Millionen Menschen
auf dreihunderttausend Quadratkilometern Fläche. Entlegenes Land gibt es so gut wie keines mehr, wobei wir sein Verschwinden vor allem dem Auto und der Straße zu verdanken haben. Nur ein verschwindend geringer Teil des Landes liegt heute weiter als acht Kilometer vom nächsten befahrbaren Weg entfernt. Landesweit sind an die dreißig Millionen Autos im Verkehr, und allein in Großbritannien gibt es dreihundertdreißigtausend Kilometer Straße. Würde man diese Asphaltschlangen lang ziehen und zu einer durchgehenden Trasse verbinden, könnte man darauf bis fast zum Mond fahren. Die Straßen wiederum sind neue mobile Lebensräume geworden: Zu Stoßzeiten sitzen in Großbritannien und Irland Schätzungen zufolge mehr Menschen in Fahrzeugen, als die gesamte Londoner Innenstadt Einwohner hat. Die meistbenutzte Landkarte Englands ist der Straßenatlas. Wenn Sie ihn aufschlagen, sehen Sie ein Netz aus Autobahnen und Straßen, das das gesamte Land überzieht. Beim Anblick dieses Dickichts von Straßen kann einem der Gedanke kommen, dass die Hauptelemente, aus denen die Landschaft heute besteht, Asphalt und Benzin wären.
Zugleich sieht man im Straßenatlas überdeutlich, was fehlt. Es ist keine Wildnis mehr darin verzeichnet. Hügel, Höhlen, Berge, Wälder, Moore, Flussniederungen und Marschen sind aber keineswegs verschwunden. Falls sie überhaupt erscheinen, dann als Hintergrundschraffierung oder als Symbol in der Legende. Für gewöhnlich sind sie allerdings allesamt verblasst wie alte Tinte, sind verdrängte Erinnerungen an ein Archipel aus vormaliger Zeit.
Natürlich drückt das Land selbst keinen Wunsch aus, wie es gern dargestellt würde. Es ist gleichgültig gegenüber den Bildern, die es von ihm gibt, und gegenüber denen, die das Bild entwerfen. Aber die Art und Weise, wie Landkarten Informationen über eine Landschaft anordnen, hat einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere Wahrnehmung. Durch die Auswahl des Erscheinungsbildes, die Eingrenzung auf bestimmte Gesichtspunkte und die Einordnung nach deren Bedeutsamkeit, beeinflussen sie nicht nur die Betrachtungsweise, sondern auch den Umgang mit einer Landschaft.
Um das Vorurteil zu überwinden, das die Landkarte uns aufdrängt, bedarf es Zeit und Anstrengung. Und eine verzerrtere Vorstellung als die, die ein Straßenatlas schafft, ist kaum denkbar. Der erste englische Straßenatlas wurde 1675 von John Ogilby angefertigt. Er umfasste sechs Bände und beanspruchte für sich, die einzige »ikonografische und historische Darstellung aller bedeutsamen Fahrtwege in England und Wales« zu sein. Ogilbys Karten legten größten Wert auf landschaftliche Details: Sie zeigten nicht nur Straßen, sondern auch die Hügel, Flüsse und Wälder, um und an und entlang und über die sich die Fahrbahnen erstreckten.
In den Jahrhunderten seit Ogilbys Erfindung gewann der Straßenatlas immer mehr an Einfluss und Allgemeingültigkeit. In Großbritannien und Irland werden jährlich über eine Million Exemplare verkauft; zwanzig Millionen sind schätzungsweise fortwährend in Umlauf. Die Prioritäten des modernen Straßenatlas sind klar. Ausgehend von Satellitenfotos, erstellt ein Computer eine Darstellung zwecks Transit und Transport. Wir möchten die Landschaft ausschließlich im Kontext der motorisierten Fortbewegung betrachten. Damit wird der Blick des Lesers von der natürlichen Welt abgelenkt und entfernt.
Wenn ich an diese Karte denke – in dieser Karte denke –, sehe ich die Landschaft als eine Folge grobkörniger Standbilder aus Überwachungskameras, als Bilder mit Richtung, Reiseziel und Zweck: Bremsleuchten im Dämmerlicht, heißer Auspuffatem. Der Straßenatlas macht mich allzu leicht vergessen, dass es all diese Gegenden tatsächlich gibt, dass die Länder, die wir ›England‹, ›Irland‹, ›Schottland‹ und ›Wales‹ nennen, über 5 000 Inseln, 500 Berge und 300 Flüsse umfassen. Er verweigert sich der Vorstellung, dass in diesen Landstrichen, lange bevor sie zu politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Entitäten wurden, schlicht und einfach Stein, Wald und Wasser war.
Es muss kurze Zeit nach diesem Sturm gewesen sein, dass erstmals diese Idee in mir auf kam: Könnte ich nicht einige Reisen durch Großbritannien und Irland machen und mich auf die Suche nach den letzten Flecken Wildnis begeben? Ich glaubte nicht oder wollte nicht an die Abgesänge auf die Wildnis glauben. Sie schienen mir verfrüht, sogar gefährlich. Wie die Trauer um einen Menschen, der noch gar nicht gestorben ist, vermittelten sie den Eindruck eines unschicklichen Verlangens nach einem Ende oder eines Zugeständnisses der eigenen Hilflosigkeit. Es war unübersehbar, dass Großbritannien und Irland ihre letzten wilden Orte verloren, und die Bedrohung – durch Umweltverschmutzung, durch Klimawandel – schien gravierender und mannigfaltiger als je zuvor. Aber ich wusste, die Wildnis war noch nicht ganz und gar verschwunden.
Und so begann ich, meine Reisen zu planen. Ich schrieb meinen Freunden, um sie zu fragen, wann und wohin sie gehen würden, wenn sie die Wildnis suchten. »Freitagabend nach Birmingham, wenn die Pubs zu machen«, antwortete einer. Ein anderer erzählte mir vom Grind of Navir auf den Shetlandinseln, wo die dreißig Meter hohen Wellen der Springflut Felsbrocken vierhundert Meter weit ins Hinterland schleudern, sodass dort, vom Meer aus nicht mehr zu sehen, ein zweiter, ein Sturmstrand entsteht. Dann rief mich mein Freund Roger Deakin an und empfahl mir Breachan’s Cave an der einsamen Nordwestküste der Hebrideninsel Jura sowie eine Halbinsel im Loch Awe in den südlichen Highlands, auf deren herrlicher, krähenbevölkerter Burgruine er einmal eine erfrischend übellaunige Begegnung mit einem Gutsverwalter gehabt habe. Aber, schlug er vor, ich solle doch einfach zu ihm rüberkommen, damit wir in aller Ruhe reden könnten.
Zum Thema Wildnis hätte ich keinen besseren Gesprächspartner als Roger finden können. Als Gründungsmitglied der Friends of the Earth war er seit jeher von Natur und Landschaft begeistert – und zwar derart begeistert, dass er sich Ende der 1990er Jahre daranmachte, Großbritannien schwimmend zu durchqueren. Mehrere Monate schwamm Roger durch Dutzende Flüsse, Seen, Llyns und Lochs, Ströme und Küstengewässer von England, Wales und Schottland. Er wollte das Land ›aus der Froschperspektive‹ sehen, sich in das unbekannte Element einfühlen, eine noch unerprobte Sicht auf seine Heimat einnehmen. Das Logbuch eines Schwimmers, in dem er seine Reise beschreibt, ist ein Klassiker; ein witziger, poetischer Reisebericht, zugleich Verteidigungsschrift für die letzten bestehenden und Elegie auf die bereits verschwundenen Wildgewässer. Wie auch ein Widerhall seiner Persönlichkeit: lebhaft, leidenschaftlich, mit tausend Einfällen. »Er ist jetzt über sechzig«, sagte einmal ein gemeinsamer Freund zu mir, »und immer noch voller Energie wie ein junger Fuchs!«
Unsere gemeinsame Leidenschaft für die Wildnis hatte Roger und mich einige Jahre zuvor zusammengeführt. Ich hatte ein Buch über Berge geschrieben, er eines über Flüsse und Seen. Obwohl er doppelt so alt war wie ich, befreundeten wir uns bald. Als meine Tochter Lily geboren wurde, schlüpfte er in die Rolle des Pseudogroßonkels. Zu ihrem ersten Geburtstag schenkte er ihr eine Dampfmaschine aus Holz, eingewickelt in Platanenblätter, die mit Gras zusammengebunden waren. Bevor sie zum ersten Mal zu Besuch in sein verwinkeltes Haus kam, verriet er mir, er habe ein weiteres Geschenk angefertigt: Wir kamen in ein Blätterlabyrinth – Tausende von leuchtend gelben Maulbeerblättern, die er zusammengeharkt und zu einem liliesken Labyrinth aufgetürmt hatte.
Eines strahlend schönen Tages, etwa eine Woche nach unserem Telefonat, fuhr ich also zu Roger nach Mellis Common in Suffolk und bog bei dem dicken, eigenhändig gestutzten Weidenstamm in das Sträßchen ein, das zu seinem Hof führte.
Roger bewohnte das ungewöhnlichste Haus, das mir je untergekommen ist. Er hatte 1969, mit gerade sechsundzwanzig Jahren, die baufälligen Reste eines elisabethanischen Gehöfts und zwölf Morgen umliegendes Weideland gekauft. Abgesehen vom quellgespeisten Wallgraben und dem riesigen Kamin mit Sitzecke war von den ursprünglichen Anlagen aus dem
16. Jahrhundert nur noch wenig erhalten. Also zog er mit seinem Schlafsack an den Kamin und wohnte dort, während er um sich herum ein Haus baute.
Die Walnut Tree Farm, wie Roger sie taufte, war größtenteils aus Holz gefertigt. Das Tragwerk bestand aus Eiche, Kastanie und Esche, und über dreihundert hölzerne Stäbe hielten Dach und Böden. Wenn der Ostwind blies, knackten und ächzten die Balken, die ihn an »ein Schiff im Sturm« erinnerten, wie er einmal sagte, oder an »einen sich wiegenden Wal«. Das Haus war einem Lebewesen so ähnlich, wie ein Gebäude es nur sein konnte. Roger hielt Türen und Fenster geöffnet, damit Luft hereinströmte und auch die Tiere ein und aus gehen konnten. Blätter wehten zur einen Tür herein, zur anderen wieder hinaus, und selbst Fledermäuse flatterten zwischen den Fenstern hin und her, sodass man meinen konnte, das Haus würde atmen. Spinnen zogen seidene Girlanden und Bänder in jeder Ecke. Im großen Kamin nisteten Schwalben, im Strohdach die Stare. Efeu und Rosen kletterten an den Außenwänden in die Höhe und schickten durch Astlöcher und Risse vorwitzig wissbegierige Ranken nach innen. An der Vorderseite des Hauses wuchs der namensgebende Walnussbaum, der im frühen Herbst harte grüne Früchte auf das Dach der Scheune und die Köpfe der Besucher herunterpoltern ließ. Hinter der rückwärtigen Seite lag der Wallgraben, in dem Roger in den Sommermonaten fast täglich badete und den Tausendschaften von Tellerschnecken – die Reinigungsfachkräfte der stehenden Gewässer – sauberhielten.
Ich war schon oft bei Roger zu Besuch gewesen und kannte seinen Hof und die Umgebung gut. Die Felder, die er bebaute, aber nicht bewirtschaftete, brummten vor Leben. Sperber fuhren über uns durch den Himmel, Igel schliefen unter Wellblech, und aus dem Wäldchen, das er aus Hainbuchen und Eichen angelegt hatte, riefen die Waldkäuze. Über die Jahrzehnte hatte er in seinen Wiesen eine Vielfalt von Unterständen errichtet, eine Schäferhütte mitsamt Bett, Ofen und Ofenrohr, einen alten Wohnwagen, ganz aus Holz, in dem ein Fenster zersprungen war, und einen Eisenbahnwaggon, den er purpurn angestrichen hatte wie den guten alten Pullmanwagen. In stürmischen Nächten schlief er gern dort: »Letzte Nacht gab es einen großartigen Sturm, ich lag wach und lauschte«, hatte er mir einmal nach einem Sommergewitter geschrieben. »Man liegt wie in einer Kesselpauke, während um einen herum die Sinfonie des Donners tost, in Vierkanalstereo!« Eines Morgens erwachte er in der Schäferhütte und musste feststellen, dass die gesamte Konstruktion wackelte. Ein Erdbeben? Nein, nur ein Reh, das den Bewohner nicht bemerkt hatte und sich an einer Ecke der Hütte schubberte.
Bei meinem diesmaligen Besuch also sprachen wir stundenlang über die Wildnis, tranken Tee aus großen tönernen Tassen, zogen dann und wann ein Buch oder eine Karte aus dem Regal und glichen unsere Erfahrungen und unsere Auffassungen von meiner Reiseidee miteinander ab. Roger erzählte mir von einigen Orten in England, die für ihn zu den sonderlichsten und wildesten zählten: die Brecklands in East Anglia, das Undercliff in Lyme Regis, Canvey Island in Essex. Ich berichtete ihm von einer Gumpe unter einem Wasserfall hoch oben im Glen Feshie, über dem Wanderfalken kreisten und dessen Wasser braun wie ein Pferderücken war, und vom Shelter Stone, einem riesigen, wie freischwebenden Felsblock inmitten der Cairngorms, unter dem man, sogar winters, die Nacht verbringen konnte.
Ich fragte ihn, ob er mich bei Gelegenheit auf meinen Reisen begleiten würde, was er gerne tun wollte, vor allem durch England und Irland – und er würde sich sehr darauf freuen, gemeinsam mit mir ein paar Verbotsschilder zu übersehen. Eine Expedition durch Madonnas Anwesen in Wiltshire reizte ihn besonders, da er das Bürgerrecht geltend machen wollte, diese schönen waldreichen Ländereien zu betreten. Ich reagierte verhalten, stammelte feige etwas von gefährlichen Fußangeln und Wildhütern, freute mich aber insgeheim auf unsere gemeinsamen Abenteuer. Damals ahnte ich noch nicht, wie unverzichtbar Roger für meine Reisen werden und wie stark sein Einfluss mein Verständnis von Wildnis veränderte sollte.
Nach meinem Besuch bei Roger plante ich noch einige Wochen weiter. Ich lieh oder kaufte mir Spezialkarten – geologische, meteorologische, naturhistorische –, ließ meine Fantasie über ihnen schweifen, suchte mit der Wünschelrute nach möglichen Zielen und malte mir aus, was die Karten nur vermuten ließen. Flüssen folgte ich Steilhängen hinab und stellte mir die Form der Felsen vor, die sie höhlten. In schottischen Lochs und irischen Loughs fuhr ich mit dem Finger um namenlose bewaldete Inseln, stellte mir vor, wie ich zu ihnen hinausschwamm, auf die Bäume stieg und darauf die Nacht verbrachte. Ich markierte straßenlose und offene Gegenden: die Ebene des Rannoch Moor und die Wildnis von Fisherfield. Ich betrachtete die verschiedenen Gesteinstypen – Gabbro, Steine mit Hornblende, Serpentinit, Oolith, Geschiebelehm –, die in der Landschaft versanken und dann wieder an die Oberfläche traten. Über meinen Schreibtisch hängte ich mir ein Zitat des Bergsteigers und Forschers W. H. Murray, der noch mit den alten ›Inch-to-the-Mile‹-Karten arbeitete, aus der Zeit, als er in den Highlands eine Bergerkundung auf den Ben Alder unternahm: »Schon auf dem farbigen Papier trug die ganze Landschaft mit ihren gewaltigen Bergkesseln unverkennbar die Prägung von Wildnis und bestimmt würden auf deren Rücken noch wildere Festen zu finden sein, in denen geheime Dinge der Erkundung harrten. Welche Art von Dingen, könnten Sie mich jetzt fragen. Aber das wusste ich natürlich selber nicht.«
Ich machte mir eine Liste von Hügelfestungen, Grabhügeln und Tumuli in den walisischen Marschen und den südwestlichen Grafschaften und suchte nach Verbindungswegen. Dann hielt ich Ausschau nach Kliffs und Klippen: dem legendären Felsbug von Sron Ulladale auf North Harris; den Steilhängen des südwestlichen Ausläufers der Insel Mull, die über fast dreihundert Meter auf Felsstrände abfallen; den fast senkrechten Klippen von Clò Mór bei Cape Wrath; dem nach Norden ausgerichteten Kar von Braeriach in den Cairngorms, wo das ganze Jahr über Schnee liegt, der langsam zu Eis sintert. Außerdem notierte ich die Zufluchtsorte, an denen sich bestimmte Tiere und Vögel auf hielten: Steinadler, Regenpfeifer, Grünschenkel, Otter, Schneehase, Schneehuhn und sogar die gespenstische Schneeeule mit ihren seltenen Vorstößen aus dem Polarkreis in Richtung Süden.
Fast alle diese Orte lagen weit im Norden oder Westen: in den hohen Bergen und an den entlegenen Küsten von Schottland und Wales. Durch diese grundlegende Schief lage schien sich bereits eine grobe natürliche Abfolge meiner Reisen abzuzeichnen. Ich würde mit dem beginnen, was ich kannte und liebte, und mich dann nach außen und in die Höhe vorarbeiten, zu den Gipfeln und an die Küstenstriche, die Fowles als die letzten Enklaven »alter Natur« bezeichnet hatte und die auch meiner persönlichen Vorstellung von Wildnis am nächsten kamen. Irgendwo weit oben im Norden würde ich mich dann wieder nach Süden wenden und durch Irland möglicherweise bis ins urbane England zurückkehren, wo die Wildnis am stärksten gefährdet war, am schwersten fassbar und mir am fremdesten.
Außerdem beschloss ich, auf meiner Reise eine Karte zu zeichnen – als meinen Gegenentwurf zum Straßenatlas. Eine Prosakarte, die einige der letzten Flecken Wildnis der Inselgruppe wieder sichtbar machen oder sie noch einmal beschreiben sollte, ehe sie für immer verschwanden. Diese Karte würde, so hoffte ich, nicht Städte, Orte, Hotels und Flughäfen verbinden. Sondern Landzungen, Klippen, Strände, Gipfel, Berge, Wälder, Flussmündungen und Wasserfälle.
Das vorliegende Buch ist diese Karte. Mit dem Schreiben begann ich, als ich mich in Richtung Westen aufmachte, den spitzen Arm der nordwalisischen Lleyn-Halbinsel entlang und hinaus zu einer abgelegenen Insel mit dem ersten Aufschimmern eines wilden Bewusstseins.
2 Insel
Auf den Bugwellen schimmerte das tiefe Abendlicht. Ein starker Wind wehte, und das Boot krängte um zwanzig Grad zur Horizontalen. Die Segel waren straff, die See grau und aufgewühlt. Alle drei hielten wir uns an Holz und Drahtseilen, suchten auf dem schrägen Deck nach Halt. Ich stand am Steuer und mühte mich, geraden Kurs auf die Insel zu halten. Ich spürte die Strömung, die seitlich gegen das Boot drückte und uns nach Norden riss, zu den fernen Felsen des Festlands, wo sich in feiner Linie blass die Brandung brach. Über der Küste hingen zwei dünne Wolkenschichten, schwarz auf weiß: ein Zeichen für Störung in der Luft.
Ein früher Abend im Frühsommer, vor dem westlichsten Zipfel der Lleyn-Halbinsel. Wir hatten den Hafen erst spät verlassen, obwohl wir wussten, dass ein kräftiger Wind ging und uns höchstens drei Stunden bis zur Dunkelheit blieben.
Das Boot fuhr mit annähernd acht Knoten und war in ein gleichmäßiges Nicken gekommen; plötzlich ein Knirschen, und ein weißes Etwas stieg heftig flatternd in die Höhe wie ein Schwan. Jäh zog das Boot leewärts und verlor an Fahrt, als wäre das Wasser dickflüssig geworden, und wir schleuderten nach vorn. Kalte Gischt schoss empor, brach über Steuerbord und schlug mir ins Gesicht. Dann hörte ich ein Geräusch, das wie ein unregelmäßiges Trommeln klang.
Vorn am Bug war das Stagsegel vom Deck gerissen worden. Der dicke Bolzen, in den es eingehakt gewesen war, hatte sich unter dem Druck des Windes gelöst, und nun flatterte es, nur noch am Masttop gesichert, fast frei in der Luft. Die schwere Metallspule am losen unteren Ende des Segels schwang wild herum und hämmerte aufs Glasfaserdeck.
John, der Kapitän, gab kurze, klare Befehle. Er übernahm das Steuer, drehte das Boot zurück in den Wind und übergab es dann wieder mir, damit ich den Kurs hielt. Schäumende Gischt spülte über Deck. Johns Ehefrau Jan hangelte sich die aufgebuckelte Bootseite entlang, ergriff die Spule und band sie an der Reling fest. Das Segel wurde geborgen, wir trotzten es dem Wind wieder ab, rollten es auf und klebten es an Deck fest.
Die letzte Stunde verging in der Ruhe, die nach dem Sturm folgt. Da weniger Segel gehisst waren, fuhren wir nun langsamer. Vier Knoten, selten mehr.
Die untergehende Sonne konturierte die südwestlich vor uns liegende Insel: ein großer schwarzer Rücken aus Fels und Kliff, der sich fünfzehn Meter hoch aus dem Wasser hob und in einen langen, flachen Landarm auslief. Auf diesem Arm stand ein großer Leuchtturm, dessen matte Spiegel alle paar Sekunden aufblitzten.
Schließlich gerieten wir in den Windschatten der Kliffs, und unser einziges Segel hing luftlos schlaff am Hauptmast. Als Willkommensgruß oder als Wunder – natürlich war es weder das eine noch das andere – brach die tiefstehende Sonne durch die Wolken, verwandelte die See in strahlendes Silber, auf dem wir in den schützenden kleinen Hafen einliefen.
Wie wir uns der Küste näherten, füllte ein hohes Wehklagen die Luft, das zunehmend lauter wurde. Ich hielt es für einen akustischen Effekt des Windes – die singende Luft in den gespannten Drahtseilen des Bootes – und wandte mich zu meinen Gefährten, ob sie es vielleicht auch gehört hatten. Als das Geräusch noch lauter wurde, stellte ich fest, dass es kein einzelner, sondern Dutzende unterschiedlicher Töne waren, die alle in der Höhe leicht voneinander abwichen. Da begriff ich. Seehunde! Das Wehklagen kam von ihnen: Auf jedem Felsen in der Bucht, auf jeder tangbewachsenen Schäre lagen, wie auch entlang der gewundenen Küstenlinie, Hunderte von Seehunden. Sie gaben dieses Geräusch von sich, ohne dass man es sah, wie Bienen oder Wasser. Ihre Färbung war mannigfaltig: Grau, Schwarz, Weiß, Gelb, Fuchsrot und Lederbraun. Als wir an drei kleineren Weibchen vorbeisegelten, sah ich in ihrem Fell elegante Kringel und Konturen.
John ruderte mich mit dem Beiboot an Land, ließ es auf den dämmrigen Kiesstrand auflaufen. Von dort ging ich schließlich allein durch den Cantus planus der Seehunde landeinwärts und machte mich auf die Suche nach einem Schlafplatz.
Die Insel trägt den Namen Ynys Enlli, was so viel bedeutet wie ›Insel der Strömungen‹. Der Name ist gut gewählt, da rund um Enlli mehrere Gezeitenströme brodelnd aufeinandertreffen. Ein Gezeitenstrom entsteht, wenn die See bei Ebbe oder Flut mit hoher Geschwindigkeit durch eine Rinne schießt. Das Wasser verhält sich, gerade wenn zwei oder mehr Gezeitenströme aufeinandertreffen, auf unvorhersehbare Weise. Beim Gezeitenwechsel kann es geradezu spiegelglatt ruhen, aber bei Ebbe oder Flut verschränken sich unter der Oberfläche die Ströme ineinander, dass das Wasser aufschäumt. Wo verschiedene Gezeitenströme zusammenkommen, richten sich Wellen wie Haifischflossen auf, und das Meer kocht vor aufsteigenden Blasen, als würde der Meeresgrund aufgewühlt.
Gezeitenströme können bis in scheinbar offenes Wasser hineinreichen. Wenn ein solcher Strom auf eine Landzunge stößt, wie etwa an der Spitze der Lleyn-Halbinsel, wird er zur Seeseite abgelenkt. Wie weit, hängt von seiner Geschwindigkeit ab: Schnelle Ströme können über viele Kilometer einen bedrohlichen Arm bilden. Man begreift sofort, weshalb die ersten Seefahrer, die in den Sog einer solchen Strömung gerieten, bestimmten Landzungen oder Halbinseln eine überirdische Heimtücke zuschrieben.
Ynys Enlli ist einer von vielen abgelegenen Orten an der westlichen und nordwestlichen Küste Englands und Irlands, die zwischen 500 und 1000 n. Chr. besiedelt wurden. In dieser Zeit gab es erstaunliche Wanderbewegungen. Tausende Mönche, Eremiten, Klausner und andere umherziehende Gläubige zog es in Buchten und Wälder, auf Landspitzen und Gipfel und die Inseln der Atlantikküste. Mit ungeeigneten Schiffen und ohne viel Segelerfahrung fuhren sie über gefährliche Meere und suchten nach ›Wildnis‹, wie wir heute vermutlich sagen würden. Wo sie hielten, bauten sie Klöster, Klausen und Kapellen, hoben Gräber für ihre Toten aus und errichteten Steinkreuze für ihren Gott. Diese Reisenden wurden landläufig peregrini genannt: Der Begriff stammt vom lateinischen Wort peregrinus ab und bezeichnet jemanden, der eine Strecke gewandert ist, was wir noch in dem Wort ›Pilger‹ wiederfinden. Ehe ich nach Enlli fuhr, hatte ich in eine Landkarte die bekannten Routen und Landungsorte dieser Wanderschaften eingezeichnet und erhielt so ein filigranes Maßwerk der bis heute wildesten Orte Englands und Irlands.
Die keltisch-christliche Kultur der Einsiedelei stammt aus dem Irland des 5. und 6. Jahrhunderts. Sie geht auf die Heiligen in der Einöde zurück, wie es sie in den vorangegangenen Jahrhunderten gegeben hatte, setzte um 430 mit dem Heiligen Patrick ein und breitete sich bis ins heutige Westschottland und an die walisischen Küsten aus: eine zentrifugale Kraft, die die Menschen an die äußersten Ränder Europas und darüber hinaus trug.
Es leuchtet ein, dass diese abgelegenen Orte ein Spiegel der Gemütsruhe und Entsagung der peregrini waren. Die Reisen zu diesen wilden Orten standen für die Sehnsucht, eine Entsprechung zwischen Glauben und Ort, zwischen innerer und äußerer Landschaft zu finden. Wir können mutmaßen, dass die Mönche in die Ferne gingen, um alles bewohnte Land hinter sich zu lassen: Land, auf dem alles und jedes einen Namen trug. Fast alle keltischen Ortsnamen sind Namen des Gedenkens: Noch im 17. Jahrhundert lehrten die Bardenschulen die Geschichte der Orte anhand ihrer Namen, sodass die Landschaft zum Schauplatz der Erinnerung wurde, der seinen Bewohnern ihre Zugehörigkeit und Verbundenheit beständig ins Gedächtnis rief. Wer von den benannten Orten (deren Topografie stets mit Gemeinschaft und Erinnerung aufgeladen war) an die Küsten (die unkartierten Inseln, die anonymen Wälder) reiste, traf dort auf Land ohne jedes Zeichen von Inbesitznahme. Damit trat er aus einem Land der Geschichte in ein Land der Unendlichkeit.
Ynys Enlli ist aus den frühen Jahren des keltischen Christentums als Pilgerziel der peregrini bekannt, und man nimmt an, dass dort im 6. Jahrhundert das erste Kloster errichtet wurde. Obwohl die Insel schwer zugänglich ist, zählt sie dennoch zu den am leichtesten erreichbaren Mönchssiedlungen. Man fragt sich, wie es den Mönchen gelungen ist, Landstriche wie die Gavellochs zu besiedeln – jene Inseln vor der Küste von Argyll, wo sie vor über eintausend Jahren lose Steine zu bienenkorbförmigen Hütten aufeinanderschichteten –, oder Skellig Michael – jenen Felszahn, der vierzehn Kilometer westlich vor Kerry 217 Meter aus dem Atlantischen Ozean ragt. Die obersten Hänge von Skellig Michael sind übersät mit Klausen, die die im 6. Jahrhundert angelandeten Mönche auf dem Fels gebaut hatten. Sämtliche Klausen, die der Buße und der Meditation dienten, waren zum Atlantik hin ausgerichtet. Der Fels darunter fällt so jäh und steil ab, dass man kaum glaubt, festen Boden unter sich zu haben, und einen das Gefühl befällt, hoch über Luft und Wasser zu schweben. Hier, mit dem Blick auf den sich weit erstreckenden Ozean und den freien, unverstellten Horizont, hatten die Mönche alle Zeit der Welt, um über die Unendlichkeit nachzusinnen.
Im September 1910 reiste George Bernard Shaw in einem klinkergebauten Ruderboot zu den Skelligs. Bei ruhigem Wetter dauerte die Überfahrt zweieinhalb Stunden; die Rückfahrt indes sollte länger und anstrengender werden. Durch dichten Nebel und Dunkelheit, ohne Kompass, ohne Mond steuerten Shaws Begleiter das Boot nur nach ihrem Instinkt und ihrer Erfahrung durch Gezeitenströme, Wind und Wellen. Am Abend des darauffolgenden Tages schrieb Shaw im Parknasilla Hotel in Sneem am Kaminfeuer seinem Freund Barry Jackson einen Brief über die Erlebnisse auf Skellig Michael: »Eines kann ich dir sagen, dieser Ort gehört zu keiner Welt, in der du oder ich jemals gelebt oder gewirkt hätten. Er ist Teil unserer Traumwelt … Ich habe immer noch nicht das Gefühl, wieder ganz in die Realität zurückgekehrt zu sein!« Die Skellig-Insel regte Shaw, wie schon die Mönche, die vor ihm dort gelebt hatten, zu einem Denken an, das nirgendwo anders möglich gewesen wäre. Es war ein Ort für tiefe Träumerei.
Die Seereisen, die die peregrini unternahmen, sind höchst beachtlich. Wir hatten Schwierigkeiten, Ynys Enlli mit einer hochseetauglichen 10-Meter-Jacht zu erreichen. Shaw hatte bei seiner Rückkehr von den Skelligs in einem gut ausgestatteten Ruderboot um sein Leben gefürchtet. Die Mönche aber mussten in Nussschalen von viel schlechterer Bauart, die noch weniger Schutz boten, zu den Skelligs übersetzen und unternahmen im rauen Nordatlantik zudem sehr viel längere und gefahrvollere Reisen – bis hinauf nach Island oder Grönland.
Ihre Boote trugen je nach Tradition unterschiedliche Namen: In Wales hießen sie ›coracle‹ oder ›curricle‹, auf Gälisch sagte man ›carraugh‹, auf Nordisch ›knarr‹. Auch in der Form unterschieden sie sich: Das curragh war meist lang und schmal, hatte eine Stupsnase und einen rechtwinklig abfallenden Bug, während das coracle linsenförmig war. Die Bauweise hingegen war identisch. Der Schiffsrumpf bestand aus Rindsleder, das zunächst mit Eichenlohe gegerbt, dann angefeuchtet und über einen Rahmen aus Ruten und gebogenen Kanthölzern gespannt wurde. Die trocknende Tierhaut zog sich über dem Rahmen zusammen, bis dieser fest wurde. Anschließend fettete man das Ganze zur Abdichtung mit Talg. Eine weitere Gemeinsamkeit dieser Boote war die Fahrund Manövrierweise. Dank ihrer Leichtigkeit und ihres flachen Kiels konnten sie gut über Strömungen, kabbelige See und Wellen hinweggleiten. Darin lagen bei Fahrten auf strömungsreichem Gewässer ihre Vorzüge: In ihrer maritimen Listigkeit bewegten sie sich, fast ohne Tiefgang, wendig und mit der sachten Berührung eines Wasserläufers über das Meer.
Im letzten Licht des Tages ging ich nahe von Enllis südlichster Spitze über eine Wiese verblühter Strand-Grasnelken, jener gedrungenen Blumen, die im Salzklima des Küstensaums besonders üppig wachsen. Die spröden Köpfe zitterten im Wind auf ihren steifen Stängeln, sodass man in der Dämmerung meinen konnte, dass der Boden wankte. Von Süden her hörte ich die klappernden Flügel eines Kormorans, der aus dem Wasser aufstieg. Ich sah den flimmernden Lichtschein aus der Kajüte des Bootes, das schaukelnd in der Bucht lag, und wünschte mir für einen Moment, ich wäre an Bord bei John und Jan: mit warmem Essen, einem Whisky und in guter Gesellschaft.
Dann wandte ich mich um und schaute aufs Festland. Es lag nur noch als Strich in der Dämmerung, dünn wie ein Drahtseil. Die Mönche mussten ihre Boote in den kleinen Buchten der Halbinsel zu Wasser gelassen haben. Selbst jetzt, im Sommer, kann es bei schlechtem Wetter zwei oder drei Tage dauern, ehe sich die Insel anfahren lässt. Wenn die Winterstürme einsetzen, ist Enlli zuweilen für Wochen vom Festland abgeschnitten.
Die Mönche mussten immer sehr sorgsam den richtigen Zeitpunkt abgepasst haben. Das lange Warten auf ruhige See. Das Beobachten der Gezeiten. Dann das Zuwasserlassen des Bootes, die knirschenden Kiesel, das platschende Wasser. Die Boote, die schon in der Dünung der Bucht zu schlingern begannen, und schließlich die Ausfahrt in die ungeschützte Meerenge, wo unter ihnen, in den tieferen Schichten, die Gezeitenströme rauschten.
Wie ausgeliefert sie sich gefühlt haben mussten, dachte ich. Aber vielleicht stimmte das auch gar nicht, vielleicht hatten sie einen so unbedingten Glauben, dass dieser an Fatalismus grenzte – eine besondere Art der Furchtlosigkeit. Sicher sind viele von ihnen – namenlos und nirgends erwähnt – in dieser Meerenge verunglückt und fanden in den Wellen und Strömungen den Tod. »Es gibt da eine Insel, zu der man nur / im kleinsten Boot gelangt«, schrieb der Dichter und Geistliche R. S. Thomas aus der Gemeinde Aberdaron, die vom Festland aus auf Enlli schaut:
… über den Wegder Heiligen entlang den Fratzen der Ertrunkenen,die mit vollem Mund den Kies der Strände kauen …
Es gibt nur wenig gesichertes Wissen über die peregrini. Wir kennen nur wenige Namen. Doch als ich die Darstellungen ihrer Reisen und Erlebnisse an Orten wie Enlli las, erkannte ich darin würdige Beweggründe und eine heilsame Geisteshaltung. Diese Männer begaben sich nicht auf die Suche nach materiellem Gewinn, sondern nach heiligen Landschaften: Landschaften, die ihren Glauben unerschütterlich machen sollten. Sie waren ihrer eigenen Religionsauffassung nach Verbannte auf der Suche nach der Terra Repromissionis Sanctorum – dem Gelobten Land der Heiligen.
Es gibt eine lange christliche Tradition, nach der alle Menschen peregrini sind, da alles menschliche Leben als Exil verstanden wird. Dieser Gedanke lebt im Salve Regina fort, jenem Gesang, der oft zum letzten Geleit erklingt. Post hoc exilium heißt es dort an einer Stelle: Nach diesem Exil wird alles wieder gut sein. Gesungen klingt das Salve Regina altertümlich und beunruhigend. Diese Musik setzt sich unverkennbar mit der Wildnis auseinander, einer frühen Vorstellung von Wildnis, und vermag uns auch heute noch zu rühren.
Vieles von dem, was wir über das Leben der Mönche auf Enlli und an ähnlichen Orten wissen, entnehmen wir der umfassenden Literatur, die sie hinterlassen haben. Ihre Gedichte sind beredte Zeugnisse davon, wie rein und leidenschaftlich ihre Beziehung zur Natur war und wie sich Empfänglichkeit und Distanznahme darin mischten. Einige Gedichte lesen sich wie eine flüchtig notierte Auflistung oder wie Feldnotizen: »Bienenschwärme, Käfer, sanfte Musik der Welt, ein leises Summen; Ringelgänse, Nonnengänse, kurz vor Allerheiligen, Musik des dunklen wilden Stroms.« Andere berichten von Augenblicken der Verzückung: dem Gesang einer Amsel, die bei Belfast Loch auf einem Ginsterzweig sitzt, oder von Füchsen, die sich auf einer Lichtung tummeln. Der Eremit Marban, der im 19. Jahrhundert in einem Tannenwäldchen nahe Druim Rolach in einer Hütte wohnte, schrieb von der »Stimme des Windes im dichten Wald an einem Tag grauer Wolken«. Ein namenloser Mönch, der im 9. Jahrhundert auf der Insel North Rona eine Trockenmauer zu errichten hatte, unterbrach seine Arbeit, um ein Gedicht über die Beglückung zu schreiben, als er »auf der hellen Landzunge« über das »glatte Ufer« hin zur »ruhenden See« blickte und den Gesang der »wundersamen Vögel« hörte. Ein Schreiber aus dem 10. Jahrhundert, der auf einer Insel im Kloster lebte, unterbrach seine Tätigkeit gerade so lange, um neben den lateinischen Text eine kurze Notiz auf Gälisch zu kritzeln: »Mich erfreut, wie die Sonne heute glänzend auf die Seiten fällt.«
Fundstücke wie diese geben uns Einblick in die Natur des Glaubens der peregrini. Es sind Momentaufnahmen, die über weite Entfernungen in der Geschichte ganz unverfälscht hinweggetragen wurden, wie bestimmte Geräusche, die über Wasser oder gefrorenes Land noch in der Ferne ungewöhnlich klar zu vernehmen sind. Die Betrachtung der Natur war für diese Autoren eine Form der Andacht und Anteilnahme, die Verehrung gleichkam. Die Kunstwerke, die sie uns hinterließen, zählen zu den frühesten Zeugnissen der Liebe des Menschen zur wilden Natur.
Begriffe sind trügerisch wie Wellen. Sie begleiten uns über immense Entfernungen, doch ihre Vergangenheit ist oft unsichtbar oder lässt sich nur schwerlich entziffern. ›Wildnis‹ ist so ein Begriff, der ungeheure zeitliche Entfernungen zurückgelegt hat. Einst gab es zwei große Erzählungen über die Wildnis, die in Konkurrenz zueinander standen. In der ersten Erzählung ist Wildnis ein Zustand, der bezwungen werden muss; in der zweiten ein Zustand, der in Ehren zu halten ist.