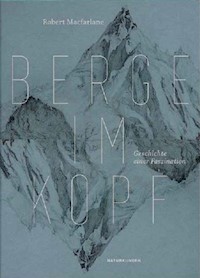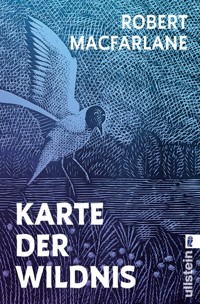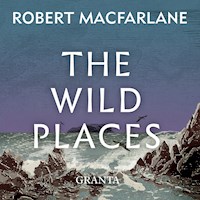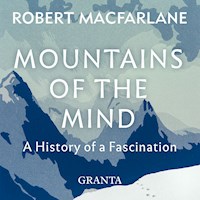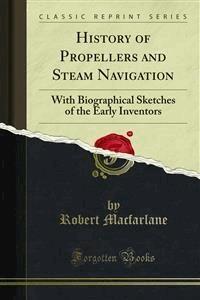15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Robert Macfarlane folgt den alten Wegen – jenen Pfaden, Hohlstraßen, Fuhrten, Feld- und Seewegen, die seit der Antike die menschlichen Siedlungsräume miteinander verbinden und noch immer als unsichtbare Wegweiser unsere Bewegungen bestimmen. Seine Reise führt den wichtigsten Naturschriftsteller Großbritanniens von den englischen Kreidefelsen zu den einsamen Vogelinseln Schottlands, von den Kulturlandschaften Spaniens zu den Pilgerrouten Palästinas und bis in den Himalaya. Sie lässt ihn in fünftausend Jahre alte Fußstapfen treten und in einem kleinen Segelboot auf den nächtlichen Atlantik hinaustreiben. Er lauscht den Geschichten, die diese alten Wege noch immer erzählen, und den Stimmen derjenigen, die er auf seinen Fußmärschen begegnet: andere Wanderer, Spaziergänger und Sinnsucher, sogar tibetanische Mönche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Alte Wege
ROBERT MACFARLANE, 1976 in Nottinghamshire geboren, lehrt Literaturwissenschaft in Cambridge, ist Essayist und Kritiker und gilt als wichtigster britischer Autor des Nature Writing. Er ist Fellow der britischen Royal Society of Literature und Gründungsmitglied der Naturschutzorganisation Action for Conservation. Bei Ullstein sind bislang Karte der Wildnis und Alte Wege erschienen.
Robert Macfarlane folgt den alten Wegen – jenen Pfaden, Hohlstraßen, Feld- und Seewegen, die seit der Antike die menschlichen Siedlungsräume miteinander verbinden und noch immer als unsichtbare Wegweiser unsere Bewegungen bestimmen. Seine Reise führt den wichtigsten Naturschriftsteller Großbritanniens von den englischen Kreidefelsen zu den einsamen Vogelinseln Schottlands, von den Kulturlandschaften Spaniens zu den Pilgerrouten Palästinas und bis in den Himalaya. Sie lässt ihn in fünftausend Jahre alte Fußstapfen treten und in einem kleinen Segelboot auf den nächtlichen Atlantik hinaustreiben. Er lauscht den Geschichten, die diese alten Wege noch immer erzählen, und den Stimmen derjenigen, die er auf seinen Fußmärschen begegnet: andere Wanderer, Spaziergänger und Sinnsucher, sogar tibetanische Mönche. Diese alten Pfade, begreift er bald, sind mehr als Möglichkeiten, einen Raum zu durchmessen. Nach ihrer jahrhundertelangen Begehung sind sie vielmehr auch Knotenpunkte unseres Denkens, Netzwerke unseres Wissens und ein geographisches Gewebe unserer Gefühle geworden.
Robert Macfarlane
Alte Wege
Aus dem Englischen von Andreas Jandl und Frank Sievers
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Juli 2024Copyright © der deutschen Ausgabe 2024 Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinCopyright © der englischen Originalausgabe 2012, The Old Ways: A Journey on Foot, by Robert Macfarlane; Penguin Randomhouse UKTypographie und Lithographie: Pauline Altmann, BerlinDie deutsche Ausgabe dieses Buches erschien zuerst in der Reihe Naturkunden, herausgegeben von Judith Schalansky bei Matthes & Seitz.Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenTitelabbildung: shutterstock / © ArezzAutorenfoto: © Angus MuirE-Book-Konvertierung powered by PepyrusAlle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN 978-3-8437-3148-5
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Das Buch
Titelseite
Impressum
Vorbemerkung des Autors
I Fährten (England)
Fährte
Pfad
Kreide
Watt
II Fußstapfen (Schottland)
Wasser – Süden
Wasser – Norden
Torf
Gneis
Granit
III Ferne (Ausland)
Kalkstein
Wurzeln
Eis
IV Heimkehr (England)
Schnee
Flintstein
Geist
Spur
Glossar
Verwendete Literatur
Weiterführende Literatur
Anhang
Danksagung
Anmerkungen
Leseprobe: Karte der Wildnis
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Vorbemerkung des Autors
Vorbemerkung des Autors
Dieses Buch hätte nicht im Sitzen geschrieben werden können. Es handelt von der Beziehung zwischen Pfaden, Gehen und Vorstellungskraft, weshalb sich das Denken zumeist im Laufen vollzog – und nicht anders hätte vollziehen können. Obwohl Alte Wege das dritte Buch einer losen Trilogie über Landschaften und das Innere des Menschen ist, lässt es sich auch ohne die Kenntnis oder das Geleit seiner Vorgänger lesen. Es erzählt davon, wie ich tausend und mehr Meilen auf alten Wegen zurücklege, um Fährten in die Vergangenheit zu finden, nur um immer und immer wieder in der Gegenwart zu landen. Es erkundet die Geister und Stimmen, die solche alten Pfade heimsuchen, die Geschichten, die den Wegen innewohnen und von ihnen erzählt werden, die Pilgerreisen und Grenzüberschreitungen, die Traumpfade und ihre Sänger und die sonderbaren Kontinente, die sich in einem Landstrich verbergen. Vor allem aber erzählt dieses Buch von Menschen und Orten : vom Gehen als einer Entdeckungsreise ins Innere und davon, auf welch subtile Weise die Landschaften, die wir durchqueren, uns prägen und formen.
I Fährten (England)
Fährte
Alle Dinge zeichnen unablässig ihre Geschichte auf … nicht als Fußabdrücke in Schnee oder Erde, sondern in Form vielerlei Spuren, die kürzer oder länger überdauern, eine Kartografie ihres Vorübergehens. Der Erdboden ist überall von Hinweisen und Zeichen überzogen; und jedes Ding ist über und über mit Spuren bedeckt. In der Natur geschieht die ständige Fährtenlegung ganz automatisch, und ihre Aussage verhält sich zum Geschehen wie der Abdruck im Wachs zum Petschaft.
ralph waldo emerson, 1850
Zwei Tage vor der Wintersonnenwende; Gezeitenwechsel des Jahres. Den ganzen kalten Tag wirkten Stadt und Land wie angehalten, abgestellt. Fünf Grad unter null, die Luken der Erde dicht. Die Wolken voller Schnee, der nicht fallen wollte. Die Schulen in den Vororten geschlossen, die Menschen ans Haus gekettet, spiegelglatte Bürgersteige, vereiste Straßen. Im flachen Bogen zog die Sonne über den Himmel. Dann, kurz bevor es dämmerte, kam der Schnee – und fiel fünf Stunden ohne Pause, drei Zentimeter die Stunde.
Ich saß an diesem Abend am Schreibtisch, ohne zu arbeiten, weil das Wetter mich ablenkte. Immer wieder hielt ich inne, stand auf, sah aus dem Fenster. Der Schnee segelte durch den orangen Kegel einer Straßenlaterne, dicke Flocken wie Funken aus dem Hochofen.
Gegen acht Uhr hörte es auf zu schneien. Eine Stunde später ging ich hinaus, eine Runde drehen, den Flachmann mit Whisky zum Aufwärmen in der Tasche. Ich lief einige hundert Meter durch dunkle Nebenstraßen, auf denen reiner, unberührter Schnee lag. Die Häuser wurden weniger. Wo die Vorhänge nicht zugezogen waren, sah ich Familien vor flackernden plappernden Fernsehern. Die Kälte spitz wie Draht in der Nase. Ein Schwall Sterne, die Welt silbern überspült vom Mond.
Am südlichen Ende der Siedlung steht vor einer Weißdornhecke die letzte Laterne, daneben ein Loch in der Hecke, das auf einen schmalen Feldweg führt.
Ich folgte dem Feldweg in ostsüdöstlicher Richtung hinauf zur Kuppe eines langgestreckten Kreidehügels, der im Dunkeln wie ein Walfischrücken glänzte. Im Norden leuchtete die Stadt, rot blinkende Flugwarnleuchten auf Türmen und Kränen. Der Schnee knirschte trocken unter meinen Schritten. Über das Feld im Westen trabte ein Fuchs. Der Mond war so hell, dass alles scharfe Schatten warf. Schwarz auf Weiß, holzschnittartig. Hartriegel-Ruten warfen Zebra-Muster auf den Pfad; Weißdorne ein Gitter. Die Bäume weiß verziert, mit zentimeterdickem Schnee auf Ästen und Zweigen. Im Schnee wirkte alles größer, das Mondlicht schien alles zu verdoppeln.
Diesen Pfad bin ich vermutlich öfter gelaufen als jeden anderen. Es ist ein junger Weg, vielleicht fünfzig Jahre alt, kaum mehr. Die Hecke nach Osten hin besteht hauptsächlich aus Weißdorn und ist knapp drei Meter hoch; im Westen steht eine jüngere Mischung aus Schwarzdorn, Weißdorn, Haselnuss und Hartriegel. Keine sonderlich schöne Strecke, aber beidseitig von Hecken gesäumt fühle ich mich auf meinem Weg zwischen Feld und Straße angenehm abgeschirmt und geborgen. Im Sommer sah ich hier aus Kardenköpfen kleine Stieglitzwolken aufsteigen, die immer wieder ein Stück weiterflogen, sich kurz setzten und so, während ich mich näherte, immer denselben Abstand zu mir wahrten.
An diesem Abend war der Pfad eine graue Schneegasse, die ich bis zu einem mit Birken bewaldeten Hang hinaufging, oben auf dem Walrückenhügel, wo der Lehmboden in blanke Kreide übergeht. Am hinteren Saum des Birkenhains schlüpfte ich durch eine efeubedeckte Lücke auf das vierzig Morgen große freie Feld.
Auf den ersten Blick schien das Feld makellos; eine weite Eisfläche. Doch als ich es betrat und querfeldein lief, entdeckte ich mehr und mehr Abdrücke. Der Schnee war dicht überzogen mit den Spuren von Vögeln und Tieren – ein Archiv Hunderter Wegstrecken, aufgezeichnet seit dem Ende des jüngsten Schneefalls. Es gab markante Spuren von Rotwild, Abdrücke von Rebhühnern, die wie Pfeilspitzen den Weg wiesen, und die Löcher von Kaninchenpfoten. Einige Spuren führten im Bogen von mir weg, verschwanden in der Dunkelheit oder in einer Hecke. Auf der schrägen Feldfläche vertiefte das Mondlicht die näher gelegenen Abdrücke noch, sodass sie wie gefüllte Tintenfässer wirkten. Zu all diesen Spuren fügte ich meine hinzu.
Der Schnee war erstaunlich gut lesbar. Jede Fährte schien eine rückwärts zu lesende Abhandlung, eine Reihe von Hinweisen auf vergangene Geschehnisse. Ich entdeckte eine Linie von Fuchspfoten, die da und dort vom Schwanz verwischt waren, als hätte das Tier seine eigenen Spuren auslöschen wollen. Und ich sah, wie ich vermutete, Abdrücke eines Fasans beim Abflug : tiefe Fußspuren dort, wo er Anlauf genommen hatte, dann in einigen Abständen die Abdrücke von Federn zu beiden Seiten, die langsam feiner wurden und schließlich völlig verschwanden.
Ich beschloss, der Spur des Rotwilds zu folgen, die in einem scharfen Winkel um eine Ecke des Feldes verlief. Sie führte durch eine Schwarzdornhecke : Ich kletterte mühsam hindurch und betrat eine surreale Landschaft.
Im Norden fiel das Land über etwa 300 Meter sacht ab. Im Süden und oberhalb meines Standorts säumten große weiße Höcker scheinbar einen hübschen kleinen See, in dessen Mitte ein Flaggenstock steckte. Buchenwäldchen und Kiefernstände, jähe Senken und Rinnen, rundliche Hügel und lange Täler.
Ich ging zum See, betrat seine Oberfläche, setzte mich neben den Flaggenstock und nahm einen Schluck Whisky. In der Dunkelheit von den Golfern befreit, durch Schnee und Mondlicht verwandelt, war der exklusivste Golfplatz der Grafschaft zu einem seltsamen Reich der freien Natur geworden. Scheinheilig Entschuldigungen gegenüber den Clubmitgliedern murmelnd, verließ ich das erste Grün und machte mich daran, den Platz zu erkunden. Ich lief direkt in der Mitte der Fairways, meinen durch nichts deformierten Schatten an der Seite. In den Bunkern lag wadentief Schnee. Auf dem fünften Grün legte ich mich auf den Rücken und betrachtete das langsam drehende Rad der Sterne.
Die meisten Spuren auf der Anlage stammten von Kaninchen. Wer Kaninchenspuren im Schnee kennt, weiß, dass sie Geistermasken ähneln oder dem Gesicht von Edvard Munchs Der Schrei : Die Hinterläufe zeichnen seitlich zwei lang gezogene Augen, zwischen denen die Vorderpfoten auf leicht versetzter Linie eine Nase und einen ovalen Mund bilden. Aus dem Schnee starrten mich Tausende solcher Gesichter an.
Gelegentlich zogen Autoscheinwerfer als lange gelbe Lichttunnel die Straße nach Westen entlang. Auf dem zwölften Fairway rannte ein großes, dunkles Etwas aus dem Schatten eines Baumes ins Gebüsch : Es sah aus wie ein Wolf, musste aber ein Reh oder Fuchs gewesen sein und versetzte mir einen dummen Schreck, der mir wie Nadeln in die Handrücken fuhr.
Am anderen Ende des Golfplatzes folgte ich Kaninchenspuren durch eine weitere Schwarzdornhecke auf die Römerstraße, die kilometerweit über niedrige Kreidehügel führt. Unterm Schnee war die alte Trasse überwältigend schön – eine weiße, weit in beide Richtungen führende Linie –, der ich nach Südosten folgte. Zu beiden Seiten sah ich durch die Hecken weite Felder, die das Mondlicht als blasse harte Rechtecke nach oben zurückwarfen. Von einer hohen Esche ließ ein Vogel Schneetupfen auf den Weg fallen, wie helle Flecken auf alten Filmen.
Die Entfernungen schienen seltsam gedehnt oder die Zeit zusammengezogen, weil ich glaubte, bereits viele Kilometer oder Stunden gelaufen zu sein, als ich eine mir bekannte Stelle erreichte, an der eine breite Birkenallee von der Römerstraße abzweigt. Ich lief durch die Allee, die Wälle einer großen eisenzeitlichen Ringfestung entlang, überquerte eine Straße und kam auf eine weitläufige Wiese, die sich bis zur Kuppe eines unbewaldeten Kreidehügels erstreckt, dessen höchster Punkt gut achtzig Meter über dem Meeresspiegel liegt. Holzkohlenschwarze Bäume, auf der Zunge ein Geschmack von Zinn.
An der höchsten Erhebung setzte ich mich in den Schnee, Mondschein, in der Nähe schemenhaft ein bronzezeitliches Hünengrab, und trank noch einen Schluck Whisky. Als ich zurückblickte, sah ich die Linie meiner eigenen Fußspuren zum Gipfel hinauf. In einiger Entfernung liefen im Nordwesten Dutzende anderer Fährten wie gedruckt den Hügel hinab in die Ferne. Ich suchte mir eine dieser Fährten aus, um ihr zu folgen und zu sehen, wohin sie wohl führte.
Pfad
Fährte ~ Trampelpfade & Hohlwege ~ Eis blau & klar ~ Utsi’s Stone ~ Ein Labyrinth von Freiheit ~ Einvernehmliches Tun ~ Wunschlinien ~ George Borrow ~ Die »horrors« ~ Geistertrassen ~ Ein territoriales Muster ~ Kosmisch-komische Visionen ~ Edward Thomas ~ »Geduldige sublunare Beine« ~ Hänsel & Gretel ~ Hodologie ~ Schritte als Wissen ~ Traumpfade ~ Der »Weg der Verdammnis« & Sternschnuppenschwärme ~ Biogeografie ~ Das poetische Knistern des Hochspannungsmasts
Menschen sind Tiere, und wie alle Tiere hinterlassen wir auf Schritt und Tritt Spuren : sichtbare Zeichen in Schnee, Sand, Schlamm, Gras, Tau, Erde oder Moos. Die Jägersprache besitzt ein lichtes Wort für diese Art von Ein- und Abdruck : ›Fährte‹. Die Fährte eines Tieres ist seine Spur. Nur vergessen wir heute oftmals, dass auch wir Spuren hinterlassen, weil wir zumeist auf Asphalt oder Beton laufen – Materialien, die nicht leicht zu prägen sind. »Immer und überall sind Menschen gegangen und haben die Erde mit sichtbaren und unsichtbaren, symmetrischen und mäandernden Pfaden überzogen«, schreibt Thomas Clark in seinem eindrücklichen Prosagedicht In Praise of Walking (Lob des Wanderns). Tatsächlich sieht jeder, der seine Aufmerksamkeit auf Pfade und Wege richtet, dass die Landschaft von ihnen durchfurcht ist – im Schatten des modernen Straßennetzes, das sie zuweilen schräg oder im rechten Winkel kreuzen. Spricht man all die verschiedenen Namen für Wege schnell vor sich hin, werden sie gleichsam zum Gedicht oder zur Liturgie : Saumpfade, Pilgerpfade, Feldwege, Viehtrifte, Leichenwege, Trampelpfade, Stege, Ley-Linien, Deichwege, Heckenwege, Handelspfade, Treidelpfade, Pässe, Gassen, Pisten, Gehsteige, Chausseen, Hohlwege, Wanderwege, Kreuzwege, Dammwege, Kirchwege, Seewege, Reitwege, Heidewege, Rennsteige.
In vielen Regionen gibt es noch die alten Wege, Verbindungstrassen zwischen den Orten, die über Pässe oder um Berge herum zu einer Kirche oder Kapelle, zu einem Fluss oder zum Meer führen. Nicht alle zeugen von einer frohen Vergangenheit. In Irland gibt es Hunderte Meilen famine roads : In den 1840 er Jahren von verhungernden Menschen für fast nichts erbaute und ins Nichts führende Straßen, die auf keiner amtlichen Grundkarte verzeichnet sind. In den Niederlanden gibt es doodwegen und spookwegen – die Straßen der Toten und der Geister –, die zu den mittelalterlichen Friedhöfen führen. Spanien verfügt nicht nur über ein breites, funktionstüchtiges Netz an cañada, den Viehtriften, sondern hat auch den zigtausend Kilometer langen Camino de Santiago, dessen weit verzweigtes Wegenetz die Pilger zum Schrein in Santiago de Compostela führt. Auf dem Jakobsweg zählt jeder Schritt zweifach, einmal auf dem tatsächlichen Weg und einmal auf dem Weg des Glaubens. In Schottland gibt es clachan und rathad – schmale, gepflasterte Straßen und Gebirgspfade – und in Japan kleine Landwege, die der Dichter Basho¯ in seinem Band Auf schmalen Pfaden durchs Hinterland von 1689 beschreibt. Die amerikanischen Prärien des 19. Jahrhunderts sind von breiten ›Bisonwegen‹ durchschnitten, die von dichten Bisonherden geschaffen wurden und auf denen später die ersten Siedler über die ›Great Plains‹ nach Westen zogen.
Geschichtsträchtige Wege gibt es nicht nur an Land, sondern auch auf dem Wasser. Die Ozeane sind durchfurcht von Seewegen – Routen, deren Verlauf von den vorherrschenden Winden und Strömungen bestimmt ist –, und Flüsse zählen zu den ältesten Wegen überhaupt. Zum abgelegenen Zanskar-Tal im indischen Himalaya-Gebirge gibt es in den Wintermonaten nur einen einzigen Zugang : über den zugefrorenen Fluss. Der Zanskar fließt durch steilwandige Täler aus Schiefergestein, an deren Hängen Schneeleoparden jagen. In den tieferen Becken ist das Eis blau und klar. Möchte jemand die Reise den Fluss hinab antreten, chadar genannt, begleiten ihn die ›Eislotsen‹, erfahrene Wanderer, die alle Gefahren kennen.
Verschiedene Pfade haben verschiedene Eigenschaften, je nach Geologie und Zweck.
Auf manchen Leichenwegen in Cumbria liegen auf der hügelzugewandten Seite flache resting stones, ›Absetzsteine‹, auf denen die Sargträger ihre Last absetzen konnten, um die müden Arme auszuschütteln und die steif gewordenen Schultern kreisen zu lassen. Auf manchen Leichenwegen im irischen Westen sind ›Absetznischen‹ in den Hang gehauen, und jeder Trauernde legt einen Kieselstein in sie hinein. Die prähistorischen Trampelpfade über die Downs in Südostengland können wir noch heute nachverfolgen, weil auf dem durch jahrhundertelangen Tritt verdichteten, kreidehaltigen Boden Gänseblümchen gut gedeihen. Das Moor auf der Insel Lewis in den Äußeren Hebriden ist von tausend Wegen der Moorarbeiter durchkreuzt und erinnert aus der Vogelperspektive betrachtet an genarbtes Leder. Ich denke auch an die Serpentinen der Bergpfade im schottischen Hochland, an die mit Flaggen geschmückten und über Brücken führenden Packeselrouten in Yorkshire und Mid Wales und die eingesunkenen Grünsandpfade in Hampshire, an deren schattigen Rändern sich im Frühling gerollte Farne wie kleine Hirtenstäbe emporrecken.
Die Markierungsmethoden alter Pfade scheinen selbst einer geheimnisvollen Sage entnommen, in der es viel um Steinhaufen, Steinkreise, Sarsensteine, sogenannte hoarstones (Ehrensteine), Menhire, Meilensteine, Cromlechen und andere Landmarken geht. In den Sümpfen von Dartmoor liegen Brocken weißer Porzellanerde verstreut, um einen sicheren Weg durch die Dämmerung zu weisen, wie die Kieselspur bei Hänsel und Gretel. In Gebirgsgegenden markieren oft Findlinge die Stelle, an der sich Flüsse gut überqueren lassen, wie Utsi ’s Stone 1 in den Cairngorms, der die Furt durch den Allt Mor anzeigt, durch die man zu den traditionellen Weidegebieten gelangt, ein Stein, in den von geschickter Hand die Zeichnung eines Rentiers eingeritzt ist, das im abendlichen Sonnenlicht springlebendig zu werden scheint.
Pfade und ihre Markierungen können seit Langem meinen Blick ködern, auf sich ziehen, zu sich heran und weiter auf den Weg. Der Pfad lockt das Auge, das äußere wie das innere. Der Kopf kann nicht umhin, dieser Linie über das Land zu folgen – nicht nur voran durch den Raum, sondern auch zurück durch die Zeit, hinein in die Geschichte des Weges und all derer, die ihn genutzt haben. Wenn ich einem Pfad folge, denke ich oft an seine Anfänge, daran, warum er wohl entstand, an die regelmäßigen Reisen, deren Zeuge er ist, und die Geheimnisse, die er bewahrt, all die Abenteuer, Begegnungen und Abschiede. Ich selbst bin in meinem Leben vermutlich 1 100 bis 1 200 Kilometer auf Pfaden gegangen : mehr als die meisten Menschen, aber nicht annähernd so viel wie die großen Wanderer. Thomas De Quincey schätzt, dass Wordsworth 280 000, vielleicht sogar 300 000 Kilometer gelaufen ist : Seine bekanntermaßen knorrigen Beine, die »bei allen weiblichen Bekannten auf ostentative Ablehnung stießen«, wie De Quincey giftig notiert, verwandelten sich beim Wandern in Siebenmeilenstiefel. In Gedanken habe ich bereits Tausende Kilometer zurückgelegt, weil ich nachts, wenn ich nicht schlafen kann – fast jede Nacht –, die von mir gewanderten Pfade abgehe, bis ich manchmal doch in den Schlaf finde.
»Es freut mich einfach, auf ihnen zu gehen«, bringt John Clare sein Verhältnis zu Feldwegen auf den Punkt. Mir geht es genauso. »Meine linke Hand hakt sich um deine Hüfte«, verkündet Walt Whitman – freundschaftlich, erotisch, gebieterisch – in Grasblätter (1855), »Meine rechte Hand zeigt auf die Landschaften der Kontinente und die offene Straße«. Fußwege sind im besten Sinne des Wortes mundan : ›weltlich‹, für jeden offen. Vom Wegerecht geschützt und durch Benutzung erhalten, bilden sie ein Labyrinth von Freiheit, ein feingliedriges Netzwerk von Allmenden, das sich bis heute durch unsere aggressiv privatisierte Welt zieht, trotz aller Stacheldrahtzäune und Schranken, Überwachungskameras und ›Betreten-verboten‹-Schilder. Dass es dieses Labyrinth bei uns gibt, ist einer der wichtigsten Unterschiede zum Landnutzungsrecht in den USA.2 Die Amerikaner haben uns Briten lange um unser Fußwegesystem und die damit verbundenen Freiheiten beneidet, so wie ich die Skandinavier um ihr Allemansrätten beneide, ihr Jedermannsrecht. Diese rechtliche Übereinkunft entstand in einer Gegend ohne jahrhundertelange Feudalherrschaft und vererbte Unterwürfigkeit gegenüber der grundbesitzenden Klasse und gestattet den Bürgern, alles Brachland zu betreten, vorausgesetzt, sie richten keinen Schaden an; es ist erlaubt, Feuer zu machen; überall außerhalb fester Wohnstätten zu schlafen; Blumen, Nüsse und Beeren zu sammeln und in allen Gewässern zu schwimmen (Rechte, denen sich auch die neoaufklärerischen schottischen Zugangsgesetze zunehmend annähern).
Pfade sind die Gewohnheiten der Landschaft. Sie entstehen aus einvernehmlichem Tun. Allein einen Pfad anzulegen ist schwierig. Der Künstler Richard Long hat einmal eine schnurgerade Linie in den Wüstensand getrampelt, indem er immer wieder, Dutzende Male, auf und ab ging. Aber das war eine Spur, kein Weg : Sie führte nirgendwohin, nur zu ihrem eigenen Ende, und während er auf ihr ging, war Long wie der Tiger im Käfig oder ein bahnenziehender Schwimmer. Ohne eine mögliche Verlängerung verhielt sich seine Linie zu einem Pfad wie ein abgebrochener Ast zu einem Baum. Pfade verbinden. Das ist ihre oberste Pflicht, ihre Daseinsberechtigung. Sie verbinden im wörtlichen Sinne Orte und im weiteren Sinne Menschen.
Pfade sind auch etwas Einvernehmliches, denn ohne gemeinschaftliche Instandhaltung und Nutzung verschwinden sie wieder : überwuchert von Vegetation, durchpflügt oder bebaut (obgleich sie möglicherweise im Erinnerungsschatz des Bodenrechts fortbestehen). Wie Fahrrinnen in Gewässern, die regelmäßig ausgebaggert werden müssen, um befahrbar zu bleiben, müssen Pfade begangen werden. In Suffolk wurden im 19. Jahrhundert kleine Sicheln, sogenannte hooks, an die Zaunübertritte und Pfosten am Anfang einiger vielgenutzter Wege gehängt, zum Beispiel zwischen zwei Dörfern oder auf den kleinen Pfaden zu den Pfarrkirchen. Der Wanderer griff sich eine solche Sichel und schnitt damit die überhängenden Zweige ab. Am anderen Ende des Pfades hängte er das Gerät für den nächsten Wanderer wieder auf, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. So wurde der Pfad gemeinschaftlich für die allgemeine Nutzung instand gehalten. Doch nicht nur alte Pfade sind interessante Pfade. In jedem Ort und in jeder Stadt sehen wir heute jenseits der befestigten Bürgersteige und Straßen inoffizielle Wege, die die ausgetretenen Pfade verlassen und in Form einer Abkürzung Parkanlagen und Brachen durchschneiden. Stadtplaner nennen diese improvisierten Routen ›Wunschlinien‹. In Detroit – wo Zehntausende Häuser verlassen und weite Gebiete der Stadt von Vegetation überwuchert sind und sich nur noch die Wenigsten ein Auto leisten können – haben sich Spaziergänger und Radfahrer eigenmächtig Tausende solcher spontanen Wege geschaffen.
Jahrelang bin ich auf Pfaden gegangen, und jahrelang habe ich über sie gelesen. Die Wanderliteratur ist umfangreich, es gibt Gedichte, Lieder, Geschichten, Abhandlungen und Wanderführer, Landkarten, Romane und Essays. Die Symbiose von Schreiben und Wandern ist fast so alt wie die Literatur selbst – auf jedem Spaziergang gibt es etwas zu erleben, und jeder Pfad hat etwas zu erzählen.
Der Charismatischste unter den modernen Wanderschreibern ist sicher George Borrow, der einen regelrechten Boom des romantischen Wanderns und Beschreitens alter Wege auslöste, eine Massenbewegung, die Mitte des 19. Jahrhunderts Europa und Amerika erfasste und bis heute nachwirkt. In den 1820 er Jahren zog Borrow zunächst hier und dort durch die Gegend, wanderte Tausende Meilen durch England und Wales, dann auf der anderen Seite des Kanals durch Frankreich, Spanien, Portugal und Russland, sogar bis nach Marokko, und lernte so die fahrenden Kulturen und Völker kennen : die Roma, die Nomaden, die Landstreicher, Zunftgenossen, Schafhirten, Bauern und Gastwirte. Mit seinen gut 1,80 Meter, seinem fülligen Leib, dem typischen schwarzen Anzug mit weißen Socken, nicht selten gekrönt von einem Sombrero, gab Borrow auf den Pfaden eine markante Figur ab, besonders markant in so verschlafenen ostenglischen Örtchen wie Norwich oder Great Yarmouth, durch die man ihn manchmal ohne Sattel auf seinem ›Hochblüter‹ Sidi Habismilk reiten sah, einem schwarzen Araberhengst, den er auch zärtlich »Meinen Herrn den Erhalter unseres Königreichs« nannte.
Borrow war als Wanderer von erstaunlicher Ausdauer und als Autor von nahezu unfassbarem Talent, er beherrschte im Alter von achtzehn Jahren angeblich bereits zwölf Sprachen und erwarb im Laufe seines Lebens beachtliche Kenntnisse in über vierzig Sprachen – darunter Aztekisch, Tibetanisch, Armenisch und Malorussisch. Im Winter 1832/33 lud ihn die British and Foreign Bible Society kurzerhand zu einem Vorstellungsgespräch nach London ein, um zu prüfen, ob er womöglich die Bibel in einige schwierige Sprachen übersetzen könnte. Der Kommission gefiel, was sie sah, und Borrow wurde gebeten, das Neue Testament ins Mandschurische zu übertragen. Nur hatte er der Bibelgesellschaft nicht gesagt, dass er gar kein Mandschurisch konnte. Doch kein Problem. Nachdem er den Auftrag in der Tasche hatte, besorgte er sich »einige Bücher im mandschurisch-tatarischen Dialekt« sowie Amyots Mandschurisch-Französisch (!) -Wörterbuch. Anschließend kehrte er (verständlicherweise mit der Kutsche) nach Hause zurück und schloss sich mit den Büchern drei Wochen lang ein. Danach konnte er »ohne größere Schwierigkeiten ins Mandschurische übersetzen« und den gewünschten Text abliefern.3
Borrows Gemütsverfassung war unstet, und wie viele Langstreckenwanderer litt er an Depressionen, seit seiner Jugend durchlebte er die von ihm so genannten horrors. Im Gehen konnte er seine Traurigkeit einfach abhängen. Legendär machte ihn sein Credo des Wanderers aus der kunstfertigen Para-Autobiografie Lavengro von 1851 :
Es gibt Nacht und Tag, Bruder, und beide sind schön; die Sonne, der Mond und die Sterne, sie alle sind schön; und auf der Heide gibt es den Wind. Das Leben ist schön, Bruder, wer wollte da sterben?
Das Bemerkenswerte an Lavengro ist die unviktorianische, sprich : nonkonformistische Perspektive auf das England des frühen 19. Jahrhunderts. Im Buch vermischen sich Traum, Bekenntnis, Gesellschaftsgeschichte und Memoiren, und alle Romantik findet im schroffen Ton ihr Gegengewicht. Borrow kannte die Entbehrungen des Umherziehens ebenso gut wie dessen Genuss. Er wusste, wie fragwürdig es war, das Leben auf der Straße zu zelebrieren, während viele Menschen keine andere Wahl hatten und dort ein erbärmliches Dasein fristen mussten : die Arbeits- und Obdachlosen, die Landstreicher, Wanderarbeiter und Vagabunden, die Enteigneten und Erschöpften.
Doch das Borrow ’sche Beispiel erlangte – in fein gewobener Prosa – einen ungeheuren Einfluss. Den frischen Wind im Gesicht, das Sternenzelt als Dach, das Feuer am Wegesrand, das Philosophieren in Hecken und das freie Wanderleben : Das waren die Bilder, die Borrow in die Vorstellungswelt des 19. Jahrhunderts einbrachte. Und obwohl die meisten seiner Nachahmer statt der Erkenntnis nur Blasen ernteten, wuchs der Kult um das müßiggängerische Vagabundieren. Zahlreiche Wandervereine wurden Ende des 19. Jahrhunderts gegründet, und es gab massenhaft Wanderliteratur über die alten Wege. Handliche Büchlein mit Titeln wie The Open Road oder On Foot, in grünes Steifleinen oder rotes Wildleder gebunden, wurden zu Bestsellern. Robert Louis Stevenson schrieb seine dunklen, mystischen Songs of Travel (1896) – deren Tempo dem gemächlich walzenden Schritt der Langstreckenwanderer entspricht. Der Ornithologe W. H. Hudson wagte sich ins Gebiet der Psychogeografie, für die er monatelang über Englands Fußwege vagabundierte, um auf den »Charme des Unbekannten« zu hoffen, der seine Ruten ausschlagen ließe (wobei er für seine Reisen nicht nur von Borrow inspiriert wurde, sondern auch von früheren englischen Mystikern wie Thomas Traherne, Henry Vaughan und Thomas Browne). Zur Jahrhundertwende stiefelte Hilaire Belloc von Frankreich nach Italien und schrieb seine schwülstige Reiseerzählung Der Weg nach Rom (1902). John Muir wanderte 1867 zweitausend Kilometer von Indianapolis zu den Florida Keys und schwankte fortwährend zwischen zwei Extremen, Hunger und Ekstase; siebzehn Jahre später zog ein junger Mann namens Charles Lummis einmal quer durch Amerika, von Ohio nach Kalifornien, und erklärte, er habe »die längste jemals dokumentierte Wanderung aus reinem Vergnügen unternommen«. 1892 war das Gründungsjahr des Sierra Club, der sich Muirs Überzeugung zu eigen machte, dass der Kontakt des Wanderers mit der ursprünglichen, wilden Welt beiden nütze, dem Wanderer und der Welt, und dass »nach draußen zu gehen … im Grunde (heißt), nach innen zu gehen«.
Der Schock des Ersten Weltkriegs steigerte das Interesse der Briten an den alten Wegen enorm. Einige heimkehrende Soldaten zogen sich mit ihren körperlichen und seelischen Wunden aufs Land zurück und hofften, das Gefühl von Zugehörigkeit zu einem bestimmten Ort und zur Natur könnte ihrem versehrten Leben wieder etwas Erhabenheit verleihen (genährt von dem Wunsch, das alles sei es irgendwie wert gewesen). Henry Williamson war einer von ihnen. Mit Gasvergiftung aus Frankreich heimgeschickt und ausgemustert, zog er sich ins ländliche Devon zurück, wo er Dartmoor durchwanderte und sich auf die Spur der dortigen Wildlinge begab. Diesen Jahren rang er sein Meisterwerk Tarka, der Otter (1927) ab – für das er sich, wie er es selbst einmal formulierte, »jedes einzelne Wort vom Brustbein hobeln musste«.4
Andere, vom Krieg bis zum Aberglauben traumatisiert, liefen die Pfade auf der Suche nach Geistern ab – auf den Spuren der Verschollenen und Zurückgelassenen. Alte Pfade wurden zu einem zweifachen Medium : der Begegnung und der Bewegung. Die Geisterhaftigkeit dieser Geistertrassen zog die Menschen an. Die geselligen Pilgerreisen, die Chaucer beschrieb, wurden von morbidem Historizismus eingefärbt : Gespenster traten aus den Hecken und Bäumen und sprachen zu den Wanderern. So heißt es bei John Masefield : »Die Hügel schienen voll von unsichtbaren Seelen; / Sie kamen auf mich zu und wollten mir erzählen, / Damit die Lebenden die Toten recht verstehen.«
Ich habe all diese Wanderer der alten Wege gelesen und bin dabei verschiedenen Versionen ein und derselben verführerischen Idee begegnet : dass wir, indem wir auf diesen Pfaden gehen, »uns aus unserer modernen Welt zurückschleichen« können, wie Hudson es ausdrückt. Immer wieder erwähnen diese Wanderer ein aufregendes Gefühl von Verbundenheit, vom Gehen als Séance, von Stimmen, die sie auf dem Weg hörten. Basho¯ soll einem Schüler erzählt haben, dass er auf seinen Wanderungen in den Norden oft mit lang verstorbenen Dichtern gesprochen habe, etwa seinem Urahnen Saigyo aus dem zwölften Jahrhundert, weshalb er seine Reisen als Unterredung zwischen »Geistern und einem künftigen Geist« ansah. In den Romanen von Thomas Hardy kann ein Wegabschnitt ebenso Erinnerungen an einen Menschen in sich tragen, wie ein Mensch sich an einen Pfad erinnern kann. Richard Jefferies beschreibt in einem Tagebucheintrag aus dem Jahr 1887, dass er an einem bronzezeitlichen Hügelgrab in Gloucestershire den Eindruck hat, »als könnte ich zurückblicken und das Damals fühlen; den Sonnenschein von damals, und das Leben dieser Menschen«. Man stellte sich Pfade wie Gräben vor, in denen die Zeit als reine Oberfläche fließt, in bizarren Morphologien, ein gespenstisches Origami.
Bestimmt muss man kein Mystiker sein, um zu sehen, dass einige alte Pfade nur auf den ersten Blick gerade verlaufen. Sie haben Verästelungen wie Bäume und Zuläufe wie Flüsse. Vor sieben Jahren bin ich nach Dorset gefahren, um mit meinem Freund Roger Deakin zwischen den Milchviehbetrieben dieses grünen Countys die Hohlwege zu erkunden. Das Wort Hohlweg stammt aus dem Angelsächsischen hol weg und bezeichnet einen ausgetretenen Pfad, der von Füßen, Rädern und Witterung im Laufe der Jahrhunderte immer tiefer in die Erde gegraben wurde. Dorset ist – wie viele der weichsteinigen Countys in England – von solchen Pfaden durchzogen, die zum Teil sechs Meter unter der sie umgebenden Landschaft liegen und heute meist von Brombeeren und Nesseln überwuchert sind. Roger und ich verbrachten mehrere Tage im kiesigen, karamellfarbenen Sandstein rund um das Örtchen Chideock, liefen durch die Hohlwege und entdeckten die Geschichten, die sie umgaben. Berichte von verfolgten Rekusanten, die sich im 16. Jahrhundert in ihnen versteckten, von den Priestern, die im 17. Jahrhundert in den Wäldern Messen abhielten, und von verfolgten Adeligen, die sich im 20. Jahrhundert in sie flüchteten. Im Dämmerlicht der Hohlwege schien diese Vergangenheit höchst lebendig und präsent – als hätte sich die Zeit in sich selbst verschränkt und auf diese Weise unzusammenhängende Momente in historische Korrespondenz gebracht, die nun ein wiederkehrendes Muster von Versteck und Flucht an diesem Ort entstehen ließen.
Zwei Jahre nach diesem Ausflug starb Roger unerwartet und viel zu jung. Vier Jahre nach seinem Tod kehrte ich nach Dorset zurück, um noch einmal durch dieselben Hohlwege zu gehen, und sah mich unseren eigenen Spuren nachspüren – der Stechpalme, von der wir uns Knüppel abgeschnitten, dem Feldrand, an dem wir übernachtet hatten – und sah erschreckend klare Erinnerungsbilder von Roger selbst, der plötzlich an einer Biegung stand oder vor mir den Pfad entlangging.
Nicht alle Wanderer, die die alten Wege beschritten, waren angenehme Zeitgenossen oder führten Gutes im Schilde. Die Vorstellung, sich durch diese alten Pfade in reale wie imaginierte Gebiete begeben zu können, zog auch Gesindel an, Blender, Frömmler und andere unliebsame Fanatiker. Mit Abscheu habe ich Bücher multipler Misanthropen gelesen, Nationalisten mit abstrusen Rassentheorien oder Nostalgiker, die sich damit brüsten, einen anständigen Tod einem kläglichen Leben vorzuziehen. Verblüfft las ich die Verfechter eines ›Zurück zur Natur‹, die das Wandern (neben energetischen Moriskentänzen und lebenslangem Sandalentragen) zur Reinigung der besudelten männlichen Seele empfahlen.
Aber ich bin auch vielen Wanderschreibern begegnet, die diesen Gedankenfallen und Schwachsinnsideen zu entgehen wussten. Borrow tanzte vergnügt durch ihre Reihen und wob sie in seine kosmisch-komischen Visionen ein. John Clare liebte Fußwege, weil sie »reich & freudvoll für den Geist« seien : als Wanderwege und Gedankenwege. Für William Wordsworth führten die vielbegangenen Pfade rundweg ins Abenteuer, in »die Schlupfwinkel des Landes«. William Hazlitt war ein radikaler Wanderer, der von Kapelle zu Kapelle ging, um die unitarischen Priester predigen zu hören, und begrüßte Fußwege als »Linien der Verständigung, die die Flamme der bürgerlichen und religiösen Freiheit am Brennen halten«.
Je tiefer ich in das Thema vordrang, umso mehr Pfade und Wege schienen in den vergangenen zweihundert Jahren die Prosa, Lyrik und Kunst Europas, Amerikas und – vor allem – Großbritanniens zu durchziehen. Ich fand sie in den Tagebüchern einer Dorothy Wordsworth, in den Kriegslandschaften eines Paul Nash, im Zickzack der Bohlenwege, in dem Film A Canterbury Tale von Michael Powell und Emeric Pressburger von 1942, in dem die Panzerbrigaden beim Manöver ungeniert einen alten Pilgerweg verwüsten, und in Bill Brandts Fotografie von 1950, auf der ein kleiner Ausschnitt desselben Weges in der schneeweißen Kreide wie eine Spalte erscheint – durch die man nicht nur in eine andere Zeit, sondern gleichsam in eine andere Welt und Sphäre schlüpfen könnte. Sehr ans Herz gewachsen sind mir Eric Ravilious’ traumwandlerische Aquarelle der prähistorischen Wege in den englischen Downs, und wieder und wieder habe ich die Berichte der schottischen Autorin Nan Shepherd gelesen, die sich das Cairngorm-Massiv erlief und jahrelang über seine Grate und Hirschwege wanderte, bis ihr schien, sie steige nicht mehr auf, sondern in die Berge. Dass alte Pfade solche Wirkung zeigen, kann ich sehr gut nachvollziehen : Das Wandern eröffnet ein Sehen und Denken und ist mehr als Flucht und Entkommen; Pfade führen nicht nur durch eine Gegend, sondern auch zum Fühlen, zum Sein, zum Wissen.
Den größten Einfluss auf mich hatte aber das Leben und Werk von Edward Thomas, dem Essayisten, Soldaten, Sänger und einem der bedeutendsten englischen Dichter der Moderne – sowie dem Spiritus Rector dieses Buches. Thomas wurde 1878 in London geboren, seine Eltern stammten aus Wales; schon als Jugendlicher wanderte und schrieb er. Mit einigen Reiseberichten, naturkundlichen Büchern und Biografien machte er sich bald einen Namen und begann im Winter 1914, im Alter von sechsunddreißig Jahren, Lyrik zu verfassen. In einem erstaunlich spät erfolgten künstlerischem Ausbruch schrieb er in kaum mehr als zwei Jahren 142 Gedichte : Werke, die der Lyrik eine völlig neue Richtung gaben und deren Einfluss noch heute besteht. Am Ostermontag 1917 fiel er bei Tagesanbruch im Alter von neununddreißig Jahren in der Schlacht von Arras.
Zum ersten Mal las ich Thomas’ Lyrik in der Schule, in einer Anthologie, die seine bekanntesten Gedichte enthielt : Adlestrop und As the Team’s Head-Brass. Damals schien er mir ein angenehm einfacher Autor, beinahe naiv : ein Verfasser von Elegien über das ländliche England mit seinen Ackerleuten und Heuschobern und dem Mädesüß, ein Land, das damals, als er darüber schrieb, bereits im Verschwinden begriffen war. Ich brauchte fast zwanzig Jahre, um zu erkennen, wie beschränkt diese Auffassung war. Zwar wird er auch heute noch oft als bukolischer Dichter gesehen, der Orte und Zugehörigkeit zelebriert, für mich aber sind seine wahren Themen Bindungslosigkeit, Zwiespalt und Heimatlosigkeit. Seine Gedichte sind bevölkert von Geistern, dunklen Gestalten und Doppelgängern, in tiefen Wäldern verlaufen Pfade ins Nichts; die Landschaften sind oft nur dünne Oberflächen, stets kurz davor aufzubrechen. Wenngleich ihn die romantische Figur des selbstbewussten einsamen Wanderers faszinierte, trieb ihn vielmehr die Frage um, wie uns die Orte, durch die wir uns bewegen, zerstören oder auch stärken können.
Thomas hatte zwei »geduldige sublunare Beine« 5, wie Keats es einmal formulierte, und diese trugen ihn Tausende von Wegmeilen, auf berühmten alten Pfaden (dem Sarn Helen in Wales, dem Icknield Way und dem Ridgeway in Südengland) sowie auf den Wegen vor seiner Tür (der Old Litton und der Harepath Lane nahe seinem Wohnort im östlichen Hampshire). »Die ersten Straßen zogen wie Flüsse durch das Land«, schreibt er, »und hatten, wie Flüsse, nur den Drang, in Bewegung zu bleiben.« Thomas nutzte die alten Wege, um sich selbst in Bewegung zu halten, da er wie Borrow – dessen Biografie er schrieb und mit dem er sich stark identifizierte – depressiv war. Wie bei Borrow zählte das Wandern bei Thomas zu den wenigen Tätigkeiten, die ihn aus seinen Depressionen hinauszuholen vermochten. Er schnitt sich einen Stock – sein liebstes Steckenholz war das der Stechpalme – und machte sich auf den Weg über »unauslöschliche alte Straßen«, »abgetragen von Hufen und den bloßen Füßen und schleifenden Wanderknüppeln längst vergangener Generationen«. Diese uralten Wege waren »kraftvolle, magische Dinge«, die »die Zeit aufhoben«, während er »über viele Jahrhunderte schlenderte«. Die Geschichte von Hänsel und Gretel, die in den Wald geführt werden, aber eine Spur weißer Kiesel legen und auf diese Weise wieder aus dem Wald herausfinden, war für ihn »eine der großen Geschichten dieser Welt«.
In Thomas’ Wahrnehmung verbanden Pfade nicht nur reale Orte,6 sondern führten auch hinaus in die Metaphysik, zurück in die Geschichte und nach innen ins Ich. Diese Querungen – zwischen Konzeptuellem, Geisterhaftem und Privatem – leuchten oft unerklärt in seinem Schreiben auf und bilden gewissermaßen dessen Quintessenz. Seine Vorstellung von sich selbst fasste Thomas in topografische Begriffe. Kurven, Verzweigungen, Hürden, Wegweiser, Gabelungen, Kreuzungen, Nebenpfade, Auf-und-davon-Straßen sowie in die Gefahr, den Tod oder die Verheißung führende Fährten : Er verinnerlichte die Beschaffenheit der pfaddurchfurchten Landschaften, bis sie seiner Melancholie und Hoffnung Form gaben. Das Wandern ließ ihn sein eigenes Mythenbild erschaffen und nährte zugleich seine alltägliche Sehnsucht : Er dachte nicht nur auf Pfaden und an Pfade, sondern auch in ihnen.
Denn Pfade verlaufen ganz sicher ebenso durch Menschen wie durch Orte. Der amerikanische Historiker und Geograf John Brinckerhoff Jackson – ein grundsätzlich jeder Romantisierung misstrauisch gegenüberstehender Mann – hat dafür die passenden Worte gefunden : »Über Zigtausende von Jahren reisten wir zu Fuß über holprige Pfade«, schreibt er, »nicht nur als Hausierer, Pendler und Touristen, sondern auch als einfache Männer und Frauen, die von Pfaden und Wegen eindrücklich überrascht wurden : durch Freiheit, Begegnungen mit Unbekannten, eine neue Wahrnehmung der Landschaft. Das Wandern war eine Reise ins Unbekannte, bei der wir uns am Ende selbst erkennen konnten.«
Seit Langem fasziniert mich, wie wir Menschen uns in Landschaftsbegriffen verstehen, in Topografien unseres eigenen Wesens, die wir in uns tragen, und den Karten, mit denen wir uns durch diese inneren Landschaften bewegen. Wir denken in ortsbezogenen Metaphern, die unsere Gedanken nicht nur schmücken, sondern bisweilen aktiv formen. Landschaften können, um es mit George Eliot zu sagen, »das innere Reich, in dem wir uns bewegen, vergrößern«.
Mir scheint, dass Landschaften nicht wie ein Steg oder eine Halbinsel in uns hineinragen, bis zu einer bestimmten Tiefe und in begrenztem Umfang, sondern wie das flirrende, unkartierbare Sonnenlicht, das alles durchdringt und erhellt. Was wir aus Orten machen, das können wir sagen, wenn auch manchmal verschämt – aber zum Ausdruck zu bringen, was Orte aus uns machen, fällt uns ungleich schwerer. Seit einiger Zeit glaube ich zu wissen, dass es zwei Fragen gibt, die wir jeder Landschaft, die uns beeindruckt, stellen sollten. Die erste : Was weiß ich, wenn ich an diesem Ort bin, was ich nirgendwo sonst wissen kann? Die zweite, auf immer unbeantwortete : Was weiß dieser Ort von mir, was ich selbst nicht wissen kann?
Von der Ferse bis zum Zeh messe ich 29,7 Zentimeter bzw. 11,7 Zoll. Das ist mein Schritt- und mein Denkmaß. »Ich kann nur im Gehen denken«, schreibt Jean-Jacques Rousseau im neunten Buch seiner Bekenntnisse, »sobald ich Halt mache, ist es mit dem Denken vorbei, und mein Kopf hält nur mit meinen Füßen Schritt«. Søren Kierkegaard mutmaßte, der menschliche Geist funktioniere am besten bei gewöhnlichem Schritttempo, bei vier bis fünf Kilometern pro Stunde, und beschreibt in einem Tagebucheintrag, wie er auf einem Spaziergang »so überwältigt von Ideen« war, dass er »kaum mehr gehen konnte«. Christopher Morley schrieb über Wordsworth, er setze »seine Beine als philosophisches Instrument« ein, und Wordsworth selbst sprach von seinem »fühlenden Intellekt«. Nietzsche war auch bei diesem Thema von der ihm typischen Unbedingtheit – »Nur die ergangenen Gedanken haben Werth« – und Wallace Stevens von seiner typischen Zögerlichkeit : »Vielleicht / beruht die Wahrheit auf einem Gang um einen See.« In all diesen Zeugnissen gelangt der Mensch nicht durchs Wandern zu Wissen, sondern das Wandern selbst ist das Medium des Wissens.
Die Annahme, dass Erkenntnisgewinn bewegungsabhängig und ortsspezifisch ist, existierte bereits vor dem Zeitalter der Romantik, wenngleich Rousseau den Gedanken erst berühmt machte. Heute ist sie weitverbreitet, und wir tun gut daran, mit einer gewissen Skepsis zu reagieren, falls jemand sie zur Regel erheben sollte. Manchmal ist das Wandern unserem Denken feingeistiger Begleiter; manchmal brutaler Antagonist. Wer jemals eine lange Strecke gewandert ist, Tag um Tag, der weiß, wie die Müdigkeit des Gehens alles bis auf die grundlegenden Gehirnfunktionen lahmlegt. Nach dreißig Kilometern habe ich einen Tunnelblick und stiere dümmlich auf die immergleichen Sequenzen in meinem »Schädelkino«, wie John Hillaby es einmal nannte.
In nichtwestlichen Kulturen ist die Vorstellung weitverbreitet, Schritte als Wissen und Wandern als Denken zu begreifen, und fungiert nicht selten als Metapher für Rückbesinnung – die Geschichte als Gegend, in die man zurückkehrt. Keith Basso berichtet, dass sich die Cibecue-Apachen die Vergangenheit als einen Pfad vorstellen (’intin), den ihre Vorfahren ausgetreten haben, der aber für die Lebenden weithin unsichtbar ist, weshalb er nur mithilfe bestimmter Gedächtnisspuren begangen werden kann. Diese Spuren – zu denen Ortsnamen, Geschichten, Lieder und Reliquien gehören – nennen die Apachen biké’ goz’áá – Fußabdrücke, Spuren. Für das Volk der Thcho im Nordwesten Kanadas sind Wandern und Denken kaum voneinander trennbare Tätigkeiten : Ihr Wort für Wissen ist gleichbedeutend mit dem Wort für Fußabdruck. Ein circa sechshundert Jahre alter buddhistischer Text aus Tibet verwendet das Wort shul für »eine Spur, die bleibt, nachdem das, was sie verursacht hat, vorübergegangen ist« : Fußabdrücke sind shul, ein Pfad ist shul, und beide lassen uns in der Zeit zurückgehen und vergangener Ereignisse gewahr werden.
Dass Wandern gleich Denken sein kann oder dass Füße etwas wissen können, erscheint uns, wenn wir es zum ersten Mal hören, abwegig und rätselhaft. Wir neigen nicht dazu, den Fuß als denkfähiges oder gar gescheites Körperglied zu betrachten. Dem Fuß fehlt die Wendigkeit der Hand. Vor allem der unbewegliche dicke Zeh : Wenn wir etwas mit ihm greifen wollen, gelingt uns bestenfalls ein ungeschicktes Klammern im Zusammenspiel mit dem zweiten Zeh. Unser Fuß fühlt sich eher wie eine Prothese an, die uns tragen kann, das schon, nicht aber unsere Umwelt erfassen oder interpretieren. Unsere Hand ist entschieden feinfühliger als unser Fuß – weshalb wir nur von Manipulation, nie von Pedipulation sprechen. Richard Long aber – der einmal dreiunddreißig Tage hintereinander dreiunddreißig Meilen am Tag ging, vom Lizard Point in Cornwall bis zum Dunnet Head in Schottland – setzt unter seine Briefe einen roten Stempel mit den Umrissen zweier Füße, die den Betrachter mit eingesetzten Augen ansehen. Die Landschaft durch sehende Sohlen erfassen; Berührung als Betrachtung – dieser Gedanke gefällt mir.
Für Ludwig Wittgenstein war es Bestandteil seiner Philosophie, Argumentationslinien nicht nur im Geiste, sondern auch zu Fuß zu verfolgen. Als er bei Bertrand Russell in Cambridge studierte, ging er in dessen Zimmer mitunter stundenlang in erregtem Schweigen auf und ab und legte in dem wenige Meter messenden Raum kilometerweite Wege zurück. »Denken Sie über Logik nach oder über Ihre Sünden?«, fragte Russell einmal seinen schreitenden Studenten, nur halb im Scherz. »Über beides!«, entfuhr es Wittgenstein. 1913 zog er sich nach Skjolden zurück, ein winziges Dorf an einem abgelegenen norwegischen Fjord, wo er einen langen dunklen Winter verbrachte, über Logik nachdachte und auf den Pfaden wanderte, die am Fjord entlang und hinauf in die Berge führten. Die Landschaft – asketisch, entschlossen – entsprach seiner Art zu denken, und so gelang es ihm in diesem Winter, ein wichtiges philosophisches Problem zur Symbolik von Wahrheitswertefunktionen zu lösen. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich woanders genauso hätte arbeiten können wie dort«, schrieb er Jahre später seiner Schwester. »Es kommt mir so vor, als hätte ich damals in mir neue Denkbewegungen geboren.« Das Wort Denkbewegungen, mit dem Wittgenstein sein Denken beschreibt, ist eine Wortschöpfung für Ideen, die durch die Bewegung, das Gehen entlang eines Weges hervorgebracht werden.
In einem der stillen Gedichte von Thomas Clark kommt ein Spaziergänger, der die Küste entlangwandert, nahe einem Schiffanleger zu einer Steintreppe, die »aus dem Fels gehauen / hinab ins Wasser führt«. Das Gedicht folgt der Einladung, die Stufen hinunterzusteigen, und der Mann stellt sich vor, wie er »hinab ins Meer schreitet / in ein anderes Wissen / wild und kalt«. Er spielt damit auf Elizabeth Bishops großes Gedicht At the Fishhouses an, das in das »klare graue eisige Wasser« eines Hafens in Neufundland eintaucht; Wasser, das »so ist, wie wir uns das Wissen vorstellen : / dunkel, salzig, klar, flüssig und unendlich frei«. Bishop wiederum wendet sich, wie ich denke, an Wordsworth, der 1815 darüber schrieb, wie man in die »Tiefen des Denkens« eindringt : ein unergründliches Reich, »in das der Geist nicht von allein friedvoll sinken kann – sondern in das er Stufe um Stufe über die Gedanken hinabschreiten muss«. Die drei Gedichte nehmen aufeinander Bezug und schreiben einander neu – eine Stufenfolge, ein auf Papier geprägter Pfad.
Die bekannteste Verbindung zwischen Schritt, Wissen und Gedächtnis ist die Vorstellung der australischen Aborigines von den Songlines, den Traumpfaden. Ihrer Kosmogonie zufolge entstand die Welt in einer als Traumzeit bekannten Epoche, in der die Erde eine schwarze, flache und gesichtslose Fläche war. Als unsere Urahnen begannen, über diesen Unort zu wandern, brachen sie die Erdkruste auf und setzten das darunter schlafende Leben frei, sodass jeder Schritt ein neues Stück Landschaft zum Vorschein brachte. Wie Bruce Chatwin in seiner zwar fehlerhaften, aber einflussreichen Nacherzählung erläutert, soll »jeder totemistische Ahn auf seiner Reise durch das Land eine Spur von Wörtern und Noten neben seinen Fußspuren ausgestreut« haben. Je nachdem, wohin die Schritte fielen, gingen diese Klang-Spuren eine Verbindung mit bestimmten Merkmalen der Landschaft ein. Sie überzogen die Welt mit Traumpfaden, die »sich wie ›Verkehrs‹-Wege … über das ganze Land« hinzogen, und jede Spur besaß ihr eigenes Lied. Daher konnte man sich den australischen Kontinent, wie Chatwin es ausdrückt, »wie Spaghetti aus Iliaden und Odysseen vorstellen, die sich hierhin und dorthin schlängelten, wobei jede ›Episode‹ den geologischen Formen abzulesen war«. Das Wandern war untrennbar mit dem Geschichtenerzählen verbunden,7 und obwohl mit jeder Generation Lieder verloren gehen, haben sie doch die Zeiten überdauert, sodass singen und seinen Weg finden nach wie vor dasselbe bedeuten.
Die Beziehung zwischen Denken und Gehen steckt auch tief in der Sprachgeschichte und findet in der wohl wundervollsten Etymologie, die ich kenne, brillanten Ausdruck. Die Reise beginnt mit unserem heutigen Verb to learn, also Wissen erwerben. Bewegen wir uns rückwärts in die Sprachhistorie, kommen wir zum altenglischen leornian, Wissen bekommen, kultiviert sein. Von leornian führt der Pfad weiter zurück ins frikative Dickicht des Protogermanischen und zum Wort liznojan, dessen Grundbedeutung einer Spur folgen oder eine Spur finden war (vom protoindoeuropäischen Präfix leis- mit der Bedeutung Spur). Lernen bedeutet damit ursprünglich – spursprünglich – einer Spur folgen. Wer hat das gewusst? Ich nicht, und ich bin dem Spähtrupp pirschender Etymologen sehr dankbar, dass sie die verloren gegangene Verbindungslinie zwischen lernen und gehen wieder aufgespürt haben.
In den Monaten nach meiner Sonnenwendnachtwanderung durch den Schnee beschloss ich, selbst ein paar Spuren zu hinterlassen : Ich wollte die alten Wege zu Fuß entdecken und herausfinden, was ich von ihnen lernen konnte. Und so verließ ich eines Morgens Ende Mai mein Haus in Cambridge und lenkte meine Schritte zum Icknield Way, dem, wie oft behauptet wird, ältesten britischen Landweg, auf dem Edward Thomas einhundert Jahre vor mir gewandert und geradelt war.
Dies war meine erste Wanderung; in diesem Buch erzähle ich von vielen, und auf allen erlebte ich die für das Wandern typische Mischung aus Aufregung, Ohnmacht, Langeweile, Abenteuer und Erleuchtung. Der Icknield Way war mein Eingangstor zu einem Geflecht alter Routen, die die britischen Landschaften und Gewässer durchziehen, sie mit fremden Ländern und Kontinenten verbinden. Auf dem Weg – auf den Wegen – brach ich mir mehr Knochen als in zwanzig Jahren Bergwandern, trank mit einer Art Schamanen in den Äußeren Hebriden zu viel Gin, ging bei Liverpool Schritt für Schritt mit einem 5 000 Jahre alten Mann, durchquerte auf Pfaden die Trockentäler des besetzten Palästina und pilgerte – wie viele englische Wanderer vor mir – unter einem geiererfüllten Himmel über eine wüstenhafte Nebenstrecke des Jakobswegs. Ich folgte einem Gezeitenweg mit dem Spitznamen ›Doomway‹ (Weg der Verdammnis), bekannt als der tödlichste Weg Großbritanniens, auf dem ich allerdings einen herrlichen Spaziergang machte, bestaunte das himmlische Funkeln von Meteorenschauern über dem Nordatlantik, folgte einem Bogen des winterlichen Ridgeway auf Skiern und sah, da bin ich mir sicher, in Wiltshire einen Schwarzen Panther. Ich verbrachte die Nacht in Wäldern, auf Feldern, in Berghütten und auf der Kuppe eines Kreidehügels in Sussex, wo mir ein nächtlicher Spuk die Haare zu Berge stehen ließ, auch wenn ich mittlerweile vermute, statt Gespenster wohl Eulen gehört zu haben. Und überall begegnete ich Menschen – gewöhnlichen und ungewöhnlichen, stillen und redseligen, normalen und exzentrischen –, für die Land und Wandern lebensnotwendig sind, um sich und die Welt zu begreifen. Ich traf auf Tagediebe, Träumer, Sportler, Führer, Pilger, Wanderer, Stromer, Unbefugte, Kartografen – und einen Mann, der sich für einen Baum hielt und glaubte, Bäume seien Menschen.
Unter den Dutzenden Menschen, von denen ich in diesem Buch berichte, ist Edward Thomas der wichtigste. Er geistert durch alle meine Reisen, er trieb mich voran. Ich machte mich auf den Weg, um bis zu ihm zurückzugehen, ihm nahezukommen, und folgte den Pfaden als Routen in seine Vergangenheit; letztlich aber habe ich mehr über die Lebenden als über die Toten erfahren. In seiner Berliner Chronik erwähnt Walter Benjamin die Idee, sein eigenes Leben kartografisch darzustellen : »Lange, jahrelang eigentlich, spiele ich schon mit der Vorstellung«, schreibt Benjamin, »den Raum des Lebens – Bios – grafisch in einer Karte zu gliedern.«
So malte ich mir schließlich die Sphäre von Thomas’ Leben als eine Art Wegekarte aus, wie sie im vorletzten Kapitel zu finden ist : streng genommen nicht als Biografie, sondern im Sinne einer Biogeografie. Dieses Kapitel ist der Konvergenzpunkt meines Buches : die Kreuzung, an der alle Wege zusammenkommen.
Die Reisen, von denen ich hier erzähle, beziehen sich auf Zweierlei, die ferne Vergangenheit und die Trümmer und Phänomene der Gegenwart, denn das ist die Forderung, die alte Landschaften an uns stellen : Sie wollen im Damals gelesen und im Jetzt erspürt werden. Die Wegmarken meiner Wanderungen waren nicht nur Dolmen, Grabhügel und Hünenbetten, sondern auch das Eschenlaub des letzten Jahres (spröde in der Hand), die Fuchslosung der letzten Nacht (beißend in der Nase), der Vogelruf des Moments (schrill im Ohr), das poetische Knistern des Hochspannungsmasts und das Zischen der Pestizidspritzen.
Kreide
Jubelnde Lerchen ~ Gut fundierte Geologie ~ Träume in Kreide ~ Die ersten Pfade ~ Aufbruch ~ Der Unfall ~ Knochen für Kreide ~ Pfade als Wegweiser für den Geist ~ Apokalypse & amtliche Sperrung ~ Das Ei einer Lerche ~ Blinde Straßen & Schattenstätten ~ Luftfotografie als Wiederauferstehung ~ Der Schlafplatz am Hünenbett ~ Grabekunst ~ Der Phantomschritt ~ Die Wallabys von Buckinghamshire ~ Eine Illusion von Endlosigkeit ~ Spätes Tageslicht ~ Eine seltsame Zusammenkunft
… es handelt von einem Weg, der schon viele Meilen beginnt, bevor ich ihn betreten konnte, und erst Meilen endet, nachdem ich ihn verlassen musste.
edward thomas, 1913
Vier Uhr morgens, Ende Mai, lernte ich auf einem Hügel nahe Letchworth Garden City einen der wirksamsten Wecker der Welt kennen : einen Himmel voller Lerchen. Jetzt weiß ich, dass an Schlaf nicht zu denken ist, wenn Lerchen singen, und dass Lerchen nicht gerade Langschläfer sind. Sie singen bis zum letzten Sonnenstrahl und fangen im Morgengrauen wieder an.
Zwei Stunden mehr Schlaf hätte ich gut gebrauchen können. Ich war tags zuvor fast fünfzig Kilometer gewandert und weitere zehn geradelt. Ich hatte mir mindestens eine Rippe gebrochen, den linken Arm aufgeschürft und das rechte Knie geprellt. Ich hatte Blasen an den Füßen, für die es artesische Brunnen gebraucht hätte, um sie auszutrocknen. Meine Bettstatt war ein kleines Stück Wiese voller Disteln. Zwei weitere Stunden Schlaf hätte ich wirklich gut gebrauchen können. Aber der Lerchenwecker hatte geläutet. Sobald ich wieder wusste, wo ich war – unter freiem Himmel auf einem Kreidehügel, neben einem neolithischen Hünenbett –, besserte sich meine Laune. Und nachdem ich mich zum Hünenbett hinaufgeschleppt hatte und über die Landschaft von Bedfordshire blickte, die in einem langsam fließenden Meer aus weißem Nebel versunken lag, war ich in Hochstimmung. Unterdessen bereitete mich das unentwegte Lied der Lerchen auf einen langen Tag vor : den zweiten Tag auf dem Icknield Way, den zweiten Tag auf Kreide.
Man nehme eine gut fundierte geologische Karte der Britischen Inseln und breite sie auf dem Tisch oder Boden aus. Sie ist ein Werk von großer Schönheit, deren Farbmuster einem komplex marmorierten Vorsatzpapier aus dem 18. Jahrhundert gleicht. Jede Gesteinsoberfläche des Landes ist auf dieser Karte verzeichnet, jede in einer anderen Farbe. Granit ist dunkelrot. Weald-Lehm ein schlammiges Armeegrün. Das untere Westfalium, eine der kohleführenden Gesteinsschichten, glänzt in tintendunklem Purpur. London-Lehm ist rosa wie das Hemd eines Hedgefonds-Managers. Größere Städte und Straßen sind zwar auf der Karte verzeichnet, jedoch nur in Blassgrau, schwach durchscheinend unter den starken Farben.