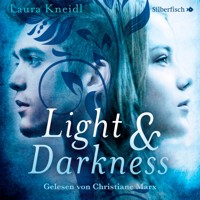9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Berühre mich nicht Reihe
- Sprache: Deutsch
Sie dachte, dass sie niemals lieben könnte. Doch dann traf sie ihn ...
Als Sage in Nevada ankommt, besitzt sie nichts - kein Geld, keine Wohnung, keine Freunde. Nichts außer dem eisernen Willen, neu zu beginnen und das, was zu Hause geschehen ist, zu vergessen. Das ist allerdings schwer, wenn einen die Erinnerungen auf jedem Schritt begleiten und die Angst immer wieder über einen hereinbricht. So auch, als Sage ihren Job in einer Bibliothek antritt und dort auf Luca trifft. Mit seinen stechend grauen Augen und seinen Tätowierungen steht er für alles, wovor Sage sich fürchtet. Doch Luca ist nicht der, der er auf den ersten Blick zu sein scheint, und als es Sage gelingt, hinter seine Fassade zu blicken, lässt dies ihr Herz gefährlich schneller schlagen ...
Sage und Luca - DIE große Liebesgeschichte des Winters!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Playlist
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
Danksagung
Die Autorin
Impressum
LAURA KNEIDL
Berühre mich. Nicht.
Roman
Zu diesem Buch
Ich habe keine Angst. Die Angst ist nicht real. Das ist Sage Dertings Mantra, als sie an ihrem 18. Geburtstag ihre Sachen packt, sich in ihr klappriges Auto setzt und Tausende Meilen zwischen sich und ihre Vergangenheit bringt. In Melview, Nevada, will sie neu beginnen – und vergessen. Vergessen, was zu Hause geschehen ist. Was er ihr angetan hat. Doch der Neuanfang gestaltet sich schwierig: Sie kennt niemanden in dem verschlafenen Städtchen, hat kein Geld und keine Wohnung. Zudem begleiten sie die Erinnerungen an ihn auf jedem Schritt. Immer wieder bricht die Angst über sie herein. So auch, als Sage einen Aushilfsjob in der Unibibliothek annimmt und dort auf Luca Gibson trifft. Luca ist groß und schweigsam. Mit den Tattoos auf seinen Armen und den stechend grauen Augen ist er genau die Art Mann, vor der Sage sich fürchtet. Die Vorstellung, stundenlang allein mit ihm im verstaubten Magazin der Bibliothek zu sein, lähmt sie. Doch sie weiß auch, dass sie keine Wahl hat, wenn sie das nötige Geld für ihr Studium aufbringen und ihre Nächte nicht länger in ihrem VW-Transporter verbringen will. Schnell merkt sie, dass Luca nicht der ist, der er auf den ersten Blick zu sein scheint. Hinter seiner kühlen Fassade verbirgt sich ein ganz anderer Mann – ein Mann, der Sage’ zerbrechliches Herz gefährlich schnell schlagen lässt …
Für die Eskalationsmädels, die mir immer zur Seite stehen – Bianca, Caro, Kim, Mona, Nadine, Rebecca und Yvonne
Playlist
Sia – Never Give Up
Danko Jones – Don’t Fall In Love
Katelyn Tarver – You Don’t Know
Casper – Ariel
Emilie Autumn – Manic Depression
Kaleo – Automobile
Disturbed – The Sound Of Silence
Florence + The Machine – Long & Lost
Rihanna feat. Calvin Harris – We Found Love
Hozier – Work Song
Jennifer Rostock – Deiche
Adele – Chasing Pavements
Zella Day – Wonderwall
Johnny Cash – One
Silverstein – Smile In Your Sleep
Seether feat. Amy Lee – Broken
Hurts – Stay
Slipknot – Snuff
Slipknot – Goodbye
MIKA – Happy Ending
1. Kapitel
Ich habe keine Angst.
Die Angst ist nicht real.
In meinem Kopf wiederholte ich die Worte wieder und wieder in der Hoffnung, mein Verstand würde diese irrationale Empfindung eines Tages auslöschen. Nur war dieser Tag nicht heute.
Ich wischte mir die feuchten Handflächen an der Jeans ab und atmete tief ein und wieder aus. Die Luft in der Bibliothek war trocken und kühl von der Klimaanlage. Es roch nach Staub und dem Leim, der benutzt wurde, um beschädigte Buchrücken zu kleben.
»Was kann ich für Sie tun?«
Ich blinzelte und trat mit weichen Knien einen Schritt vor. Der Bibliothekar, der hinter der Theke auf meine Antwort wartete, hatte dunkles Haar, und ein Bartschatten umspielte seinen Kiefer, als hätte er am Morgen keine Zeit mehr gehabt, sich zu rasieren. Er hatte dicke Finger mit abgekauten Nägeln und trug einen Ehering aus Gold. Er lächelte mich an.
Ich erwiderte das Lächeln nicht, sondern ließ stattdessen eine Strähne meines braunen Haars vor mein Gesicht fallen. In der rechten Hand konnte ich das verräterische Kribbeln einer herannahenden Panikattacke spüren. Normalerweise wurden diese nicht von so alltäglichen Situatione wie dieser ausgelöst, aber die neue Umgebung förderte meine Anfälle. Ich schluckte schwer und wollte antworten, doch die Worte, die ich mir am Morgen zurechtgelegt hatte, kamen mir nicht über die Lippen. Unbeholfen deutete ich auf das Schild, das neben der Theke angebracht war: Aushilfe(n) für Magazin-Katalogisierung gesucht.
Der Bibliothekar musterte mich eingehend, und ich verfluchte das Semester, das offiziell erst in einer Woche beginnen würde. In diesem Moment hätte ich mir ausnahmsweise die Anwesenheit anderer Studenten gewünscht. Eigentlich mochte ich Menschenansammlungen nicht sonderlich, und für gewöhnlich mied ich sie, dennoch war ich lieber eine von vielen, anstatt im Mittelpunkt zu stehen. Doch mit Ausnahme einiger weniger Besucher war die Bibliothek leer und ich die einzige Person an der Infotheke, sodass der Bibliothekar nur mich ansehen konnte.
»Sie wollen sich für den Aushilfsjob bewerben?«
»Ja.« Meine Stimme war ein heiseres Flüstern.
Hinter seiner Brille zog der Bibliothekar die Augenbrauen zusammen. Ich kannte diesen Ausdruck, ich hatte ihn schon auf Hunderten von Gesichtern gesehen. Sie alle hielten mich für durchgeknallt oder krankhaft schüchtern. Ich war weder das eine noch das andere, aber ich ließ die Leute gern in dem Glauben. Alles war besser, als wenn sie die Wahrheit kannten.
»Studieren Sie hier?«
Ich nickte.
Der Bibliothekar sah auf seinen Computerbildschirm. »Und wie heißen Sie?«
Mein Name.
Ich kannte meinen Namen.
Ich musste ihn nur aussprechen.
»Sage Derting.«
Der Bibliothekar tippte ihn in das System. »Gefunden.« Er runzelte die Stirn. »Sie haben keine aktuelle Adresse hinterlegt. Ich nehme an, Sie wohnen nicht mehr in Maine?«
Ich schüttelte den Kopf. Die Erinnerung daran, wie weit ich von Maine entfernt war, ließ etwas von meiner Panik weichen. Ziel meiner Reise war es gewesen, meinem alten Leben zu entkommen, und das war mir gelungen. Monatelang hatte ich meiner Flucht entgegengefiebert und alles in meiner Macht Stehende getan, um genügend Geld zusammenzukratzen, um hierherkommen zu können. Doch Benzin, Snacks, eine Übernachtung im Hostel, ein platter Reifen und ein Ölwechsel hatten mich auf der fast dreitausend Meilen langen Fahrt alles gekostet, und mein Kontostand näherte sich dem Nullpunkt. Deshalb brauchte ich diesen Job unbedingt. Ich hatte in der vergangenen Woche schon zu viele Absagen kassiert, um mir auch diese Chance entgehen zu lassen.
Ich räusperte mich. »Ich bin noch auf Wohnungssuche.« Die Lüge kam mir leicht über die Lippen, und der Bibliothekar stellte sie nicht infrage.
Er wühlte unter der Theke, zog ein Formular hervor und schob es mir über den Tresen zu. »Sie sind spät dran, aber wir haben uns noch für niemanden entschieden. Gehen Sie geradeaus bis zur Reihe G, dann links. Sie haben eine halbe Stunde, bis wir schließen.« Er hielt mir einen Stift mit dem Logo der Universität entgegen.
Ich betrachtete den Kugelschreiber und schätzte ab, wie nahe meine Finger seinen kommen würden, wenn ich danach griff. Fünfzehn Zentimeter. Es wäre keine direkte Berührung, käme dem allerdings sehr nahe.
»Ich habe etwas zum Schreiben dabei«, erwiderte ich, nahm das Formular an mich und eilte davon.
Das Kribbeln in meiner Hand ließ nach, als ich dem breiten Gang bis zu den Arbeitsplätzen im hinteren Bereich der Bibliothek folgte. Ein paar früh angereiste Studenten standen vereinzelt zwischen den massiven Holzregalen. Ich nahm jeden Einzelnen von ihnen wahr, doch während ich den Frauen kaum Beachtung schenkte, betrachtete ich die Männer ganz genau. Sie alle waren mit ihren Büchern oder Laptops beschäftigt und schienen mich nicht einmal zu bemerken.
Ich bog nach links in Reihe G ab und entdeckte mehrere Tische aus demselben dunklen Holz wie die Regale. An einem Ende saßen sich zwei Typen gegenüber. Derjenige der beiden, der mir den Rücken zugewandt hatte, hatte sich über ein Buch gebeugt und die Hände resigniert in die Haare geschoben, als würde er kein Wort von dem, was er da las, verstehen. Der andere kaute gedankenverloren auf seinem Bleistift herum und trommelte mit den Fingern der anderen Hand nervös auf die Tischplatte. Ein Teil von mir registrierte, dass er gut aussah. Seine Haut hatte eine natürliche Bräune, seine Haare waren rabenschwarz und das T-Shirt, das sich über seinen Bizepsen spannte, zeigte deutlich, dass er seine Zeit nicht nur in der Bibliothek verbrachte. Doch der Teil von mir, der wider jede Logik handelte, ließ mich in die entgegengesetzte Richtung laufen. Am anderen Ende der Reihe ließ ich mich auf einen freien Platz neben einem Mädchen fallen.
Sie blickte von ihrem Buch auf und runzelte die Stirn. »Hallo?«, fragte sie skeptisch.
»Hey.« Ich lächelte. »Kannst du mir einen Stift leihen?«
»Klar.« Sie griff in ihren Rucksack und reichte mir einen Kugelschreiber, der genauso aussah, wie der, den mir der Bibliothekar zuvor angeboten hatte.
Ich nahm ihn, ohne zu zögern. »Danke.«
»Du bewirbst dich um einen Aushilfsjob?« Sie deutete auf das Formular, das vor mir auf dem Tisch lag, und sofort fielen mir die Armbänder an ihrem Handgelenk auf. Sie waren aus Leder gebunden, mit eingeflochtenen Steinchen und goldenen Elementen, die den braunen Schnüren etwas Elegantes und Weibliches verliehen.
Ich nickte. »Hast du dich auch beworben?«
»Nein, in staubigen Kellern abzuhängen ist nicht so mein Ding. Ich habe eine Zusage vom Bistro auf dem Süd-Campus bekommen. Le Petit.« Sie sprach den Namen übertrieben französisch aus. »Kennst du es?«
»Ja, ich bin schon daran vorbeigelaufen.«
Ich hatte dem Bistro einen Besuch abgestattet, nachdem ich eine Stellenanzeige dafür am Schwarzen Brett entdeckt hatte. Allerdings hatte ich den Gedanken, mich dort zu bewerben, sofort wieder verworfen. Die Tische im Innenraum standen so eng beisammen, dass man sich unmöglich ohne Körperkontakt zwischen den Gästen hindurchbewegen konnte. Zudem war der Laden unübersichtlich und der Besitzer ziemlich Angst einflößend, mit seinen breiten Schultern und dem verschlossenen Gesicht.
»Ich bin übrigens April«, stellte sich das Mädchen vor. Sie hatte blonde Haare, die ihr in sanften Wellen über die Schultern fielen und ihr schmales Gesicht betonten. Mir wurde bewusst, dass sie die erste Person in meinem Alter war, mit der ich seit meiner Ankunft in Melview sprach.
»Sage.«
»Freut mich, dich kennenzulernen.« April schob ihren Block in das Buch und schloss es. »Studierst du im ersten Semester?«
Ich nickte. »Du auch?«
»Jup. Ich bin vor zwei Wochen hergezogen und büffle mich gerade durch die Vorkurse. Reicht es nicht, während des Semesters gequält zu werden?« Sie seufzte.
Ich lächelte sie mitfühlend an. »Woher kommst du?«
»Brinson. Eine Kleinstadt auf der anderen Seite des Sees, etwa hundert Meilen von hier.« Melview lag in der Nähe des Lake Tahoe, und nur ein paar Wälder trennten die Stadt und das College von dem See, der von zahlreichen Naturschutzgebieten umgeben war. »Kommst du von hier?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, aus Maine.«
»Wow, da bist du ganz schön weit weg von zu Hause.«
Ich zuckte mit den Schultern und senkte den Blick auf das Bewerbungsformular. Wäre es nach mir gegangen, hätte die Distanz noch größer sein können. Was natürlich schwachsinnig war. Dreitausend Meilen waren mehr als genug, dennoch gefiel mir die Vorstellung von einem Ozean zwischen mir und meiner Vergangenheit.
»Ich wollte mal in den Westen der USA«, sagte ich ausweichend.
»Und wieso nicht gleich Kalifornien?«
»Die UCLA hat mich abgelehnt.«
»Schade, aber hey, jetzt bist du hier, und wir haben uns kennengelernt. Also kein Grund, traurig zu sein.« April grinste mich an, als das Handy, das neben ihr auf dem Tisch lag, zu vibrieren begann. Ihr Lächeln verschwand, und sie öffnete die eingegangene Nachricht mit einem Seufzen. »Ich muss los, meinen Bruder abholen. Es wird Zeit, dass er endlich seinen Führerschein macht.« Sie packte ihre Unterlagen zusammen und stopfte sie in ihren schwarzen Rucksack. »Es war nett, dich kennenzulernen, Sage. Willst du mir vielleicht deine Handynummer geben?«
»Gerne.« Wir tauschten unsere Nummern aus, und April wünschte mir viel Erfolg bei meiner Bewerbung.
Ich sah ihr nach, bis sie hinter dem nächsten Regal verschwunden war, und versicherte mich mit einem Blick zur Seite, dass die Jungs noch immer in ihre Arbeit vertieft waren, ehe ich begann, das Bewerbungsformular auszufüllen.
Fünf Minuten vor Schließung der Bibliothek gab ich meine Bewerbung ab. Ich legte das Formular auf die Theke, um einer möglichen Berührung mit dem Bibliothekar zu entgehen. Er studierte das Blatt, nickte zufrieden und teilte mir mit, dass ich in den nächsten Tagen von ihm hören würde. Ich rang mir ein steifes Lächeln ab, das hoffentlich nicht allzu gequält wirkte, und verließ das alte Gebäude.
Ursprünglich war die Melview Universität eine Privatschule gewesen, mit der Bibliothek als Kernstück der Institution, wie man der Webseite der MVU entnehmen konnte. Erst in den Fünfzigerjahren war die Schule umfunktioniert worden, und seitdem war der Campus stetig erweitert worden, was zu einem interessanten Architekturmix geführt hatte. Einige Direktoren hatten den alten Stil beibehalten wollen, der an Harvard und andere Ivy-League-Colleges erinnerte. Andere wiederum waren auf Modernisierung aus gewesen, und so gab es nicht nur Gebäude aus Stein, sondern auch Neubauten mit klaren Kanten, viel Glas und Metall.
Mir gefiel diese Verschmelzung von Alt und Neu, und ich drehte mich noch einmal zu der Bibliothek um, während ich über den verlassenen Campus in Richtung der Parkplätze lief. Die Sonne war fast untergegangen, aber die Nächte in Nevada waren zu dieser Zeit des Jahres sehr mild. In Maine zeigte das Thermometer selten dreißig Grad, und ich besaß mehr Pullover und Jacken, als ich hier gebrauchen konnte. Allerdings fehlte mir das nötige Geld, um meine Garderobe anzupassen. Ich brauchte den Job in der Bibliothek. Dringend. Und auch ungeachtet meiner Garderobe würde mein Studium ohne Geld ein schnelles Ende finden. Ich konnte mir das College kaum leisten, nachdem ich für alle Stipendien abgelehnt worden war und nicht auf die finanzielle Unterstützung meiner Familie setzen konnte. Vermutlich würden sie mir das Geld geben, wenn ich danach fragte, aber das würde ich nicht tun. Mit geliehenem Geld gingen Verpflichtungen einher, die ich mit meiner Familie nicht bereit war einzugehen. Und bevor ich deswegen auch nur einen Fuß zurück nach Maine setzte, machte ich es mir lieber unter einer Brücke bequem.
Ich erreichte den Parkplatz, auf dem der alte VW-Transporter stand, den ich seit drei Monaten mein Eigen nennen durfte. Der rote Lack war zerkratzt und wies bereits Rostflecken auf, der Motor röhrte unangenehm laut und die Polster waren durchgesessen. Für jemand anderen wäre der Wagen wohl ein Wrack; ich liebte ihn. Ich hatte keine Ahnung von Mechanik und dergleichen, aber dieser VW hatte mir die Freiheit gebracht und bot mir darüber hinaus seit einer Woche ein Dach über dem Kopf.
Ich schob die große Flügeltür auf und stieg ein. Sofort schaltete ich die drei Taschenlampen ein, die ich mithilfe von Schnüren, Klebeband und Drähten an der Decke befestigt hatte. Sie leuchteten den Innenraum aus, der derzeit mein ganzes Leben beherbergte. Auf der einen Seite lag mein Schlafsack, den ich mit Matten unterlegt hatte, um es auf dem metallenen Untergrund bequemer zu haben. Ich besaß nur ein einziges Kissen und eine alte Patchworkdecke aus pinkfarbenen und violetten Flicken, die mir meine verstorbene Großmutter zur Geburt genäht hatte. Sie war nicht sonderlich groß und ziemlich verwaschen, mit losen Fäden und kleinen Löchern. Aber ich brachte es nicht über mich, sie wegzuschmeißen, denn in gewisser Hinsicht war sie mein wertvollster Besitz. Sie erinnerte mich an eine Zeit, in der noch alles in Ordnung gewesen war, und wenn ich tief genug Luft holte, glaubte ich manchmal, dass sie noch immer nach dem Haus meiner Großmutter roch. Nach Plätzchen, Kräutern und Geborgenheit. Auf der anderen Seite des Innenraums, neben meinem provisorischen Bett, standen zwei übereinandergestapelte Kartons mit Kleidung. Der restliche Platz wurde von Plastikcontainern eingenommen, in denen ich das Zubehör für den Schmuck aufbewahrte, den ich designte und auf Etsy verkaufte.
Ich setzte mich auf meinen Schlafsack, mummelte mich in die Patchworkdecke ein und las die SMS, die mir meine Mom bereits vor einer Stunde geschickt hatte.
Ich hab versucht, dich anzurufen, aber habe dich nicht erreicht. Leider muss ich gleich zur Arbeit. Vielleicht versuch ich es in der Pause noch mal, wenn es nicht zu spät wird. Hab dich lieb. Mom.
Ich las die Nachricht ein zweites Mal und hoffte, die Worte würden irgendetwas in mir auslösen. Sehnsucht. Heimweh. Zugehörigkeit. Aber da war nichts; nur Erinnerungen, die ich vergessen wollte. Ich schluckte schwer, und um keinen Verdacht zu wecken, schickte ich meiner Mom eine Nachricht, in der ich ihr eine ruhige Nacht im Krankenhaus wünschte. Sie hatte keine Ahnung von den Dingen, die passiert waren.
Bevor ich mich in meinen negativen Gedanken verlieren konnte, zog ich eine der Schmuckboxen zu mir heran, in der ich angefangene Ketten aufbewahrte, und machte mich an die Arbeit.
Mit fünfzehn hatte ich begonnen, Armbänder, Ketten und Ohrringe zu entwerfen. Zuerst hatte der Schmuck nur eine Ablenkung sein sollen. Das Fädeln von Ketten und Kleben von Ohrringen half mir dabei, nicht über meine Situation nachzudenken, doch mittlerweile war die handwerkliche Arbeit zu einer Flucht aus dem Alltag geworden. Wenn ich hier saß, in meinem Van, mit meiner Decke und den Perlen, war meine Welt in Ordnung. Für eine Weile schien die Realität stillzustehen, und ich konnte mich in ein Leben träumen, in dem meine Ängste nicht existierten. Und je mehr Schmuck ich bastelte, desto näher kam ich dieser Realität.
Es war meine Freundin Megan gewesen, die mich dazu gedrängt hatte, die Ketten und Ohrringe online zu verkaufen. Ich hatte mir nicht viel davon versprochen, zu meiner Überraschung fand meine Arbeit allerdings schnell erste Interessenten. Ein Vermögen verdiente ich damit nicht, aber ohne das falsche Gold, das Silber und die Lederbändchen hätte ich mir die Flucht aus Maine nie leisten können.
Eigentlich sollte ich nicht hier sein. Nur Studenten, die in den Wohnheimen lebten, durften die Häuser ohne Begleitung betreten. Aber ich hatte keine andere Wahl, wenn ich duschen wollte.
Ich passte die Mittagszeit ab, zu der immer Leute aus den Wohnheimen kamen, um in die Mensa zu gehen. Ich lauerte vor der Tür und tat so, als wäre ich mit meinem Handy beschäftigt, bis zwei Mädchen das Gebäude verließen. Sie waren so in ihre Unterhaltung vertieft, dass sie mich überhaupt nicht bemerkten. Ich zögerte nicht und hielt die Tür auf, bevor sie wieder zufallen konnte, dann schlüpfte ich ins Innere des Wohntrakts und straffte meine Schultern, um eine selbstsichere Haltung bemüht.
Die Flure waren leer und von einer gespenstischen Stille erfüllt, die am offiziellen Semesterbeginn der Vergangenheit angehören würde. Nur vereinzelt waren aus den Zimmern Geräusche zu hören. Mit einem Handtuch unter dem Arm lief ich die Treppe hinauf. Zwar besaß jede Etage eine Gemeinschaftsdusche, aber wie ich vor einigen Tagen beobachtet hatte, waren im ersten Stock neue Brauseköpfe angebracht worden, und ich hatte Lust, mir etwas Luxus zu gönnen. Ich konnte das Schild mit der Aufschrift Waschraum bereits von der Treppe aus sehen und beschleunigte meine Schritte.
Plötzlich wurde eine der Zimmertüren geöffnet. Ich zuckte zusammen, ermahnte mich allerdings weiterzugehen, um nicht aufzufallen. Doch ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein Mann aus dem Zimmer kommen würde.
Ich erstarrte. Der Kerl, der mir nun gegenüberstand, erschien mir wie die Personifizierung all meiner Ängste. Er war groß, ein Riese im Vergleich zu meinen eins fünfundsechzig. Eine Tätowierung erstreckte sich über seinen gesamten rechten Arm, und an seinem Zeigefinger glaubte ich ebenfalls einen dunklen Schatten zu erkennen. Dies lenkte meine Aufmerksamkeit auf seine Hände. Seine freien Hände. Hände, mit denen er mich jederzeit packen und gegen die Wand drücken könnte. Mit einem Mal wurde mir so kalt, als würde Eiswasser statt Blut durch meine Adern fließen, und ein taubes Gefühl breitete sich in meinen Gliedern aus.
Als der Kerl meinem Blick begegnete, sog ich scharf die Luft ein. Seine Augen waren wie ein Regentag – diesig, kalt und grau, seine Haare wellten sich in dunkelblonden Locken um sein Gesicht. Und ein schiefes Grinsen, das anzüglicher nicht hätte sein können, umspielte seine Lippen. Langsam zog er die Tür hinter sich zu.
Ich habe keine Angst.
Die Angst ist nicht real.
Mein Mantra half nicht. In diesem Moment war meine Angst sehr real. Sie war mir so vertraut wie eine alte Bekannte, und einmal mehr war ich dem Irrglauben erlegen, sie kontrollieren zu können.
Der Typ kam mit bedachten Schritten auf mich zu. Ich wollte wegrennen, aber ich war eine Gefangene meines eigenen Körpers. Je näher er mir kam, umso mehr Details nahm ich wahr. Die Tätowierung an seinem Arm bestand ausschließlich aus geometrischen Figuren, die sich zu einem symmetrischen Muster verwoben. Der Schatten an seinem Finger war ein Blitz. Ein kleiner Höcker zierte seine Nase, zu ebenmäßig, um von einem Bruch zu stammen, und ein violetter Bluterguss prangte an seinem Hals.
Obwohl dieser Kerl mich lediglich ansah, wuchs in mir der Drang, um Hilfe zu schreien. Doch selbst wenn ich es wirklich gewollt hätte, wäre ich nicht dazu in der Lage gewesen, auch nur einen Ton herauszubringen.
Mittlerweile war der blonde Typ nur noch eine Armlänge von mir entfernt. Er erwiderte meinen Blick, und diesmal lag etwas Gieriges in seinen Augen. Gefiel ich ihm?
»Du hast mich nicht gesehen«, flüsterte er, eine Drohung in seinen Worten.
Ich nickte mechanisch.
Sein Lächeln wurde breiter, und er ging an mir vorbei zur Treppe.
Regungslos verharrte ich auf der Stelle, bis seine Schritte verklungen waren. Dann schloss ich die Augen und holte tief Luft, um mich zu beruhigen. Meine Hände zitterten heftig, und meine Muskeln entspannten sich nur langsam. Unsicher auf den Beinen lief ich weiter in Richtung des Waschraums. Immer wieder spähte ich über die Schulter. Der Typ kam nicht zurück, und ich schlüpfte eilig in das Gemeinschaftsbad.
Fünf Minuten später stand ich unter einem der neuen Brauseköpfe, aus dem warmes Wasser auf mich herabregnete. Die Dusche hatte nicht die entspannende Wirkung, auf die ich gehofft hatte, aber zumindest war inzwischen die Panik von mir abgefallen, nur ein dumpfes Echo des Unwohlseins war zurückgeblieben und ließ mich diesen Kerl nicht vergessen. Wer war er? Und was hatte er im Mädchenwohnheim getrieben? Die Antwort war natürlich offensichtlich und der Knutschfleck an seinem Hals Hinweis genug. Ich war vielleicht paranoid und kaputt, aber ganz bestimmt nicht dumm. Schließlich hatten nicht alle Achtzehnjährigen dasselbe gestörte Verhältnis zum anderen Geschlecht wie ich.
Ich wusste, dass meine Reaktion unlogisch und ich vermutlich verrückt war. Es war nicht richtig, alle Männer über einen Kamm zu scheren und mit ihm zu vergleichen. Der Bibliothekar beispielsweise war wahrscheinlich ein völlig normaler Familienvater, der gewöhnliche Dinge mit seinen Kindern unternahm. Er war harmlos, und mein logisches Ich erkannte das auch. Aber dieses Etwas, das meine Angst heraufbeschwor, hatte nichts mit Logik zu tun. Es war ein Instinkt, ein Schutzmechanismus, der mich antrieb, sobald mir ein männliches Wesen gegenüberstand, das mir körperlich überlegen war.
In den Monaten, bevor ich meinen Highschoolabschluss gemacht hatte, hatte ich mich häufiger mit der Schulpsychologin getroffen. Ich wollte herausfinden, was es mit meiner Angst auf sich hatte, um sie besser verstehen zu können. Wir hatten versucht, das Problem zu analysieren, was uns bis zu einem gewissen Grad auch gelungen war. Dr. Pacat hatte allerdings immer wieder betont, mir erst richtig helfen zu können, wenn ich ihr alles erzählte. Ich war dazu nicht bereit gewesen, was zur Folge gehabt hatte, dass unsere Termine immer seltener geworden waren, bis sie schließlich gar nicht mehr stattgefunden hatten.
Ich stellte das Wasser ab und drückte eine große Portion des nach Mango duftenden Shampoos aus dem 99-Cent-Store in meine Hand. Es schäumte ordentlich, wie ich es mochte, und hätte es ein Radio gegeben, wäre die Dusche perfekt gewesen.
Das Gesicht gegen den Wasserstrahl gerichtet und die Augen geschlossen spülte ich mir den Schaum aus den Haaren, als mein Handy klingelte. Es spielte keinen Song aus den Charts oder dergleichen, sondern piepste einfach vor sich hin. Schnell schlang ich mir das Handtuch, das ich bereitgelegt hatte, um den Körper und sprang aus der Dusche. Ich eilte zu meinem Kleiderstapel und fischte das Handy mit nassen Fingern aus der Hosentasche.
»Hallo?«
»Miss Derting?«, fragte eine männliche Stimme.
»Ja?« Es war erleichternd zu wissen, dass mich meine Angst zumindest nicht daran hinderte, mit Männern zu telefonieren.
»Hier ist Mr Strasse aus der Bibliothek. Sie haben sich um den Aushilfsjob im Magazin beworben. Ich wollte Ihnen mitteilen, dass Sie die Stelle bekommen haben und …« Seine nächsten Worte hörte ich nicht, denn eine Woge der Erleichterung erfasste mich. Ich unterdrückte ein Quietschen und sprang aufgeregt auf und ab.
Ich hatte einen Job!
Ich hatte einen Job!
Ich hatte einen Job!
Einen Job!
Einen Job, in dem ich Geld verdiente! Vielleicht könnte ich mir bald schon ein richtiges Bett leisten.
»Kommen Sie nach Ihrer letzten Vorlesung am Montag in die Bibliothek, dann erzähle ich Ihnen alles Weitere. Ist das für Sie in Ordnung?«
»Absolut«, platzte ich heraus.
Natürlich war mir bewusst, was das bedeutete. Ich würde mit Mr Strasse allein in das Magazin gehen müssen. Aber ich hatte keine andere Wahl. Und lieber verbrachte ich ein paar Minuten mit diesem Mann in einem dunklen Keller, als das ganze Semester in einer Bar oder einem Café arbeiten zu müssen. Dieser Job war genau das, was ich brauchte: abgeschieden und einsam. In der Bibliothek könnte ich mich aufhalten, ohne Ablenkung und ohne Sorge, dass bedrohlich aussehende Typen meinen Weg kreuzten.
2. Kapitel
Der erste Tag des Semesters begann mit Rückenschmerzen. Ich fühlte ein Brennen, das sich von meinen Schultern die Wirbelsäule hinab bis zu meinem Steißbein zog, als ich mich aus meinem Transporter quälte. Ich war vielleicht erst achtzehn Jahre alt, aber auf dem Boden eines VWs zu schlafen bekam niemandem gut – in keinem Alter.
Während mich in den vergangenen Tagen nur das Rauschen der Straße, das Zwitschern der Vögel und das leise Murmeln vereinzelter Unterhaltungen am Morgen begrüßt hatten, schlug mir heute ein gewaltiger Chor aus Stimmen entgegen. Seit ich auf dem Parkplatz kampierte, hatte ich den Campus noch nie so voll erlebt wie heute. Überall standen, saßen und gingen Studierende, und der Parkplatz war bis auf ein paar Lücken voll besetzt.
Mein Blick zuckte instinktiv zu den männlichen Studenten in meiner Nähe. Ich betrachtete ihre Gesichter und suchte darin nach Anzeichen von Feindseligkeit. Doch niemand schien sich für mich zu interessieren, und der in mir auflodernde Funke der Panik verglomm wieder. Ich holte tief Luft und drehte den Oberkörper nach links und rechts, bis ein angenehmer Schmerz durch meine Wirbelsäule fuhr und meine Muskeln sich langsam entspannten.
»Hey, Sage!«
Ich senkte die Arme und sah mich irritiert um. In Melview kannte niemand meinen Namen, außer … April. Sie lief über den Parkplatz und kam geradewegs auf mich zu. Ich hatte in den vergangenen Tagen ein paarmal überlegt, ihr eine Nachricht zu schreiben, hatte aber stets einen Rückzieher gemacht aus Angst, das Falsche zu sagen.
»Guten Morgen. Schon aufgeregt?«
Ich sah von ihr zu den Gebäuden, die hinter ihr aufragten und ihre langen Schatten über den Rasen warfen, und nickte heftig. »Ob es jemandem auffällt, wenn ich heute schwänze?«
April schürzte ihre rot geschminkten Lippen. »Vermutlich nicht, aber willst du das wirklich riskieren? Und später neben der gruseligsten Person des Kurses landen, weil das der einzige noch freie Sitzplatz ist?«
Ich schüttelte den Kopf, und Bilder des Fremden, dem ich im Wohnheim begegnet war, blitzten vor meinem inneren Auge auf. »Besser nicht.«
»Da hast du deine Antwort.« April schob den Riemen ihres Rucksacks zurecht. »Hat es mit dem Job in der Bibliothek geklappt?«
Ich lächelte. »Ja, heute Nachmittag habe ich meine erste Schicht.« Der Gedanke, mit Mr Strasse allein im Magazin zu sein, bereitete mir noch immer Bauchschmerzen, dennoch konnte ich es kaum erwarten, endlich Geld zu verdienen.
»Du klingst, als würdest du dich wirklich freuen.«
»Das tu ich auch«, beteuerte ich. »Ich wollte diesen Job.«
Skeptisch zog April eine wohlgeformte Augenbraue in die Höhe. »Es macht sicherlich unglaublich viel Spaß, an einem so schönen Tag wie heute in einem Keller rumzusitzen.«
»Dort ist es schön kühl«, bemerkte ich und zog meine Tasche aus dem VW.
Ich wollte die Tür zuschieben, aber meine Bewegung hatte Aprils Aufmerksamkeit auf den Wagen gelenkt. Sie packte meinen Arm und stoppte mich, bevor ich die Tür schließen konnte. Neugierig warf sie einen Blick in das Innere des VWs. Die Taschenlampen an der Decke waren ausgeschaltet, allerdings reichte das Tageslicht aus, um alles erkennen zu können. Und obwohl ich stolz auf diesen Transporter war und auf das, was er für mich symbolisierte, war er mir vor April peinlich. Wir kannten uns kaum, und nun wusste sie, dass ich praktisch obdachlos war. Ein Auto galt wohl kaum als fester Wohnsitz.
Sie zog ihren Kopf aus dem Wagen und sah mich an. »Bitte sag mir, dass du nicht in deinem Auto lebst.«
»Ich lebe nicht in meinem Auto.«
»War das eine Lüge?«
»Ja.«
»Du kannst da drin nicht wohnen.«
»Können tu ich das schon.« Ich zuckte mit den Schultern und versuchte, die Situation herunterzuspielen. Ich würde alles tun, um die Sorge und das Mitleid aus Aprils Blick zu vertreiben. Der VW war nicht optimal, aber es gab Schlimmeres. Ich hatte es erlebt.
»Du kannst auf keinen Fall hierbleiben.« April musterte meinen Schlafsack und biss sich nachdenklich auf die Unterlippe. »Ich werde mit meinem Bruder reden«, sagte sie plötzlich, wilde Entschlossenheit in der Stimme.
»Worüber?«
»Ich werde ihn fragen, ob du auf unserer Couch schlafen kannst, nur ein paar Tage, bis du eine Wohnung gefunden hast.« Sie zögerte. »Du suchst doch nach einer Wohnung, oder?«
»Nein«, gestand ich.
Wieder zog April eine Braue hoch. »Nein?«
»Ja … also nein … Ich meine, ich suche keine Wohnung«, erklärte ich stotternd und zog die Tür des Transporters zu. »Ich mag meinen Wagen, und außerdem will ich mich nicht aufdrängen.«
»Du drängst dich nicht auf, ich habe es dir angeboten.« Obwohl die Tür geschlossen war, ruhte ihr Blick noch immer auf meinem VW. »Außerdem ist das Angebot nicht ganz uneigennützig. Ich könnte wirklich etwas Verstärkung gebrauchen. Weißt du, wie es ist, ständig nur von Kerlen umgeben zu sein?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Es ist furchtbar«, sagte April. »Mein Bruder wohnt seit drei Jahren in der Wohnung und sieht sie als sein Reich an. Überall stehen seine Bücher und DVDs rum, und ich bekomme schon eine Standpauke, wenn ich nur einen Eyeliner im Bad liegen lasse. Und ständig hängt sein bester Freund bei uns ab. Sie starren dann, ohne ein Wort zu sagen, auf den Fernseher und zocken irgendeinen lächerlichen Ego-Shooter. Und ich verpasse mal wieder eine neue Folge meiner Lieblingsserie.«
»Das tut mir leid.« Ich fragte April nicht, wie ich auf der Couch schlafen sollte, wenn ihr Bruder und dessen Kumpel dort die ganze Zeit mit virtuellen Waffen spielten, es war ohnehin egal. »Wieso bist du überhaupt bei deinem Bruder eingezogen, wenn er dich so nervt?«
Sie seufzte, während wir uns vom Parkplatz in Richtung Universität aufmachten. »Weil er auch mein Freund ist. Ich weiß, das klingt total öde. Welcher Versager ist schon mit dem eigenen Bruder befreundet? Aber abgesehen von dieser Wohnungssache und seinen Frauengeschichten ist er der Beste.«
»Ich finde das nicht langweilig«, erklärte ich, ohne April anzusehen. Stattdessen ließ ich den Blick zwischen den Studenten umherwandern, die unseren Weg kreuzten. Niemand achtete auf mich, und statt Angst verspürte ich nur eine gehörige Portion Unruhe, wie so oft, wenn ich unter Menschen war. Aber diese Art von Furcht lähmte mich nicht, und solange alle gebührend Abstand zu mir hielten, drohte nicht die Gefahr einer Panikattacke. »Ich wäre gerne mit meiner Schwester befreundet.«
»Jünger oder älter?«, fragte April.
»Jünger. Dreizehn, um genau zu sein, und sie ist stinksauer, weil ich hierhergezogen bin.« Zumindest vermutete ich das. Ich hatte seit meiner Abreise aus Maine nicht mehr mit ihr geredet, obwohl ich ihr versprochen hatte, sie anzurufen. Doch ich hatte es bisher nicht über mich gebracht, eine Verbindung zu meinem alten Leben herzustellen aus Angst davor, was das für meinen Neuanfang bedeuten könnte.
»Ich stehe auf ihrer Seite. Ältere Geschwister sind das Letzte. Immer bekommen sie alles vor einem und wissen das gar nicht zu schätzen.«
Ich wusste das College und seine Distanz zu Maine sehr zu schätzen, mehr als Nora jemals begreifen würde. Nur konnte ich April das nicht sagen, also tat ich ihre Bemerkung mit einem Lächeln ab.
Sie zog ein Haargummi vom Handgelenk und band ihre blonden Wellen zu einem wirren Knoten auf dem Kopf zusammen. »Ich werde trotzdem mit meinem Bruder reden. Damit er vorgewarnt ist, falls du dich entscheidest, mein Angebot anzunehmen, und sei es nur für eine Nacht. Dein Auto kann unmöglich bequem sein.«
»Danke«, erwiderte ich, ohne auf ihren letzten Kommentar einzugehen. »Vielleicht komm ich irgendwann darauf zurück.«
Sie lächelte, und damit war das Thema erledigt. Wir schlenderten über den weitläufigen Campus, an einigen Wohnhäusern und der Mensa vorbei in Richtung Bibliothek.
»Was ist deine erste Vorlesung?«, fragte April einen Moment später.
»Sozialwissenschaften. Und deine?«
»Physik.«
»Physik?«, echote ich irritiert.
Sie nickte.
»Was willst du später damit machen?«
»Das weiß ich noch nicht, aber ich mag Physik und Mathe einfach.«
»Wieso?«
»Wieso nicht?«
Ich starrte April an. Ich musste als Schlüsselqualifikation einmal die Woche einen Mathematik-Grundkurs belegen, das reichte mir bereits. »Ist das nicht offensichtlich?«
Sie lachte. »Was soll ich sagen? Ich mag die Logik hinter diesen Fächern. Sobald du den Lösungsweg begriffen hast, kann dich nichts mehr überraschen. Und wo wir gerade beim Thema Vorlesungen sind. Ich muss los.« Sie strich ihre helle Bluse mit den vergoldeten Knöpfen glatt und zupfte am vorderen Saum, um sicherzustellen, dass er auch ordnungsgemäß im Bund ihrer Boyfriend-Jeans steckte. »Wie seh ich aus?«
»Wie eine Studentin, die ihren ersten Tag rocken wird.«
Ein breites Lächeln trat auf Aprils Lippen, und wir verabschiedeten uns voneinander. Während die geisteswissenschaftlichen Kurse in den alten Gebäuden östlich der Bibliothek stattfanden, wurden die Naturwissenschaften westlich in den neueren Bauten unterrichtet.
Als ich mich auf den Weg zu meiner Vorlesung machte, vermisste ich sofort die Ablenkung durch April. Ohne sie nahm ich die Leute auf dem Campus intensiver wahr. Ein gehetzt aussehender Student eilte rechts an mir vorbei. Ein anderer Kerl kreuzte meinen Weg und rannte mich dabei beinahe um. Und direkt hinter mir lief ein Mann mit langen schwarzen Haaren, und ich hätte schwören können, dass er mir bereits seit dem Parkplatz folgte.
Ich beschleunigte meine Schritte, dankbar für die Anwesenheit der anderen Studentinnen. Mir war bewusst gewesen, dass ich mich an der MVU meinen Ängsten würde stellen müssen, aber das war der Preis, den ich zahlen musste, um wirklich frei zu sein. Zwar gab es Colleges nur für Frauen, aber den Gedanken daran, eines von ihnen zu besuchen, hatte ich von Beginn an verworfen, denn ich weigerte mich zu akzeptieren, dass mich meine Vergangenheit auf diese Weise gefangen hielt. Ich wollte ein normales Leben führen, und irgendwann würde ich dazu auch bereit sein. Nur meine Angst stand mir im Weg, und die einzige Möglichkeit, sie zu überwinden, bestand darin, sich ihr zu stellen.
Ich straffte die Schultern und lief in Richtung des Gebäudes, in dem meine erste Vorlesung stattfinden würde. Einer der Vorteile, bereits seit einigen Tagen auf dem Campus zu sein, war der, dass ich mich nicht mehr zurechtfinden musste. Die Möglichkeiten, sich in einem Transporter zu beschäftigen, waren begrenzt, weshalb ich viel über den Campus spaziert war und eine Art Spiel daraus gemacht hatte, immer neue Wege und Abkürzungen zu entdecken. Außerdem war ich häufig in der Bibliothek gewesen, um an den öffentlich zugänglichen Computern meine neusten Etsy-Bestellungen abzuarbeiten. Seit ich von zu Hause ausgezogen war, mangelte es mir am eigenen technischen Equipment. Ich hatte das Notebook, das der ganzen Familie gehörte, zurücklassen müssen, und auf dem Handy hatte ich kein Datenvolumen. Meine Abwesenheit im Netz hatte sich inzwischen merkbar auf meine Verkäufe und Bewertungen ausgewirkt. Immer häufiger beschwerten sich Kunden, dass ich nicht schnell genug auf ihre Anfragen reagierte, aber im Moment konnte ich nichts daran ändern.
Ich erreichte die Fakultät für Sozialwissenschaften. Es handelte sich um einen neueren Bau, der jedoch im Stil der alten Architektur entworfen worden war. Aus der Ferne war der Unterschied kaum zu erkennen, aus der Nähe allerdings schon. Der Stein war weniger brüchig, die Fensterläden waren zu gerade eingesetzt, und die Lüftungen funktionierten weitaus zuverlässiger als in den Altbauten.
Das Auditorium meines ersten Kurses war von überschaubarer Größe. Der Raum fasste nur etwa fünfzig Studenten, und ich fragte mich, ob frischgebackene Highschoolabsolventen für alle so offensichtlich zu erkennen waren wie für mich. Sie saßen schweigend auf ihren Stühlen, das Schreibmaterial vor sich ausgebreitet, und warteten auf den Professor, während die älteren Studenten auf den Tischen hockten und sich in kleinen Gruppen unterhielten. Es waren viele Studentinnen anwesend, und bevor ich Gefahr lief, einen männlichen Tischnachbarn zu bekommen, setzte ich mich schnell auf einen freien Platz zwischen zwei Erstsemester. Sie bedachten mich mit skeptischen Blicken, die ich ignorierte, denn ich war auch so schon nervös genug. Bisher hatten mich April und mein Weg hierher abgelenkt, aber nun fragte ich mich plötzlich, ob ich mich für die richtigen Vorlesungen entschieden hatte. Was, wenn sie mir nicht gefielen? Ich hatte ein ziemlich genaues Bild von dem, was ich später machen wollte, und jetzt festzustellen, dass mir das Studium nicht zusagte oder ich es sogar hasste, wäre eine große Enttäuschung.
Die Dozentin, Professor Carson, ließ nicht lange auf sich warten. Sie war eine hochgewachsene Frau im mittleren Alter und trug einen langen Rock und ein Top, das genauso gut aus dem Kleiderschrank einer ihrer Studentinnen hätte stammen können. Der Reihe nach las sie unsere Namen von einer Teilnehmerliste ab, und wir mussten uns der Gruppe vorstellen, mit der wir im laufenden Semester eng zusammenarbeiten würden. Mit nur sieben männlichen Zuhörern gelang es mir sogar, etwas über mich zu erzählen, ohne zu stottern. Anschließend präsentierte Professor Carson den Lehrplan und erklärte uns die Anforderungen, die sie an die Arbeiten hatte, die am Ende des Semesters unsere Note bestimmen würden.
Die Vorlesung ging schnell vorbei, und gemeinsam mit einigen anderen Studentinnen eilte ich anschließend in den Nordflügel des Gebäudes zum nächsten Kurs: Einführung in die Psychologie.
Der Raum war größer und fasste rund zweihundert Studenten. Es gab noch immer mehr weibliche als männliche Zuhörer, dennoch war das Verhältnis ausgewogener. Ich hatte einen Platz neben zwei Studentinnen ergattert, war mir aber des Kerls, der direkt hinter mir saß, nur allzu deutlich bewusst. Das Einzige, was mich davon abhielt, deswegen durchzudrehen, war der Tisch zwischen uns. Er war solide und aus Holz, eine Barriere, die nicht so leicht zu überwinden war. Dennoch musste ich mir immer wieder die feuchten Hände an der Jeans abwischen, um den Kugelschreiber zwischen den kalten Fingern halten zu können. Ich verspürte den Drang, mich umzudrehen, um der vermeintlichen Gefahr ins Auge zu blicken. Doch ich widerstand dem Bedürfnis und verfolgte stattdessen jeden Schritt von Professor Eriksen, der die Stufen des Hörsaals hinaufstieg, um das Literaturverzeichnis zu verteilen, auf dem alle Bücher aufgelistet waren, die für seine Vorträge und Klausuren relevant waren. Die Länge der Liste entlockte mir ein Stöhnen, und auch meine Kommilitonen ächzten entsetzt.
»Ich erwarte von Ihnen, dass Sie jedes dieser Bücher lesen«, erklärte Eriksen, die Arme hinter dem Rücken verschränkt. »Es mag Ihnen viel vorkommen – und das ist es auch –, aber die Psychologie ist ein komplexes Thema. Sie funktioniert nicht wie die Betriebswirtschaft. Jeder Mensch ist anders, und jedes Krankheitsbild zeigt andere Facetten …«
Eriksens nächste Worte hörte ich nicht mehr, denn in diesem Moment ließ mich eine Berührung an der Schulter zusammenzucken. Der Kerl, der hinter mir saß, hatte mich mit seinem Stift angestupst. Wieso hatte er das getan? Ich biss die Zähne zusammen und versuchte, ruhig weiterzuatmen. Wir befanden uns schließlich in einem vollen Hörsaal. Kein Grund zur Sorge.
Der Kerl tippte mich ein zweites Mal an. Ich ignorierte ihn, aber als sich der Kugelschreiber ein drittes Mal in meine Schulter bohrte, war es vorbei mit meiner Selbstbeherrschung. Ich wirbelte auf meinen Stuhl herum und drängte mich mit dem Rücken gegen meinen Tisch.
Ich starrte den Kerl an, der den Stift nun zwischen zwei Fingern hin und her drehte. Er lächelte, und ich musterte ihn eindringlich. Er hatte ein schwarzes T-Shirt an, auf dem eine Figur prangte, die mich an irgendein Videospiel erinnerte, und trotz der Hitze trug er eine Mütze. Er hatte sie weit aus der Stirn nach hinten geschoben, sodass einige schwarze Haare darunter hervorlugten.
»Hey.«
Ich blieb stumm. Blinzelte.
Der Kerl räusperte sich und neigte den Kopf. »Ich hab dich vorhin mit April über den Campus laufen sehen.« Das war keine Frage, sondern ein Statement.
Ich nickte. »Du kennst sie?« Meine Stimme war nur ein Flüstern, aber da Professor Eriksen noch referierte, konnte das zumindest niemand auf meine Angst zurückführen.
»Schon ihr ganzes Leben lang.«
Meine Unsicherheit bröckelte von mir ab, als ich begriff, wen ich hier vor mir hatte. Ich hatte nicht erwartet, Aprils Bruder in diesem Kurs anzutreffen. Er hatte nicht viel Ähnlichkeit mit ihr, abgesehen von den Augen, doch während Aprils eher gräulich waren, leuchteten seine in einem hellen Blau. Sein Blick war freundlich, und meine Muskeln entspannten sich ein wenig.
»Ich bin Gavin.«
Mein Mund war trocken, und ich fuhr mir mit der Zunge über die spröden Lippen. »Sage.«
Gavins Lächeln wurde breiter, und ich war froh, dass er nicht versuchte, mir die Hand zu reichen. »Du bist das Mädchen aus der Bibliothek.«
Ich stutzte. »Sie hat dir davon erzählt?«
Er nickte, was mich nicht wunderte. April hatte mir bereits gesagt, dass sie sich gut mit ihrem Bruder verstand. »Hast du den Job bekommen?«
»Ja, heute ist mein erster Tag.« Ich wusste nicht, wieso ich ihm diese Information gab, vermutlich, weil er es sonst ohnehin von April erfahren würde. Womöglich waren meine irrationalen Gefühle aber auch endlich mal bereit, auf meinen Verstand einzugehen, der sich keine Sorgen wegen Gavin machte.
Er grinste. »Cool.«
»Cool«, echote ich wie ein Trottel und wartete darauf, dass er noch etwas hinzufügte – irgendetwas, denn mir fehlten die Worte. Ich hatte noch nie länger mit einem Jungen in meinem Alter gesprochen und wusste nicht, was ich sagen sollte. Gavin blieb allerdings ebenfalls stumm, und somit starrten wir einander schweigend an.
Sein Blick war so eindringlich, dass mir eine Gänsehaut die Arme emporkroch. Ich schluckte schwer, meine Lippen teilten sich, aber es kam immer noch kein Ton heraus. Bevor die Situation noch merkwürdig werden konnte, wandte ich mich von Gavin ab und wieder Professor Eriksen zu. Dabei verfluchte ich mich selbst. Ob er April erzählen würde, wie eigenartig ich mich verhalten hatte?
Die Vorlesung endete, und während alle auf die Ausgänge zustürmten, blieb ich an meinem Platz sitzen und tat so, als würde ich mir Notizen machen, obwohl ich in Wahrheit nur den Körperkontakt mit anderen beim Verlassen des Saals vermeiden wollte. Mir gefiel es nicht zurückzubleiben, aber diese Tricks, die ich mir über die Jahre angewöhnt hatte, machten es mir leichter, mit allem klarzukommen.
3. Kapitel
Nach meiner letzten Vorlesung machte ich mich auf den Weg in die Bibliothek. An der Information hieß mich Mr Strasse willkommen. Er streckte mir seine Hand entgegen, aber ich ergriff sie nicht. Mit dünner Stimme murmelte ich etwas von Bakterien, was mir einen irritierten Blick einbrachte.
Strasse führte mich an den Regalen voller Bücher vorbei in die hinterste Ecke des Gebäudes, wo eine rote Kordel den Studenten den Zutritt untersagte. Hinter der Absperrung führte eine Treppe in den Keller hinab. Ich folgte dem Bibliothekar mit gebührendem Abstand bis zu einer verschlossenen Tür.
Ich habe keine Angst.
Die Angst ist nicht real.
Das Mantra half mir, ebenso wie die Gedanken an das, was passieren würde, wenn ich in diesem Job versagte und wieder zurück nach Maine musste. Die Erinnerung hielt mich an Ort und Stelle fest und machte die Situation ein wenig erträglicher.
»Sie kommen jederzeit ohne Schlüssel aus dem Magazin raus, nur nicht rein«, erklärte Strasse und entriegelte die Tür mit einem Chip, den er an den Türgriff hielt.
Das Licht im Inneren schaltete sich automatisch ein und beleuchtete einen Raum, in dem sich metallene Regale eng aneinanderreihten. Die Luft war kalt und trocken wie im Rest der Bibliothek, dazu kam der abgestandene Geruch von jahrzehntealtem Staub.
Mr Strasse führte mich tiefer in das Magazin hinein, und es kostete mich viel Konzentration, nicht nur auf seine Körperhaltung zu achten, sondern auch auf seine Worte.
Meine Aufgabe war geradezu lächerlich einfach. Ich sollte mir eine Kiste mit Büchern nehmen, die dazu passenden Katalogkarten aus einem der Schränke suchen und die Daten des jeweiligen Titels in den Computer eintippen, um sie zu digitalisieren. Anschließend gab ich jedem Karton eine Nummer, die ebenfalls hinterlegt wurde, damit die Bücher bei Bedarf schnell gefunden werden konnten. Fertig. Es war der perfekte Job, um den Verstand abzuschalten und dem stressigen Studentenalltag zu entkommen.
»Haben Sie noch Fragen?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Wenn etwas ist, wissen Sie, wo Sie mich finden.«
Ich nickte, und eine Minute später fiel die Tür hinter Mr Strasse ins Schloss. Ich war allein.
Meine Schritte hallten durch den Raum, als ich auf eines der Regale zuging und die erste Kiste herauszog. Eine dicke Staubschicht hatte sich auf dem Deckel gebildet. Vorsichtig nahm ich ihn ab und inspizierte die alten Bücher.
Nach gut einer Stunde war ich mit der ersten Kiste fertig. Obwohl die Aufgabe nicht besonders schwierig war, nahmen die einzelnen Schritte mehr Zeit in Anspruch als erwartet. Zumal die Katalogkarten im Schrank nicht alle richtig ins Alphabet einsortiert waren.
Ich schob Karton Nummer eins gerade an seinen Platz zurück, als ich hörte, wie die Tür zum Magazin geöffnet wurde. Vermutlich war es Mr Strasse, der nach dem Rechten sehen wollte. Ich richtete mich auf und stellte selbstzufrieden fest, dass ich keine Angst verspürte. Monotone Arbeit mit den Händen hatte schon immer eine beruhigende Wirkung auf mich gehabt. Ich strich mein Top glatt, ignorierte die staubigen Flecken auf dem Stoff und trat hinter dem Regal hervor – und da war er.
Er war hier.
Direkt vor mir.
Nur fünf Schritte von mir entfernt stand der Kerl aus dem Wohnheim. Mein Magen verkrampfte sich, während ich reglos auf die schwarze Tinte starrte, die unter dem Ärmel seines T-Shirts hervorlugte. Bilder, die ich am liebsten vergessen hätte, blitzten vor meinem inneren Auge auf und raubten mir den Atem. Meine Glieder begannen zu Kribbeln.
»Hey.« Seine Stimme klang so tief wie in meiner Erinnerung. »Bist du Sage?« Ich bemerkte nicht, dass ich nickte, aber offensichtlich tat ich es, denn der Kerl sprach weiter. »Ich bin Luca. Wir arbeiten zusammen an der Katalogisierung.«
Nein.
Nein.
Nein.
Nein.
Plötzlich war da nur noch dieses eine Wort.
Wir arbeiten zusammen an der Katalogisierung.
Unmöglich.
Wir konnten nicht zusammenarbeiten.
Auf keinen Fall!
Ausgeschlossen!
Gemeinsam mit Mr Strasse ein paar Minuten im Keller auszuharren war eine Sache, aber mit diesem Kerl? Nein!
»Ich glaube, wir sind uns schon mal begegnet«, fuhr er fort und machte einen Schritt auf mich zu. Er hatte einen Rucksack über der Schulter hängen. Seine Hände waren frei, er hatte sie locker in die Hosentaschen geschoben. »Im Wohnheim. Erinnerst du dich?« Bei diesen Worten trat ein träges Grinsen auf seine Lippen.
In diesem Moment wurde es mir zu viel. Ich lief in einem großen Bogen um ihn herum zum Ausgang und riss die Tür auf. Mit einem lauten Knall fiel sie hinter mir ins Schloss. Ich stürzte den schummrigen Flur entlang, die Treppe hinauf bis in die Bibliothek. Dankbar nahm ich die Anwesenheit der anderen Studenten wahr, die nun zwischen Luca und mir standen. Trotzdem hastete ich weiter durch die Regalreihen auf der Suche nach einem ruhigen Fleckchen. Dabei war ich mir der irritierten Blicke der anderen deutlich bewusst, aber es war mir egal.
Schließlich entdeckte ich einen leeren Gang. Ich lief bis zu dessen Ende und ließ mich zwischen Wand und Regal zu Boden gleiten. Ich zog die Beine an den Oberkörper, schlang die Arme um die Knie und vergrub das Gesicht in der Mulde dazwischen. Obwohl ich nur ein paar Hundert Meter gerannt war – wenn überhaupt –, war ich vollkommen außer Atem, und schwarze Punkte flimmerten vor meinen Augen. Ich japste nach Luft und verspürte eine lächerliche Erleichterung darüber, heil davongekommen zu sein. Als hätte Luca mir zur Begrüßung ein Messer an die Kehle gehalten.
Was machte dieser Kerl hier? Mr Strasse hatte nie etwas von einer zweiten Aushilfe gesagt, oder? Ich erinnerte mich an die Zusage, wie ich in der Dusche auf und ab gehüpft war und einen Teil seiner Worte verpasst hatte. Hatte er mir währenddessen von Luca erzählt? Möglicherweise, aber das spielte nun keine Rolle mehr. Ich war hier und er war es auch. Nun war die Frage, wie ich damit umgehen wollte. Meinem Bauchgefühl nach hätte ich den Job sofort kündigen sollen. Diese Art von Fluchtreaktion war typisch für mich, aber nicht die Lösung für meine Probleme. Zwar könnte ich diesem Kerl damit aus dem Weg gehen, aber vor der Realität meines neuen Lebens würde es mich nicht schützen. Arbeitsplätze für Studenten in Melview waren knapp und hart umkämpft, und ich gehörte mit meiner mangelnden Erfahrung nicht gerade zu den gefragtesten Mitarbeitern, was mir die Fülle an Absagen deutlich gezeigt hatte. Und selbst wenn ich versuchte, meine Chancen positiver einzuschätzen, würde es eine Weile dauern, bis ich eine neue Stelle fand, die meinen Bedürfnissen gerecht wurde, und so viel Zeit hatte ich nicht. Ich brauchte Bücher und Materialien für die Vorlesungen, die ich mir von den 43.22 Dollar, die sich noch auf meinem Konto befanden, nicht leisten konnte. Ganz davon abgesehen, dass ich es allmählich leid war, mich in Duschen zu schleichen, in einem Transporter zu schlafen und mich von Sandwiches aus dem Automaten zu ernähren. Und ein Studentendarlehen kam nicht infrage. Der Semesterbeitrag war bereits hoch genug, und das Letzte, was ich brauchte, waren noch mehr Schulden und Zinsen, die ich zurückzahlen musste. Ich wollte das College nicht komplett verschuldet verlassen.
Ich hob den Kopf und stützte das Kinn auf den Knien ab. Der Gang war nicht mehr leer. Nur wenige Meter von mir entfernt stand ein älterer Herr. Ich war kurz verwirrt, ihn hier zu sehen, bis ich mich erinnerte, dass das College Rentnern anbot, ausgewählte Kurse kostenlos zu besuchen.
Der Mann hatte schütteres graues Haar, das seine fleckige Kopfhaut entblößte. Als er mich bemerkte, musterte er mich aus leicht zusammengekniffenen Augen. Ein sanftes und zugleich trauriges Lächeln erschien auf seinen Lippen, als würde er meinen Schmerz verstehen. Ich erwiderte das Lächeln, und er wandte sich wieder den Büchern zu.
Warum konnte ich mich Luca gegenüber nicht so verhalten? Wieso sah mein Körper in jedem Muskel, in jedem Zentimeter Körpergröße und jedem gesprochenen Wort eine Bedrohung?
Ich seufzte, und auch wenn ein Teil von mir sich dagegen sträubte, wusste ich, was zu tun war. Jedes halbwegs ernst zu nehmende Argument führte darauf hinaus, dass ich diesen Job behielt, mich meinen Ängsten stellte und einen Weg fand, mit Luca zusammenzuarbeiten. Wieso ausgerechnet mit ihm? Wieso musste es jemand sein, der meine schlimmsten Erinnerungen so bildhaft zum Leben erweckte? Hätte es nicht jemand wie Aprils Bruder sein können? Jemand mit einem wachen Blick und einem freundlichen Lächeln, das nicht dem verführerischen Grinsen des Teufels glich?
Ich verwarf die Fragen sofort wieder. Es half nichts, ich konnte an der Situation nichts ändern, sondern mich ihr nur stellen. Also rappelte ich mich vom Boden auf und ging zur Information.
Mr Strasse fragte nicht, wieso ich das Magazin verlassen hatte, und ehe ich mich versah, stand ich im Türrahmen zum Kellerraum. Mein Inneres vibrierte nervös, aber ich musste der Sache eine Chance geben. Anderenfalls würde meine Angst gewinnen, und ich durfte nicht zulassen, dass meine Vergangenheit meine Zukunft boykottierte.
Ich nahm einen tiefen Atemzug und trat ein.
Luca saß vor dem Computer. Er lümmelte auf dem alten Bürostuhl, als wäre es ein bequemer Sessel. Die Hände in den Nacken gelegt und den Kopf zurückgeworfen, starrte er an die Decke. Noch hatte er mich nicht bemerkt, und ich nutzte die Sekunden, um ihn ausgiebig zu mustern. Er trug eine schwarze Jeans und ein graues Shirt, das seine muskulösen Arme und sein Tattoo betonte. Die blonden Locken standen wirr von seinem Kopf ab, und an seinem Hals war immer noch der Schatten eines Knutschfleckes zu erkennen.
Ich musste unbewusst einen Laut von mir gegeben haben, denn in diesem Augenblick drehte sich Luca zu mir um und ließ den Blick aus seinen grauen Augen über meinen verkrampften Körper wandern. Meine Fingerspitzen waren kalt und feucht, und ich hoffte inständig, dass er aus der Entfernung nicht sehen konnte, wie stark ich zitterte.
Einige Sekunden betrachtete Luca mich eindringlich, bis erneut ein schiefes Lächeln auf seine Lippen trat. »Wenn du das nächste Mal panisch wegrennst, wäre es nett zu wissen, warum. Ich dachte schon, es brennt.«
Ich presste die Lippen aufeinander und nickte.
»Wollen wir noch einmal von vorne anfangen?«, fragte er und richtete sich auf dem Bürostuhl auf, der unter seinem Gewicht knarzte.
Während er auf mich zukam, hielt ich den Blick fest auf seine Arme und die Bewegungen seiner Hände gerichtet. Es kostete mich all meine Kraft, nicht vor ihm zurückzuweichen, als er vor mir stehen blieb.
»Hey, ich bin Luca.« Er streckte mir eine Hand entgegen, und ich starrte seinen Finger an, auf den er einen kleinen Blitz tätowiert hatte. Ich fragte mich, was dieser bedeutete. »Du musst Sage sein. Wir arbeiten zusammen an der Katalogisierung.«
Ich sah von seiner Hand zu seinem Gesicht und wieder zurück. Ich zögerte. Nein, ich zögerte nicht, ich wusste, dass ich ihn nicht anfassen würde. Er war mir ohnehin schon zu nahe.
»Meine Hände sind staubig«, erwiderte ich und schob sie demonstrativ in die Taschen meiner Jeans. Es war eine lahme Ausrede, die mir nur stockend über die Lippen kam.
Luca zog eine Augenbraue hoch und ließ die Hand sinken. »Mr Strasse meinte, er hätte dir schon alles erklärt.«
Ich nickte. Schon wieder.
»Und?« Luca sah mich erwartungsvoll an. Sein rechter Mundwinkel zuckte, und ich war mir sicher, dass mein Herz aufhörte zu schlagen – jedoch nicht vor Entzücken. »Erklärst du es mir auch, oder muss ich raten?«
Ich schüttelte den Kopf – diesmal immerhin kein Nicken. Endlich hatte ich einen Grund, etwas Abstand zwischen uns zu bringen. Gefangen zwischen Luca und meiner Angst verknoteten sich allerdings meine Füße, als ich zurückwich, sodass ich ungeschickt in Richtung des Regals stolperte, an dem ich eben noch gearbeitet hatte.
Hinter mir hörte ich ein Husten, das wie ein unterdrücktes Lachen klang. Ohne darauf einzugehen zog ich eine der Bücherkisten hervor und hielt sie wie ein Schutzschild vor meine Brust. »Du nimmst dir einen Karton«, erklärte ich Luca, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Ich ging zum Schrank mit den Katalogkarten hinüber und stellte die Kiste davor ab. Seine Schritte hallten durch den Raum, als er mir folgte. »Dann suchst du die passenden Karten zu den Büchern heraus und gibst die Daten in den Computer ein.« Ich deutete auf den uralten Kasten, dessen Lüftung laut brummte. »Anschließend nummerierst du den Karton und hinterlegst die Zahl ebenfalls im System, damit der Inhalt schnell gefunden werden kann.«
»Das ist alles?«, fragte Luca.
Ich nickte und wartete kurz, ob er noch etwas sagen oder eine Frage stellen würde, bevor ich die Kiste öffnete und das erste Buch herausnahm. Es war ein alter Geschichtsband mit vergilbten Seiten, von denen sich einige bereits gelöst hatten. Ich machte mich daran, die Karteikarten zu durchsuchen, konnte meine Aufmerksamkeit jedoch nicht völlig von Luca lösen. Selbst ohne ihn direkt anzusehen war ich mir seiner Anwesenheit nur allzu bewusst. Ich nahm seine Bewegungen aus dem Augenwinkel wahr und hörte, wie er zum Regal lief, um selbst eine Kiste herauszunehmen. Seine Schritte echoten durch den Raum, bevor er den Karton neben meinen stellte. Staub wirbelte auf, und er hustete. Ich zuckte zusammen. Er war mir nahe. Zu nahe. Und trotzdem war ich weder erstarrt noch rannte ich davon. Die Angst war nach wie vor da, aber offensichtlich hatte dieser emotionale, unlogische Teil von mir endlich begriffen, was es für Konsequenzen haben würde, sollte es mir nicht gelingen, mich mit Luca zu arrangieren.
In den darauffolgenden Stunden arbeiteten wir schweigend nebeneinander und ich setzte alles daran, Luca aus dem Weg zu gehen. Jedes andere Mädchen hätte sich vermutlich ein Loch in den Bauch gefreut, mit jemandem wie ihm allein im Magazin zu sein. Die Möglichkeiten, die sich hier boten, waren grenzenlos, aber genau diese Möglichkeiten bereiteten mir Sorgen. Doch wenigstens war meine Angst diesmal nicht völlig blind und ohne Verstand. Mit der Zeit schien sie zu begreifen, dass Luca nicht hier war, um mir zu schaden. Er wollte Geld verdienen, genau wie ich, und sein Schweigen machte deutlich, wie gleichgültig ich ihm war. Er interessierte sich nicht für mich, und solange ich ihm nicht in die Quere kam, war ich in Sicherheit.
Zumindest hoffte ich das.
4. Kapitel
Am nächsten Morgen weckte mich ein Klopfen. Blinzelnd öffnete ich die Augen und stöhnte. Die Nacht war zu schnell vergangen. Ich war versucht, meinen Besuch zu ignorieren, als dieser erneut gegen die Außenwand des Transporters hämmerte.
»Eine Minute!«, rief ich mit rauer Stimme und schälte mich aus dem Schlafsack. Ich zupfte die Patchworkdecke, die über meinen Schultern lag, zurecht und schaltete eine der Taschenlampen ein. Ein Blick auf mein Handy zeigte mir, dass ich erneut einen Anruf meiner Mom verpasst hatte. Ich öffnete die SMS, die sie hinterhergeschickt hatte.
Ich hoffe, du hattest einen schönen ersten Tag. Wir vermissen dich. Mom.
Ohne auf die Nachricht zu antworten, warf ich das Handy in eine meiner Schmuckkisten.
Ich fühlte mich erschöpft und ausgelaugt, obwohl ich gut zehn Stunden geschlafen hatte, nur die Schmerzen im Rücken hielten mich davon ab, mich wieder auf den harten Metallboden zu legen. Nach meiner Schicht in der Bibliothek war ich am Ende gewesen – psychisch und physisch. Der gestrige Tag und vor allem Lucas Anwesenheit hatten mich all meine Kraft gekostet. Panisch und erleichtert zugleich war ich aus der Bibliothek gestolpert, nur um mich wenige Minuten später hinter einem Busch zu übergeben, nachdem sich der nervöse Knoten in meinem Magen endlich gelöst hatte.
Meine Angstzustände glichen einer Partie russischem Roulette, begleitet von dem Glauben, dass jeder Moment der letzte sein könnte. Die Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Und immer, wenn man an der Reihe war und den Abzug drückte, starb man innerlich, nur um das Leben anschließend für ein paar Minuten erneut willkommen zu heißen, wenn sich die Kugel nicht gelöst hatte – bis man wieder am Zug war. Der ständige Wechsel zwischen Furcht und Erleichterung verlangte einem alles ab. Und man musste der Versuchung widerstehen, nicht sechs Mal hintereinander den Abzug zu drücken, nur damit die Ungewissheit ein Ende fand. Nicht dass ich je versucht hätte, mich umzubringen. Zwar hatte ich schon des Öfteren daran gedacht, aber es waren sprunghafte Gedanken gewesen, wie wohl die meisten Teenager sie einmal im Leben hatten.
Wieder klopfte jemand an die Tür des Transporters. Ich blickte an mir hinunter und stellte erleichtert fest, dass ich nicht den pinkfarbenen Pyjama anhatte, der mir eigentlich schon zu klein war. Offenbar war ich zu erschöpft gewesen, um mich umzuziehen, weshalb ich nur die Jeans ausgezogen hatte. Eilig schlüpfte ich in eine Leggins und öffnete die Wagentür.
Es überraschte mich nicht, April dort zu sehen, da sie die Einzige war, die wusste, dass ich in dem VW lebte. Sie trug eine dunkle Jeans und ein kariertes Hemd, das ihr etwas zu groß war. Das Outfit hätte simpel wirken können, hätte sie es nicht mit einer Statementkette und großen Ohrringen kombiniert, die an mir affig ausgesehen hätten, jedoch perfekt zu ihr passten.
»Guten Morgen, Schlafmütze.«
Ich kniff die Augen gegen das helle Morgenlicht zusammen. »Guten Morgen.«
»Lässt du mich rein? Ich hab Frühstück mitgebracht.« Sie hielt eine Papiertüte und zwei Plastikbecher in die Höhe, die in einer Papphalterung standen. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee stieg mir in die Nase.
»Frühstück. Das Zauberwort.« Ich machte Platz, damit sie neben mir in den VW steigen konnte.
Kaum saßen wir auf meinem Schlafsack, drückte April mir einen der Becher in die Hand.
»Danke, das wäre nicht nötig gewesen.«
»Die schönsten Überraschungen sind die, die nicht nötig sind.« April grinste und holte zwei Schokomuffins aus der Tüte.
Allein der Anblick reichte aus, um mir das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen, und mein Magen gab ein bestimmendes Knurren von sich. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal einen Muffin gegessen hatte. Sie gehörten zu der Art von Luxus, den ich mir nicht mehr leisten konnte, seit ich von zu Hause weggegangen war.
»Danke«, wiederholte ich und nippte an meinem Kaffee. »Wie war dein erster Tag?«