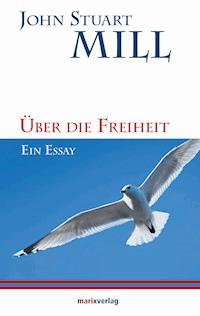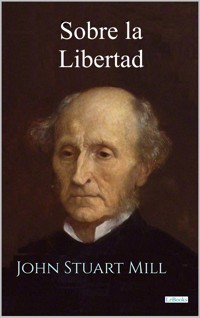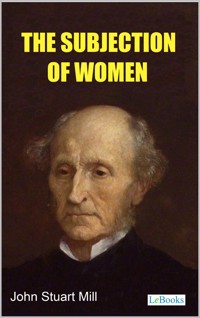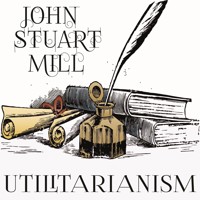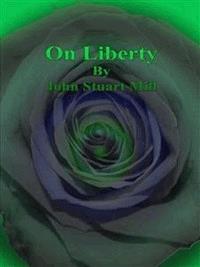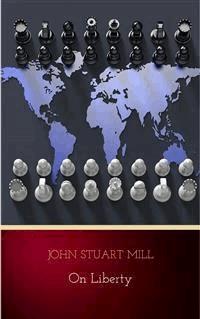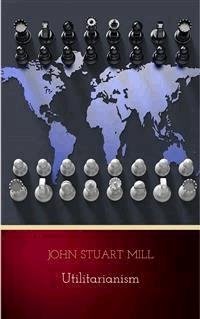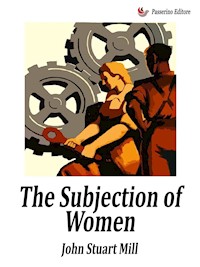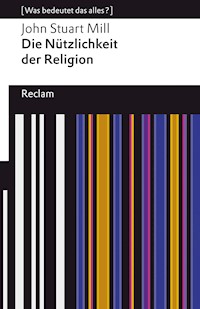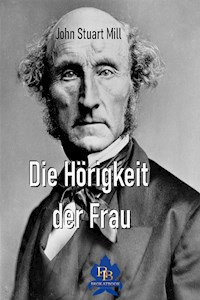17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die anhaltende Diskussion um die »Krise des Parlamentarismus« zeigt, dass die normative Begründung und systematische Bestimmung von Parlamentsfunktionen und demokratischer Öffentlichkeit von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der repräsentativen Demokratie ist. Das Problem ist aber nicht neu, wie John Stuart Mills klassischer Text zeigt. Er kreist um die Frage, wie sich die Gefahr einer »Tyrannei der Mehrheit« mit den Partizipationsanforderungen demokratischen Regierens versöhnen lässt. Mill begründet darin u. a. ein deliberatives Verständnis von Politik und erörtert die Gefahren einer bürokratischen Strangulierung politischer Freiheit. Ein Schlüsselwerk der Demokratietheorie und Parlamentarismusforschung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Die anhaltende Diskussion um die »Krise des Parlamentarismus« zeigt, dass die normative Begründung und systematische Bestimmung von Parlamentsfunktionen und demokratischer Öffentlichkeit von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der repräsentativen Demokratie sind. Das Problem ist aber nicht neu, wie John Stuart Mills klassischer Text zeigt. Er kreist um die Frage, wie sich die Gefahr einer »Tyrannei der Mehrheit« mit den Partizipationsanforderungen demokratischen Regierens versöhnen lässt. Mill begründet darin u.a. ein deliberatives Verständnis von Politik und erörtert die Gefahren einer bürokratischen Strangulierung politischer Freiheit. Ein Schlüsselwerk der Demokratietheorie und Parlamentarismusforschung.
John Stuart Mill (1806-1873), englischer Philosoph und Ökonom, gehört zu den einflussreichsten Denkern des 19.Jahrhunderts. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter des politischen Liberalismus.
Hubertus Buchstein ist Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Greifswald.
Sandra Seubert ist Professorin für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Politische Theorie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
John Stuart Mill
Betrachtungen über dieRepräsentativregierung
Herausgegeben, editorisch bearbeitetund mit einem Nachwortvon Hubertus Buchstein undSandra Seubert
Aus dem Englischen vonHannelore Irle-Dietrich
Suhrkamp
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2067
© dieser Ausgabe Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der bertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
eISBN 978-3-518-73517-6
www.suhrkamp.de
5Inhalt
Vorrede
Zur zweiten Auflage
I. Inwieweit Regierungsformen Objekt freier Entscheidung sind
II. Das Kriterium einer guten Regierungsform
III. Die Repräsentativregierung als ideal beste Regierungsform
IV. Unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen eine Repräsentativregierung unmöglich ist
V. Über die Repräsentativkörperschaften angemessenen Funktionen
VI. Schwächen und Gefährdungen der Repräsentativregierung
VII. Wahre und falsche Demokratie: Repräsentation der Gesamtheit und Repräsentation allein der Mehrheit
VIII. Über die Ausweitung des Wahlrechts
IX. Soll der Wahlvorgang aus zwei Phasen bestehen?
X. Das Abstimmungsverfahren
XI. Über die Mandatsperiode der Parlamente
XII. Sollen Parlamentsabgeordnete an Aufträge ihrer Wähler gebunden sein?
XIII. Über das Zweikammersystem
XIV. Über die Exekutive im Repräsentativsystem
XV. Über kommunale Repräsentativkörperschaften
XVI. Nationenbildung und Repräsentativsystem
XVII. Bundesstaatliche Repräsentativregierungen
XVIII. Über das Regieren von Kolonien durch freie Staaten
Hubertus Buchstein, Sandra Seubert: Nachwort
Namenregister
Sachregister
7Vorrede
Diejenigen, die mir die Ehre erwiesen haben, meine früheren Schriften zu lesen, werden wahrscheinlich den Eindruck gewinnen, dass sich in diesem Band wenig grundlegend Neues findet. Denn die Leitgedanken sind genau die, die ich während des größten Teils meines Lebens ausgearbeitet habe, und auch die meisten praktischen Vorschläge wurden bereits von anderen oder von mir selbst geäußert. Das Neue besteht im Zusammenbringen dieser Gedanken und im Aufzeigen ihres inneren Zusammenhanges sowie, wie ich meine, auch in der Untermauerung dieser Ansichten. Außerdem treffen einige der Überlegungen, wenngleich sie nicht neu sind, gegenwärtig genauso wenig auf allgemeine Akzeptanz, als ob sie es wären.
Mir scheint indes einiges darauf hinzudeuten – vor allem angesichts der jüngsten Debatten um die Parlamentsreform –, dass sowohl Konservative als auch Liberale (wenn ich sie weiterhin so bezeichnen darf, wie sie sich selbst immer noch bezeichnen) ihr Vertrauen in die politischen Überzeugungen verloren haben, zu denen sie sich nominell bekennen. Gleichzeitig hat aber keine der beiden Seiten bislang irgendeinen Fortschritt hinsichtlich der Formulierung besserer Grundsätze gemacht. Eine solche bessere Doktrin muss aber möglich sein. Und zwar nicht lediglich als Kompromiss, bei dem die Differenzen zwischen beiden aufgespalten werden, sondern als etwas Umfassenderes, so dass diese Doktrin ihres überlegenen Gesamtzusammenhangs wegen sowohl von Liberalen als auch von Konservativen angenommen werden könnte, ohne dass sie auf etwas verzichten müssten, was sie in ihren eigenen Überzeugungen als besonders wertvoll erachten. Wenn so viele Menschen dunkel das Fehlen einer solchen Doktrin spüren und sich gleichzeitig so wenige damit schmeicheln, sie bereits gefunden zu haben, dann sollte ein jeder ohne Zurückhaltung seine eigenen Überlegungen und das Beste, was er von den Gedanken anderer dazu kennt, auf den Tisch legen, um zur Herausbildung dieser Doktrin beizutragen.
(1861)
8Zur zweiten Auflage
Die einzige, nicht auf einzelne Wörter bezogene Veränderung in der gegenwärtigen Auflage (mit Ausnahme einer kurzen Anmerkung in Kapitel XIV) besteht in der Hinzufügung einiger Seiten zu Kapitel VII, die geschrieben wurden, um einige der Schwierigkeiten, auf die von den Gegnern des dort verteidigten Plans zur Vertretung von Minderheiten verwiesen wurde, zu bereinigen.
(1861)
9I. Inwieweit Regierungsformen Objekt freier Entscheidung sind
Alle Betrachtungen über Regierungsformen sind mehr oder weniger ausschließlich von zwei gegensätzlichen Theorien über politische Institutionen geprägt; oder genauer: von gegensätzlichen Auffassungen über des Wesens politischer Institutionen.
Einige Theoretiker fassen Regieren als eine im strikten Sinn praktische Kunst auf, die keine andere Frage als jene nach Mitteln und Zweck aufwirft. Regierungsformen werden mit allen anderen Mitteln zur Erreichung menschlicher Ziele auf eine Stufe gestellt. Sie werden ausschließlich als eine Frage des Erfindens und Konstruierens betrachtet. Da sie von Menschen gemacht sind, wird angenommen, dass es in der Entscheidung des Menschen steht, sie zu machen oder nicht, und zu bestimmen, auf welche Weise oder nach welchem Modell sie gemacht werden sollen. Regierung stellt nach dieser Auffassung ein Problem dar, das wie jede andere praktische Aufgabe zu bewältigen ist. Der erste Schritt ist eine Definition der Zwecke, deren Förderung man von Regierungen erwartet. Der nächste ist eine Untersuchung, welche Regierungsform am besten geeignet ist, diese Zwecke zu erreichen. Hat man in diesen beiden Punkten hinreichende Klarheit erlangt und diejenige Regierungsform ermittelt, die größtmögliche Vorteile mit den geringsten Nachteilen verbindet, so bleibt nur noch, die Zustimmung der Mitbürger – bzw. derer, für die die Institutionen bestimmt sind – zu dieser von Einzelnen gewonnenen Auffassung zu erlangen. Die beste Regierungsform zu ermitteln, andere zu überzeugen, dass sie die beste ist, und sie dazu zu bringen, auf deren Einführung zu bestehen: das ist die Gedankenfolge in den Überlegungen derer, die dieser Richtung der politischen Theorie folgen. Sie betrachten – bei Anerkennung von Unterschieden in der Größenordnung – eine Verfassung nicht anders als einen Dampfpflug oder eine Dreschmaschine.
Ihnen gegenüber steht eine andere Richtung von politischen Denkern, die, weit entfernt, eine Regierungsform einer Maschine gleichzustellen, diese vielmehr als eine Art spontanes Produkt und die Regierungslehre gewissermaßen als einen Zweig der Naturge10schichte betrachten. Ihrer Auffassung nach sind Regierungsformen kein Objekt freier Entscheidung. Im Großen und Ganzen muss man sie nehmen, wie man sie vorfindet. Regierungssysteme können nicht nach einem vorgefassten Plan konstruiert werden. Sie »werden nicht gemacht, sondern wachsen«.[1] Unsere Aufgabe ihnen wie allen anderen Naturgegebenheiten gegenüber ist es, ihre Eigenschaften kennenzulernen und uns nach ihnen zu richten. Die grundlegenden politischen Institutionen eines Volkes gelten dieser Schule als eine Art organisches Gebilde, das aus der Natur und dem Leben des betreffenden Volkes erwächst – ein Produkt seiner Gewohnheit, Instinkte, unbewussten Bedürfnisse und Wünsche, kaum je aber seiner bewussten Absichten. Der Wille des Volkes hat bei der Herausbildung seiner fundamentalen politischen Institutionen keine andere Funktion als die, den Erfordernissen des Augenblicks mit entsprechenden Planungen zu begegnen; Maßnahmen, die, sofern sie den Gefühlen und dem Charakter des Volkes einigermaßen entsprechen, in aller Regel fortbestehen und durch allmähliche Ansammlung eine politische Struktur hervorbringen. Diese ist dem betreffenden Volke angemessen, aber sie auf irgendein anderes Volk zu übertragen, aus dessen Eigenart und Lebensbedingungen sie sich nicht von selbst entwickelt hat, müsste scheitern.
Es ist schwer zu sagen, welche dieser Lehren unsinniger wäre, wenn man annehmen müsste, dass eine von beiden ausschließliche theoretische Gültigkeit besitzt. Aber die Thesen, die die Menschen in kontroversen Fragen vertreten, pflegen ihre wirklichen Ansichten nur sehr unvollständig auszudrücken. Niemand wird annehmen, dass jedes Volk in der Lage ist, mit jeder Art von Institutionen umzugehen. So weit man die Analogie zu mechanischen Hilfsmitteln auch treiben mag, nicht einmal ein Werkzeug aus Holz und Eisen wird man einzig aus dem Grunde wählen, weil es an sich das Beste ist. Man wird erwägen, ob auch die anderen Materialien vorhanden sind, in Verbindung mit denen erst seine Anwendung von Vorteil ist, und vor allem, ob diejenigen, die sich seiner bedienen sollen, auch über die für seine Handhabung nötigen Kenntnisse sowie die erforderliche Geschicklichkeit verfügen. Auf der anderen Seite sind jene, die von politischen Institutionen wie von einem 11lebendigen Organismus sprechen, keineswegs die politischen Fatalisten, als die sie sich ausgeben. Sie behaupten nicht, dass der freien Wahl des Menschen in Bezug auf die Regierung, unter der er lebt, durchaus kein Spielraum bleibt oder dass die Erwägung der Konsequenzen, die sich aus den verschiedenen Verfassungsformen ergeben, bei der Entscheidung, welche von ihnen den Vorzug verdient, keinerlei Gewicht hat. Obwohl aber jede Seite ihre Theorie aus Opposition zur anderen übertreibt und wohl niemand einer von beiden uneingeschränkt beipflichtet, entsprechen die beiden Theorien doch einem tief verwurzelten Gegensatz zwischen zwei verschiedenen Denkstilen. Und obgleich offensichtlich keine von beiden völlig im Recht ist, müssen wir, da ebenso klar ist, dass keine ganz unrecht hat, den Versuch machen, ihnen auf den Grund zu kommen und uns des Teils Wahrheit zu bemächtigen, der in beiden zu finden ist.
Erinnern wir uns zunächst, dass politische Institutionen – sosehr diese theoretische Feststellung bisweilen außer Acht geraten mag – ein Werk der Menschen sind, ihren Ursprung und ihr Vorhandensein allein dem menschlichen Willen verdanken. Der Mensch erwachte nicht etwa eines schönen Tages und sah sie fertig vor sich stehen. Ebenso wenig gleichen sie Bäumen, die, einmal gepflanzt, »immerfort wachsen«, während die Menschen »schlafen«.[2] Auf jeder Stufe ihres Daseins sind sie das, was sie sind, durch bewusstes menschliches Handeln geworden. Und wie alle Dinge, die von Menschen gemacht werden, können sie daher gut oder schlecht gemacht sein; bei ihrer Schaffung können Urteilsfähigkeit und Geschicklichkeit oder aber deren Gegenteil gewaltet haben. Wenn hingegen ein Volk es unterlassen hat oder durch äußeren Druck gehindert worden ist, sich selbst eine Verfassung zu geben, indem es in einem tastenden Prozess jedem Übelstand, der sich zeigte, das entsprechende Korrektiv entgegensetzte bzw. die jeweils Betroffenen Kraft zum Widerstand gewannen, so ist diese Verzögerung des politischen Fortschritts zwar unzweifelhaft ein großer Nachteil, beweist aber nicht, dass das, was sich für ein anderes Volk bewährt hat, nicht auch für dieses geeignet gewesen wäre und auch noch sein würde, wenn das betreffende Volk es annehmen wollte.
12Andererseits müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die politische Maschinerie nicht von selbst funktioniert. Wie sie von Menschen gemacht wurde, so muss sie auch von Menschen – und sogar von gewöhnlichen Menschen – in Betrieb gehalten werden. Sie verlangt nicht deren bloßes Gewährenlassen, sondern ihre aktive Teilnahme; und sie muss den Fähigkeiten und den Eigenschaften ebensolcher Menschen, wie sie zur Verfügung stehen, adäquat sein. Dies setzt drei Bedingungen voraus. Das Volk, für das eine Regierungsform bestimmt ist, muss bereit sein, sie zu akzeptieren – zumindest soweit, dass es ihrer Einführung keine unüberwindlichen Hindernisse entgegenstellt. Es muss bereit und fähig sein, das zu ihrer Aufrechterhaltung Nötige zu tun. Und es muss bereit und fähig sein, zu tun, was die jeweilige Regierungsform, soll sie ihren Aufgaben gerecht werden, von ihm fordert. Das Wort »tun« meint hier sowohl handeln als auch unterlassen. Das Volk muss zum Handeln wie zur bewussten Zurückhaltung vom Handeln in der Lage sein – je nachdem, welches Verhalten das bestehende Verfassungssystem zu seiner Aufrechterhaltung bzw. zur Erreichung jener Ziele fordert, denen es seinen eigenen Voraussetzungen nach verpflichtet ist.
Fehlt auch nur eine dieser Voraussetzungen, so wird eine Verfassung, so geeignet sie auch sonst zu sein verspricht, für den konkreten Fall ungeeignet.
Das erste Hindernis, die Abneigung des Volkes gegen eine bestimmte Regierungsform, bedarf kaum einer Erläuterung, da es von keiner Theorie übersehen werden konnte. Der Fall begegnet uns immer wieder. Nur fremde Gewalt könnte einen nordamerikanischen Indianerstamm bestimmen, sich den Beschränkungen zivilisierter, geregelter Herrschaft zu unterwerfen. Dasselbe ließe sich, wenn auch weniger absolut, von den Barbaren, die das Römische Reich überrannten, sagen. Es bedurfte mehrerer Jahrhunderte und einer vollständigen Veränderung der Verhältnisse, um sie – außerhalb der Zeit des eigentlichen Kriegsdienstes – zu diszipliniertem Gehorsam auch nur gegen ihre eigenen Führer zu erziehen. Es gibt Nationen, die sich freiwillig keiner anderen Regierung fügen wollen als derjenigen bestimmter Familien, die seit unvordenklichen Zeiten das Vorrecht besitzen, den Herrscher zu stellen. Manche Völker können nur durch fremde Eroberung gezwungen werden, sich mit einer Monarchie abzufinden; andere sind ebenso entschie13dene Gegner einer Republik. Oft macht also die Ablehnung, zumindest für den gegebenen Zeitraum, ein bestimmtes System nicht praktikabel.
Aber es gibt auch Fälle, in denen ein Volk, obwohl es eine Regierungsform nicht nur nicht ablehnt, sondern sie möglicherweise sogar wünscht, doch nicht bereit oder fähig ist, ihren Erfordernissen zu entsprechen. Ein Volk kann unfähig sein, selbst die Bedingungen der formalen Aufrechterhaltung eines Regierungssystems zu erfüllen. Es mag zwar einer freien Regierung theoretisch den Vorzug geben – aber wenn es aus Trägheit, Sorglosigkeit, Feigheit oder mangelndem Bürgersinn den zu ihrer Erhaltung notwendigen Anstrengungen nicht gewachsen ist, wenn es nicht für sie kämpfen will, falls sie direkt angegriffen wird, wenn es sich durch die schlauen Künste derer, die es darum betrügen wollen, täuschen lässt, wenn es sich durch zeitweilige Entmutigung, durch eine plötzliche Panik oder im Taumel der Begeisterung für irgendein Individuum dazu verleiten lässt, seine Freiheiten einem Einzelnen – und sei es einem großen Mann – zu Füßen zu legen bzw. ihm Machtbefugnisse anzuvertrauen, die es ihm möglich machen, die bestehenden Institutionen zu beseitigen – dann, in allen diesen Fällen, ist es mehr oder weniger ungeeignet für die Freiheit, und obgleich es ihm nützlich sein mag, sie auch nur kurze Zeit besessen zu haben, wird es sie wahrscheinlich nicht lange genießen. Auch mag ein Volk nicht in der Lage bzw. nicht bereit sein, die Pflichten, die eine spezielle Regierungsform ihm auferlegt, zu erfüllen. Ein unzivilisiertes Volk, das die Vorzüge einer zivilisierten Gesellschaft bis zu einem gewissen Grade zu schätzen weiß, kann doch unfähig zur Beachtung der von dieser geforderten Zurückhaltung sein: die Leidenschaften sind vielleicht noch zu heftig, der persönliche Stolz noch zu unbeugsam, als dass man bereit wäre, auf Privatfehden zu verzichten und die Ahndung wirklichen oder vermeintlichen Unrechts dem Gesetz zu überlassen. In einem solchen Fall muss eine zivilisierte Regierung, will sie dem Volk wirklich nützen, in erheblichem Maße despotisch sein: sie darf keiner Kontrolle von Seiten des Volkes unterliegen und muss einen wirksamen Zwang auf dessen Handlungen ausüben. Endlich wird man ein Volk, das bei der Bekämpfung des Verbrechens nicht aktiv mit dem Gesetz und den Vertretern der öffentlichen Gewalt zusammenarbeitet, als ungeeignet für mehr als eine bedingte und eingeschränkte Freiheit betrachten müssen. Wo die 14Menschen einen Kriminellen lieber verstecken, als ihn zu ergreifen; wo sie, wie bei den Hindus, den, der sie beraubt hat, lieber durch einen Meineid decken, als dass sie sich durch ihre Aussage gegen ihn einer Unannehmlichkeit oder der Gefahr eines Racheakts aussetzen; wo sie, wie bei einigen europäischen Nationen bis in jüngste Zeit, auf der anderen Seite vorübergehen, wenn ein Mann einen anderen auf offener Straße erdolcht, weil es Sache der Polizei ist, sich um dergleichen zu kümmern, und weil es sicherer erscheint, sich nicht in fremde Angelegenheiten zu mischen; wo sie über eine Hinrichtung außer sich geraten, ein Meuchelmord aber keine Empörung erregt – da müssen die öffentlichen Behörden mit weit härteren Zwangsmitteln ausgerüstet sein als anderswo, weil unerlässliche Grundbedingungen des zivilisierten Lebens keine andere Stütze finden. Diese bedauerliche Geistesverfassung ist in einem Volk, das nicht mehr auf der Stufe der Primitivität steht, ohne Zweifel meist Folge früherer schlechter Herrschaft, die die Menschen gelehrt hat, im Gesetz das Mittel zu einem anderen Zweck als zu ihrem Besten und in seinen Hütern schlimmere Feinde zu sehen als in jenen, die es offen verletzen. Sowenig man aber diejenigen tadeln kann, die eine solche Einstellung entwickelt haben, und so wahrscheinlich es ist, dass ein besseres Herrschaftssystem diese Haltung schließlich überwindet, so kann ein solches Volk, solange sie besteht, doch nicht mit ebenso wenig Gewalt beherrscht werden wie ein Volk, dessen Sympathien auf Seiten des Gesetzes sind und das sich an dessen Durchsetzung aktiv beteiligt. Repräsentativinstitutionen haben ferner nur geringen Wert und können sogar zum bloßen Werkzeug der Tyrannei oder der Intrige werden, wenn die Mehrheit der Wähler nicht genug Interesse für die eigene Regierung aufbringt, um sich an der Wahl zu beteiligen, oder wenn sich der Wähler bei der Stimmabgabe nicht von politischen Erwägungen leiten lässt, sondern seine Stimme für Geld verkauft bzw. sie dem Wink eines Mannes entsprechend abgibt, von dem er abhängig ist oder dessen Gunst er aus persönlichen Gründen gewinnen möchte. Eine solche Volkswahl ist keine Garantie gegen schlechte Regierung, sondern nur ein zusätzliches Rad in ihrem Mechanismus.
Neben diesen moralischen stellen oft genug auch technische Schwierigkeiten bestimmten Regierungsformen unüberwindbare Hindernisse entgegen. In der Antike etwa, in der gewiss eine oft große individuelle und lokale Unabhängigkeit herrschte, war 15funktionierende Volksherrschaft über die Grenzen eines einzelnen Stadtstaates hinaus nicht möglich, weil die physischen Voraussetzungen zur Bildung und Verbreitung einer öffentlichen Meinung über den Kreis derer hinaus, die zur Diskussion öffentlicher Angelegenheiten auf demselben Versammlungsplatz zusammenkommen, nicht gegeben waren. Gewöhnlich nimmt man an, dieses Hindernis sei durch die Einführung des Repräsentativsystems beseitigt worden. Zu seiner vollständigen Überwindung aber bedurfte es der Presse, ja sogar der Zeitungspresse – der eigentlichen, wenn auch nicht in jeder Hinsicht adäquaten Entsprechung zu pnyx und forum.[3] Selbst eine Monarchie von größerer territorialer Ausdehnung konnte in früheren Stadien der gesellschaftlichen Entwicklung oft nicht bestehen und zerfiel unvermeidlich in kleine, entweder voneinander unabhängige oder durch ein lockeres Band wie den Lehensverband zusammengehaltene Fürstentümer, weil der Herrschaftsapparat nicht perfekt genug war, um die Ausführung von Befehlen in großer Entfernung von der Person des Herrschenden durchzusetzen. Selbst der Gehorsam des Heeres beruhte im Wesentlichen auf dessen freiwilliger Treue; es gab kein Mittel, von der Bevölkerung genügend Steuern einzutreiben, um die in einem ausgedehnten Territorium zur Erzwingung des Gehorsams unabdingbare bewaffnete Macht unterhalten zu können. Es versteht sich von selbst, dass in diesen oder allen ähnlichen Fällen das Hindernis größer oder kleiner sein kann. Es kann so groß sein, dass sich die Regierungsform als ganz ineffektiv erweist, ohne dass dies ihr Fortbestehen absolut ausschlösse oder etwas an der Tatsache änderte, dass sie allen anderen möglichen Regierungsformen in der Praxis doch immer noch vorzuziehen ist. Letztere Frage hängt hauptsächlich von einer Überlegung ab, die uns erst später beschäftigen wird – der Tendenz verschiedener Regierungsformen, den Fortschritt zu fördern.
Wir haben jetzt die drei Grundbedingungen geprüft, die bei Einführung einer Regierungsform bei einem Volk, das durch sie regiert werden soll, gegeben sein müssen. Wenn die Anhänger jener politischen Theorie, die als naturalistisch bezeichnet werden soll, lediglich auf der Unabdingbarkeit dieser drei Voraussetzungen bestehen, wenn sie nur geltend machen, dass keine Regierung 16auf Dauer bestehen kann, wenn sie nicht wenigstens die erste und zweite und in erheblichem Maße auch die dritte Bedingung erfüllt, so ist ihre Lehre innerhalb dieser Grenzen unanfechtbar. Alles darüber Hinausgehende aber erscheint mir unhaltbar. Was immer über die Notwendigkeit einer historischen Basis der Institutionen, über eine notwendige Harmonie zwischen diesen und dem Brauchtum und Charakter eines Volkes und dergleichen mehr behauptet wird, läuft entweder auf dasselbe hinaus oder gehört nicht zur Sache. Solche und ähnliche Redewendungen sind jenseits ihrer rationalen Aussage in hohem Maße sentimental. Praktisch zeigt jede dieser angeblichen Grundvoraussetzungen politischer Institutionen lediglich einen Weg zur Erfüllung der drei Bedingungen. Wenn die Einführung einer Institution oder einer Reihe von Institutionen durch die Überzeugungen, Neigungen und Gewohnheiten des Volkes vorbereitet ist, wird es sich nicht nur eher zu ihrer Annahme bewegen lassen, sondern auch leichter und von Anfang an bereitwilliger das zu ihrer Erhaltung und optimalen Wirksamkeit Notwendige lernen. Einen schweren Fehler würde ein Gesetzgeber begehen, der seine Maßnahmen nicht zum allgemeinen Vorteil an solchen schon bestehenden Gewohnheiten und Empfindungsweisen, soweit sie sich als förderlich erweisen, orientiert. Andererseits aber ist es übertrieben, aus diesen bloßen Hilfsmitteln und Erleichterungen unerlässliche Bedingungen zu machen. Die Menschen lassen sich leichter bewegen und tun bereitwilliger, was sie bereits gewöhnt sind; aber sie lernen auch Dinge zu tun, die ihnen neu sind. Vertrautheit ist eine große Hilfe – aber auch ein zunächst fremdartiger Gedanke wird durch häufige Erörterung vertraut. Es gibt übergenug Fälle, in denen ein ganzes Volk sich für Dinge begeisterte, die es noch nie versucht hatte. In welchem Maße aber ein Volk fähig ist, Neues zu tun und sich neuen Verhältnissen anzupassen, ist gerade wesentlicher Teil des Problems. Hierin unterscheiden sich die verschiedenen Nationen und Zivilisationsstadien sehr deutlich. Wieweit ein Volk fähig ist, die Bedingungen einer gegebenen Regierungsform zu erfüllen, lässt sich nach keiner allgemeingültigen Regel bestimmen. Die Kenntnis des betreffenden Volkes sowie allgemeine praktische Urteilsfähigkeit und Klugheit müssen darüber entscheiden.
Und noch eine weitere Erwägung sollte man nicht vernachlässigen. Ein Volk mag auf gute Regierungsinstitutionen nicht vorbereitet sein; das Verlangen nach ihnen zu wecken aber ist ein not17wendiger Teil der Vorbereitung. Das Empfehlen und Verfechten einer spezifischen Regierungsform oder -institution, deren Vorteile in hellstes Licht gerückt werden, ist eine (und oft die einzig verfügbare) Art, eine Nation soweit zu erziehen, dass sie die betreffende Institution nicht nur annimmt und fordert, sondern auch mit ihr arbeitet. Womit hätten die italienischen Patrioten dieser und der vorigen Generation ihr Volk auf die Freiheit in Einheit vorbereiten sollen, wenn nicht damit, dass sie es anfeuerten, sie zu fordern? Allerdings dürfen jene, die eine solche Aufgabe übernehmen, nicht nur von den Vorteilen der von ihnen empfohlenen Institution der Verfassung überzeugt sein, sondern müssen sich auch der moralischen, intellektuellen und praktischen Fähigkeiten, die deren Benutzung erfordert, voll bewusst sein, um nicht Wünsche zu erregen, die den vorhandenen Fähigkeiten allzu weit vorauseilen.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass Regierungsinstitutionen und -formen – in den Grenzen der wiederholt erwähnten drei Bedingungen – durchaus Objekt freier Entscheidung sind. Die abstrakte Untersuchung der bestmöglichen Regierungsform ist keine sinnlose Spekulation, sondern eine höchst praktische Aufgabe wissenschaftlichen Denkens; und die Einführung derjenigen Institutionen, die in einem Lande unter den dort bestehenden Verhältnissen jene Bedingungen zumindest annähernd gut erfüllen können, ist einer der rationalsten Gegenstände praktischer Bemühung. Alles, was sich abschätzig gegen die Relevanz des menschlichen Willens und der menschlichen Intentionalität im Hinblick auf Regierungsformen sagen lässt, könnte gegen sie auch in jeder anderen Hinsicht geltend gemacht werden. Dem Vermögen des Menschen sind auf allen Gebieten sehr enge Grenzen gesetzt. Der Mensch kann nur wirken, indem er sich eine oder mehrere Kräfte der Natur dienstbar macht. Es müssen also Kräfte vorhanden sein, die für den intendierten Zweck verwendbar sind und doch allein ihren eigenen Gesetzen folgen werden. Wir können Wasser nicht stromaufwärts fließen lassen[4] – aber würden wir deshalb jemals behaupten, dass Wassermühlen »nicht gemacht sind, sondern wachsen«? In der Politik wie in der Mechanik muss man die Kraft, die die Maschine 18treibt, außerhalb derselben suchen; lässt sie sich nicht finden oder erweist sie sich als nicht ausreichend zur Überwindung der zu erwartenden Hindernisse, so muss das Ganze fehlschlagen. Dies ist keine Eigentümlichkeit der politischen Kunst: es besagt nichts weiter, als dass diese den Begrenzungen und Bedingungen aller Künste unterliegt.
An dieser Stelle begegnet uns ein weiterer Einwand bzw. derselbe Einwand in anderer Form. Die Kräfte, so wird behauptet, von denen die größeren politischen Phänomene abhängen, sind der Verfügung von Politikern und Philosophen entzogen. Die Regierung eines Landes ist in allen wesentlichen Fragen durch die Verteilung der gesellschaftlichen Macht von vornherein festgelegt und vorentschieden. Der jeweils stärksten Kraft innerhalb der Gesellschaft fällt die Regierungsgewalt zu; und eine Veränderung im politischen System kann nicht von Dauer sein, wenn nicht eine veränderte Machtverteilung in der Gesellschaft selbst ihr vorausgeht oder sie begleitet. Eine Nation kann also ihre Regierungsform nicht frei wählen. Über bloße Details und Organisationsfragen mag sie selbst entscheiden können; aber das wesentliche Moment, die Machtkonstellation, wird durch die gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmt.
Ich gebe ohne weiteres zu, dass in dieser Theorie ein Element Wahrheit steckt; um sie aber nutzbar zu machen, bedarf es ihrer genauen Definition und Eingrenzung. Wenn es heißt, dass die stärkste Macht innerhalb der Gesellschaft sich zur stärksten Kraft innerhalb der Regierung machen wird: was versteht man dann unter Macht? Nicht Muskeln und Sehnen; sonst wäre die reine Demokratie die einzig mögliche Verfassungsform. Wenn wir der bloßen Muskelkraft noch zwei weitere Elemente hinzufügen, nämlich Besitz und Intelligenz, kommen wir der Wahrheit näher, haben sie allerdings noch lange nicht erreicht. Nicht nur wird eine numerisch größere Gruppe oft von einer kleineren unterdrückt; die größere Gruppe kann sogar an Besitz wie an individueller Intelligenz weit überlegen sein und doch durch eine Minorität, die ihr in beidem nachsteht, gewaltsam oder auf andere Weise unterworfen werden. Die verschiedenen Machtfaktoren müssen, um politischen Einfluss zu gewinnen, organisiert sein; und die überlegene Organisation ist notwendig aufseiten derer, die im Besitz der Staatsmacht sind. Eine hinsichtlich aller anderen Machtfaktoren schwächere Partei kann 19dennoch das Übergewicht haben, wenn die Regierungsgewalt in die Waagschale geworfen wird; sie mag, allein auf dieser Basis, ihre Vorherrschaft noch lange Zeit behaupten können, obwohl eine solche Regierung sich zweifelsohne im Zustand labilen Gleichgewichts, wie man es in der Mechanik nennt, befindet: sie ist wie ein auf seinem dünneren Ende ruhender Körper, der sich, einmal aus dem Gleichgewicht gebracht, mehr und mehr von seiner früheren Lage entfernt, anstatt in sie zurückzukehren.
Indessen gibt es noch gewichtigere Einwände gegen diese Theorie der Regierung, wie sie gewöhnlich vertreten wird. Diejenige gesellschaftliche Macht, die die Tendenz hat, sich in politische Macht umzusetzen, ist keine ruhende, rein passive, sondern aktive Macht; Macht, mit anderen Worten, die wirklich ausgeübt wird; mithin nur ein Bruchteil aller vorhandenen Macht. Politisch gesehen beruht Macht wesentlich auf dem Willen zur Machtausübung. Wie sollte es also möglich sein, die Faktoren der politischen Macht zu berechnen, wenn Momente, die den Willen beeinflussen, unberücksichtigt bleiben? Wer glaubt, dass der Versuch, das Regierungssystem durch Einwirkung auf die öffentliche Meinung zu beeinflussen, zwecklos wäre, da die Inhaber der Macht in der Gesellschaft schließlich auch zu Trägern der Regierungsgewalt werden, der vergisst, dass die öffentliche Meinung selbst eine der stärksten gesellschaftlichen Kräfte ist. Ein einziger Mensch mit einer festen Überzeugung stellt eine gesellschaftliche Macht dar, die neunundneunzig Menschen, die nur Interessen haben, aufwiegt. Wem es gelingt, die Allgemeinheit von der Überlegenheit einer bestimmten Regierungsform oder irgendeines anderen gesellschaftlichen Sachverhalts zu überzeugen, der hat fast den wichtigsten Schritt schon getan, den man tun kann, um die gesellschaftlichen Kräfte für jene zu gewinnen. Würde wohl an dem Tag, an dem der erste Märtyrer in Jerusalem zu Tode gesteinigt wurde, während der künftige Apostel der Heiden dabeistand und »Wohlgefallen an seinem Tode« hatte,[5] irgendjemand geglaubt haben, dass die Partei jenes Gesteinigten damals und dort die stärkste gesellschaftliche Kraft darstellte? Und hat nicht die Folgezeit bewiesen, dass sie es war? Sie war es, weil ihr Glaube mächtiger war als jede der damals bestehenden Religionen. Der gleiche Umstand machte auf dem Wormser Reichstag einen 20Mönch aus Wittenberg zu einer mächtigeren gesellschaftlichen Kraft als Kaiser Karl V. samt allen anwesenden Fürsten. Allerdings, so könnte man argumentieren, sind dies Beispiele, in denen es um die Religion ging – und religiöse Überzeugungen sind in ihrer Stärke außergewöhnlich. Nehmen wir also einen rein politischen Fall, in dem die Religion, soweit sie überhaupt eine Rolle spielte, zu den Verlierern gehörte. Wenn irgendjemand noch überzeugt werden muss, dass das spekulative Denken einer der entscheidenden Faktoren gesellschaftlicher Macht ist, möge er an jenes Zeitalter denken, in dem es in Europa kaum einen Thron gab, auf dem nicht ein liberaler und reformfreudiger König, ein liberaler und reformfreudiger Kaiser war oder gar – und dies ist das erstaunlichste – ein liberaler und reformfreudiger Papst saß: das Zeitalter Friedrichs des Großen, Katharinas II., Josephs II., Peter Leopolds, Benedikts XIV., Ganganellis, Pombals, Arandas,[6] ein Zeitalter, in dem selbst die Bourbonen von Neapel sich liberal und reformfreudig zeigten und alle aufgeschlossenen Köpfe des französischen Adels von jenen Ideen erfüllt waren, die sie kurze Zeit später so teuer zu stehen kamen – gewiss ein überzeugendes Beispiel, wie wenig die bloße physische und ökonomische Macht allein die Summe der gesellschaftlichen Macht bilden! Nicht eine Veränderung der materiellen Interessenlage, sondern die Ausbreitung moralischer Überzeugungen hat der Negersklaverei im Britischen Empire oder anderswo ein Ende bereitet. Die Leibeigenen in Russland verdanken ihre Emanzipation wenn auch vielleicht nicht einem Gefühl moralischer Verpflichtung, so doch zumindest der Ausbreitung aufgeklärter Ansichten über die wahren Interessen des Staates. Das Handeln des Menschen wird durch sein Denken bestimmt; und obgleich die Auffassungen und Überzeugungen der Durchschnittsmenschen weit eher durch ihre persönlichen Verhältnisse als durch Vernunft bestimmt sind, ist der Einfluss auf sie nicht gering, der von den Überzeugungen und Auffassungen derer, die unter anderen persönlichen Verhältnissen 21leben und von der Autorität aller Gebildeten ausgeht. Wenn diese daher eine soziale Einrichtung bzw. eine politische oder sonstige Institution übereinstimmend für gut, eine andere für schlecht, eine für wünschenswert, die andere für verwerflich befinden, ist schon viel getan, um ihnen jenes Übergewicht an gesellschaftlicher Macht zu sichern bzw. zu entziehen, von dem ihr Bestehen abhängt. Die Maxime, dass die Regierung eines Landes durch die herrschenden gesellschaftlichen Kräfte determiniert wird, ist nur in dem Sinne zutreffend, wie sie den Versuch begünstigt statt zu entmutigen, zwischen allen unter gegebenen Verhältnissen in einer Gesellschaft praktikablen Regierungsformen rational zu entscheiden.
22II. Das Kriterium einer guten Regierungsform
Da die Regierungsform eines Landes (unter bestimmten, klar umrissenen Bedingungen) Objekt freier Entscheidung ist, muss jetzt gefragt werden, nach welchen Kriterien sich die Entscheidung richten soll. Was also sind die besonderen Kennzeichen derjenigen Regierungsform, die am besten geeignet ist, die Interessen einer bestimmten Gesellschaft zu fördern?
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!