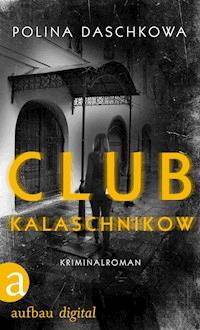Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Russische Ermittlungen
- Sprache: Deutsch
Auf der Jagd nach Unsterblichkeit. Sofja, eine junge russische Biologin, erhält 2006 das Angebot, auf der Insel Sylt an einem internationalen Forschungsprojekt mitzuarbeiten. Dass sie diese Möglichkeit nicht ihren wissenschaftlichen Fähigkeiten verdankt, sondern ihrer Herkunft, ahnt sie nicht. Ihr Urgroßvater soll ein Mittel erfunden haben, das Menschen das ewige Leben schenkt. Vor kurzem ist ihr Vater, gerade zurückgekehrt von einer Reise nach Deutschland, auf geheimnisvolle Weise gestorben. Ist ihr Auftraggeber sein Mörder?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 693
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Polina Daschkowa
Bis in alle Ewigkeit
Kriminalroman
Aus dem Russischenvon Ganna-Maria Braungardt
Impressum
Die Originalausgabe unter dem Titel
Источник счастья
erschien 2006 bei Astrel, Moskau.
ISBN 978-3-8412-0482-0
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, November 2012
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die deutsche Erstausgabe erschien 2012 bei Aufbau
Taschenbuch, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Copyright © 2006 by Polina Daschkowa
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung capa design, Anke Fesel
unter Verwendung eines Motivs von Chris Keller / bobsairport
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH,www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Impressum
»Der verstorbene Alte hat bestimmt nach dem Stein der Weisen gesucht … der Schelm! Und wie gut er das geheim zu halten wusste!«
Wladimir Odojewski, Sylphide
Erstes Kapitel
Moskau 1916
Die Wohnung von Professor Michail Wladimirowitsch Sweschnikow nahm den gesamten dritten Stock in einem neuen Haus in der Zweiten Twerskaja-Jamskaja-Straße ein. Der Professor war Witwer, noch nicht alt, und hatte drei Kinder. Böse Zungen behaupteten, er habe sie alle in Reagenzgläsern gezüchtet. Unter den umliegenden Krämerinnen kursierten Gerüchte, dieser Doktor würde Tote wieder lebendig machen, könne sich in einen schwarzen Hund und in eine weiße Maus verwandeln und sei zweitausend Jahre alt. Zu Adels- und Professorentitel und dem Rang eines kaiserlichen Generals sei er mit Hilfe schwarzer Magie sowie der japanischen und deutschen Spionagedienste gekommen.
Übrigens wussten weder der Professor selbst noch seine Hausgenossen von diesen Gerüchten. Nur das Dienstmädchen Marina, eine stille, füllige junge Frau von fünfundzwanzig Jahren, erzählte manchmal, wenn sie vom Einkauf im Lebensmittelladen kam, der alten und nahezu tauben Kinderfrau Awdotja Borissowna davon. Wenn Marina ihr laut ins Ohr flüsterte, seufzte Awdotja, stöhnte und schüttelte den Kopf. Sie glaubte, Marina spreche von erfundenen Personen, aus der Zeitung oder aus einem Buch. Sie konnte sich keinen Augenblick lang vorstellen, dass die Rede von ihrem geliebten Michail war, dessen Kinderfrau und Amme sie gewesen war, vor langer Zeit, in einem anderen Jahrhundert.
In Moskau wimmelte es von Medien, Hellsehern, Hypnotiseuren, Handlesern und Hexern – für jeden Geschmack.
Über dem Professor wohnte der Spiritist Bublikow, an seiner Tür hing sogar ein glänzendes Schild: »Doktor der Esoterik, großer Magier, verdienter Spiritist des Russischen Reichs A. A. Bublikow«. Doch er interessierte die Krämerinnen seltsamerweise weniger als Professor Sweschnikow.
An einem dunklen Januarmorgen des Jahres 1916, in der siebten Stunde, gellte aus einem Fenster des dritten Stocks, das zum Hof hinausging, ein Frauenschrei. Der Hauswart Sulejman rammte die Schaufel in eine Schneewehe und schaute hinauf. Das kleine Lüftungsfenster stand offen, durch die dichten Vorhänge drang helles elektrisches Licht. Ein Lichtstreifen lag auf der dunklen Schneewehe, und einzelne Schneekristalle funkelten darin wie eine Handvoll kleiner Diamanten.
Dem Schrei folgte nichts als Stille. Der Hauswart zog einen Handschuh aus und betete leise und ausgiebig zu Allah.
Im ehemaligen Speisezimmer, das nun als Laboratorium diente, saß das alte Dienstmädchen Klawdija auf dem Fußboden und roch an einem Salmiakfläschchen. Professor Sweschnikow stand über sie gebeugt. Unrasiert, verschlafen, in einem gesteppten seidenen Hausrock, ein Handtuch um den Hals und in warmen Hausschuhen, war er auf den Schrei des Dienstmädchens hin aus dem Bad herbeigeeilt.
»Na, na, ganz ruhig, Klawdija, hör auf zu zittern«, sagte der Professor in angenehmem, schlafheiserem Bariton, »beruhige dich und erzähl mir alles der Reihe nach.«
Klawdija schniefte, hob einen zitternden Arm und zeigte in eine entfernte Ecke, wo hinter einem Krankenhauswandschirm aus Wachstuch drei kleine Glaskästen mit Luftlöchern standen. In einem rannten zwei fette weiße Ratten, lautlos fiepend, hin und her. Im zweiten wuselte ein Dutzend kleiner Ratten herum. Der dritte war leer.
»Hast du den Käfig aufgemacht?«
Klawdija schüttelte entschieden den Kopf. Der Professor fasste sie unter, hob sie hoch, führte sie zu einer Liege, setzte sie hin und schritt energisch in die Rattenecke.
Das solide dicke Glas war an mehreren Stellen gesprungen. Der runde Metalldeckel war aufgeklappt. Feine Kiefernspäne aus dem Käfig lagen auf dem Fußboden herum.
»Hast du ihn gesehen?«, fragte der Professor und betrachtete die frischen Kratzer auf dem Metall und den abgebrochenen kleinen Riegel.
»Und ob ich ihn gesehen habe! Er hat sich auf mich gestürzt, der Teufel, wo er bloß die Kraft her hat, alt und krank, wie er ist. Ist schon fast krepiert, und dann springt er so hoch.« Klawdija zeigte mit der Hand eine Höhe von anderthalb Metern über dem Boden. »Er wär mir beinahe ins Gesicht gesprungen, der Mistkerl, ich hab ihn gerade noch mit dem Besen abwehren können, den Unhold.«
Das Dienstmädchen Klawdija war eine gottesfürchtige Person, schweigsam und ungelenk. Sie war kein Plappermaul, hob nie die Stimme, benutzte niemals Schimpfworte. Nun brannten ihre Wangen, und ihre Augen glänzten. Sie zitterte wie im Fieber und leckte sich die trockenen Lippen. Der Professor griff aus alter ärztlicher Gewohnheit nach ihrem Handgelenk und registrierte mechanisch, dass ihr Puls raste, mindestens hundertfünfzig in der Minute, und sein eigener ebenso.
»Moment mal, du meinst, er ist von irgendwo runtergefallen?«, fragte er nach und schaute sich um.
»Von wegen gefallen! Nein!«
»Sondern? Vom Boden hochgesprungen? So hoch?« Der Professor lachte nervös.
»Er ist hochgeflogen, als wär er ein Vogel und keine Ratte. Ach du meine Güte, was ist denn das?« Klawdija öffnete den Mund und riss die Augen weit auf.
Es wurde still. Man hörte den Hauswart draußen Schnee schippen. Zu diesem Geräusch gesellte sich ein anderes – ein hartnäckiges, beunruhigendes Quietschen.
Der braune Plüschvorhang bewegte sich rasch und heftig, als wäre er plötzlich lebendig. Das Ende der massiven hölzernen Gardinenstange rutschte krachend herunter, Stuck rieselte.
Der Professor besann sich als Erster. Mit einem Satz war er am Fenster und warf sich auf den zappelnden Vorhang.
»Klawa, Äther, schnell! Und Handschuhe, zieh Handschuhe an!«
Der Professor kniete am Boden. Der gefangene Vorhang tobte und fiepte in seinen Händen. Der Professor keuchte und atmete schwer. Seine Augen glänzten, die Wangen unter den grauen Bartstoppeln schimmerten rot. Er sah aus wie ein Torwart, der im letzten Moment den Ball gefangen hat, als das Spiel schon fast verloren war.
»Nein!«, rief Klawdija leise. »Ich kann das nicht! Gott ist mein Zeuge, Michail Wladimirowitsch. Ich kann nicht. Haben Sie seine Schnauze gesehen? Seine Augen?«
»Hör auf, es ist nur eine Ratte. Zieh dir Handschuhe an.«
Oben schaukelte die Gardinenstange. Sie hing nur noch an einer Schraube. Der Messingknauf am Ende drohte dem Professor auf den Kopf zu fallen. Klawdija saß reglos da, nur ihre Lippen bewegten sich kaum merklich. Sie murmelte ein Gebet.
»Na schön, geh Tanja wecken«, sagte der Professor.
Klawdija sprang hastig auf, rannte davon und prallte an der Tür gegen ein dünnes junges Mädchen von siebzehn Jahren mit blauen Augen, die Tochter des Professors. Tanja war von dem Lärm aufgewacht. In einem gelben Negligé, das hüftlange helle Haar offen, eilte sie ins Labor, ihrem Vater zu Hilfe.
Nach einer Viertelstunde lag auf dem nicht sehr großen Operationstisch ein mit Äther eingeschläfertes dickes kleines Tier. Es war eine Laborratte, genauer gesagt, ein Ratz. Ganz weiß, mit einem roten Fleck unter dem Unterkiefer. Das seltsame, für eine Ratte ungewöhnliche Mal erinnerte an ein Pentagramm, einen fünfzackigen Stern mit der Spitze nach unten.
»Die Uroma von diesem Ratz muss mit einem Urahn des Katers unserer Kinderfrau gesündigt haben«, hatte Tanja einmal gesagt. »Der schöne Mursik hat am Hals genau so einen Fleck, nur rund.«
»Ausgeschlossen«, widersprach der Professor. »Zwischen Katzen und Ratten sind derartige Beziehungen unmöglich.«
Tanja lachte, bis sie einen Schluckauf bekam. Sie amüsierte sich immer sehr über den Gesichtsausdruck ihres Vaters, wenn er vollkommen konzentriert war, keine Scherze verstand und selbst die absurdesten Mutmaßungen ernsthaft erwog.
»Komm, wir nennen ihn Grigori, zu Ehren von Rasputin«, schlug Tanja vor und berührte das rote Pentagramm.
»Wie oft habe ich dir das schon gesagt: Versuchstieren darf man keine Namen geben, nur Nummern«, entgegnete der Vater mürrisch. »Und wieso gerade der mystische Kerl Ihrer Majestät? Er ist nicht der Einzige auf der Welt, der Grigori heißt. Mendel, der Begründer der Genetik, hieß auch Grigori.«
»Umso besser! Ich werde ihn Grigori III. nennen!«, rief Tanja freudig.
»Untersteh dich! Jedenfalls in meiner Gegenwart!«, schimpfte der Vater.
Dieser Dialog lag ein halbes Jahr zurück. Seitdem nannte Tanja den Versuchsratz mit dem roten Fleck Grigori III. Irgendwann nannte ihn auch der Professor unversehens so.
Nun betrachteten beide, Vater und Tochter, verwirrt das schlafende Tier. Der nackte rosa Bauch bebte leicht. Die Pfoten, die aussahen wie winzige, zierliche Damenhändchen, vollführten ein paar schwache Kratzbewegungen und kamen dann zur Ruhe.
»Nein, Papa, das ist nicht Grigori, nein«, sagte Tanja und gähnte. »Sieh doch, sein Fell ist weiß und flauschig, die Augen rosa. Die Haut ist weich und jung. Und wo ist denn der Fleck? Wo, zeig ihn mir!«
»Hier ist er. An Ort und Stelle.«
»Ich glaube es trotzdem nicht. Grigori hat eine riesige Nachkommenschaft, irgendwer aus einem Wurf kann das rote Pentagramm geerbt haben. Das ist sein Enkel oder Urenkel. Grigori war nach der Operation fast kahl.«
»War er. Aber nun ist das Fell nachgewachsen.«
»So schnell?«
»In einem Monat. Das ist normal.«
»Und die Farbe des neuen Fells ist dieselbe wie früher, mit demselben Pentagramm am Hals?«
»Wie du siehst.«
»Grigori muss eine Narbe auf dem Kopf haben. Wo ist sie? Da ist keine Narbe.«
Tanjas Hand im schwarzen Medizinerhandschuh drehte die Ratte vorsichtig auf den Bauch. Der Professor nahm eine große Lupe und strich das dichte, glänzende Fell auf dem Scheitel der Ratte beiseite.
»Da ist die Narbe. Ganz klein.«
»Papa, hör auf!« Tanja schüttelte den Kopf. »Die Wunde kann nicht so schnell verheilt sein, und auch das Fell kann nicht so schnell gewachsen sein. Du bist doch kein Alchemist, kein mittelalterlicher Magier, kein Doktor Faustus! Du weißt genau, dass das Unfug ist. Man wird dich auslachen. Eine siebenundzwanzig Monate alte Ratte kann nicht so aussehen, das ist unmöglich! Siebenundzwanzig Monate sind für eine Ratte wie neunzig Jahre für einen Menschen.«
»Na, na, was schreist du so? Warum bist du so erschrocken, Tanja?« Der Professor streichelte seiner Tochter die Wange. »Einem alten Ratz ist ein neues, junges Fell gewachsen. Und die Augen sind wieder rosa. Das kommt vor.«
»Das kommt vor?«, rief Tanja, riss sich die Handschuhe herunter und schleuderte sie in die Ecke. »Papa, ich glaube, du hast den Verstand verloren! Du hast doch selbst immer gesagt, dass die biologische Uhr nie rückwärts geht.«
»Schrei nicht so. Hilf mir lieber, ihm Blut für den Test abzunehmen, solange er schläft, und überleg dir, wie wir den Käfigdeckel so befestigen können, dass er nicht wieder rausspringt.«
Der Professor hielt bereits eine kleine Stahlfeder und ein sauberes Reagenzglas in der Hand. Tanja drehte ihr Haar rasch zu einem Knoten, band sich ein Kopftuch um, zog es sich tief in die Stirn und streifte saubere Handschuhe über. Dabei sagte sie nervös: »Er ist am 1. August 1914 geboren. Ein denkwürdiges Datum – da begann der Krieg. Er hat als Einziger aus seinem Wurf überlebt. Er war schwach, aber aggressiv.«
»Genau, aggressiv«, murmelte der Professor glücklich blinzelnd.
Ein Tropfen Rattenblut rollte in das Reagenzglas. Tanja trug den schlafenden Ratz zum Käfig zurück und spürte durch den Handschuh hindurch das Pulsieren des weichen Körpers. Einen Augenblick lang hatte sie das Gefühl, kein Labortier in der Hand zu halten, sondern ein seltsames Geschöpf, das nicht von dieser Welt war. Sie warf einen Blick auf ihren über das Mikroskop gebeugten Vater. Durch seine grauen Igelstoppeln schimmerte eine rosa Glatze. Grigori bewegte die Pfoten. Die Wirkung des Äthers ließ nach. Tanja setzte den Ratz in den Kasten auf die Sägespäne und beschwerte den Deckel mit dem Marmorfuß einer Tintengarnitur.
»Wirst du ihn obduzieren?«, fragte Tanja, während sie Handschuhe und Kopftuch ablegte.
Sie musste die Frage noch einmal laut wiederholen. Ihr Vater klebte am Mikroskop.
»Wie? Nein, ich will ihn noch eine Weile beobachten. Sag Bescheid, sie sollen den Samowar aufsetzen. Was ist, bist du festgewachsen? Geh, sonst kommst du zu spät ins Gymnasium.«
»Papa!«
»Was denn, Tanja?«
»Sag mal, hast du das bewusste Eiweiß isolieren können?«
»Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht.«
»Warum dann?«
Der Professor hob endlich den Kopf vom Mikroskop und sah seine Tochter an.
»Es ist alles ganz einfach, Tanja. Er hat Diät gehalten, sich aktiv bewegt. Der Käfig steht näher am Fenster als die anderen, das Lüftungsfenster ist immer offen, er hatte viel frische Luft.«
»Papa, hör auf! Du hältst auch Diät und hast viel frische Luft!«
Der Professor antwortete nicht. Er beugte sich wieder über das Mikroskop. Tanja verließ das Labor und schloss leise die Tür.
Moskau 2006
Im Flur läutete hartnäckig die Klingel. Auf dem Nachttisch meldete das Mobiltelefon zwitschernd, dass eine Nachricht eingetroffen sei. Sofja wachte auf und erblickte ihren Vater. Er saß auf der Bettkante, den Finger auf den Lippen, und schüttelte den Kopf.
»Mach nicht auf«, flüsterte er, »mach auf keinen Fall auf.«
Sofja stand auf, warf sich einen Bademantel über den Pyjama und tappte barfuß in den Flur. Ihr Vater blieb sitzen und sagte nichts mehr, schaute ihr nur mit traurigem Kinderblick nach.
»Sofja Dmitrijewna Lukjanowa?«, fragte eine Männerstimme vor der Tür.
»Ja«, krächzte Sofja und hustete.
»Machen Sie bitte auf. Ich habe eine Sendung für Sie.«
»Von wem?«
Vor der Tür raschelte es.
»Lesen Sie die Nachricht auf Ihrem Mobiltelefon. Sie ist vor zwanzig Minuten gekommen«, sagte die dumpfe Männerstimme.
Auf dem Weg zurück ins Zimmer warf Sofja einen Blick in den Spiegel. Der alte Bademantel ihrer Mutter hing an ihren mageren Schultern wie ein Sack an einer Vogelscheuche. Der Verband war in der Nacht auf den Hals gerutscht, die Haare hingen wirr herunter, darin klebten Wattefetzen. Das rechte Ohr war von den Alkoholkompressen gerötet und geschwollen und schälte sich. Nach ihrem Frösteln zu urteilen, hatte sie jetzt am Morgen mindestens achtunddreißig Grad Fieber. In ihrem Ohr blubberte und zog es noch immer, die ganze rechte Kopfhälfte tat weh.
»Sehr geehrte Sofja Dmitrijewna!Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Ich wünsche Ihnen Gesundheit und viel Erfolg in der Wissenschaft!
I. S.«
Das war die letzte Nachricht. Sie war tatsächlich vor zwanzig Minuten gekommen, also um halb elf. Drei waren davor eingetroffen. Sofja las sie nicht, klappte das Telefon zu und tappte zurück in den Flur.
»Mach nicht auf«, flüsterte ihr Vater wieder.
Er stand jetzt neben ihr. Seine Wangen waren gerötet. Der zarte Flaum auf seinem Kopf zitterte. Seine Augen wirkten größer und heller.
Vor der Tür war es still.
»He, sind Sie noch da?«, fragte Sofja.
Keine Antwort.
»Ich glaube, sie sind weg«, sagte Sofja zum Vater. »Ich mache trotzdem mal auf und sehe nach. In Ordnung?«
Der Vater schüttelte erschrocken den Kopf.
Wegen des Fiebers, der Schmerzen und des ständigen Ziehens im Ohr war alles in einen zähen trüben Schleier gehüllt, als hätte sich die Luft in der kleinen Wohnung verdichtet.
»Wovor hast du denn solche Angst?«, fragte Sofja. »Du hast einfach schlecht geträumt.«
»Nein«, erwiderte der Vater, »das ist kein Traum. Das ist ganz real, Sofie. Ich bitte dich, mach die Tür nicht auf.«
»Niemals?«
»Ich weiß nicht. Jetzt jedenfalls nicht.«
Ein paar Sekunden standen sie schweigend da und sahen sich an.
»Na schön. Mir ist alles egal. Ich lege mich wieder hin«, sagte Sofja. »Weißt du vielleicht, wo unser Fieberthermometer ist?«
Der Vater trat auf sie zu und berührte mit den Lippen ihre Stirn.
»Achtunddreißig zwei. Das Thermometer hast du gestern Nacht zerbrochen. Vergiss bitte nicht, das Quecksilber unterm Bett aufzufegen. Du weißt doch, wie schädlich es ist.«
»Gut. Und wo ist der Besen?«
»Im Auto. Du hast damit Schnee abgefegt und ihn im Kofferraum gelassen. Einen zweiten Besen haben wir nicht. Aber untersteh dich, ihn holen zu gehen. Es ist Schneesturm und sehr kalt. Quecksilber kann man auch mit einem feuchten Lappen aufwischen. Ich würde es selbst tun, aber …«
Im Zimmer zwitscherte das Mobiltelefon. Noch eine Nachricht. An der Tür klingelte es, diesmal so durchdringend laut, dass Sofja zusammenzuckte.
»Sofie, bist du zu Hause? Schläfst du etwa?«
Diese Stimme war unverkennbar. Ein rollender, körniger Bass, den man fast täglich bei einem unpopulären privaten Fernsehsender aus dem Off hören konnte. Ihr Vater schaltete immer diesen Sender ein, eigens um zu hören, wie der Trinker Nolik mit seinem autoritären Bass Tabletten zur Behandlung von Alkoholismus anpries oder der dicke Nolik von den neuesten Methoden blitzschnellen Abnehmens berichtete.
Seine untreue Ehefrau hatte Nolik vor einem Jahr verlassen. Danach hatte er abendelang bei den Lukjanows in der Küche gesessen und erklärt, sein Leben sei zu Ende.
»Sofie, ich bin’s! Mach auf!«
Noliks Bass klang munter und fröhlich. Sofja dachte, dass es offenbar sehr schlecht um ihn stand. Früher hatte er morgens nicht getrunken. Sie brauchte eine ganze Weile für die Türschlösser. Ihr Vater harrte neben ihr aus und schwieg angespannt. Endlich öffnete sie die Tür.
»Miau, miau!«, sagte Nolik.
Sein rundes Gesicht strahlte. Wenn er betrunken war, miaute er immer. Doch statt Alkoholdunst schlug Sofja der intensive Duft frischer Blumen entgegen. Nolik hielt einen riesigen Rosenstrauß unterm Arm. Die dunkelroten, fast schwarzen festen Blüten waren mit Wassertropfen übersät.
»Herzlichen Glückwunsch.« Er trat über die Schwelle und reckte die Lippen nach Sofjas Wange.
»Bist du übergeschnappt?«, fragte Sofja und verzog wegen einer neuen Schmerzattacke im Ohr das Gesicht.
»Leider verbietet meine angeborene Ehrlichkeit mir das Lügen«, seufzte Nolik und reckte die Unterlippe vor. »Die sind nicht von mir. Sie lagen auf dem Fußabtreter vor der Tür. Ich habe jemanden mit dem Fahrstuhl runterfahren gehört. Wenn du jetzt gleich aus dem Küchenfenster schaust, siehst du ihn vielleicht noch.«
»Den Besen«, sagte Sofja und bekam einen Hustenanfall.
»Was heißt hier Besen! Das sind tolle Rosen! Also wirklich, Sofie!«
Nolik war empört. »Einfach wunderschön, schau doch, riech doch! Du musst unbedingt die Stiele anschneiden und abbrühen.«
»Der Autoschlüssel ist in der Tasche meiner blauen Jacke, geh runter und hol bitte den Besen aus dem Kofferraum. Mir ist das Fieberthermometer runtergefallen, das Quecksilber muss aufgefegt werden.«
»Ah, verstehe.« Nolik nickte. »Wird sofort erledigt. Aber kümmere dich um die Rosen, stell sie ins Wasser.«
Er schloss die Tür hinter sich. Sofja stand noch immer da, den raschelnden Strauß mit beiden Armen umklammernd. Sie besaß keine große Vase. Das einzige Gefäß von passender Größe war der Plastikmülleimer. Sofja nahm die Mülltüte heraus, spülte den Eimer aus und füllte ihn mit Wasser. Während sie noch mit den Blumen beschäftigt war, kam Nolik zurück. Außer dem Besen hatte er eine kleine braune Aktentasche mitgebracht, die er Sofja feierlich überreichte.
»Weißt du noch, was meine Mutter immer sagt, wenn wichtige Dinge verschwinden? Es liegt irgendwo und sagt keinen Ton! Hier, sie lag unter dem Beifahrersitz und hat natürlich kein Wort gesagt. Aber es hätte sie sowieso keiner gehört.«
Es war die Aktentasche ihres Vaters. Sie war genau an jenem schrecklichen Abend vor neun Tagen verschwunden.
»Papa!«, rief Sofja. »Komm her, sieh mal, Nolik hat dein gutes Stück gefunden.«
»Schrei nicht so«, flüsterte der Vater, »ich höre sehr gut. Ich bin hier, bei dir.«
Er stand tatsächlich direkt vor Sofja. In den wenigen Minuten war sein Gesicht eingefallen, gealtert, seine Wangen waren faltig, blass und mit grauen Greisenstoppeln bedeckt, der graue Flaum klebte nun glatt an der Kopfhaut. Seine Augen waren trüb und so hoffnungslos, dass Sofja schauderte.
»Freust du dich gar nicht, dass die Aktentasche sich angefunden hat?«, fragte Sofja leise.
Der Vater schüttelte traurig den Kopf und legte ihr die Hände auf die Schultern. Seine Hände waren warm und zu schwer. Sofja kniff fest die Augen zu, um den Schwindel zu unterdrücken, und als sie sie wieder öffnete, schaute sie in Noliks erschrockenes Gesicht und spürte seine riesigen Pranken auf ihren Schultern.
»Sofie, sieh mich an! Ich bin’s, Sofie! Siehst du mich überhaupt? Hörst du mich? Was hast du da für einen Strick um den Hals?«
»Dummkopf! Das ist kein Strick, das ist ein Verband. Nolik, ich habe eine Mittelohrentzündung, ich habe mir heute Nacht eine Kompresse gemacht, und die ist runtergerutscht. Was ist denn?«
»Du hast gerade mit Dmitri Nikolajewitsch gesprochen.«
»Ja. Und?«
Nolik legte ihr die Hand auf die Stirn.
»Du hast Fieber. Aber nicht so hoch, dass du phantasieren musst. Komm zu dir, bitte.«
Der arme Nolik war so erschrocken, dass sein leichter morgendlicher Rausch spurlos verflogen war. Sofja kam zu sich, Nolik zuliebe, damit er sich keine Sorgen machte.
»Alles in Ordnung. Ich bin okay. Ich weiß, dass Papa tot ist, wir haben ihn letzten Mittwoch beerdigt, heute ist der neunte Tag.«
»Puh, Gott sei Dank«, seufzte Nolik. »Du hast nur vergessen zu erwähnen, dass heute auch dein Geburtstag ist. Du bist dreißig geworden, Sofie. In dem Strauß sind einunddreißig Rosen. Eine Rose mehr, weil eine gerade Anzahl Blumen Unglück bringt. Und du stellst den schönen Strauß in den Mülleimer! Dir ist wirklich alles egal! Hast du wenigstens Wasser reingemacht?«
»Natürlich! Schenk mir doch eine schöne große Vase zum Geburtstag, Arnold!«
»Ich hab ein anderes Geschenk für dich. Aber du kriegst es nicht, wenn du mich Arnold nennst, Knolle. Noch einmal, und ich gehe.«
»Ach ja! Du fliegst hochkant raus, wenn du mich Knolle nennst!«
Einen Augenblick lang sahen sie sich so drohend an, als wollten sie sich prügeln. Nolik keuchte empört. Vor zwanzig Jahren hätten sie sich tatsächlich geprügelt. Nolik konnte seinen vollen Namen Arnold nicht ausstehen. Und Sofja ärgerte sich über ihren Kinder-Spitznamen Knolle. Sofort sah sie den Schulflur vor sich, die mit grüner Ölfarbe gestrichenen Wände, das graugestreifte Linoleum, hörte Getrappel und Geschrei: »Lukjanowa1! Zwiebel! Zwiebelknolle!« Nolik ging in dieselbe Schule, zwei Klassen über ihr, und hatte früher in der Wohnung gegenüber gewohnt.
Er war für sie längst mehr als ein Kindheitsfreund – eine Art Verwandter, ein jüngerer Bruder, obwohl er älter war als sie.
Der dicke, trinkende, verwöhnte Nolik, bar jeder Männlichkeit, mit unregelmäßigem Einkommen und den ernsten Ambitionen eines gescheiterten Schauspielers.
»Damit du es weißt, ich habe heute zur Feier deines Geburtstags alle Synchrontermine abgesagt. Ich bin extra früh aufgestanden und durch den Schneesturm zu dir gekommen, quer durch Moskau.«
»Du hättest einfach anrufen können.«
»Du nimmst ja nicht ab.«
»Ach nein? Tatsächlich? Warum wohl?«
»Hör mal, soll ich dir einen Arzt rufen?«
»Haha, ich bin selber Ärztin.«
»Gar nicht haha. Du bist keine Ärztin, du bist Biologin, du brauchst einen, wie heißt das? Für Hals-Nasen-Ohren.«
»Scher dich zum Teufel. Feg lieber das Quecksilber unterm Bett auf, mach mir einen Tee, und dann geh in die Apotheke und kümmer dich mal einen Tag lang um mich wie eine Mutter.«
Nolik war sofort bereit, brachte Sofja ins Zimmer ihres Vaters, bettete sie aufs Sofa, deckte sie zu und ging das Quecksilber auffegen.
Die Aktentasche war merkwürdig leicht, als wäre sie fast leer. Sofja hatte sie auf den Schreibtisch gestellt und bemühte sich, nicht hinzusehen. Zu stark war die Versuchung, sie sofort zu öffnen.
Vor kurzem war ihr Vater in Deutschland gewesen. Zwölf Tage. Er hatte gesagt, er wolle seinen ehemaligen Doktoranden Resnikow besuchen. Bei seiner Rückkehr war er nachdenklich und bedrückt gewesen, hatte kaum mit Sofja gesprochen. Und sich keinen Augenblick von seiner Aktentasche getrennt. Er hatte sie in Deutschland gekauft.
»Lass sie mich mal ansehen«, hatte Sofja gebeten.
Sie hatte eine Schwäche für Taschen. Die Aktentasche hatte an der Seite Ringe für einen Schulterriemen. An ihr würde sich dieses elegante teure Ding sehr schick ausnehmen.
Ihr Vater gab sie ihr nicht. Er wurde wütend und erklärte, sie würde bestimmt das Schloss kaputtmachen oder den Griff abreißen. Vermutlich legte er sich die Tasche nachts sogar unters Kopfkissen.
Sofja versuchte ihn auszufragen, in welchen Städten er gewesen sei, was er dort getan und gesehen habe, wie es Resnikow ginge, doch der Vater hatte hartnäckig geschwiegen oder sie angeknurrt: Sie habe das Geschirr wieder nicht abgewaschen, sie laufe bei dieser Kälte ohne Kopfbedeckung herum, im Bad tropfe der Wasserhahn, das Sofa lasse sich nicht mehr aufklappen und sei so zum Schlafen zu schmal, der Drucker sei seit einem halben Jahr kaputt, und er könne keine Filme mehr schauen, weil das DVD-Laufwerk hinüber sei.
»Das kannst du alles selber reparieren«, knurrte Sofja zurück, »du bist doch Ingenieur, Doktor der technischen Wissenschaften.«
Sofjas Eltern hatten sich vor einem halben Jahr getrennt. Ohne Scheidung, formal waren sie noch verheiratet. Aber die Mutter lebte seit fünf Jahren in Australien, sie hatte ein langfristiges Stipendium an einer dortigen Universität bekommen. Und sie verheimlichte weder Sofja noch deren Vater, dass sie in Sydney einen engen Freund hatte, den Australier Roger, einen Witwer, älter als ihr Mann. Sofja hatte das Vergnügen gehabt, ihn kennenzulernen. Er war eigens dafür mit ihrer Mutter zusammen nach Moskau gekommen. Der krummbeinige Mann, der einen Kopf kleiner war als die Mutter und krause dunkle Haare in Nase und Ohren hatte, gab sich große Mühe, einen guten Eindruck auf Sofja zu machen, und zwinkerte ihr ständig zu. Später erklärte ihr die Mutter, der arme Roger habe vor Aufregung an einem nervösen Tick gelitten.
Um an die Aktentasche heranzukommen, musste Sofja aufstehen und zwei Schritte bis zum Schreibtisch laufen. Die glänzenden runden Schlösser ließen sich natürlich nicht ohne weiteres öffnen. Aber sie wusste, wo die Schlüssel waren. Sie hatte sie im guten dunkelgrauen Anzug ihres Vaters gefunden, als sie ihn für die Beerdigung ankleidete. Der Ring mit den beiden kleinen Schlüsseln war mit einer Sicherheitsnadel ordentlich am Futter der Innentasche festgesteckt gewesen.
»Ach ja, apropos Mutter«, sagte Nolik, der in einer alten Schürze mit Marienkäfern darauf in der Tür erschien. »Du hast hoffentlich nicht vergessen, dass Vera Alexejewna übermorgen kommt? Sie hat mich angerufen und mich gebeten, dich daran zu erinnern, dass du sie mit dem Auto abholen sollst. Sie macht sich große Sorgen, weil du nicht ans Telefon gehst. Ich habe mir für alle Fälle die Flugnummer und die Ankunftszeit aufgeschrieben. Willst du wirklich nach Domodedowo fahren, so krank, wie du bist?«
»Kein Problem. Ich nehme einen Haufen Tabletten und setze dich auf den Beifahrersitz, als zusätzliche Heizung. Wann kommt sie an?«
»Ich glaube, nachts, um halb eins.«
»Hör mal, was macht der Tee? Ich brauche was Warmes. Ich hab schreckliche Halsschmerzen.«
»Ja, gleich. Soll ich ihn herbringen, oder trinkst du ihn in der Küche?«
»In der Küche. Hier verschütte ich ihn nur.«
»Das ist wahr.« Nolik lachte spöttisch. »Du solltest dir was an die Füße ziehen. Bei deinem Fieber darfst du nicht barfuß rumlaufen. Immer das Gleiche mit dir.«
»Was soll ich machen?« Sofja seufzte. »Meine Hausschuhe bleiben nie paarweise zusammen. Meine Socken übrigens auch nicht. Wenn du was Paarweises findest, ziehe ich es an.«
Nolik streifte ihr Wollsocken ihres Vaters über die nackten Füße. Zum Glück lag in Vaters Zimmer alles an seinem Platz, ordentlich in Schubfächern. Auf dem Weg in die Küche stieß sie im Flur beinahe den Eimer mit den Rosen um.
»Ach, übrigens, wer hat eigentlich diesen Prachtstrauß gebracht?«, fragte Nolik.
»Keine Ahnung.«
»Dein Mobiltelefon klingelt wie verrückt, hörst du das nicht?«
»Das sind SMS. Hilf mir beim Hinsetzen, lehn mich an die Wand, und dann nimm das Telefon, lies, wer mir da gratuliert, und sag es mir.«
Nolik schenkte ihr und sich Tee ein und setzte sich mit dem Telefon auf einen Hocker. Er las lange und voller Interesse, stieß hin und wieder einen Pfiff aus oder schüttelte den Kopf.
Na gut, dachte Sofja, Vater war siebenundsechzig, das ist ja nicht mehr jung, das ist schon ein reifes Alter, aber er war doch noch kein Greis gewesen.
Vater hatte nie Herzbeschwerden gehabt. Sie kannte niemanden, der gesünder und kräftiger war als er. Er hatte keinen Alkohol getrunken, nie geraucht, nichts Süßes und nichts Fettes gegessen und jeden Morgen am offenen Fenster Gymnastik gemacht. Auch seine Nerven waren völlig in Ordnung gewesen. Wieso also plötzlich akutes Herzversagen? Und mit wem war er an dem bewussten Abend in einem der teuersten und snobistischsten Moskauer Restaurants gewesen? Er mochte keine Restaurants, schon gar nicht solche pompösen. Warum hatte ihn derjenige, der ihn eingeladen hatte, nicht nach Hause gefahren? Der Vater hatte Sofja am Abend um halb elf angerufen und sie gebeten, ihn abzuholen. Als sie ankam, saß er auf einer Parkbank, die Arme um seine Aktentasche geschlungen. Die Bank war voller Schnee, er saß auf der Lehne und sah aus wie ein Schneemann, sogar in seinen Brauen glitzerten Schneekristalle. Sofja hatte gefragt, was passiert sei, und er hatte geantwortet: nichts. Erst später, als sie an dem Restaurant vorbeifuhren, sagte er, dass er dort gegessen habe. Und versprach, ihr am nächsten Tag alles zu erzählen. Zu Hause hatte er über Schwäche geklagt und sich gleich schlafen gelegt. Am Morgen atmete er nicht mehr und war schon kalt. Sofja rief die »Schnelle Hilfe«, und sie sagten, ihr Vater sei gegen ein Uhr nachts gestorben.
»Wer ist I. S.?«, fragte Nolik und riss sich endlich von Sofjas eingegangenen SMS los.
»Was?« Sofja schreckte auf. »I. S., das ist der, der die Rosen geschickt hat. Apropos – wo ist dein Geschenk?«
»Warte, gleich. Hör zu: ›Sofie, warum nimmst du nicht ab? Wir machen uns Sorgen!‹
›Dein Meerschweinchen mit dem Myom ist gestorben. Melde dich!‹
›Du wolltest das Ergebnis der Biopsie dringend haben, es ist fertig, aber du bist nicht da!‹
›Sofie, dein Artikel ist angenommen, du sollst ihn fertig machen!‹
›Du hast doch bald Geburtstag? Einen runden? Entschuldige, ich hab vergessen, wann genau. Schreib es mir, ich will dir gratulieren.‹
›Sofie, bist du krank? Geh ans Telefon!‹ Ah, die ist von mir.
›Sehr geehrte Sofja Dmitrijewna! Herzlichen Glückwunsch! I. S.‹
›Sofja Dmitrijewna, alles in Ordnung mit Ihnen? Wie geht es Ihnen? I. S.‹«
Nolik nahm einen Schluck Tee und starrte Sofja an.
»Das ist gerade eben gekommen. Hör mal, Knolle, wer ist dieser I. S.?«
Sofja wollte wegen der »Knolle« mit ihm schimpfen, musste aber husten.
»Er hat also die Rosen geschickt?« Nolik holte seine Zigaretten hervor und zündete sich nervös eine an.
»Ja, wahrscheinlich.«
»Wer ist er?«
»Keine Ahnung. Irgendwer aus dem Institut.«
Sie wurde von heftigen Hustenanfällen geschüttelt, aber Nolik war so in Fahrt, dass er das gar nicht bemerkte.
»Unsinn! In deinem Institut gibt es niemanden, der sich einen solchen Strauß leisten könnte. Vielleicht bahnt sich da eine ernsthafte Affäre an?«
»Schon möglich.« Sofja lächelte schwach. Der Husten war endlich vorbei.
»Aber du kennst ihn? Du hast dich schon mit ihm getroffen, mit diesen I. S.?«
»Nein, Nolik, nein. Wie oft soll ich das noch sagen?«
»Was? So ein Strauß ist unheimlich teuer, Sofie, den schickt kein x-beliebiger guter Onkel.«
»Es war leider kein Absender dabei. Du hast versprochen, in die Apotheke zu gehen, ich hab nichts mehr gegen das Fieber, und außerdem brauche ich Ohrentropfen.«
»Und du versuchst gar nicht, es herauszufinden?«
»Wie denn?«
»Antworte ihm, frag ihn, wer er ist.«
»Ja. Mach ich. Aber nicht jetzt.«
»Warum nicht?«
»Weil mein Vater gestorben ist, weil ich krank bin und weil mir alles scheißegal ist.«
Nolik schwieg eine Weile mürrisch und rauchte, dann seufzte er und sagte etwas ruhiger: »Du solltest dich wenigstens bedanken. Du warst immer gut erzogen, Sofie.«
»Es reicht.«
Sofja lehnte den Kopf gegen die Wand und schloss die Augen. »Weißt du was, Papas Doktorand Resnikow, der war auf der Beerdigung.«
»Ich weiß. Er hat den Sarg tragen geholfen. So ein Glatzkopf mit Bärtchen. Und?«
»Er hat gesagt, er habe Papa nicht nach Deutschland eingeladen. Er lebt seit langem in Moskau.«
»Moment, wieso Resnikow?«
»Papa hat behauptet, er fahre ihn in Deutschland besuchen. Papa hat nie gelogen.«
»Na ja, vielleicht war das … na, was Persönliches? Warum nicht? Mama hat einen boyfriend in Sydney, und Papa hat sich jemanden in Berlin angeschafft.«
»In Hamburg. Nein, Nolik. Das hätte er mir erzählt. Hör mal, mir geht’s echt elend. Geh bitte in die Apotheke. Im Flur steht meine Tasche, darin ist mein Portemonnaie.«
Als Nolik gegangen war, blieb Sofja noch ein paar Minuten in der Küche sitzen, den Kopf an die kalten Fliesen gelehnt und die Augen geschlossen. Sie wünschte sich, dass ihr Vater wieder erschien. Sie wusste, sie würde jetzt aufstehen, in sein Zimmer gehen und die Aktentasche öffnen, und der verrückte Gedanke, dass sie das ohne seine Erlaubnis nicht tun dürfe, ließ ihr keine Ruhe. Unterwegs hockte sie sich hin und senkte ihr Gesicht in die Rosen. Wer immer dieser unbekannte I. S. war – sie war ihm dankbar. Tatsächlich hatte sie zum ersten Mal im Leben einen solchen Strauß geschenkt bekommen. Wäre Vaters Tod nicht gewesen und die Mittelohrentzündung, hätte sie sich bestimmt schrecklich gefreut und sich geschmeichelt gefühlt.
Sie tappte mühsam bis zum Zimmer des Vaters, nahm die Aktentasche in die Hand und kam sich beinahe wie eine Diebin vor. Vielleicht hatte Nolik recht, und ihr Vater hatte in Hamburg eine Freundin? Nicht ohne Grund hatte er nicht gewollt, dass Sofja ihn zum Flughafen begleitete.
Wahrscheinlich hatten sie sich hier in Moskau kennengelernt. Schon einige Monate vor seiner Reise nach Deutschland hatte er sich merkwürdig verhalten, war oft spät nach Hause gekommen. Doch Sofja hatte nie vermutet, dass ihr gemütlicher alter Vater ein intimes Privatleben haben könnte.
Aber Sitzungen der Sektion und des wissenschaftlichen Rates dauerten nie bis nach Mitternacht. Wie viele seiner Kollegen verdiente sich der Vater etwas nebenbei, indem er Abiturienten auf die Aufnahmeprüfungen an Universitäten und Hochschulen vorbereitete. Die jungen Mädchen und jungen Männer kamen normalerweise zu ihm nach Hause, der Vater unterrichtete sie in seinem Zimmer. Er fuhr nie zu ihnen. Aber in den letzten zwei Monaten hatten Sitzungen der Sektion und des wissenschaftlichen Rates bis ein Uhr nachts gedauert, und der größte Teil des Unterrichts mit den Abiturienten hatte sonstwo stattgefunden.
Sofja stellte sich eine elegante ältere Frau vor, eine gelehrte Dame mit adrettem grauen Haar und einem bezaubernden Porzellanlächeln.
Inzwischen hatte sie die Aktentasche geöffnet. Darin lag nur ein fester kleiner Briefumschlag. Er enthielt Fotos, schwarzweiß und ziemlich alt.
Ein junges Mädchen und ein junger Mann. Sie etwa achtzehn, er höchstens fünfundzwanzig. Vermutlich in einem Fotoatelier aufgenommen. Sie sitzen da und blicken ins Objektiv, scheinen aber nur einander zu sehen. Er dunkelhaarig, die großen Ohren leicht abstehend, das Gesicht schmal, die Nase gerade, die Lippen dünn. Sie hat den dicken hellen Zopf über die Schulter geworfen, ihre Augen sind groß und dunkel. Sie wirkt verwirrt und schrecklich schutzlos.
Das kleine gelbgraue Rechteck hatte gezackte Ränder. Auf der Rückseite waren mit Bleistift kaum erkennbar vier Ziffern notiert: 1 9 3 9. Sofja begriff nicht gleich, dass das eine Jahreszahl war.
Das nächste Foto – dasselbe Paar, diesmal draußen. Schwer zu sagen, wo genau. Man sah nur die kahlen Äste von Bäumen. Der junge Mann und das junge Mädchen stehen nebeneinander. Sie in Hut und Mantel. Er in einem Militärmantel, eine Schirmmütze tief in die Stirn gezogen. Er hält ein längliches Bündel im Arm. Sofja sah genauer hin und erkannte, dass es ein in eine Decke gewickelter Säugling war. Auf der Rückseite des Fotos stand keine Jahreszahl.
Auf den anderen, noch älteren Fotos, waren Offiziere und junge Frauen, ein halbwüchsiger Gymnasiast in Uniformmantel und mit Schirmmütze und ein düsterer junger Mann im Russenhemd. Ein Gruppenfoto auf dem Hof eines Lazaretts. Viele Menschen. Verwundete und Soldaten, Krankenschwestern, Ärzte. Die Gesichter waren zu klein, nicht zu erkennen. Ein noch nicht alter, aber grauhaariger Herr im weißen Kittel auf demselben Lazaretthof, allein, auf einer Bank sitzend und rauchend. Eine junge Frau, die sie schon auf anderen Fotos gesehen hatte, diesmal in Schwesterntracht. Dann sie zusammen mit dem grauhaarigen Herrn. Noch einmal sie, in einer Bluse mit Stehkragen und einer Brosche am Hals, mit einem Offizier mittleren Alters. Noch einmal der Grauhaarige, allein, an einem Schreibtisch.
Sofja kniff die Augen zusammen, schüttelte den Kopf und schaute noch einmal auf das letzte Foto. Sie stand auf, schaltete die Deckenlampe ein, die Schreibtischlampe und die Wandlampe. Sie rannte in ihr Zimmer und kam mit einem dicken Buch zurück, das sie kaum halten konnte – Geschichte der russischen Medizin. Enzyklopädie. Nach kurzem Blättern fand sie, was sie suchte. Das Foto des Grauhaarigen, nur größer und deutlicher – im Anhang, unter den Fotos berühmter Ärzte.
Ein Ausschnitt, nur das Gesicht. Der grauhaarige Herr. Michail Wladimirowitsch Sweschnikow. Professor an der medizinischen Fakultät der Moskauer Universität, Mitglied der Physikalisch-medizinischen Gesellschaft. General der kaiserlichen Armee. Militärchirurg. Autor herausragender Arbeiten zur Medizin und zur Biologie, leistete einen bedeutenden Beitrag zur Erforschung von Blutbildung und Geweberegeneration. Geboren 1863 in Moskau. Wann und wo gestorben, war nicht bekannt.
Moskau 2006
Der quecksilberfarbene Sportwagen, flach wie eine fliegende Untertasse, raste in einem für Moskau unmöglichen Tempo den Lenin-Prospekt entlang. Es war Abend, ein Schneesturm tobte. Aus dem Auto drang eine moderne Mozart-Adaption. Am Steuer saß ein glatzköpfiger älterer Herr. Auf der Rückbank schlief zusammengerollt ein junges Mädchen. Sie war höchstens zwanzig. Selbst im Schlaf kaute sie weiter Kaugummi.
Seltsamerweise waren sämtliche Verkehrspatrouillen vom Prospekt verschwunden. Alle anderen Autos machten den Weg frei, obwohl Moskauer Autofahrer selbst Feuerwehr und Notarztwagen selten vorbeilassen. Der Wagen jagte dahin, die nagelneuen Reifen berührten kaum die Straße, der Tacho zeigte 120 Stundenkilometer. Am Gagarin-Platz hatte sich ein Stau gebildet, und wer weiß, wie der magische Flug des Sportwagens geendet hätte – doch er bog in eine ruhige Nebenstraße ein und drosselte das Tempo.
»Maschka, wach auf, wir sind da!«, sagte der Mann und stellte die Musik lauter.
»Ich bin Jeanna«, murmelte das Mädchen, ohne die Augen zu öffnen.
»Entschuldige, mein Sonnenschein.«
»Hmhm.« Das Mädchen setzte sich auf, klimperte mit den angeklebten Wimpern und holte eine Puderdose aus der Handtasche.
Das französische Restaurant »Je t’aime« war vor fünf Jahren in einen großen Hof gesetzt worden, anstelle zweier abgerissener Plattenbauten. Die zweistöckige Villa im Stil des europäischen Jugendstils beherbergte zwei Speisesäle, einen Bankettsaal mit einer Bühne für ein Orchester, drei Séparées und eine Bar mit riesigen Samtsofas. Der Chefkoch war Franzose. Der Portier und einige Kellner waren Schwarze. Von der Straße führte ein Wandelgang mit Girlanden bunter Lämpchen und einem Teppichläufer zum Eingang.
Der Wagen hielt, und sofort stürzten Kameraleute und Journalisten mit Mikrofonen herbei.
»Na so was, Mozart! Früher hat er im Auto Kriminellensongs gehört«, flüsterte die Korrespondentin eines schmalen Hochglanzmagazins, eine große vierzigjährige Dame mit Kinderzöpfen und einem Dutzend Ringen in jedem Ohr.
»Wer ist das?«, fragte ihr Fotograf.
»Colt. Pjotr Borissowitsch Colt.« Die Journalistin drängte sich geschickt zwischen die Kollegen und zog den schwerfälligen Fotografen hinter sich her.
Ein beleibter kleiner Mann stieg aus dem Auto. Die uralte Jeans rutschte ihm fast vom Leib, das graue Fischgrätensakko war zerknittert, als habe eine Kuh darauf herumgekaut. Unter dem Sakko trug er ein T-Shirt mit dem englischen Aufdruck: »Gott liebt alle, sogar mich«.
Die Journalistin mit den Zöpfen stieß ihren Fotografen mit dem Ellbogen an und flüsterte: »Die Füße! Mach ein Foto von den Füßen!«
An den Füßen trug Colt schmutzige orangene Leinenschuhe. Colt gähnte, reckte sich und verzog das Gesicht wegen der Blitzlichter.
»Pjotr Borissowitsch, guten Tag! Magazin ›Joker‹. Was halten Sie von der heutigen Veranstaltung?«
»Herr Colt! Was ist das Geheimnis eines erfolgreichen Unternehmens?«
»Pjotr, sagen Sie, stimmt es, dass Sie für zehn Millionen Euro die Fußballmannschaft der Elfenbeinküste gekauft haben?«
Es hagelte Fragen, Blitze zuckten, Mikrofone schoben sich gegenseitig beiseite. Colt kratzte sich den dicken weichen Bauch, bedachte die Journalisten mit einem gutmütigen Lächeln und sagte mit tiefer Stimme: »Es ist alles ganz eitel.«
Dann drehte er dem Publikum den Rücken zu, öffnete den hinteren Wagenschlag und zog das verschlafene, vor sich hin kauende Mädchen heraus.
Die glatten hellen Haare fielen ihr ins Gesicht, und sie blies sie mit vorgereckter Unterlippe weg. Als sie sich aufrichtete, reichte Colts runder Kopf ihr knapp bis zur Schulter. Das Mädchen trug eine khakifarbene kurze Daunenjacke. Ihre gelbe Seidenhose war so geschnitten, dass vorn ein beträchtlicher Teil des Bauches entblößt und hinten die Ritze zwischen den Pobacken deutlich erkennbar war.
Das Mädchen fotografierten die Journalisten nicht; sie ließen von Colt ab. Das Paar, rührenderweise Hand in Hand, lief zum Eingang. Die Journalistin mit den Zöpfen hatte schon ein paar Sätze für ihre Notiz in petto: Endlich sei dystrophische Magerkeit aus der Mode, nun seien üppige Formen aktuell. Der Antiglamour-Stil setze sich immer mehr durch. Alte, abgetragene, zerknitterte, betont billige und hässliche Sachen wie vom Flohmarkt gelten jetzt in der Szene als besonders schick.
Ein Wachmann stieg in den Sportwagen und fuhr ihn auf den restauranteigenen Parkplatz, um Platz zu machen für einen quadratischen schwarzen Jeep, in dem ein populärer Fernsehmoderator und dessen Frau saßen.
Im geräumigen Restaurantfoyer war an langen Tischen ein Büfett aufgebaut.
Gemäß dem in der Einladung vorgegebenen Dresscode trugen die Männer strenge Anzüge, Frack oder Smoking, die Damen Abendkleider. Ein äußerst solides Publikum: Bankiers, Politiker, Besitzer von Zeitschriften, Zeitungen und Fernsehsendern. Bisher hatte noch niemand gewagt, auf einer derart seriösen Veranstaltung in Flohmarkt-Schick zu erscheinen.
In einer halben Stunde sollte der feierliche Akt beginnen – die Überreichung der Preise für besondere Erfolge im Mediengeschäft.
Die Preise selbst waren nicht besonders wertvoll. Jeder Ausgezeichnete erhielt eine kleine Bronzestatue, einen Vogel oder einen Fisch, einen Blumenstrauß und seine Portion Beifall. Kostbar war etwas anderes: An der Zeremonie teilnehmen zu dürfen, die schwarze Einladungskarte mit Golddruck im Kuvert aus rosa Seidenpapier erhalten zu haben. Außenstehende hatten hier keinen Zutritt.
Die Gäste drängten sich um die Tische, schoben sich mit Tellern und Gläsern durch die Menge, bemüht, niemanden zu schubsen, nichts fallen zu lassen oder zu verschütten, was nicht so einfach war, denn es wurde immer voller.
Colts Erscheinen löste einige Bewegung aus, aber nicht wegen der schlabbrigen Jeans und des zerknitterten Sakkos, nicht einmal wegen des halbnackten großen Hinterns seiner Freundin Jeanna. Die Bewegung rührte einzig daher, dass Colt sich recht rabiat in die Menge drängte, manchen anstieß und anderen auf den Fuß trat. Entschuldigen konnte er sich nicht, weil er dabei telefonierte. Auch das Mädchen Jeanna entschuldigte sich nicht, weil sie das prinzipiell nie tat.
»Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hier sind massenhaft Leute!«, trompetete Colt in den Hörer. »Schön, bleib, wo du gerade stehst, und leg nicht auf!«
Der Mann, zu dem Colt strebte, stand nicht, sondern saß. Er hatte einen bequemen Platz in der Ecke ergattert, neben dem Flügel. Er rauchte, lässig auf ein Sofa gelümmelt, lauschte den ausgezeichneten Jazzimprovisationen des Restaurantpianisten und musterte neugierig das Publikum. Er sah aus wie höchstens fünfundvierzig. Auf den ersten Blick wirkte er hässlich, ja unsympathisch. Ein großes dunkles Gesicht mit breiten Wangenknochen und Stupsnase, dünnes, mattes Haar von unbestimmter Farbe, ein schweres Kinn, blasse, aufgeworfene Lippen. Aber er hatte klare blaue Augen, eine reine Stirn und ein wundervolles Lächeln. Mit diesem Lächeln bedachte er Jeanna, die allerdings in keiner Weise darauf reagierte, sondern weiter ihren Kaugummi kaute.
»Geh was essen, misch dich unter die Leute«, sagte Colt zu ihr und setzte sich auf das Sofa.
»Nun, was ist?«, flüsterte er ungeduldig, als das Mädchen sich entfernt hatte.
»Vorerst nichts.«
»Was heißt das – nichts? Ich hab doch gesagt – jede Summe. Jede! Hast du ihm das erklärt?«
»Hab ich. Er ist einverstanden.«
»Und?!« Colts kleine gelbe Augen glänzten, und er schlug seinem Gesprächspartner aufs Knie. »Wie viel also?«
»Das ist nicht mehr wichtig.«
»Was heißt das – nicht mehr wichtig?«
»Er ist tot.«
»Wer?!«, rief Colt so laut, dass man sich nach ihm umsah.
»Psss …« Der Dunkle schürzte die Lippen und schüttelte den Kopf. »Nein, nein, ihm ist nichts passiert, keine Sorge. Lukjanow ist tot.«
»Ach so.« Colt atmete erleichtert auf, runzelte aber sogleich die Stirn. »Moment mal, wie das so plötzlich? Er war doch noch gar nicht alt und kerngesund, hast du gesagt. Fünfundsechzig, wie ich.«
»Siebenundsechzig. Akutes Herzversagen.«
»Und wie weiter?«
»Wir werden weiterarbeiten.«
»Mit wem?«, fragte Colt besorgt.
»Mit ihr.« Der Mann lächelte.
Ganz in ihr Gespräch vertieft, hatten sie nicht bemerkt, dass die Menge in den Bankettsaal gestrebt war. Durch das nun leere Foyer kam ein großer brünetter Schönling im weißen Smoking wie aus der Werbung angelaufen und sagte, verlegen von einem Bein aufs andere tretend: »Pjotr Borissowitsch, Iwan Anatoljewitsch, entschuldigen Sie bitte, aber dort warten schon alle, Sie möchten bitte kommen, es ist Zeit.«
»Ja, wir kommen. Wir kommen schon«, erwiderte Colt.
Bevor er auf die Bühne stieg und Iwan Anatoljewitsch in der ersten Reihe platzierte, drückte ihm Colt die Hand und flüsterte ihm ins Ohr: »Und wenn sie nun auch plötzlich stirbt? Wie alt ist sie?«
»Erst dreißig, gerade heute geworden.«
Auf Iwan Anatoljewitschs Gesicht erstrahlte ein sanftes, bezauberndes Lächeln.
Zweites Kapitel
Moskau 1916
Der 25. Januar war Tanjas Geburtstag. Sie wurde achtzehn.
Professor Sweschnikow lebte zurückgezogen, konnte Empfänge nicht leiden, besuchte fast nie jemanden und lud auch selten Gäste ein. Aber auf Tanjas Bitte machte er an diesem Tag eine Ausnahme.
»Ich will eine richtige Feier«, hatte Tanja einige Tage zuvor gesagt, »viele Gäste, Musik und Tanz und keine Gespräche über den Krieg.«
»Was versprichst du dir davon?«, fragte der Professor erstaunt. »Das Haus voller fremder Leute, Gedränge und Lärm. Du wirst sehen, schon nach einer halben Stunde bekommst du Kopfschmerzen und möchtest alle zum Teufel jagen.«
»Papa mag keine Menschen«, spottete Wolodja, Sweschnikows ältester Sohn. »Dass er Frösche, Ratten und Regenwürmer misshandelt, das ist Sublimierung nach Doktor Freud.«
»Danke für die netten Worte.« Sweschnikow neigte den runden grauen Kopf mit dem Igelschnitt. »Der Wiener Scharlatan klatscht dir Beifall.«
»Siegmund Freud ist ein großer Mann. Das zwanzigste Jahrhundert wird das Jahrhundert der Psychoanalyse, nicht das der Zelltheorie von Sweschnikow.«
Der Professor lachte spöttisch, klopfte mit einem Löffel ein Ei auf und knurrte: »Zweifellos hat die Psychoanalyse eine große Zukunft. Tausende Gauner werden mit dieser Geschmacklosigkeit einen Haufen Geld machen.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!