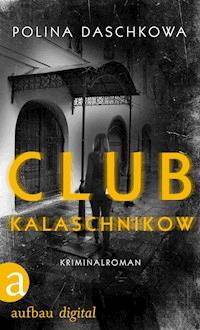Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Russische Ermittlungen
- Sprache: Deutsch
Bravourös meistert die Journalistin Lena ihren Alltag - bis ihre Freundin Olga mit einer Hiobsbotschaft auftaucht. Ihr Bruder, ein Liedermacher, hat sich angeblich in seiner Wohnung im Drogenrausch erhängt. Anders als die Polizei, die sofort an Selbstmord glaubt, hat Lena ihre Zweifel. Ausgerechnet als er Aussicht auf einen Plattenvertrag hatte? Lena stößt auf Ungereimtheiten. Wenig später wird ein Anschlag auf sie und ihr Kind verübt … "Unglaublich dicht und spannend!" Brigitte. "Dieses Buch ist ein Meisterwerk." Literaturen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Polina Daschkowa
Die leichten Schritte des Wahnsinns
Kriminalroman
Aus dem Russischen von Margret Fieseler
Impressum
Die Originalausgabe unter dem Titel
»Ljochkije schagi besumija«
erschien 1999 bei Eksmo-Press, Moskau.
ISBN E-Pub 978-3-8412-0289-5
ISBN PDF 978-3-8412-2289-3
ISBN Printausgabe 978-3-7466-2372-6
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2011
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die deutsche Erstausgabe erschien 2001 bei Aufbau;
Aufbau ist eine Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
© by Polina Daschkowa 1998
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung gold, Anke Fesel und Kai Dieterich
unter Verwendung eines Fotos von Carla Brno / bobsairport
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH, KN digital - die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Epilog
Kapitel 1
Moskau, März 1996
Lena Poljanskaja zog den Kinderwagen durch den tiefen Frühjahrsmatsch und kam sich dabei vor wie ein Wolgatreidler. Die Räder versanken in dem pappigen, angetauten Schnee, auf dem Bürgersteig der schmalen Straße türmten sich hartgewordene Schneewehen, und die Autos bespritzten die Passanten mit dickem braunem Schmutz.
Die zweijährige Lisa versuchte die ganze Zeit, sich im Kinderwagen aufzustellen, sie wollte unbedingt selbst laufen, denn sie fand sich schon viel zu groß für einen Kinderwagen, und außerdem passierte ringsum so viel Interessantes: Spatzen und Krähen zankten sich lauthals um eine feuchte Brotrinde, ein junger Hund mit zotteligem rotem Fell jagte hinter seinem eigenen Schwanz her, ein großer Junge kam ihnen entgegen und biß in einen riesigen, leuchtendroten Apfel.
»Mama, Lisa will auch Apfel«, erklärte die Kleine mit wichtiger Stimme und versuchte von neuem, auf die Beine zu kommen.
Am Griff des Kinderwagens hing eine große Tasche mit Lebensmitteln. Kaum wollte Lena ihre Tochter hochheben, um sie wieder richtig hinzusetzen, verlor der Wagen auch schon das Gleichgewicht und kippte um.
»Alles hinfallen«, stellte Lisa seufzend fest.
»Ja, Lisa, alles hingefallen. Jetzt sammeln wir es wieder ein.« Lena stellte ihre Tochter vorsichtig auf den Bürgersteig, hob die Lebensmittelpakete auf und klopfte sie mit dem Handschuh sauber. Plötzlich bemerkte sie, daß sie aus einem dunkelblauen Volvo, der auf der anderen Straßenseite parkte, beobachtet wurde. Die Scheiben des Wagens waren getönt, so daß Lena niemanden erkennen konnte, aber sie spürte einen Blick.
Als sie später in den Hof einbog, fiel ihr der dunkelblaue Volvo erneut auf. Er fuhr ganz langsam vorbei, so als wollten die Insassen feststellen, in welchem Hauseingang die junge Mutter mit dem Kinderwagen verschwand.
Es waren zwei, die im Wagen saßen – am Steuer eine Frau, neben ihr ein Mann.
»Bist du sicher?« fragte die Frau leise, als sich die Haustür hinter Lena geschlossen hatte.
»Absolut«, sagte der Mann, »sie hat sich in all den Jahren kaum verändert.«
»Sie müßte jetzt sechsunddreißig sein«, bemerkte die Frau, »aber diese junge Mutter ist höchstens fünfundzwanzig. Und das Kind ist so klein. Hast du sie nicht doch verwechselt? Immerhin ist viel Zeit vergangen.«
»Nein«, entgegnete der Mann, »ich habe sie nicht verwechselt.«
***
In der leeren Wohnung überschlug sich das Telefon.
»Hast du einen Augenblick Zeit für mich?« Nur mit Mühe erkannte Lena ihre enge Freundin und frühere Kommilitonin Olga Sinizyna – die Stimme im Hörer klang merkwürdig fremd.
»Hallo, Olga, was ist passiert?« Lena preßte mit der Schulter den Hörer ans Ohr und löste die Bänder an Lisas Mütze.
»Mitja ist tot«, sagte Olga ganz leise.
Lena glaubte sich verhört zu haben.
»Entschuldige, was hast du gesagt?« fragte sie zurück und zog Lisa die Stiefel von den Beinen.
»Mama, Lisa muß A-a machen«, verkündete ihre Tochter feierlich.
»Olga, bist du zu Hause? Ich rufe dich in einer Viertelstunde zurück. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Ich ziehe Lisa aus, setze sie auf den Topf und rufe dich sofort an.«
»Kann ich nicht gleich zu dir kommen?«
»Natürlich!«
Bis Olga eintraf, hatte Lena für ihre Tochter das Abendbrot gemacht, sie zu Bett gebracht, das Geschirr gespült, Kohlsuppe gekocht und die Waschmaschine eingeschaltet. Eigentlich wollte sie heute noch wenigstens fünf Seiten von dem langen Artikel des amerikanischen Modepsychologen David Crowell übersetzen, der unter dem Titel »Die Grausamkeit des Opfers« im »New Yorker« erschienen war und sich mit den jüngsten Forschungsergebnissen zur Psychologie von Serienmördern befaßte.
Obwohl Lisa gerade erst zwei geworden war, arbeitete Lena sehr viel. Sie leitete das Ressort Kunst und Literatur der Zeitschrift »Smart«, hatte allerdings nur zwei Anwesenheitstage. Den größten Teil der Arbeit nahm sie mit nach Hause und saß nächtelang am Computer. Wenn sie in die Redaktion mußte, blieb Lisa bei der Nachbarin – Lena und ihr Mann Sergej hatten keine Eltern mehr. Lisa wuchs ohne Oma und Opa auf, und der gebildeten Rentnerin Vera Fjodorowna machte es Freude, den Tag mit dem ruhigen, lieben Kind zu verbringen. Ja, und das Geld, das ihr Lena und Sergej dafür gaben, konnte sie bei ihrer kümmerlichen Rente nur zu gut gebrauchen.
Vera Fjodorowna war für Lena wie eine Märchenfee. Sergejs Gehalt – er war Oberst im Innenministerium und stellvertretender Leiter der Kriminalabteilung im Sicherheitsdienst – reichte kaum. Noch wichtiger aber war, daß Lena ohne Arbeit einfach nicht leben konnte. Außerdem wußte sie, daß sie nur ein wenig nachzulassen brauchte, und schon wäre ihre Stelle besetzt.
So war jede Minute ihrer Zeit verplant, sie schuftete unablässig und schlief nicht mehr als fünf Stunden pro Nacht. Von den kostbaren zwei Stunden, die Lisa tagsüber schlief, war jetzt noch eine Stunde geblieben. Aber nach Olgas Anruf konnte Lena nur noch an Mitja denken. Was mochte ihm zugestoßen sein? Ein Unfall? Hatte ein Auto ihn überfahren?
Lena war gerade dabei, Kaffee zu kochen, als es klingelte.
Olga stand in einem schwarzen Kopftuch, offenbar von ihrer Großmutter, vor der Tür. Man sah auf den ersten Blick, daß sie sich weder gekämmt noch gewaschen hatte und schnell das erste, was ihr in die Hände gekommen war, übergeworfen hatte.
»Er hat sich erhängt«, sagte Olga mit dumpfer Stimme, während sie ihren Mantel auszog. »Er hat sich heute nacht erhängt, in seiner Wohnung. Hat seinen Ledergürtel am Gasrohr über der Küchentür befestigt.«
»Und wo war seine Frau um diese Zeit?«
»Sie hat geschlafen. Sie hat ruhig im Nebenzimmer geschlafen und nichts gehört.«
»Wer hat denn als erster …?« Lena wollte sagen »die Leiche gefunden«, aber sie stockte – dieses Wort wollte ihr im Zusammenhang mit Mitja nicht über die Lippen. Mitja, der sie noch vor kurzem besucht hatte, der hier bei ihr auf dem Küchensofa gesessen und vor Energie, Gesundheit und optimistischen Zukunftsplänen nur so gesprüht hatte.
»Seine Frau hat ihn gefunden. Sie ist aufgewacht, in die Küche gegangen und hat ihn gesehen.«
Lena fiel auf, daß Olga in der letzten Zeit die Frau ihres Bruders nicht mehr mit Namen nannte. Früher hatte sie ständig von Katja, Katjuscha, Katjenka geschwärmt.
»Und was war weiter?«
»Wie es passiert ist, hat niemand gesehen.« Olga zuckte nervös die Schultern und zündete sich eine Zigarette an. »Wir wissen das alles nur von ihr, und sie erinnert sich an nichts mehr. Sie selbst hat Mitja aus der Schlinge gezogen. Ich weiß ja, es passiert alles mögliche, aber einfach so, aus heiterem Himmel, nicht einmal ein Brief. Und vor allem – Mitja hat immer gesagt, Selbstmord sei eine schwere Sünde, davon war er überzeugt. Für die Polizei ist das natürlich kein Argument, aber Mitja ist getauft, und er war gläubig, ging zur Beichte und zur Kommunion. Zwar selten, aber immerhin. Und jetzt kann ich ihn nicht einmal kirchlich beerdigen lassen, Selbstmörder bekommen kein kirchliches Begräbnis. Jede andere Sünde wird vergeben – nur diese nicht.«
Olga hatte dunkle Ringe unter den Augen, ihre Hand mit der erloschenen Zigarette zitterte leicht.
»Er war noch vor etwa einem Monat bei mir«, sagte Lena leise. »Er hatte so viele Pläne, erzählte, er hätte fünf neue Lieder geschrieben, hätte die Bekanntschaft eines berühmten Produzenten gemacht und würde jetzt bestimmt einen Videoclip nach dem anderen herausbringen. Ich erinnere mich nicht mehr an alles, worüber wir gesprochen haben, aber mir schien, daß er eine richtige Glückssträhne hatte. Er war ein bißchen erregt, aber freudig erregt. Vielleicht haben sich irgendwelche Hoffnungen, die mit diesem Produzenten verbunden waren, zerschlagen?«
»Solche Hoffnungen hatte er jeden Monat ein Dutzend Mal, und genausooft haben sie sich wieder zerschlagen.« Olga lächelte traurig. »Daran war er gewöhnt und nahm das ganz gelassen. Nein, wenn ihm etwas wirklich naheging, dann seine eigene Arbeit, wobei es ihm nicht auf Popularität oder Geld ankam. Ihm war wichtig, ob er schreiben konnte oder nicht. Im letzten Monat konnte er schreiben wie nie zuvor, und das war für ihn die Hauptsache.«
»Das heißt, du hältst es für möglich, daß Mitja nicht selber …?« fragte Lena vorsichtig.
»Die Polizei versichert, daß er es selbst getan hat.« Olga steckte sich noch eine Zigarette an.
»Hast du heute eigentlich schon etwas gegessen? Soll ich dir einen Kaffee kochen?«
»Von mir aus.« Olga nickte gleichgültig. »Und wenn es geht, würde ich gern bei dir duschen. Ich habe mich heute nicht einmal gewaschen. Entschuldige, daß ich mit dieser schrecklichen Geschichte zu dir komme, aber zu Hause halte ich es nicht aus, und ich muß ein bißchen zur Besinnung kommen und dann meine Eltern beruhigen, und Großmutter.«
»Heb dir diese Förmlichkeiten für deine Japaner auf. Komm, ich gebe dir ein sauberes Handtuch.«
»Lena, ich glaube nicht, daß er es selber getan hat«, sagte Olga leise, als sie vor dem Badezimmer stand. »Das alles ist mehr als seltsam. Ihr Telefon hat den ganzen Tag nicht funktioniert. Ich habe mich beim Amt erkundigt, die Leitungen waren alle in Ordnung. Irgendwas war am Apparat kaputt, der Nachbar hat es heute morgen in einer Minute repariert. Den Krankenwagen und die Polizei hat seine Frau vom Apparat der Nachbarn aus alarmiert, um fünf Uhr morgens. Diese Nachbarn haben auch mich angerufen. Ich bin hingefahren, da hatte man Mitja schon weggebracht. Weißt du, seine Frau war in dieser Nacht – also, sie war vollgepumpt mit Drogen. Und Mitja, so hat man mir gesagt, ebenfalls. Es hieß, ein klarer Fall von Selbstmord aufgrund einer narkotischen Psychose. In der Wohnung sind Ampullen und Spritzen gefunden worden, und an seinem Arm waren Einstiche. Deshalb hat die Polizei keine besonderen Anstrengungen unternommen. Mir wurde gesagt – verehrte Olga Michailowna, Ihr Herr Bruder war drogensüchtig. Und seine Frau ebenso. Alles klar!«
»Mitja war nicht drogenabhängig«, sagte Lena, »er hat nicht einmal getrunken. Und Katja …«
»Sie hat schon seit anderthalb Jahren gespritzt. Aber Mitja nicht. Niemals.«
»Du hast ihn im Leichenschauhaus gesehen?«
»Nein. Ich konnte nicht, ich hatte schreckliche Angst, daß ich es nicht ertrage und womöglich in Ohnmacht falle. Er war schon im Kühlraum. Für eine Obduktion muß man sich in eine Warteliste eintragen – es wären zu viele Leichen, heißt es. Wenn ich einen Antrag bei der Staatsanwaltschaft stelle – dann muß er da liegenbleiben, bis er an die Reihe kommt.«
»Und was willst du tun?«
»Ich weiß nicht. Der Antrag, so heißt es, hat nicht viel Sinn. Die Sache wird irgendeinem unbedarften Mädel übergeben, das bei der Moskauer Staatsanwaltschaft eigentlich für alle Aufenthaltsgenehmigungen zuständig ist, es gibt nämlich zuwenig Untersuchungsführer. Und so ein Mädchen wird nicht lange nachforschen, ist ja eine klare Sache, Selbstmord. Es gibt so viele unaufgeklärte Morde, und das hier ist nur ein Drogensüchtiger.«
Während Olga duschte und sich herrichtete, stand Lena mit der surrenden Kaffeemühle in der Hand am Fenster und dachte an Mitja Sinizyn. Worüber hatten sie neulich gesprochen? Immerhin war er ganze zwei Stunden hier gewesen. Er hatte von seinen fünf neuen Liedern erzählt und ihr sogar eine Kassette dagelassen. Sie mußte sie suchen und sich anhören. Bis jetzt hatte sie noch keine Zeit dafür gefunden.
Und von diesem Superproduzenten hatte er gesprochen, der da an seinem Horizont aufgetaucht war. Seinen Namen nannte Mitja nicht, er sagte nur: »Eine sagenhafte Berühmtheit, du wirst es nicht glauben! Und überhaupt, ich will’s nicht beschreien!« Nachdem er mit Appetit gegessen hatte, saßen sie noch lange zusammen und redeten. Es ging um ihre Studentenzeit.
Mitja hatte am Institut für Kulturwissenschaften studiert, Regie für Volkstheater. Ein seltsames Fach, besonders heutzutage. Er hatte aber nie in dieser Sparte gearbeitet, sondern seine Lieder geschrieben und meist in kleinem Kreis vorgetragen. Ende der achtziger Jahre konnte er sogar ein paar Konzerte in Klubs geben, und immer wieder war über eine Schallplatte verhandelt worden, später dann über eine CD und einen Videoclip. Diese Verhandlungen kamen nie zu einem Abschluß, aber Mitja verlor den Mut nicht. Er glaubte daran, daß seine Lieder gut waren, nur eben keine Popmusik.
In der letzten Zeit hatte er als Gitarrenlehrer an einem kleinen Kindertheater gearbeitet. Das Gehalt war erbärmlich, aber die Kinder liebten ihn, und das war ihm wichtig – eigene Kinder konnten Katja und er nicht bekommen, obwohl sie sehr gern welche gehabt hätten.
Angenommen, Mitja war tatsächlich auf so ausgeklügelte Weise ermordet worden, dann tauchte sogleich die Frage auf: Weshalb? Wem konnte ein Mensch im Wege sein, der Kindern klassische Gitarre beibrachte und Lieder schrieb?
Draußen fiel feuchter Schnee. Lena blickte aus dem Fenster und registrierte automatisch, daß Olga ihren kleinen grauen VW nicht eben glücklich auf dem Hof geparkt hatte – er stand in einer Schneewehe, aus der sie nur mit Mühe herauskommen würde. Und ebenso automatisch streifte ihr Blick den dunkelblauen Volvo, der ein paar Meter von Olgas Auto entfernt stand und schon mit einer leichten Schneeschicht bedeckt war.
***
»Siehst du«, sagte die Frau am Steuer des Volvo leise, »ich war mir sicher, daß sie noch Kontakt zueinander haben, und sogar recht engen. In dieser Situation ist sie nicht irgendwohin, sondern zu ihr gefahren.«
»Ich habe Angst«, flüsterte der Mann mit ausgetrockneten Lippen.
»Nicht doch«, sagte die Frau und streichelte zärtlich über seine Wange, »du bist mein tapferer Held. Ich weiß, wie groß deine Angst jetzt ist. Sie kommt tief aus dem Inneren, steigt vom Magen zur Brust hoch. Aber du läßt sie nicht weiter hinauf, du läßt sie nicht in deinen Kopf und dein Unterbewußtsein. Du hast es schon so oft geschafft, diese kompakte, brennende, unerträgliche Angst aufzuhalten. Du bist sehr stark und wirst noch stärker, wenn wir diese Anstrengung auf uns nehmen – sie ist schwer, unumgänglich, aber es wird die letzte sein. Ich bin bei dir, und wir werden es schaffen.«
Ihre kurzen, kräftigen Finger glitten langsam und zärtlich über seine glattrasierte Wange. Die langen Fingernägel waren mit tiefrotem, mattem Lack überzogen. Auf der leichenblassen Wange wirkte diese Farbe unangenehm grell. Während sie leise ihre einlullenden Worte sprach, nahm die Frau sich vor, diesen Lack noch heute abend zu entfernen und die Nägel mit einer gedämpfteren und raffinierteren Farbe zu lackieren.
Der Mann schloß die Augen. Er atmete tief und ruhig. Als die Frau spürte, daß seine Gesichtsmuskeln sich völlig entspannt hatten, ließ sie den Motor an, und der dunkelblaue Volvo rollte langsam vom Hof.
***
Während des Studiums an der journalistischen Fakultät waren Olga Sinizyna und Lena Poljanskaja eng befreundet. Dann hatten sie sich eine Zeitlang aus den Augen verloren, und erst acht Jahre nach dem Studium waren sie sich ganz zufällig wiederbegegnet.
Lena flog damals nach New York. Die Columbia-Universität hatte sie eingeladen, eine Reihe von Vorlesungen über zeitgenössische russische Literatur und Publizistik zu halten. Im Abschnitt für Raucher setzte sich eine elegante, gepflegte Geschäftsfrau in einem schlichten teuren Kostüm neben sie.
Man schrieb das Jahr 1990, und derartige Business-Damen waren in Rußland noch eine Seltenheit. Lena streifte sie mit einem flüchtigen Seitenblick und wunderte sich, warum eine reiche Amerikanerin mit Aeroflot und nicht mit PanAm oder Delta Airlines flog. Da schüttelte die Dame bekümmert ihren leuchtendblonden Kopf und sagte auf Russisch:
»Na also, weißt du, Poljanskaja! Die ganze Zeit warte ich, ob du mich erkennst oder nicht.«
»Lieber Himmel, Olga! Oljuscha Sinizyna!« rief Lena erfreut.
Olga Sinizyna, die an der ganzen Fakultät für ihre Zerstreutheit, Lebensfremdheit und ihre verworrenen, eher unglücklichen Liebesgeschichten bekannt gewesen war, und diese kühle, unnahbare Dame mit dem perfekten höflichen Lächeln einer Amerikanerin, selbstbewußt und gutsituiert, schienen von verschiedenen Planeten zu stammen.
»Ich lebe allein mit meinen beiden kleinen Jungen, sie sind nur ein Jahr auseinander«, erzählte Olga. »Ich hatte ja Giwi Kiladse geheiratet, erinnerst du dich an ihn?«
Giwi Kiladse hatte mit ihnen studiert und war vom ersten bis zum letzten Studienjahr unglücklich in Olga verliebt. Er war Georgier, aber schon in Moskau geboren, und an seine Muttersprache erinnerte er sich nur dann, wenn er jemanden umbringen wollte. Und umbringen wollte er immer entweder Olga oder jeden, der es wagte, sich ihr auf mehr als drei Meter zu nähern.
»Weißt du, mit der Leidenschaft war es schnell vorbei, und es fing der widerwärtige, armselige Alltag an. Giwi fand keine Arbeit, begann zu trinken und schleppte alle möglichen Herumtreiber mit nach Hause, die unsere Handtücher und Teelöffel mitgehen ließen. Alle bekamen bei uns zu essen und ein Bett für die Nacht. Er hatte ein großes Herz, und ich lief mit meinem dicken Bauch und einer Toxikose herum. Als unser Gleb geboren wurde, holte Giwi seine Großtante aus den Bergen zu uns, sie sollte mir mit dem Kind helfen. Nach der Großtante kam der Großonkel, dann noch Onkel und Tante. Schließlich habe ich Gleb genommen und bin zu meinen Eltern geflüchtet. Da fing das Drama dann an, besser gesagt, die Schmierenkomödie: ›Ich bringe mich um, ich bringe dich um!‹ Na ja, schließlich haben wir uns wieder versöhnt. Damals war ich fest überzeugt, daß ein Kind den Vater braucht, selbst wenn er verrückt ist, er bleibt doch der Vater.
Mein Gleb hat schwarze Haare und schwarze Augen, aber Goscha, der kleinere, kam mit blondem Haar und blauen Augen auf die Welt. Da hat dieser Idiot irgendwelche Berechnungen angestellt und fing an zu heulen, Goscha sei nicht sein Sohn. Weißt du, was ich gemacht habe, um nicht überzuschnappen? Ich fing an, Japanisch zu lernen! Stell dir das Bild vor: die junge Mutter, den Säugling an der Brust, liest laut Hieroglyphen, der Vater rennt mit hervorquellenden Augen und dem Familiensäbel in der Hand umher und brüllt: ›Ich stech dich ab!‹, und Gleb mit seinen zweieinhalb Jahren sitzt auf dem Topf und sagt auf Georgisch: ›Papa, bring Mama nicht um, sie ist lieb!‹ – die beiden Alten aus den Bergen hatten ihm das beigebracht. Zum Schluß bin ich doch wieder zu meinen Eltern zurück, hab die Kinder genommen, und weg.«
»Du hättest doch mal anrufen können.« Lena seufzte. »Warum bist du so spurlos verschwunden?«
»Und du?« sagte Olga und lächelte. »Warum bist du verschwunden?«
»Tja, ich weiß nicht.« Lena zuckte die Schultern. »Ich habe wohl auch meine Leiche im Keller. Hast du denn nun Japanisch gelernt?«
»Das habe ich, und wie! Weißt du, ich bin Giwi sogar dankbar. Wenn er mich nicht so weit getrieben hätte, wäre ich heute nicht Managerin der russischen Filiale von Kokusai-Koyeki, einer fabelhaften Firma. Ich habe als Übersetzerin dort angefangen, ohne von den Computern und der ganzen Bürotechnik, mit der sie handeln, auch nur die leiseste Ahnung zu haben. Aber die Kinder mußten ernährt werden, und Mama, Papa, Oma und Mitja ebenfalls. Mein Bruderherz ist noch immer der gleiche Schwachkopf wie früher, schreibt seine Lieder, singt sie zur Gitarre und will sonst nichts machen – er wartet auf den Weltruhm. Aber essen möchte er natürlich auch.
Also mußte ich Geld verdienen. Und das ist mir nicht übel gelungen. Ich war bald so gut eingearbeitet, daß ich sehr viel verdient habe. Mama und Oma haben auf die Kinder aufgepaßt, und ich habe Karriere gemacht. Weißt du, es läuft alles hervorragend, ich verdiene einen Haufen Geld, aber manchmal sehe ich in den Spiegel und frage mich, wer ist diese fremde Frau? Weißt du noch, ich habe mal Gedichte geschrieben? Und meine Seminararbeit über Kafka? Damals habe ich mit dem Kopf gearbeitet, aber jetzt … Manchmal habe ich das Gefühl, daß in meinem Schädel anstelle des Gehirns ein kleiner Computer sitzt und seine Ergebnisse ausspuckt.«
»Laß gut sein, Sinizyna.« Lena lachte. »Dir geht’s doch prima. Kafka und die Gedichte, das ist alles noch da und nicht verschwunden, nur die Jugend ist vorüber. Alles hat seine Zeit.«
»Aber deine Jugend ist noch nicht vorüber«, bemerkte Olga und betrachtete Lenas große graue Augen, ihr schmales ungeschminktes Gesicht. »Du bist noch ganz dieselbe wie im ersten Studienjahr.«
»Was redest du!« Lena schüttelte ihren kastanienbraunen Kopf. »Ich bin nur so dünn, deshalb sehe ich jünger aus. Außerdem sind für meine Arbeit Business-Kostüme und Make-up nicht erforderlich. Als Journalistin kann ich ruhig in Jeans und Pullover herumlaufen.«
Seit dieser Begegnung im Flugzeug waren sechs Jahre vergangen. Olga war inzwischen stellvertretende Verkaufsleiterin der russischen Filiale von Kokusai-Koyeki geworden. Sie hatte nicht wieder geheiratet, die erste Erfahrung mit dem Eheleben hatte ihr ein für allemal gereicht. Das bißchen Freizeit, das ihr neben der Arbeit blieb, widmete sie ihren Söhnen und ihrem jüngeren Bruder.
Im Laufe dieser sechs Jahre hatten Lena und Olga sich nicht wieder aus den Augen verloren, sie telefonierten häufig und trafen sich hin und wieder. Beide begriffen sehr gut: Je älter man wird, desto schwieriger ist es, neue Freunde zu finden. Und man braucht unbedingt einen Menschen, den man zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen kann.
Kapitel 2
Tobolsk, September 1981
Er liebte es, an seine Kindheit zu denken. Dabei holte er aus der Tiefe seines Gedächtnisses irgendeine besonders bedrückende, schmerzliche Episode hervor und vergegenwärtigte sie sich in allen Einzelheiten. Je quälender diese Einzelheiten waren, desto länger verweilte er bei ihnen.
Er war ein stilles, gehorsames Kind gewesen. Seine Mutter beobachtete ihn bei jedem Schritt, bei jedem Atemzug.
»Du bist der Enkel eines legendären roten Kommandeurs«, schärfte sie ihm wieder und wieder ein. »Du mußt dich deines berühmten Großvaters würdig erweisen.«
Der kleine Junge begriff nicht recht, was das bedeuten sollte – sich des Großvaters würdig erweisen. Der finstere, breitgesichtige Mann mit dem hellen Schnurrbart, der Lederjacke und dem Gewehrriemen blickte ihn von zahllosen großen und kleinen Porträts in der ganzen Wohnung an. Einen anderen Wandschmuck gab es im Haus nicht – keine Bilder, keine Kalender, nur Porträts des legendären Großvaters. Auf dem Schreibtisch der Mutter standen außerdem noch kleinere Bronzebüsten der beiden großen Führer – Lenin und Stalin. Wenn er den Staub von den kalten kleinen Gesichtern wischte und die bronzenen Augen und Schnurrbärte mit Zahnpulver scheuerte, gab Wenja Wolkow sich immer große Mühe. Seit seinem siebten Lebensjahr war es seine Pflicht, das Zimmer sauberzuhalten, und die Mutter kontrollierte seine Arbeit sehr gewissenhaft.
Als sie eines Tages unter dem Auge von Stalin einen weißen Fleck entdeckte – die Reste des Zahnpulvers –, gab sie ihrem Sohn eine Ohrfeige. Damals war er zehn Jahre alt.
Er wunderte sich nicht über die Bestrafung und hielt sie für verdient. Aber zum erstenmal erschreckte ihn das vollkommen ruhige, gleichgültige Gesicht seiner Mutter. Während sie ihn systematisch ohrfeigte, sah sie ihm starr in die Augen und wiederholte:
»Im Leben gibt es keine Zufälle. Nachlässigkeit ist Absicht. Nachlässigkeit ist immer kriminell.«
Viele seiner Mitschüler wurden von ihren Eltern geschlagen, aber gewöhnlich schlugen die Väter – wenn sie betrunken waren oder der Junge ihnen gerade zur Unzeit in die Hände geriet.
Wenja Wolkow wurde von seiner Mutter geschlagen, und zwar immer auf die Wangen und mit der Handfläche, was überhaupt nicht weh tat. Aber seine Wangen brannten danach. Der Vater, ein stiller, unauffälliger Mensch, nahm ihn nicht in Schutz. Er arbeitete als Ingenieur in einer Brotfabrik und blieb dort oft ganze Tage, manchmal auch Nächte. Der Sohn erzählte dem Vater nie etwas.
Überhaupt erzählte er nie jemandem etwas.
Die ganze väterliche Erziehung bestand darin, dem Sohn ohne Unterlaß einzuprägen:
»Alles, was sie für dich tut, ist zu deinem Nutzen. Du mußt stolz auf deine Mutter sein und ihr in allem gehorchen.«
Die Mutter war Parteisekretärin in derselben Brotfabrik. Man wählte sie regelmäßig in den Stadtsowjet, ihr Foto prangte auf dem zentralen Platz und auf der Ehrentafel »Die besten Menschen unserer Stadt«.
Er gehorchte, aber stolz war er nicht auf sie. Ein Mensch, der mindestens zweimal wöchentlich geohrfeigt wird, ist kaum noch imstande, auf etwas oder jemanden stolz zu sein.
Jetzt saß Wenjamin Wolkow, Kulturamtsleiter des Tobolsker Komsomolkomitees, ein blonder, hochgewachsener, hagerer Mann von sechsundzwanzig Jahren, in seinem kleinen, verrauchten Arbeitszimmer, starrte die Papiere auf seinem Schreibtisch an und ließ in seinem Kopf zum soundsovielten Mal eine der quälendsten Szenen seiner Kindheit abrollen.
Es war im Februar, einem eisigen sibirischen Februar mit durchdringenden, beißend kalten Winden. Wenja hatte sein Sportzeug vergessen und rannte in der großen Pause nach Hause.
Sein Vater hatte Grippe und morgens noch mit hohem Fieber und einer Kompresse auf der Stirn im Bett gelegen. Im Glauben, er schliefe, schloß Wenja leise die Tür auf und erstarrte noch auf der Schwelle.
Aus dem Zimmer der Eltern drangen seltsame Laute – das rhythmische Quietschen der Sprungfedermatratze, begleitet von leisem, unterdrücktem Stöhnen.
Wenja schlich auf Zehenspitzen näher und lugte durch die angelehnte Tür. Auf dem zerwühlten Bett der Eltern wälzten sich zwei nackte Körper. Der eine war der seines Vaters, der andere gehörte der Nachbarin Lara, einer zwanzigjährigen angehenden Bibliothekarin.
Diese Lara aus der Wohnung gegenüber, eine kleine, rundliche Brünette mit Stupsnase und lustigen Grübchen, rief in Wenja schon lange ein merkwürdiges, stechendes Gefühl hervor, das er nicht verstand.
Wenja starrte auf die beiden Körper, die rhythmisch auf und ab hüpften. Er sah ihre Gesichter, auf denen qualvolle Seligkeit geschrieben stand, ihre geschlossenen Augen und die leicht verzerrten Münder.
Das war es also, wovon alle schmutzigen Wörter, alle geheimnisvollen, verbotenen Gespräche auf der Schultoilette, alle anatomischen Zeichnungen auf Zäunen und Wänden handelten. Deswegen malte sich die rundliche Nachbarin die Lippen flammendrot und duftete nach süßem Parfum, und genau wie sie machten es Millionen Frauen auf der Welt. Davon handelten Filme, Bücher, sogar Musik. Ihre Helden litten für die Liebe, intrigierten, erschossen sich, wurden verrückt. Und weswegen? Wegen dieser widerwärtigen rhythmischen Zuckungen, wegen dieser Abscheulichkeit hier?
Und Kinder werden auch dadurch geboren, nur dadurch.
Aber das Allerwiderwärtigste war die plötzliche Anspannung in seiner Leistengegend. Ein heißer, fast stechender Schmerz erfüllte ihn unterhalb des Bauches. Wenja spannte sich wie eine Saite. Einen Augenblick später spürte er in seiner Hose einen feuchten, klebrigen Fleck.
Der Ekel vor sich selbst brachte ihn zur Besinnung. Die beiden im Bett waren mit sich selbst beschäftigt und bemerkten ihn nicht. Alles dauerte nicht länger als fünf Minuten, aber Wenja kam es vor wie eine Ewigkeit.
Mit angehaltenem Atem stürzte er in sein Zimmer, zog sich rasch und geräuschlos um, faltete seine beschmutzte Hose und Unterwäsche ordentlich zusammen und schob sie unter sein Kopfkissen. Eine Viertelstunde später war er schon im Umkleideraum der Turnhalle.
Der Kulturamtsleiter des Tobolsker Komsomolkomitees hob seine hellen, durchsichtigen Augen von den Papieren auf dem Schreibtisch und sah zum Fenster hinaus. Draußen schien die Sonne. Die leuchtendgelben Blätter einer Birke berührten leicht die Fensterscheibe und zitterten kaum merklich im warmen Wind.
In Tobolsk gab es viele Bäume, die meisten Häuser waren aus Holz, die Zäune aus dicken, unbehauenen Brettern. An Holz wurde nicht gespart – ringsherum war die Taiga. Der Stadtpark war ebenfalls dicht bewaldet. Er begann am Ufer des Tobol und zog sich, immer undurchdringlicher werdend, weit hin. Tagsüber war dort keine Menschenseele, abends leuchtete nicht eine Laterne.
»Wenjamin, kommst du mit essen?« Die Instrukteurin der Nachbarabteilung, Galja Malyschewa, sah ins Zimmer – eine junge, schon sehr füllige und kurzatmige Frau.
Er zuckte wie ertappt zusammen.
»Was? Essen? Nein, ich gehe später.«
»Immer beschäftigt, immer fleißig«, sagte Galja, »paß nur auf, daß du nicht zu mager wirst, sonst nimmt dich keine mehr zum Mann.« Sie lachte vergnügt über ihren Scherz, machte die Bürotür von außen zu, und er hörte, wie sich ihre schweren Schritte auf den Plateausohlen über den Flur entfernten.
Wirklich, ich sollte essen gehen, dachte er und überlegte, wann er zuletzt gegessen hatte. Gestern abend vermutlich. Schon da hatte er das Essen kaum hinunterbekommen. Er wußte, es würde ihn in den nächsten Tagen riesige Anstrengungen kosten, sich zum Essen zu zwingen. Aber andernfalls würde er vor Hunger in Ohnmacht fallen. Und vor Schlaflosigkeit.
In der letzten Zeit waren die Anfälle immer häufiger gekommen. Früher hatte er sie einmal im Jahr, und sie dauerten nicht länger als zwei Tage. Jetzt wiederholten sie sich alle drei Monate und dauerten fast eine Woche. Er wußte, in Zukunft würde es noch schlimmer werden.
Zuerst überfiel ihn immer eine stumpfe, ausweglose Melancholie. Er versuchte, sie zu bekämpfen, dachte sich verschiedene Arbeiten und Ablenkungen aus, las Bücher, ging ins Kino. Alles war nutzlos. Die Melancholie verwandelte sich in Verzweiflung, heftiges Selbstmitleid kam in ihm auf, Mitleid mit dem kleinen, gehorsamen Jungen, den niemand liebhatte.
Früher betäubte er die Verzweiflung mit grellen Bildern aus der Vergangenheit. Er wußte – dort lag die Wurzel seiner Krankheit, in der finsteren, eisigen Kindheit. Dort fand er auch das Heilmittel.
Der fünfzehnjährige Wenja erzählte niemandem, was er zu Hause, im Bett der Eltern, erblickt hatte. Aber nach diesem stürmisch-kalten Februartag betrachtete er seine Eltern und sich selbst mit anderen Augen. Jetzt wußte er genau, daß sie alle logen.
Auch früher hatte er zu seinem Vater kein rechtes Verhältnis finden können, er war gewohnt, ihn als Anhängsel der starken, herrischen und von allen respektierten Mutter anzusehen. Aber nun lösten sich alle Rechtfertigungen der mütterlichen Härte wie Rauch auf.
Nicht ein einziges Mal hatte die Mutter Mitleid mit dem Sohn gehabt, selbst dann nicht, wenn er krank war oder sich Ellbogen und Knie aufgeschlagen hatte. »Mitleid erniedrigt den Menschen!« Nicht ein einziges Mal hatte sie ihn geküßt oder über den Kopf gestreichelt. Sie wollte, daß ihr Sohn, der Enkel des legendären roten Kommandeurs, ohne Sentimentalitäten und täppische Zärtlichkeiten aufwuchs. Aber jetzt begriff Wenja – in Wirklichkeit liebte sie ihn einfach nicht. Die Mutter gab ihm nur deshalb Ohrfeigen und ignorierte ihn wochenlang, sprach mit ihrer ruhigen, eiskalten Stimme unerträgliche Worte, weil es ihr gefiel, zu herrschen und die Schwachen und Schutzlosen zu erniedrigen und zu quälen.
Aber nun kannte er ein wichtiges Erwachsenengeheimnis, das seine Mutter betraf, und zwar nicht als Parteifunktionärin, nicht als kristallene Kommunistin, sondern als gewöhnliche, nicht besonders junge und nicht besonders attraktive Frau. Hier war sie schutzlos. Jetzt konnte er ihr jeden Augenblick weh tun. Aber er schwieg. Er bewahrte dieses schmachvolle Erwachsenengeheimnis sorgsam und ängstlich für sich. Mit einem besonderen, rachsüchtigen Vergnügen beobachtete er, wie die junge Nachbarin seine geschätzte Mutter respektvoll grüßte, wie diese parteigemäß der molligen Rivalin die kleine weiche Hand drückte, ohne zu ahnen, daß es sich um ihre Rivalin handelte, noch dazu um die glücklichere.
Das Geheimnis zerriß ihn fast, aber er wußte genau – das war eine Waffe, die man nur einmal verwenden konnte. Zu gern hätte er darüber gesprochen – wenn schon nicht zur Mutter, so doch wenigstens mit einem von den dreien, die durch dieses Geheimnis fest miteinander verbunden waren. Zu gern hätte er sich am Erschrecken der Erwachsenen geweidet.
Eines Tages hielt er es nicht mehr aus. Als er die Nachbarin auf der Treppe traf, sagte er ihr leise und deutlich ins Gesicht:
»Ich weiß alles. Ich habe meinen Vater und dich gesehen.«
»Was weißt du, Wenja?« Die Nachbarin hob ihre feinen Brauen.
»Ich habe euch im Bett gesehen, wie ihr …«
Das zarte Gesichtchen verzerrte sich etwas. Aber die Wirkung, die Wenja erwartet hatte, blieb aus.
»Ich sage alles der Mutter«, fügte er hinzu.
»Nicht doch, Wenja«, bat das Mädchen leise, »davon wird niemandem leichter.«
In ihren runden braunen Augen entdeckte er zu seinem Erstaunen Mitleid. Das war so unerwartet, daß Wenja außer Fassung geriet. Sie hatte keine Angst vor ihm – er tat ihr leid.
»Weißt du was«, schlug das Mädchen vor, »laß uns in aller Ruhe darüber reden. Ich will versuchen, dir alles zu erklären. Das ist nicht leicht, aber ich will es versuchen.«
»Gut«, sagte er, »tu das.«
»Aber nicht hier, auf der Treppe«, besann sie sich. »Wenn du willst, gehen wir ein bißchen spazieren, bis zum Park. Das Wetter ist so schön.«
Das Wetter war wirklich prächtig – ein lauer Maiabend.
»Verstehst du, Wenja«, sagte sie, während sie auf den Park zugingen, »dein Vater ist ein sehr guter Mensch. Auch deine Mutter ist gut. Aber sie ist für ihn zu stark, zu streng. Männer wollen selber stark sein, deshalb verurteile deinen Vater nicht. Im Leben kommt so vieles vor. Wenn du Angst hast, ich würde eure Familie zerstören – das ist nicht meine Absicht. Ich habe deinen Vater einfach sehr lieb.«
Wenja hörte ihr schweigend zu. Er war sich noch nicht ganz im klaren, was in seinem Inneren vor sich ging. Vom süßen Duft des Parfums wurde ihm schwindlig. Auf Laras milchweißem Hals pulsierte eine bläuliche Ader.
»Wenn du es der Mutter erzählst, wird sie es nicht verzeihen. Weder ihm noch mir. Sie ist einfach nicht fähig zu verzeihen, deshalb habt ihr beide es auch so schwer mit ihr. Aber du, Wenja, du mußt lernen zu verzeihen. Anders kann man nicht leben.«
Keine Menschenseele war in der Nähe. Lara redete so hitzig und begeistert, daß sie nicht aufpaßte, wohin sie trat. Sie stolperte über eine dicke Baumwurzel und fiel der Länge nach ins Gras. Ihr karierter Wollrock schob sich nach oben, entblößte die Ränder der Perlonstrümpfe, die rosa Gummibänder des Strumpfgürtels und die zarte milchweiße Haut.
Ohne ihr Zeit zum Aufstehen zu lassen, stürzte Wenja sich mit der ganzen Kraft seines gierigen fünfzehnjährigen Fleisches auf sie. Er tat mit ihr, wovon die Klassenkameraden so derb und in allen Einzelheiten erzählten und was er selber zu Hause gesehen hatte, im Bett der Eltern.
Lara wollte schreien, aber er hielt ihr mit der flachen Hand Mund und Nase zu. Sie trat um sich, wand sich unter ihm, aber er schaffte es, sie auf den Rücken zu drehen und ihr mit dem Knie die Oberschenkel, die sie krampfhaft zusammengepreßt hielt, auseinanderzudrücken.
Er wunderte sich selber, wie leicht und rasch alles vor sich ging. Nachdem er aufgestanden war und sich die Hose zugeknöpft hatte, warf er einen Blick auf den im Gras ausgestreckten, wie zertrampelt wirkenden Körper. Einen Sekundenbruchteil schoß ihm der ängstliche Gedanke durch den Kopf: Sie ist doch nicht etwa tot? Aber im selben Augenblick hörte er ein schwaches, klägliches Stöhnen.
»Du darfst das niemandem erzählen«, sagte Wenja ruhig, »niemandem wird davon leichter. Du mußt lernen zu verzeihen, Lara. Anders kann man nicht leben.«
Er wandte sich um und ging schnell nach Hause.
Bevor er zu Bett ging, wusch er alle Kleidungsstücke, die er getragen hatte, aus – die Hose, das karierte Flanellhemd, die Unterwäsche. Ihm schien, als seien die Sachen vom Duft des billigen süßen Parfums durchtränkt.
Einige Tage später hörte er, Lara habe die Bibliothekarsausbildung aufgegeben und sich für eine Arbeit im Neulandgebiet beworben.
Kapitel 3
Moskau, März 1996
Der beigefarbene Lada von Milizoberst Sergej Krotow stand schon vierzig Minuten im Stau auf dem Gartenring. Der feuchte Schnee, der seit dem frühen Abend fiel, hatte sich zur Nacht in einen richtigen Schneesturm verwandelt. Um diese Stunde waren zwar nicht mehr viele Autos unterwegs, aber offenbar hatte es einen Unfall gegeben. Die Wärme im Wageninneren und das rhythmische Hin und Her der Scheibenwischer wirkten einlullend. Sergej fielen die Augen zu. In der letzten Zeit hatte er kaum geschlafen. In zwei Tagen sollte er eine Dienstreise nach England antreten. Scotland Yard hatte eine Gruppe von Mitarbeitern des Innenministeriums zu einem dreiwöchigen Erfahrungsaustausch eingeladen. Bis zur Abreise hatte er noch einen solchen Berg von Dingen zu erledigen, daß ihm der Kopf schwirrte.
Vorgestern morgen hatte er der Staatsanwaltschaft die Untersuchungsergebnisse zur Schießerei im Restaurant »Der Recke« übergeben. Eine Abrechnung unter Banditen, eigentlich nichts Besonderes – aber unter den sieben Getöteten waren zwei Mitarbeiter des Innenministeriums. Daher war die Sache sofort an die innere Abwehr übergeben worden, und zwar direkt an Sergejs Abteilung.
Vor zehn Tagen hatte im »Recken« ein üppiges Festbankett stattgefunden. Der berühmte Mafioso Pawel Anatoljewitsch Drosdow, genannt Drossel, feierte seinen fünfundvierzigsten Geburtstag. Die Gäste hatten gerade die kalten Vorspeisen gegessen und drei Trinksprüche auf das Wohl des teuren Geburtstagskindes ausgebracht, als schwerbewaffnete jugendliche Rambos den Bankettsaal stürmten, vorbei an der professionell ausgerüsteten und bestens postierten Leibwache. Nicht alle Gäste des Jubilars konnten rechtzeitig ihre eigenen Kanonen ziehen, fünf wurden auf der Stelle niedergemäht. Als erster wurde Drossel selbst getötet, und gleich nach ihm die beiden Mitarbeiter des Innenministeriums.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!