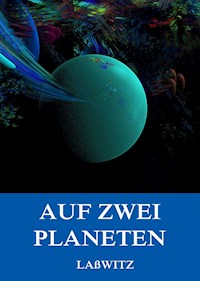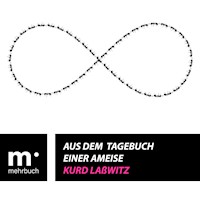Kurd Laßwitz
Bis zum
absoluten Nullpunkt
des Seins
Geschichten aus der vergangenen Zukunft
Mit einem literaturhistorischen Nachwort
edition future past
Impressum
Copyright © 2024
krautpublishing
Dr. Ansgar Warner
Rungestr. 20 (V)
10179 Berlin
Veröffentlicht über Tolino Media
Herausgegeben &
mit Nachwort versehen
von Ansgar Warner
Neuausgabe, basierend auf:
Bilder aus der Zukunft (1874)
Seifenblasen (1894)
Die Welt u. d. Mathematikus (1924)
Coverbild:
Mickey (cc-by-2.0)
Seifenblasen
“Onkel Wendel, Onkel Wendel! Sieh' nur die große Seifenblase, die wunderschönen Farben! Woher nur die Farben kommen?”
So rief mein Söhnchen vom Fenster herab in den Garten, wohin es seine bunten Schaumbälle flattern ließ.
Onkel Wendel saß neben mir im Schatten der hohen Bäume, und unsere Zigarren verbesserten die reine, würzige Luft eines schönen Sommernachmittags.
«Hm!» sagte oder vielmehr brummte Onkel Wendel zu mir gewendet, «Hm, erklär's ihm doch! Hm! Bin neugierig, wie du's machen willst. Interferenzfarben an dünnen Blättchen, nicht wahr? Kenn' ich schon. Verschiedene Wellenlänge, Streifen decken sich nicht, und so weiter. Wird der Junge verstehen — hm?»
«Ja», erwiderte ich etwas verlegen, «die physikalische Erklärung kann das Kind freilich nicht verstehen — aber das ist auch gar nicht nötig. Erklärung ist ja etwas Relatives und muss sich nach dem Standpunkte des Fragenden richten; es heißt nur, die neue Tatsache in einen gewohnten Gedankengang einreihen, mit gewohnten Vorstellungen verknüpfen — und da die Formeln der mathematischen Physik noch nicht zum gewohnten Gedankengang meines Sprösslings gehören —”
«Nicht übel, hm!» nickte Onkel Wendel. «Hast es so ziemlich getroffen, kannst es nicht erklären, nicht mit gewohnten Vorstellungen verbinden — gibt gar keinen Anknüpfungspunkt. Das ist es eben! Erfahrung des Kindes — ganz andere Welt — gibt Dinge, für die alle Verbindung fehlt, ist überall so! Der 'Wissende' muss schweigen, der Lehrer muss lügen. Oder er kommt ans Kreuz, auf den Scheiterhaufen, in die Witzblätter — je nach der Mode. Mikrogen! Mikrogen!”
Die beiden letzten Worte murmelte der Onkel nur für sich. Ich hätte sie nicht verstanden, wenn ich nicht den Namen “Mikrogen” schon öfter von ihm gehört hätte. Es war seine neueste Erfindung.
Onkel Wendel hatte schon viele Erfindungen gemacht. Er machte eigentlich nichts als Erfindungen. Seine Wohnung war ein vollständiges Laboratorium, halb Alchymistenwerkstatt, halb modernes physikalisches Kabinett. Es war eine besondere Gunst, wenn er jemand gestattete einzutreten. Denn er hielt alle seine Entdeckungen geheim. Nur manchmal, wenn wir vertraulich beisammen saßen, lüftete er einen Zipfel des Schleiers, der über seinen Geheimnissen lag. Dann staunte ich über die Fülle seiner Kenntnisse, noch mehr über seine tiefe Einsicht in die wissenschaftlichen Methoden und ihre Tragweite, in die ganze Entwicklung des kulturellen Fortschritts. Aber er war nicht zu bewegen, mit seinen Ansichten hervorzutreten, und darum auch nicht mit seinen Entdeckungen, weil diese, wie er sagte, ohne seine neuen Theorien nicht zu verstehen seien. Ich habe selbst bei ihm gesehen, wie er aus anorganischen Stoffen auf künstlichem Wege das Eiweiß darstellte. Wenn ich in ihn drang, diese epochemachende Entdeckung, welche geeignet wäre, unsere sozialen Verhältnisse gänzlich umzugestalten, bekannt zu machen oder wenigstens zu fruktifizieren, so pflegte er zu sagen: «Habe nicht Lust, mich auslachen zu lassen, könnens doch nicht verstehn. Sind noch nicht reif, kein Anknüpfungspunkt, andere Welt, andere Welt! Tausend Jahre warten! Lasse die Leute streiten, einer weiß so wenig wie der andere.”
Jetzt hatte er das “Mikrogen” entdeckt. Ich weiß nicht recht, war es ein Stoff oder ein Apparat; aber so viel habe ich begriffen, dass er dadurch imstande war, eine Verkleinerung sowohl der räumlichen als der zeitlichen Verhältnisse in beliebigem Maßstabe zu erzielen. Eine Verkleinerung nicht etwa bloß für das Auge, wie sie durch optische Instrumente möglich ist, sondern für alle Sinne; die ganze Bewusstseinstätigkeit wurde verändert, so dass zwar qualitativ alle Empfindungsarten dieselben blieben, aber alle quantitativen Beziehungen verengt wurden. Er behauptete, er könne ein beliebiges Individuum und mit ihm dessen Anschauungswelt einschrumpfen lassen auf den millionsten, auf den billionsten Teil seiner Größe. Wie er das mache? Ja, dann lachte er wieder still für sich und brummte:
«Hm, nicht verstehen können — kann's euch nicht erklären — nützt euch doch nichts. Menschen bleiben Menschen, ob groß oder klein, sehen nicht über sich hinaus. Wozu erst streiten?»
«Wie kommst du jetzt auf das Mikrogen?» fragte ich ihn.
«Sehr einfach, lieber Neffe. Das Mikrogen ist für die heutige gelehrte Welt, was die Seifenblase für deinen Jungen ist. Vielleicht ein Spielzeug, jedoch zum Verständnis fehlt jeder Anhaltspunkt. Weil aber die Gelehrten keine Kinder sind und alles zu verstehen beanspruchen, würde es einen unendlichen Streit geben, wenn ich meine Lehre auskramen wollte. Gänzlich zwecklos, weit die Entscheidung über alle heutige Einsicht hinaus liegt. Würden mich auslachen — hm— Irrenhaus —»
«Ganz gleich,» rief ich, «die Wahrheit zu verkünden ist Pflicht, und wenn ich auch das Martyrium der Verkennung auf mich nehmen müsste. Nur auf diesem Wege sind die Fortschritte der Kultur errungen worden. Bringe deine Beweise.»
«Hm», sagte der Onkel, «wenn aber die Beweise niemand verstehen kann? Wenn wir zwei verschiedene Sprachen reden? Dann endet der Streit damit, dass die Minorität totgeschlagen wird, physisch oder moralisch. Habe keine Lust dazu.»
«Und trotzdem,» erwiderte ich stolz, «würde ich die Wahrheit bekennen, wenn ich die Beweise für mich in der Hand habe.»
«Vor Unmündigen und Blinden — wie? Möchtest du's probieren? Ja? Sieh dir mal das Ding an.”
Onkel Wendel zog einen kleinen Apparat aus der Tasche. Ich erkannte einige Glasröhrchen in Metallfassung, mit Schrauben und feiner Skala. Er hielt mir die Röhrchen unter die Nase und begann zu drehen, ich fühlte, dass ich etwas Ungewohntes einatmete.
«Ah, wie schön die da ist!» rief mein Knabe wieder, auf eine neue Seifenblase deutend, die langsam von der Fensterbrüstung herabschwebte.
«Nun sieh' dir mal die Seifenblase an,» sagte Onkel Wendel und drehte weiter.
Mir schien es, als ob sich die Seifenblase sichtlich vergrößerte. Ich kam ihr näher und näher. Das Fenster mit dem Knaben, der Tisch, vor dem wir saßen, die Bäume des Gartens entfernten sich, wurden immer undeutlicher. Nur Onkel Wendel blieb neben mir; sein Röhrchen hatte er in die Tasche gesteckt. Jetzt war unsere bisherige Umgebung verschwunden. Wie eine mattweiße, riesige Glocke dehnte sich der Himmel über uns, bis er sich am Horizont verlor. Wir standen aus der spiegelnden Fläche eines weiten, gefrorenen Sees. Das Eis war glatt und ohne Spalten; dennoch schien es in einer leise wallenden Bewegung zu sein. Undeutliche Gestalten erhoben sich hie und da über die Fläche.
«Was geht hier vor!» rief ich erschrocken. «Wo sind wir? Trägt uns auch das Eis?»
«Auf der Seifenblase sind wir,» sagte Onkel Wendel kaltblütig. «Was du für Eis hältst, ist die Oberfläche des zähen Wasserhäutchens, welches die Blase bildet. Weißt du, wie dick diese Schicht ist, auf der wir stehen? Nach menschlichem Maße gleich dem fünftausendsten Teile eines Zentimeters; fünfhundert solcher Schichten übereinandergelegt wurden erst einen Millimeter betragen.»
Unwillkürlich zog ich einen Fuß in die Höhe, als konnte ich mich dadurch leichter machen.
«Um Himmelswillen, Onkel,» rief ich, «treibe kein leichtsinniges Spiel! Sprichst du die Wahrheit?»
«Ganz gewiss. Aber fürchte nichts. Für deine jetzige Größe entspricht dieses Häutchen an Festigkeit einem Stahlpanzer von 200 Meter Dicke. Wir haben uns nämlich mit Hilfe des Mikrogens in allen unseren Verhältnissen im Maßstabe von Eins zu hundert Millionen verkleinert. Das macht, dass die Seifenblase, welche nach menschlichen Maßen einen Umfang von vierzig Millimetern besitzt, jetzt für uns gerade so groß ist, wie der Erdball für den Menschen.»
«Und wie groß sind wir selbst?» fragte ich zweifelnd. «Unsere Höhe beträgt den sechzigtausendsten Teil eines Millimeters. Auch mit dem schärfsten Mikroskop würde man uns nicht mehr entdecken.»
«Aber warum sehen wir nicht das Haus, den Garten, die Meinigen — die Erde überhaupt?»
«Sie sind unter unserm Horizont. Aber auch wenn die Erde für uns aufgehen wird, so wirst du doch nichts von ihr erkennen, als einen matten Schein, denn alle optischen Verhältnisse sind infolge unserer Kleinheit so verändert, dass wir zwar in unserer jetzigen Umgebung völlig klar sehen, aber von unserer früheren Welt, deren physikalische Grundlagen hundertmillionenmal größer sind, gänzlich geschieden leben. Du musst dich mit dem begnügen, was es auf der Seifenblase zu sehen gibt, und das ist genug.»
«Und ich wundere mich nur», fiel ich ein, «dass wir hier überhaupt etwas sehen, dass unsere Sinne unter den veränderten Verhältnissen ebenso wirken wie früher. Wir sind ja jetzt kleiner als die Länge einer Lichtwelle; die Moleküle und Atome müssen uns jetzt ganz anders beeinflussen.»
«Hm!» lachte Onkel Wendel in seiner Art. «Was sind denn Ätherwellen und Atome? Ausgeklügelte Maßstäbe sind's, berechnet von Menschen für Menschen. Jetzt machen wir uns klein, und alle Maßstäbe werden mit uns klein. Aber was hat das mit der Empfindung zu tun? Die Empfindung ist das Erste, das Gegebene; Licht, Schall und Druck bleiben unverändert für uns, denn sie sind Qualitäten. Aber die Quantitäten ändern sich, und wenn wir jetzt physikalische Messungen anstellen wollten, so würden wir die Ätherwellen auch hundertmillionenmal kleiner finden.»
Wir waren inzwischen auf der Seifenblase weitergewandert und an eine Stelle gekommen, wo durchsichtige Strahlen springbrunnenähnlich rings um uns in die Höhe schossen, als mich ein Gedanke durchzuckte, der mir vor Entsetzen das Blut in den Adern stocken ließ: Wenn die Seifenblase jetzt platzte! Wenn ich auf eines der entstehenden Wasserstäubchen gerissen wurde und Onkel Wendel mit seinem Mikrogen auf ein anderes! Wer sollte mich jemals wieder finden? Und was sollte aus mir werden, wenn ich in meiner Kleinheit von ein Sechzigtausendstel Millimeter mein Leben lang bleiben musste? Was war ich unter den Menschen? Gulliver in Brobdignak lässt sich gar nicht damit vergleichen, denn mich konnte überhaupt niemand sehen! Meine Frau, meine armen Kinder! Vielleicht sogen sie mich mit dem nächsten Atemzuge in ihre Lunge, und während sie meinen unerklärlichen Verlust beweinten, vegetierte ich als unsichtbare Bakterie in ihrem Blute!
«Schnell, Onkel, nur schnell!» rief ich. «Gib uns unsere Menschengröße wieder! Die Seifenblase muss ja sofort platzen! Ein Wunder, dass sie noch hält! Wie lange sind wir denn schon hier?»
«Keine Sorge,» sagte Onkel Wendel ungerührt, «die Blase dauert noch länger, als wir hier bleiben. Unser Zeitmaß hat sich zugleich mit uns verkleinert, und was du hier für eine Minute hältst, das ist nach irdischer Zeit erst der hundertmillionste Teil davon. Wenn die Seifenblase nur zehn Erdsekunden lang in der Luft fliegt, so macht dies für unsere jetzige Konstitution ein ganzes Menschenalter aus. Die Bewohner der Seifenblase freilich leben wieder noch hunderttausendmal schneller als gegenwärtig wir.»
«Wie, du willst doch nicht behaupten, dass die Seifenblase auch Bewohner habe?»
«Natürlich hat sie Bewohner, und zwar recht kultivierte. Nur verläuft ihre Zeit ungefähr zehnbillonenmal so schnell wie die menschliche, d. h. sie empfinden, sie leben zehnbillionenmal so rapid. Das bedeutet, drei Erdsekunden sind so viel wie eine Million Jahre aus der Seifenblase, wenn auch deren Bewohner den Begriff des Jahres in unserem Sinne nicht ausgebildet haben, weil ihre Seifenkugel keine regelmäßige und genügend schnelle Rotation besitzt. Wenn du nun bedenkst, dass diese Seifenblase, auf der wir uns befinden, vor mindestens sechs Sekunden entstand, so musst du zugeben, dass in diesen zwei Millionen Jahren sich schon ein ganz hübsches Leben und eine angemessene Zivilisation hierselbst entwickeln konnte. Wenigstens entspricht dies meinen Erfahrungen aus anderen Seifenblasen, welche alle in ihren Produkten die Familienähnlichkeit mit der Mutter Erde nicht verleugneten.»
«Aber wo sind diese Bewohner? Ich sehe hier wohl Gegenstände, die ich für Pflanzen halten möchte, und diese halbkugelförmigen Kuppeln könnten eine Stadt vorstellen. Doch etwas Menschenähnliches kann ich nicht entdecken.»
«Sehr natürlich. Unsere Empfindungsfähigkeit, wenn sie auch hundertmillionenmal so groß geworden ist, als die der Menschen, ist doch nach hunderttausendmal langsamer als die der Saponier (so wollen wir die Bewohner der Seifenblase nennen). Während wir jetzt eine Sekunde vergangen glauben, erleben sie 28 Stunden. In diesem Verhältnisse ist hier alles Leben beschleunigt. Betrachte nur diese Gewächse».
«Es ist richtig», sagte ich, «ich sehe deutlich, wie hier die Bäume — denn diese korallenartigen Bildungen sollen ja wohl Bäume sein — vor unseren Augen wachsen, blühen und Früchte zeitigen. Und dort scheint ein Haus gewissermaßen ans dem Boden zu wachsen.»
«Die Saponier bauen daran. In dieser Minute, während welcher nur zuschauen, beobachten wir den Erfolg von mehr als zweimonatlicher Arbeit. Die Arbeiter selbst sehen wir nicht, weit ihre Bewegungen viel zu schnell für unsere Wahrnehmungsfähigkeit verlaufen. Doch wir wollen uns bald helfen. Mittels des Mikrogens will ich unseren Zeitsinn aus das Hunderttausendfache verfeinern. Hier, rieche noch einmal. Unsere Größe bleibt dieselbe, ich habe nur die Zeitskala verstellt.»
Onkel Wendel brachte aufs neue sein Röhrchen hervor. Ich roch, und sofort fand ich mich in einer Stadt, umgeben von zahlreichen, rege beschäftigten Gestalten, die eine entschiedene Menschenähnlichkeit besaßen. Nur schienen sie mir alle etwas durchsichtig, was wohl von ihrem Ursprünge ans Glycerin und Seife herrühren mochte. Auch vernahmen wir ihre Stimmen, ohne dass ich jedoch ihre Sprache verstehen konnte. Die Pflanzen hatten ihre schnelle Veränderlichkeit verloren, wir waren jetzt in gleichen Wahrnehmungsverhältnissen zu ihnen wie die Saponier, oder wie wir Menschen zu den Organismen der Erde. Was uns vorher als Springbrunnenstrahlen erschienen war, erwies sich als die Blütenstengel einer schnell wachsenden hohen Grasart.
Auch die Bewohner der Seifenblase nahmen uns jetzt wahr und umringten uns unter vielen Fragen, welche offenbar Wissbegierde verrieten.
Die Verständigung fiel sehr schwer, weil ihre Gliedmaßen, welche eine gewisse Ähnlichkeit mit den Armen von Polypen besaßen, so seltsame Bewegungen ausführten, dass selbst die Gebärdensprache versagte. Indessen nahmen sie uns durchaus freundlich auf; sie hielten uns, wie wir später erfuhren, für Bewohner eines anderen Teiles ihres Globus, den sie noch nicht besucht hatten. Die Nahrung, welche sie uns anboten, hatte einen stark alkalischen Beigeschmack und mundete uns nicht besonders, mit der Zeit gewöhnten wir uns jedoch daran, nur empfanden wir es sehr unangenehm, dass es keine eigentlichen Getränke, sondern immer nur breiartige Suppen gab. Es war überhaupt auf diesem Weltkörper alles auf den zähen oder gallertartigen Aggregatzustand eingerichtet, und es war bewundernswert zu sehen, wie auch unter diesen veränderten Verhältnissen die Natur oder vielmehr die weltschöpferische Kraft des Lebens durch Anpassung die zweckvollsten Einrichtungen geschaffen hatte. Die Saponier waren wirklich intelligente Wesen. Speise, Atmung, Bewegung und Ruhe, die unentbehrlichen Bedürfnisse aller lebenden Geschöpfe, gaben uns die ersten Anhaltspunkte, Einzelnes aus ihrer Sprache zu verstehen und uns anzueignen.
Da man bereitwillig für unsere Bedürfnisse sorgte und Onkel Wendel versicherte, dass unsere Abwesenheit von zu Hause einen für irdische Verhältnisse verschwindenden Zeitraum nicht übersteigen könne, so ergriff ich mit Freuden die Gelegenheit, diese neue Welt näher kennen zu lernen. Ein Wechsel von Tag und Nacht fand zwar nicht statt, aber es folgten regelmäßige Ruhepausen auf die Arbeit, welche ungefähr unserer Tageseinteilung entsprachen. Wir beschäftigten uns eifrig mit der Erlernung der saponischen Sprache und versäumten nicht, die physikalischen Verhältnisse der Seifenblase, sowie die sozialen Einrichtungen der Saponier genau zu studieren. Zu letzterem Zwecke reisten wir nach der Hauptstadt, wo wir dem Oberhaupte des Staates, welches den Titel “Herr der Denkenden” führt, vorgestellt wurden. Die Saponier nennen sich nämlich selbst die “Denkenden”, und das mit Recht, denn die Pflege der Wissenschaften steht bei ihnen in hohem Ansehen, und an den Streitigkeiten der Gelehrten nimmt die ganze Nation den regsten Anteil. Wir sollten darüber eine Erfahrung machen, die uns bald übel bekommen wäre.
Über die Resultate unserer Beobachtungen hatte ich sorgfältig Buch geführt und reiches Material angehäuft, welches ich nach meiner Rückkehr auf die Erde zu einer Kulturgeschichte der Seifenblase zu bearbeiten gedachte. Leider hatte ich einen Umstand außer acht gelassen. Bei unserer sehr plötzlich notwendig werdenden Wiedervergrößerung trug ich meine Aufzeichnungen nicht bei mir, und so geschah das Unglück, dass sie von den Wirkungen des Mikrogens ausgeschlossen wurden. Natürlich sind meine unersetzlichen Manuskripte nicht mehr zu finden; sie fliegen als unentdeckbares Stäubchen irgendwo umher und mit ihnen die Beweise meines Aufenthaltes auf der Seifenblase.
Wir mochten ungefähr zwei Jahre unter den Saponiern gelebt haben, als die Spannung zwischen den unter ihnen hauptsächlich vertretenen Lehrmeinungen einen besonders hohen Grad erreichte. Die Überlieferung der älteren Schule über die Beschaffenheit der Welt war nämlich durch einen höchst bedeutenden Naturforscher, Namens Glagli, energisch angegriffen worden, welchem die jüngere progressistische Richtung lebhaft beifiel. Man hatte daher, wie dies in solchen Fällen üblich ist, Glagli vor den Richterstuhl der “Akademie der Denkenden” gefordert, um zu entscheiden, ob seine Ideen und Entdeckungen im Interesse des Staates und der Ordnung zu dulden seien. Die Gegner Glaglis stützten sich besonders darauf, dass die neuen Lehren den alten und unumstößlichen Grundgesetzen der “Denkenden” widersprächen. Sie verlangten daher, dass Glagli entweder seine Lehre widerrufen oder der auf die Irrlehre gesetzten Strafe verfallen solle. Namentlich fanden sie folgende drei Punkte ans der Lehre Glaglis für irrtümlich und verderblich:
Erstens: Die Welt ist inwendig hohl, mit Luft gefüllt, und ihre Rinde ist nur dreihundert Ellen dick. Dagegen wendeten sie ein: Wäre der Boden, auf welchem sich die “Denkenden” bewegen, hohl, so würde er schon längst gebrochen sein. Es stehe aber in dem Buche des alten Weltweisen Emso (das ist der saponische Aristoteles): “Die Welt muss voll sein und wird nicht platzen in Ewigkeit”.
Zweitens hatte Glagli behauptet: Die Wett besteht nur aus zwei Grundelementen, Fett und Alkali, welche die einzigen Stoffe überhaupt sind und seit Ewigkeit existieren; aus ihnen habe sich die Welt auf mechanischem Wege entwickelt, auch könne es niemals etwas anderes geben, als was aus Fett und Alkali zusammengesetzt sei; die Luft sei eine Ausschwitzung dieser Elemente. Hiergegen erklärte man, nicht bloß Fett und Alkali, sondern auch Glycerin und Wasser seien Elemente; dieselben könnten unmöglich von selbst in Kugelgestalt gekommen sein; namentlich aber stehe in der ältesten Urkunde der Denkenden: “Die Welt ist geblasen durch den Mund eines Riesen, welcher heißt Rudipudi.”
Drittens lehrte Glagli: Die Welt sei nicht die einzige Welt, sondern es gäbe noch unendlich viele Welten, welche alle Hohlkugeln aus Fett und Alkali seien und frei in der Luft schwebten. Auf ihnen wohnten ebenfalls denkende Wesen. Diese These wurde nicht bloß als irrtümlich, sondern als staatsgefährlich bezeichnet, indem man sagte: Gäbe es noch andere Welten, welche wir nicht kennen, so würde sie der “Herr der Denkenden” nicht beherrschen. Es steht aber im Staatsgrundgesetze: “Wenn da Einer sagt, es gäbe etwas, das dem Herrn der Denkenden nicht gehorcht, den soll man in Glycerin sieden, bis er weich wird.”
In der Versammlung erhob sich Glagli zur Verteidigung; er machte besonders geltend, dass die Lehre, die Welt sei voll, derjenigen widerspräche, dass sie geblasen sei, und er fragte, wo denn der Niese Rudipudi gestanden haben solle, wenn es keine anderen Welten gäbe. Die Akademiker der alten Schule hatten trotz ihrer Gelehrsamkeit einen harten Stand gegen diese Gründe, und Glagli hätte seine beiden ersten Thesen durchgesetzt, wenn nicht die dritte ihn verdächtig gemacht hätte. Aber die politische Anrüchigkeit derselben war zu offenbar, und selbst Glaglis Freunde wagten nicht, für ihn in dieser Hinsicht einzutreten, weil die Behauptung, dass es noch andere Welten gäbe, als eine reichsfeindliche und antinationale betrachtet wurde. Da nun Glagli durchaus nicht widerrufen wollte, so neigte sich die Majorität der Akademie gegen ihn, und schon schleppten seine eifrigsten Gegner Kessel mit Glycerin herbei, um ihn zu sieden, bis er weich sei.
Als ich all das grundlose Gerede für und wider anhören musste und doch sicher war, dass ich mich auf einer Seifenblase befand, die mein Söhnchen vor etwa sechs Sekunden ans dem Gartenfenster meiner Wohnung mittelst eines Strohhalmes geblasen hatte, und als ich sah, dass es in diesem Streite doppelt falscher Meinungen einem ehrlich nachdenkenden Wesen ans Leben gehen sollte — denn das Weichsieden ist für einen Saponier immerhin lebensgefährlich — so konnte ich mich nicht länger zurückhalten, sondern sprang auf und bat um's Wort.
«Begehe keinen Unsinn,» flüsterte Onkel Wendel, sich an mich drängend. «Redest dich ins Unglück! Verstehen's ja doch nicht! Wirst ja sehen! Sei still!»
Aber ich ließ mich mich stören, sondern begann: «Meine Herren Denkenden! Gestatten Sie mir einige Bemerkungen, da ich tatsächlich in der Lage bin, über Ursprung und Beschaffenheit Ihrer Welt Auskunft zu geben.»
Hier entstand ein allgemeines Murren: «Was? Wie? Ihrer Welt? Haben Sie vielleicht eine andere? Hört! Hört! Der Wilde, der Barbar! Er weiß, wie die Wett entstanden ist.»
«Wie die Welt entstanden ist,» fuhr ich mit erhabener Stimme fort, «kann niemand wissen, weder Sie noch ich. Denn die “Denkenden” sind so gut wie wir beide nur ein winziges Fünkchen des unendlichen Geistes, der sich in unendlichen Gestalten verkörpert. Aber wie das verschwindende Stückchen Welt, auf dem wir stehen, entstanden ist, das kann ich Ihnen sagen. Ihre Welt ist in der Tat hohl und mit Luft gefüllt, und ihre Schale ist nicht dicker, als Herr Glagli angibt. Sie wird allerdings einmal platzen, aber darüber können noch Millionen Ihrer Jahre vergehen. (Lautes Bravo der Glaglianer.) Es ist auch richtig, dass es noch viele bewohnte Welten gibt, nur sind es nicht lauter Hohlkugeln, sondern viel millionenmal größere Steinmassen, bewohnt von Wesen wie ich. Und Fett und Alkali sind weder die einzigen, nach sind sie überhaupt Elemente, sondern es sind komplizierte Stoffe, die nur zufällig für diese Ihre kleine Seifenblasenwelt eine Rolle spielen.»
«Seifenblasenwelt?» Ein Sturm des Unwillens erhob sich von allen Seiten.
«Ja,» rief ich mutig, ohne auf Onkel Wendels Zerren und Zupfen zu achten, «ja, Ihre Welt ist weiter nichts als eine Seifenblase, die der Mund meines kleinen Söhnchens mittelst eines Strohhalms geblasen hat und die der Finger eines Kindes im nächsten Augenblicke zerdrücken kann. Freilich ist, gegen diese Welt gehalten, mein Kind ein Riese —»
«Unerhört! Blasphemie! Wahnsinn!» schallte es durcheinander, und Tintenfässer flogen um meinen Kopf. «Er ist verrückt! Die Welt soll eine Seifenblase sein? Sein Sohn soll sie geblasen haben! Er gibt sich als Vater des Weltschöpfers aus! Steinigt ihn! Siedet ihn!»
«Der Wahrheit die Ehre!» schrie ich. «Beide Parteien haben Unrecht. Die Welt hat mein Sohn nicht geschaffen, er hat nur diese Kugel geblasen, innerhalb der Welt, nach den Gesetzen, die uns allen übergeordnet sind. Er weiß nichts von Euch, und Ihr könnt nichts wissen von unserer Welt. Ich bin ein Mensch, ich bin hundertmillionenmal so groß und zehnbillionenmal so alt als Ihr! Lasst Glagli los! Was streitet Ihr um Dinge, die Ihr nicht entscheiden könnt?»
«Nieder mit Glagli! Nieder mit dem “Menschen”! Wir werden ja sehen, ob Du die Welt mit dem kleinen Finger zerdrücken kannst! Ruf' doch Dein Söhnchen!» So raste es um mich her, während man Glagli und mich nach dem Bottich mit siedendem Glycerin hinzerrte.
Sengende Glut strömte mir entgegen. Vergebens setzte ich mich zur Wehr. «Hinein mit ihm!» schrie die Menge. «Wir werden ja sehen, wer zuerst platzt!»
Heiße Dämpfe umhüllten, ein brennender Schmerz durchzuckte mich und —
Ich saß neben Onkel Wendel am Gartentische. Die Seifenblase schwebte noch an derselben Stelle.
«Was war das?» fragte ich erstaunt und erschüttert.
«Eine hunderttausendstel Sekunde! Auf der Erde hat sich noch nichts verändert. Hab' noch rechtzeitig meine Skala verschoben, hätten Dich sonst in Glycerin gesotten. Hm? Soll ich noch die Entdeckung des Mikrogens veröffentlichen? Wie? Meinst jetzt, dass sie Dir's glauben werden? Erklär's ihnen doch!»
Onkel Wendel lachte, und die Seifenblase zerplatzte. Mein Söhnchen blies eine neue.
Apoikis
Motto: „Im Schoße der Götter“
Tristan da Cunha, 28. Dezember 1881
Verehrter Freund!
Fernab vom Wege des Weltverkehrs, im südlichen Teil des Atlantischen Ozeans schreibe ich Ihnen heute auf einsamer Berginsel, wo ich der siebenundachtzigste Bewohner bin, und der achtundachtzigste wohl sobald nicht ankommen wird, und ich täte vielleicht besser, hier zu bleiben und ein beschauliches Einsiedlerleben zu führen, als aus der Gemeinschaft seliger Götter, die ich vor wenigen Tagen verlassen, wieder in das Barbarentum Europas zurückzukehren, das meine Berichte verlachen wird. Ach, hätten Sie einmal den Fuß in das Seelenschiff gesetzt, einmal vom ambrosischen Tisch gegessen und, wie ich, wenigstens einen Blick in das intelligible Paradies geworfen! Sie würden gleich mir zwischen stolzer Wonne und unstillbarer Sehnsucht nach dem Unerreichbaren schwanken. Doch Ihnen mit Ihrem zeitlichen Bewusstsein muss man ja in historischer Ordnung erzählen, wenn Sie hören sollen.
Der Einladung Lord Lyttons folgend, hatte ich, wie Sie wissen, die Archäologie für einige Monate beurlaubt und mich ganz der Reiselaune unseres generösen Freundes anvertraut. Wir schwammen auf seiner Dampf-Jacht Moonshine unter der Obhut des wackeren Kapitäns Clynch bei prächtigem Wetter in dem einsamen, selten besuchten südlichen Teile des Atlantik. Am 11. Dezember 1881, mittags um 12 Uhr, als wir unter 28 Grad 34 Minuten westlicher Länge (von Greenwich) und 39 Grad 56 Minuten südlicher Breite uns gerade zum Frühstück setzen wollten, wurde uns die Nähe von Eisbergen gemeldet. Bald tauchten nicht nur einzelne helle Massen, sondern eine meilenlange, hohe, weißglänzende Mauer vor unseren Blicken auf — das seltsame Phänomen musste untersucht werden. Während sich der Moonshine in sicherer Entfernung hielt, ruderten vier kräftige Matrosen den Arzt des Schiffes, Mr. Gilwald, und mich nach den glitzernden Kolossen hin. Je näher wir dem Gebirge kamen, umso mehr bemerkten wir zu unserem Erstaunen, dass wir es gar nicht mit schwimmenden Eismassen, sondern mit dem steilen Felsenstrande einer Insel zu tun hatten. Ein tief eingeschnittener Fjord eröffnete unserem Boote eine Einfahrt, und es gelang uns einen passenden Platz zum Anlegen zu finden. Und nun überzeugten wir uns zu unserer Überraschung, dass das vermeintliche Eis nichts anderes war als eine Felsenwand von riesigen Kalkspat-Kristallen, die allerdings aus der Ferne mit ihren Reflexen im Sonnenlichte Eisbergen täuschend ähnlich sahen. Hierin lag jedenfalls der Grund, weshalb an dieser Meeresstelle auf der Karte zwar die Beobachtung von Eisbergen, aber nichts von einer Insel verzeichnet war. Ich begann die Felswand, deren Höhe etwa hundert Meter betragen mochte, hinaufzuklettern, da die vorspringenden Kristalle das Unternehmen nicht sehr schwierig machten.
Kaum hatte ich den oberen Rand erreicht und einen Blick hinüber geworfen, als ich wie bezaubert stehen blieb, unfähig vor Erstaunen und Bewunderung mich zu rühren. Die Felswand fiel, einem Riesenwalle ähnlich, zuerst steil ab, dann aber ging sie in ein hügeliges Gelände über, das im blühenden Grün eines reichen Pflanzenschmuckes prangend sich allmählich zu einer stillen Meeresbucht herabsenkte. Hinter der Bucht erhoben sich neue Hügel, auf denen zwischen dem Grün der Lorbeer- und Olivenbäume die glänzend weißen Häuser und Paläste einer ausgedehnten Stadt aufstiegen, alles überragt von jenem Wunderbau der Akropolis, wie er einst die Stadt der Pallas Athene geschmückt hatte. Auf diesem entzückenden landschaftlichen Hintergrunde spielte sich das regste Leben ab; auf dem Meere Fahrzeuge von seltsamer Gestalt und Menschen, die über das Wasser zu huschen schienen, am Ufer eine zahlreiche Menge in lebhafter Bewegung, aber in Trachten und Formen, wie ich sie noch nie beobachtet hatte.
Nach den ersten Augenblicken regungslosen Hinstarrens suchte ich mich zu besinnen. Meinen Gefährten zuzurufen getraute ich mich nicht, weil ich noch gar nicht an die Wirklichkeit des Gesehenen glaubte. Wie sollte diese bunte Welt, die einerseits entschieden an das griechische Altertum mahnte, andererseits aber wieder einen unbeschreiblichen, mit nichts vergleichbaren Eindruck des Märchenhaften machte, wie sollte diese Welt in die Öde des Atlantischen Ozeans kommen? Während ich solcher Frage nachhängend auf das seltsame Treiben zu meinen Füßen starrte, mochte ich wohl langsam auf dem Felsenwall fortgegangen sein, denn ich befand mich plötzlich vor einer zwar steilen, jedoch gangbaren Treppe, welche von der Höhe nach den Hügeln hinabführte. Jetzt begann ich doch zu zweifeln, ob ich mich ohne meine Gefährten in dieses unbekannte Reich wagen sollte, aber ehe ich noch mit mir einig wurde, tauchte ein Einwohner des Landes vor mir auf, der mich durch eine Handbewegung einlud, die Stufen hinabzusteigen.
Dieser Aufforderung musste ich Folge leisten – warum, das hätte ich nicht angeben können, aber die Einladung war zwingend wie der Wink einer Gottheit. Ich kann auch das Gefühl, das ich hatte, als ich gegen meine kurz vorher gehegte Absicht nun unbedingt und doch willig dem Unbekannten nachgab, mit nichts anderem vergleichen als mit der Stimme des Gewissens, das uns zu einer Handlung treibt ohne Wahl, es mag unsere Reflexion sagen, was sie will. Der Bewohner des Landes, der einen leichten Mantel von einem goldglänzenden Stoffe über einem dichtanliegenden Untergewand trug, war von kleiner Statur, aber edler Haltung, eine Waffe konnte ich an ihm nicht bemerken; stolzen Ganges schritt er voran, während ich, gleichwie im Traume, machtlos ihm nachwandelte. Als wir an das Ufer der Meeresbucht gelangt waren, wendete er sich nach mir um (dass ich ihm gefolgt war, schien er mit absoluter Sicherheit zu wissen, denn er hatte sich während des zehn Minuten langen Weges nicht um mich bekümmert) und richtete eine Frage an mich. Die Sprache klang mir im ersten Augenblicke fremd, und ich hätte ihn vielleicht nicht verstanden, wenn nicht der hellenische Gesamt-Charakter unserer Umgebung plötzlich den Gedanken in mir hätte aufleuchten lassen: Das ist griechisch. Und als er seine Frage wiederholte, verstand ich sie auch, nur die ungewohnte Aussprache hatte mich stutzig gemacht. Er fragte mich, aus welchem Lande ich stamme und wie ich auf diese Insel gekommen sei, auch ob ich wüsste, welche Stadt vor meinen Augen läge. Es schien mir, dass er wohl keine Antwort auf seine Fragen erwartete, sondern sie nur gestellt hatte, um sich von meinem Barbarentum zu überzeugen; denn als ich nach bestem Vermögen in klassischem Griechisch, freilich in ihm offenbar befremdlicher, aber doch verständlicher Aussprache Antwort gab, nahmen seine Mienen den Ausdruck freudigen Erstaunens an.
Er wurde plötzlich freundlich, reichte mir die Hand und sagte: “Willkommen in Apoikis, wer du auch seist; die Sprache der Hellenen bewahrt dir die Freiheit.” Darauf nahm er vom Uferrande ein paar eigentümlich geformte Schuhe, die er mir reichte, während er ein gleiches Paar an seinen Füßen befestigte und damit aufs Wasser hinaustrat, als sei es festes Land. Ich stand natürlich höchst verdutzt da, unwissend was ich beginnen sollte, etwa wie ein Feuerländer, dem man ein Opernglas reicht mit der Bitte, sich zu bedienen. Der Apoikier lächelte und erklärte mir den Gebrauch der Anthydors, wie er die Schuhe nannte. Ich muss gestehen, dass ich ihn nicht ganz verstand, und ich kam mir immer mehr barbarisch diesem zivilisierten Hellenen gegenüber vor. Doch ersah ich so viel, dass die Sohlen, welche aus Metallstreifen zusammengesetzt waren, bei der Berührung mit dem Wasser dasselbe unter lebhaftem Aufbrausen so stark zersetzten, dass ein Einsinken unmöglich wurde. Ich fasste Mut, legte die Anthydors an und bewegte mich, von meinem Führer gestützt, zu Fuße über das Wasser, nicht ohne Bangen und Beschämung ob meiner Unkenntnis. Ach, mein Stolz auf die europäische Kultur des neunzehnten Jahrhunderts sollte bald noch tiefer, ganz tief sinken. Ich sah jetzt, dass gleich uns viele andere über das Wasser gemütlich fortschritten, ich sah aber zugleich in ihren Händen Instrumente und rings um mich, auf dem Wasser, an den Ufern und an den Häusern Vorrichtungen aller Art, die mir gänzlich fremd waren. Ein Wilder, der eine unserer europäischen Hauptstädte betritt, kann vor alten Erfindungen der Neuzeit nicht dümmer stehen, als ich vor den Kunstwerken von Apoikis.
Mein Führer bog aus einer Straße auf einen weiten Platz ein, als plötzlich aus dem uns umgebenden Gewühl von Menschen ein Mann, in ähnlicher Kleidung wie mein Begleiter, hervorstürzte und mir ungestüm um den Hals fiel. “Ehbert”, rief er auf deutsch, “wie kommst Du nach Apoikis?” Mein Führer trat nicht ohne Ehrerbietung vor dem Herangekommenen zurück, während ich mich kurze Zeit besinnen musste, wen ich vor mir habe. Denn das ungewohnte Kostüm befremdete mich. Dann erkannte ich zu meiner freudigsten Überraschung — nun raten Sie — unseren lieben Studienfreund Philandros, mit dem wir im Sommer 1872 so herzerhebende Stunden in Heidelberg verlebten. Jetzt war ich geborgen. Philandros erklärte sich zu meinem Gastfreunde — er ist hier eine höchst angesehene Persönlichkeit – und führte mich in sein Haus. Meine stürmischen Fragen beantwortete unser Freund mit seinem stillen, olympischen Lächeln, das Sie an ihm kennen.
“Mit der Zeit”, sagte er, “sollst Du erfahren, so viel Du vermagst; nur halte Dich maßvoll, willst Du bestehen. Wir sind nicht wie ihr an die sinnliche Welt der Erscheinung gebunden — doch ich merke, dass Du augenblicklich von einem phänomenalen Hunger gequält wirst.”
Er stellte mich seiner Gattin vor, einer graziösen, in Violett und Gold gekleideten Dame, die ich in dem Verdacht habe, dass sie bei meinem Anblicke das Lachen nur mit Mühe unterdrückte. In der Tat mochte mein Erstaunen über meine Umgebung bewirken, dass ich noch einfältiger aussah, als ich bin. Sie führte mich indes durch einen freundlichen Wink in ein weites Gemach, das als Speisekammer, Küche und Esszimmer zugleich diente.
“Bei uns gibt es keine Bedienung”, sagte sie, “jeder bereitet seine Nahrung selbst.”
Eine zweite Handbewegung wies mich auf die Vorräte an den Wänden hin, die ich nicht kannte, auf die Geräte, deren Gebrauch ich nicht verstand — ich zuckte die Achseln, und Frau Lissara lächelte nun wirklich, nur ein klein wenig, aber ich sah es doch. Philandros nahm einige Früchte und Fleischstücke, legte sie in eine Schale und goss eine Flüssigkeit darüber, die er Diapetton nannte, und die Berührung mit derselben vollbrachte in einer halben Minute die Wirkung eines trefflichen Bratofens. Vor mir stand ein garniertes Filet, dessen Genuss mir nicht nur vorzüglich mundete, sondern auch meine Seele in eine erhöhte Stimmung versetzte, mich von jeder Müdigkeit befreite und mir die Lust erweckte, einige der schwierigsten philosophischen Probleme zu lösen, wie man etwa bei uns zum Nachtisch Nüsse knackt. Frau Lissara fragte mich, was die europäischen Damen für Ansichten über die Identität des ethischen und logischen Noumenons hätten, und ob meine Frau die Transzendenz oder die Immanenz des Gefühles vorzöge; und sie schlug die Hände über dem Kopfe zusammen, als ich ihr sagte, dass bei uns weder Ethik noch Logik in der Mädchenerziehung eine Rolle spielten.
“Auch nicht im Leben?” fragte sie.
Ihr Gatte ersparte mir die Verlegenheit der Antwort, indem er sich bereit erklärte, mir einige Aufhellung über die Verhältnisse von Apoikis zu geben. Was ich von seinen Ausführungen verstand, kann ich Ihnen nur ganz kurz skizzieren, so weit es überhaupt im Rahmen unserer Begriffe möglich ist.
Nach der Hinrichtung des Sokrates (399 vor Christi Geburt) verließ bekanntlich eine Anzahl seiner persönlichen Freunde, Gesinnungsgenossen und Schüler Athen. Gleich ihrem Meister erkannten sie, dass, nachdem der naive Glaube an die Unerschütterlichkeit der Volkssitte einmal gestört war, nicht das Zurückgehen auf das Alte, sondern nur die Erneuerung der Sitte von innen heraus zu helfen vermöge, dass aus dem Eingehen in das Bewusstsein des Einzelnen und die Berechtigung der freien persönlichen Überzeugung der Fortschritt von engherziger nationaler Starrheit zu edlem Menschentum geschehen müsse. In der Absicht, an noch unbesiedelter Küste, sei es in Spanien oder in Afrika, ein selbständiges Staatswesen zu gründen, welches nach den Grundsätzen ihrer Erkenntnis verwaltet sich vollständig frei entwickeln sollte, rüstete ein begütertes Brüderpaar, Chairephon und Chairekrates, von Megara aus, wohin sie sich, wie bekanntlich auch Platon, zunächst begeben hatten, eine Anzahl von Schiffen, die mit allem versehen wurden, was zur Gründung einer Kolonie gehörte. Jedoch sollte diese Ansiedlung sich möglichst unabhängig stellen und nur auf ihre eigene Kraft bauen. Ein eigentümliches Geschick wollte es, dass hier in der Tat die Pflanzstätte eines neuen Menschentums gelegt wurde, denn nachdem die Expedition die Reede von Megara verlassen, hat kein Mensch auf dem Erdenrund mehr eine Kunde von ihr erhalten; die Ausgewanderten selbst und ihre Nachkommen sind von jedem Verkehr und Einflüsse anderer Menschen und Völker abgeschnitten gewesen. Ich bin der erste, dem es gestattet ist, Kunde von jenen erhabenen Wesen nach Europa zu bringen, auf das sie mitleidig herabsehen.
Durch Stürme über die Säulen des Herkules hinausgetrieben, wurde die Expedition nach wochenlangen Gefahren bis an jene Felseninsel verschlagen, wo heute Apoikis steht. Hier fand sie Rettung. Der Fjord, in welchen auch unser Boot eingefahren war, windet sich weiterhin rückwärts und bildet das versteckte Binnenmeer, an dessen blühenden Ufern die Stadt Apoikis gegründet wurde. Das Land im Innern der Insel, sobald man die hohen Kalkspatmauern, die sie umgeben, überstiegen hatte, erwies sich als außerordentlich fruchtbar, das Klima milde und angenehm. Eine Bevölkerung von 7000 bis 8000 Seelen findet hier reichliche Nahrung, bei sehr geringer Arbeit. Eine größere Zahl von Einwohnern aber hat Apoikis niemals erreicht. Denn, wie mein Gastfreund sagte, das Glück eines Volkes besteht nicht in der möglichst großen Menge von einzelnen Zentren des Bewusstseins, sondern in der intensiven und gleichmäßigen Konzentration des Bewusstseins in jedem einzelnen Individuum.
Als ich ihn fragte, ob denn Apoikis nie an Übervölkerung leiden könne, da lächelte er und sprach: “Das kann ich Dir schwer erklären. Wenn Du die ganze Entwicklung unseres Kulturzustandes kenntest und die Tiefe unserer sittlichen Weltauffassung zu begreifen vermöchtest, dann würdest du einsehen, dass Deine Frage zu jenen unberechtigten gehört, wie z. B.: warum die Welt existiert, ob die Seele im Gehirn sitzt, ob die Tugend blau oder grün ist.”
— “Erzähle nur unsere Geschichte weiter”, warf Frau Lissara ein. —
“Als wir hierher kamen”, fuhr Philandros fort, “Schüler des Sokrates und Freunde des Platon, mit den Versen des Sophokles auf den Lippen und vor den Augen die Erinnerung an die Bilder des Phidias, im Herzen die Lehren des weisesten der Menschen, als wir hier ein sorgenloses Leben fanden, da bildeten wir eine kleine, aber glückliche Gemeinde philosophischer Seelen, und frei von jeder Nötigung, äußeren Gefahren entgegenzutreten, richteten wir alle Kraft auf die harmonische Ausgestaltung unseres inneren Lebens, Vertiefung des Denkens, Erziehung des Willens, maßvollen Genuss heiterer Sinnlichkeit. Zwei volle Jahrtausende verflossen, ohne dass ein Segel am Horizonte von Apoikis aufgetaucht wäre. In dieser Zeit haben wir unter Bedingungen, wie sie die menschenerfüllte Erde keinem Volke bieten kann, einer ungestörten, fortschreitenden Entwicklung uns erfreut. Was wir indessen erreichten, das könnt Ihr nie und nimmer gewinnen, auch wenn Eure Kultur im gleichen Maße, wie in dem letzten Jahrhundert, noch ein paar Jahrtausende emporstiege, denn Ihr steht auf ganz anderen historischen Grundlagen als wir. Hunderte von Millionen wollen glücklich werden, dazu müsst Ihr erst das Leben in mühseligem Kampfe erstreiten und dann in hundert Millionen Herzen das Gefühl maßvoller Bescheidung wecken; das letztere könnt Ihr vielleicht erreichen durch eine Religion, welche die Gemüter fortreißt. Aber leben müsst Ihr doch. Und wie Ihr gestellt seid, so kann die Linderung des äußeren Elendes auch nur erreicht werden durch äußere Arbeit, und darum geht alle Eure Kultur nur auf Machtentwicklung der Menschheit. Sie muss darauf gehen, weil Ihr das Leben nicht anders zu bezwingen vermögt. Die unsere aber verachtet und kann verachten die ungemessene Höhe, auf welche der Mensch durch Bezwingung der äußeren Kräfte der Natur gelangen kann. Denn sie hat erreicht die Tiefe, in welcher das Bewusstsein die Welt der Erfahrungen gestaltet und in welcher ihr alles andere von selbst zufällt.
Ihr seht nur das Zifferblatt der großen Weltenuhr und studiert den Gang der Zeiger; wir aber blicken in das Räderwerk und auf die treibende Feder, die wir selbst sind, und verstehen das Werk zu rücken. Euch trifft damit kein Vorwurf, Ihr konntet nicht anders vorwärtsschreiten, denn wo Ihr es versuchtet, die Welt zu verachten und das Glück ans dem Innern zu gewinnen, da riss Euch immer die hungernde Masse in den Zwang der Wirklichkeit, ehe Ihr mit dein Bewusstsein der Gesamtheit in das Idealreich zu dringen vermochtet. Ihr konntet die äußere Macht nicht entbehren. Um sie zu gewinnen, musstet Ihr die Natur, die Ihr verachten wolltet, wieder in Eure Rechnung aufnehmen; Ihr musstet beobachten und sammeln und nur durch Erfahrung könnt Ihr die Kenntnis gewinnen, die Euch mächtig macht. Und darin müsst Ihr fortfahren, Ihr habt kein anderes Mittel, denn Euer Denken ist nicht anders fähig, die Welt zu erkennen. Sie ist Euch nur zugänglich in Raum und Zeit und Notwendigkeit, und so müsst Ihr gehorchen.
Wir aber bedurften zwei Jahrtausende lang nichts von der Natur, als was sie uns von selbst schenkte. Hier gab es keine darbende und unwissende Menge, keine habgierige und übermütige Gesellschaft, keine Herren und Sklaven, sondern nur eine bescheidene Anzahl gleichmäßig harmonisch durchgebildeter, sich selbst beschränkender Menschen. Wir bedurften keiner Teilung der Arbeit und keiner Fachkenntnisse, wir begnügten uns mit dem, was jeder verstehen konnte. Und so kamen wir auf einem ganz anderen Wege als Ihr zur Kultur, die Ihr bei uns erblickt, und zu Erfindungen und Bequemlichkeiten, die Ihr nicht kennt. Jetzt freilich seht Ihr hier Prachtbauten und tausenderlei Verfeinerungen, aber jeder macht nur freiwillig, was er gerade kann und will, und wir sind jetzt so weit in der Kultur des Bewusstseins, dass jeder den Gesamt-Zusammenhang und sich selbst begreift, dass Pflicht und Wunsch in des Apoikiers Seele nicht mehr getrennt bestehen. Wir sind nicht Sklaven der Sitte, wie die Naturvölker, nicht Herren der äußeren Natur, wie die gesitteten Nationen Europas, wir sind nur Herren von uns selbst, Herren unseres Willens, Herren des Bewusstseins überhaupt, und darum sind wir frei. Uns stört keine Sorge um darbende Völker, noch um eigennützige Tyrannen, wir haben keine Gesetze, denn jeder trägt das Gesetz in sich selbst. Wir haben keine Naturwissenschaft und keine Industrie in Eurem Sinne, wir brauchen der Natur keine Geheimnisse abzulauschen und ihre Kräfte nicht in unseren Dienst zu zwingen. Die Entwicklung unseres Geistes, frei von dem Druck der europäischen Millionen, ging einen andern Weg. Bei uns folgte auf Platon kein Aristoteles, keine Scholastik, kein Dogmatismus, so brauchten wir keinen Galilei, keinen Newton, keinen Darwin. Wir hatten keine Römerherrschaft, keine Völkerwanderung, kein Feudalsystem, so brauchten wir keine Revolution. Zu der Zeit, da Achaja römische Provinz wurde, da lehrte man bei uns, was Euch Kant und Schiller offenbarten. Als die christlichen Märtyrer in den Gärten Neros brannten, da emanzipierte sich unser Denken von den Schranken der Sinnlichkeit und lernte seine Bedingungen im Absoluten kennen.
Als in Euren Klosterschulen die spärlichen Reste der Neuplatoniker studiert wurden, da hatte man bei uns die Metaphysik als eine empirische Wissenschaft begründet. Und während Eure Metaphysiker sich luftige Wolkenbauten im unbeschränkten Reich der Träume errichteten, da hatten wir die inneren Wesensbedingungen des Bewusstseins erfasst und das Geheimnis der Schöpferkraft uns angeeignet. Was Ihr nun messend und wägend und rechnend an Entdeckungen und Erfindungen der Natur abringt, das schaffen wir, nachdem sich unser Verstand aus seinen Fesseln befreit und in Intuitivkraft gewandelt hat, aus unserem eigenen Selbst in freier Wahl. In unserer Welt besteht kein Gegensatz von Zwang und Freiheit. Wollen, Sollen und Können sind nicht mehr getrennt. Und das haben wir errungen durch die alleinige Pflege des wollenden, fühlenden und denkenden Bewusstseins. Ihr konntet es nicht, denn Ihr musstet Völker ernähren und Kriege führen.
In den äußeren Formen haben wir die Überlieferungen unserer Vorfahren festgehalten, so weit sie uns passend erschienen; schönere haben wir bei Euch nirgends gefunden. Seit den letzten beiden Jahrhunderten, in denen, wenn auch selten, sich hie und da Schiffe in unseren Gewässern zeigten, haben wir uns auch um die Geschichte der übrigen Menschheit gekümmert. Wir senden alle zehn Jahre einen Erwählten nach Europa, die Zeitverhältnisse zu studieren. Ich war der Letzte, der drüben war, und dabei lernten wir uns kennen. Wir verschweigen die Existenz unseres Staates, denn wir würden nicht verstanden werden und wollen nicht gestört sein.”
“Und fürchtet Ihr nicht”, fragte ich, “dass Europäer Euch entdecken, dass sie Eure kleine Insel in Besitz nehmen und Eure Freiheit unterdrücken?”
Mein Freund lächelte wieder.
“Ich sehe”, sagte er, “Du hast unser Wesen noch immer nicht begriffen. Frage Dich doch, konntest Du dem Winke des Apoikiers widerstehen, der Dich zur Stadt führte? So wenig, als der Ehrliche das Unrecht zu wollen vermag. Deine Gefährten haben wir aufgegriffen, das Schiff selbst vorläufig weggenommen, um zum Vergnügen der Einwohner, welche die Stadt nicht verlassen, ihnen die fremden Barbaren zu zeigen. Wir werden Euch wieder freigeben, Ihr mögt nach Europa zurückkehren. Wir werden wollen, dass Deinen Gefährten jede Erinnerung an dieses Land verschwindet; keiner wird imstande sein zu erzählen, dass er unsere Insel gesehen. Du allein magst eine Ausnahme machen. Du bist nicht Gefangener, sondern Gastfreund. Dich soll nichts binden; aber ich sage Dir im voraus, dass Dir niemand glauben wird. Aber auch dies möge sein; lass' die Kriegsflotte Englands vor unserer Insel auffahren, lass' die Armeen Europas auf unseren Kalkspatwällen stehen — wir werden wollen, und kraft des Zusammenhanges alles Bewusstseins im Absoluten werden die Kommandierenden keinen anderen Befehl auszusprechen vermögen als den des Rückzuges.”
Ich mochte wohl ein sehr dummes Gesicht zu diesen Worten machen, denn mein Freund fuhr fort: “Ich sehe wohl, Du kannst das Gesagte nicht fassen. Es ist dies ebenso, als wolltest Du einem Indianerstamm klar machen, dass er nie die Weißen Männer aus Amerika vertreiben könne, weil die moralische Macht der Zivilisation die Besetzung jenes Erdteils unumgänglich erzwingt. Du kannst ihn nur überzeugen durch die physische Macht, indem Du auf die Zahl der Kanonen und Gewehre hinweist. Du bist uns gegenüber in dem unzureichenden Fassungsvermögen des Indianers, so will ich auch Deine Sprache reden. Wenige Minuten genügen, um unsere Insel mit einem Strome freien Äthers zu umziehen. Kein Körper kann diesen Strom durchdringen, in Atome aufgelöst, wird er fortgewirbelt werden. Granate und Panzerschiff verschwinden in ihm wie der Strohhalm in der Flamme.”
Ich schwieg. Das Mahl war zu Ende. Mein Freund führte mich durch die Stadt. Was ich staunend sah und erlebte, hoffe ich Ihnen mündlich zu erzählen, wie die Fahrt auf dem Seelenschiff, die psychische Schaukel, das Begriffsspiel und zahlloses andere. Im Hafen sah ich das große submarine Eilschiff, welches alle zehn Jahre unter der Oberfläche des Wassers nach Europa führt. Die treibende Kraft ist auch hier die chemische Zersetzung des Wassers, diese selbst aber wird durch Ätherströme bewirkt; der nähere Mechanismus ist mir nicht bekannt. Zu Fahrten in der Nähe der Insel werden dreireihige Ruderboote gebraucht, die genau nach dem Muster der athenischen Trieren gebaut sind. Man betreibt diese Ruderfahrten als einen Sport. Dann führte mich mein Freund in das Haus, in welchem meine gefangenen Gefährten untergebracht waren. Man hatte es europäisch eingerichtet, aber die eine Seite offen gelassen, dort standen die Apoikier in dichten Scharen und amüsierten sich über unsere Leute, wie wir uns über die Feuerländer im zoologischen Garten amüsiert hatten. Und eben so verblüfft und verständnislos wie jene Wilden waren hier die Europäer. Lord Lytton las in einer alten Nummer des Standard, Capitän Clynch trank Grog, Dr. Gilwald mikroskopierte ein hier gefangenes, unbekanntes Insekt. Ein Apoikier warf ihm ein kleines Rohr zu, Gilwald hielt es vor das Auge und an das Ohr, und da er nichts damit anzufangen wusste, warf er es fort unter dem Gelächter der Apoikier. Es war ein Noumenalrohr, das, auf den Nacken gelegt, die Raumvorstellung aufhebt und das intelligible All-Eins empfinden lässt.
Die Abschiedsstunde nahte. Lord Lytton wollte nach seiner Entlassung seine Reise nach dem südlichen Eismeer fortsetzen, ich aber bat, meine schnelle Rückreise nach Europa zu ermöglichen. Man lud mich ein, eine Triere zu besteigen, schlank und schön, wie sie schmucker kein Nauarch in des Perikles Zeit aus dem Piräus geführt hat. Sie hieß der Odysseus und trug das Bild des Dulders aus Parasemeion am Borderteil, in lebensvoller Schönheit in Holz geschnitzt. So mochte der verschlagene Mann auf der meerumflossenen Ogygia, dem Eilande der Kalypso, gesessen sein, wenn er, die Augen mit der Hand beschattend, sehnsüchtig über das Meer hinausblickte und die unnahbare Ferne suchte. Und wie die Phäaken den Odysseus an Ithakas Strand, so setzten mich die Apoikier schlafend auf Tristan da Cunhas Küste aus und legten ihre Gastgeschenke neben mich: einen goldenen Syllogismusbecher mit Urteils-Würfeln und die am Feuer der Götterinsel versengten Flügel meiner Psyche. Als ich erwachte, standen zwei nach Tran duftende Walfischjäger vor mir und versetzten mich durch einen Schluck aus der Rumflasche in die Welt der Sinne zurück, in welcher Sie wehmütig grüßt
Ihr R. Ehbert.
Aladdins Wunderlampe
Wir hatten uns nach dem Abendessen um den runden Tisch in der gemütlichen Ecke gesetzt, und der Professor Alander bot mir seine Zigarren an, während unsere Frauen ihre Handarbeiten auswickelten.
«Und was würden Sie wählen?” sagte er, das Gespräch fortsetzend, zu meiner Frau, «die Tarnkappe, oder den Mantel des Dr. Faust, oder den unerschöpflichen Beutel Fortunats, oder den Apfel vom Baum des Lebens, oder —»
«Den Mantel natürlich, den Mantel», rief meine Frau. «Dann könnte man doch einmal sich satt reisen —»
«Und zu den Mahlzeiten wieder zu Hause sein»; fiel Alanders junge Gattin lächelnd ein. «Das wäre ja ganz nach Deinem Geschmack, Georg.»
“Still!» drohte Alander. «Du nimmst Dir doch die Tarnkappe — überall dabei sein und unsichtbar zuschauen, das ist so etwas für unsere Frauen. Und Sie» — wendete er sich zu mir — «als Hypochonder, mit dem gefährlichen Druck bald rechts und bald links, bekommen den heilsamen Apfel, da bleibt für mich das große Portemonnaie, und das ist mir gerade recht.»
«Ihre Aufzählung von Zauber-Requisiten war sehr unvollständig», entgegnete ich. «Mit diesen beschränkten Dualitäten bin ich nicht zufrieden. Wenn ich einmal in den Hexenschatz greifen könnte, so wählte ich irgend ein Mittel, wodurch mir jeder Wunsch erfüllt würde—» «Um Himmelswillen, was würden Sie da für Unfug anrichten», unterbrach mich Frau Alander und rückte ein Stück zur Seite; «dann sitze ich nicht mehr neben Ihnen —»
«Dann würde ich mir's eben wünschen müssen», sagte ich und hob ihr das herabgefallene Zwirnknäuel auf. «Und das Knäuel —»
«Ließen Sie natürlich liegen —»
«Und wärst der unglücklichste Mensch der Welt, dem jede Laune erfüllt wird und der keine Wünsche mehr hat», bemerkte meine Frau.
«Das sehe ich nicht ein. Denn erstens könnte ich ja jede etwaige Torheit wieder reparieren, und zweitens —»
«Könnten Sie sich ja vorher den nötigen Verstand wünschen», meinte Alander trocken.
«Erlauben Sie», sagte ich. «Ich meine das Ding nicht so, dass jeder flüchtige Gedanke mir gleich zur Tat werden sollte; nein, ich würde mir einen Apparat wählen, der erst nach einer gewissen Überlegung benützt werden kann, der mir etwa einen gewaltigen, aber doch nicht allmächtigen Geist dienstbar machte — dadurch schon wäre eine wohltätige Einschränkung gegeben — ich will einmal sagen, Aladdins Wunderlampe.»
«Und dann?» fragte unsere liebenswürdige Wirtin.
«Dann stellte ich Ihnen meinen Geist zur Verfügung.»
«Sie meinen hoffentlich den Geist der Lampe. Gut, so wollen wir uns einen hübschen Wunsch überlegen.»
Alander lächelte still für sich und nahm von seinem Schreibtische einen Gegenstand, den er auf den Tisch stellte. Es war eine kleine antike Lampe von Kupfer mit seltsamen Verzierungen.
«Die Lampe ist da», sagte er, «ich bitte um den Geist.»
«Was haben Sie da für ein seltenes Stück?» rief meine Frau, nach der Lampe greifend. «Das habe ich ja noch nie bei Ihnen gesehen.»
«Es ist heute erst für das Museum zum Kauf angeboten worden; ich hatte selbst noch nicht Zeit zur näheren Untersuchung.»
«Und woher stammt die Lampe?»
«Man hat sie im Tigris gefunden, daran ist kein Zweifel, die Belege sind sicher.»
Wir betrachteten die Lampe, die meine Frau in der Hand hielt.
«Im Tigris gefunden?
---ENDE DER LESEPROBE---