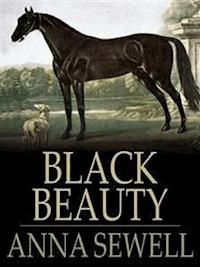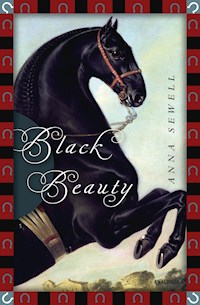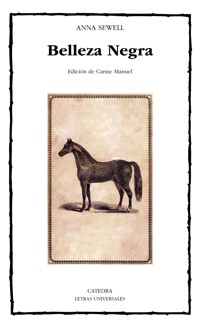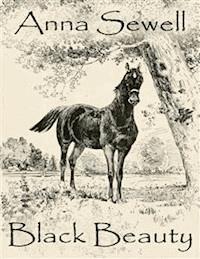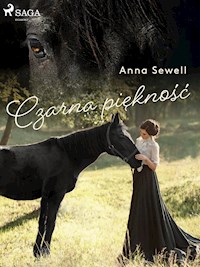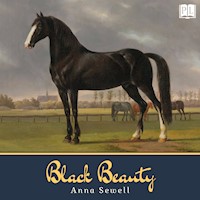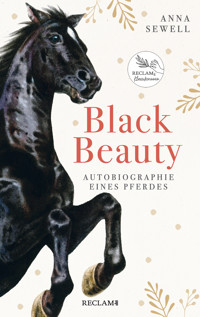
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reclams Klassikerinnen
- Sprache: Deutsch
Viele Leser:innen sind mit Kindergeschichten über den schwarzen Hengst Black Beauty großgeworden – dabei richtet sich der Originaltext von Anna Sewell an Erwachsene. 1877 veröffentlichte die engagierte Tierschützerin ihren Roman und machte sogleich mit einer neuen Idee Furore: Erstmals erzählt ein Tier darin seine eigene Lebensgeschichte – die Autobiographie eines Pferdes eben. Ein großer Roman über Ausbeutung und Ungerechtigkeit, aber auch die Kraft der Freundschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Anna Seweill
Black Beauty
Autobiographie eines Pferdes
Reclam
Englischer Originaltitel:Black Beauty. The Autobiography of a Horse (1877 erstmals erschienen)
2024 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH
Coverabbildung: © Andrew Beckett (IMAGO / Ikon Images)
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2024
ISBN978-3-15-962248-4
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011427-8
www.reclam.de
Inhalt
TEIL 1
Mein erstes Zuhause
Die Jagd
Wie ich eingeritten wurde
Birtwick Park
Ein gelungener Einstand
Freiheit
Ginger
Gingers Geschichte geht weiter
Merrylegs
Eine Unterhaltung im Obstgarten
Klare Worte
Ein stürmischer Tag
Im Zeichen des Teufels
James Howard
Der alte Stallknecht
Der Brand
John Manly erzählt
Der Arzt wird geholt
Nur Unwissenheit
Joe Green
Der Abschied
TEIL 2
Earlshall
Ringen um Freiheit
Lady Anne
Reuben Smith
Wie die Sache ausging
Ruiniert: Es geht bergab
Ein Mietpferd und seine Fahrer
Cockneys
Ein Dieb
Ein Aufschneider
TEIL 3
Auf dem Pferdemarkt
Ein Londoner Droschkenpferd
Ein altes Schlachtross
Jerry Barker
Sonntagsfahrten mit der Droschke
Die goldene Regel
Dolly und ein wahrer Gentleman
Seedy Sam
Die arme Ginger
Der Metzger
Die Wahl
Ein Freund in der Not
Der alte Captain und sein Nachfolger
Jerrys Neujahrsnacht
TEIL 4
Jakes und die Dame
Schwere Zeiten
Mr. Thoroughgood und sein Enkel Willie
Mein letztes Zuhause
Zu dieser Ausgabe
Nachwort
Black BeautyAutobiographie eines Pferdes
TEIL 1
1. KAPITEL
Mein erstes Zuhause
Der erste Ort, an den ich mich gut erinnern kann, war eine schöne große Wiese, in deren Mitte ein Teich mit klarem Wasser lag. Ein paar schattenspendende Bäume neigten sich darüber, und am tiefen Ende wuchsen Binsen und Seerosen. Von der einen Seite der Wiese blickten wir über eine Hecke auf ein gepflügtes Feld, von der anderen Seite über ein Gatter auf das Haus unseres Herrn, das an der Straße stand. An der höchsten Stelle der Wiese befand sich ein Hain aus Fichten, und am unteren Ende plätscherte ein Bachlauf mit einem überhängenden Steilufer.
Als ich noch jung war, ernährte ich mich von der Milch meiner Mutter, da ich kein Gras fressen konnte. Tagsüber lief ich neben ihr her, abends schmiegte ich mich eng an sie. Wenn es heiß war, standen wir meist beim Teich im Schatten der Bäume; wenn es kalt war, hatten wir einen schönen warmen Unterstand unweit des Fichtenhains.
Sobald ich alt genug war, Gras zu fressen, ging meine Mutter tagsüber zur Arbeit und kam erst abends zurück.
Außer mir waren noch sechs andere Fohlen auf der Weide. Sie waren älter als ich, einige von ihnen waren fast so groß wie ausgewachsene Pferde. Ich tollte mit ihnen herum und hatte viel Spaß, gemeinsam drehten wir im Galopp, so schnell wir konnten, auf der Wiese eine Runde nach der anderen. Manchmal ging es ziemlich ruppig zu, denn beim Galoppieren bissen die anderen oft um sich und schlugen aus.
Eines Tages, als es besonders wild zuging, wieherte meine Mutter mich zu sich und sagte dann: »Ich möchte, dass du mir genau zuhörst bei dem, was ich dir jetzt sage. Die Fohlen, die hier leben, sind sehr gute Fohlen, aber es sind Fohlen von Zugpferden, und natürlich haben sie nicht gelernt, was sich gehört. Du bist wohlerzogen und von guter Herkunft. Dein Vater hat in dieser Gegend einen guten Ruf, und dein Großvater hat zweimal den Pokal bei den Newmarket Pferderennen gewonnen. Deine Großmutter hatte das friedfertigste Gemüt, das ich je bei einem Pferd kennengelernt habe, und ich denke, dass du mich nie hast ausschlagen oder beißen sehen. Ich hoffe, dass du zu einem sanftmütigen und guten Pferd heranwächst und dir keine Unarten angewöhnst. Verrichte deine Arbeit guten Willens, hebe deine Hufe ordentlich an, wenn du trabst, und niemals sollst du beißen oder ausschlagen, nicht einmal im Spaß.«
Ich habe den Rat meiner Mutter nie vergessen, ich wusste, dass sie ein weises, altes Pferd war, und unser Herr hielt große Stücke auf sie. Sie hieß Duchess, aber er sagte oft Liebling zu ihr.
Unser Besitzer war ein gütiger, freundlicher Mensch. Er gab uns ordentliches Futter, brachte uns gut unter und hatte stets ein nettes Wort für uns; mit uns sprach er genauso liebevoll wie mit seinen kleinen Kindern. Wir mochten ihn alle gern, und meine Mutter liebte ihn sehr. Wenn sie ihn beim Gatter erblickte, wieherte sie vor Freude und trabte zu ihm. Dann klopfte er ihr auf den Hals und streichelte sie und sprach: »Nun, mein alter Liebling, wie geht’s denn deinem kleinen Darkie?« Ich hatte ein mattschwarzes Fell, daher nannte er mich Darkie1. Oft gab er mir ein Stück Brot, was sehr gut schmeckte, und manchmal brachte er meiner Mutter eine Möhre mit. Alle Pferde kamen zu ihm, aber ich denke, wir waren seine Lieblinge. An Markttagen brachte meine Mutter ihn immer in einem leichten Gig in die Stadt.
Es gab da einen Ackerknecht, Dick hieß er, der manchmal auf unsere Weide kam und Brombeeren an unserer Hecke pflückte. Hatte er genug davon gegessen, machte er sich, wie er es nannte, einen Spaß mit den Fohlen, indem er Steine oder Stöcke nach ihnen warf, so dass sie davonsprengten. Uns machte das nicht viel aus, da wir weggaloppieren konnten, aber manchmal traf uns doch ein Stein, und das tat weh.
Eines Tages trieb er wieder sein Spielchen, wusste aber nicht, dass unser Herr im Feld nebenan war. Doch er war da und verfolgte genau, was vor sich ging: Prompt sprang er über die Hecke, packte Dick beim Arm und verpasste ihm eine solche Ohrfeige, dass der Bursche vor Schmerz und Schreck aufschrie. Sobald wir den Herrn erblickten, trabten wir näher heran, um zu sehen, was sich dort abspielte.
»Du böser Junge!«, sagte er, »du frecher Bengel! Dass du hier die Fohlen jagst. Das ist nicht das erste Mal, auch nicht das zweite, aber es wird das letzte Mal sein. Hier – nimm deinen Lohn und scher dich nach Hause, ich will dich nicht länger auf meinem Hof sehen.« Also bekamen wir Dick nicht mehr zu Gesicht. Der alte Daniel, der Mann, der sich um die Pferde kümmerte, war genauso sanftmütig wie unser Herr, deshalb erging es uns gut.
2. KAPITEL
Die Jagd
Als ich noch keine zwei Jahre alt war, kam es zu einem Zwischenfall, den ich nie vergessen habe. Es war Anfang Frühling. Nachts hatte es noch etwas Frost gegeben, und ein leichter Nebel hing über den Pflanzungen und Wiesen. Ich und die anderen Fohlen, wir grasten am unteren Ende der Weide, als wir in einiger Entfernung etwas hörten, das sich nach Hundegebell anhörte. Das älteste Fohlen unter uns hob den Kopf, stellte die Ohren auf und sagte: »Dort kommen die Jagdhunde!« und preschte sofort davon, gefolgt von uns anderen, zum höhergelegenen Bereich der Weide, von dem aus wir über die Hecke mehrere Felder und Äcker überblicken konnten. Meine Mutter und ein altes Reitpferd unseres Herrn standen auch in der Nähe und schienen zu wissen, was dort vor sich ging.
»Sie haben einen Feldhasen aufgespürt«, meinte meine Mutter, »und wenn sie hier vorbeikommen, können wir die Jagd verfolgen.«
Schon bald rasten die Hunde über das Feld mit jungem Weizen unmittelbar neben unserer Wiese. Ich hatte noch nie einen solchen Lärm gehört, wie die Meute ihn machte. Die Hunde bellten nicht, heulten und jaulten auch nicht, sondern stimmten ein »Jo! jo, o, o! jo! jo, o, o!« aus vollem Halse an. Hinter ihnen tauchten Männer auf Pferden auf, einige von ihnen trugen grüne Röcke, und alle ritten in gestrecktem Galopp. Das alte Pferd schnaubte und sah ihnen begierig nach, und wir jungen Fohlen wollten am liebsten mit ihnen auf und davon, aber kurz darauf waren sie weiter unten auf den Feldern angelangt. Dort hielten sie sich allem Anschein nach länger auf, die Hunde machten keinen Krawall mehr, sondern liefen kreuz und quer, mit den Nasen dicht am Boden.
»Sie haben die Fährte verloren«, sagte das alte Rennpferd. »Vielleicht kommt der Hase davon.«
»Welcher Hase?«, wollte ich wissen.
»Oh! Ich weiß nicht, welcher Hase, wahrscheinlich einer von unseren Hasen aus den Pflanzungen. Den Hunden und Menschen ist es gleich, welchem Hasen sie nachjagen können.« Es dauerte nicht lange, ehe die Hunde wieder ihr »Jo! jo, o, o!« anstimmten, und schon kamen sie in Windeseile zurück. Sie hielten direkt auf unsere Wiese zu, und zwar dort, wo die steile Böschung und die Hecke über den Bachlauf ragten.
»Jetzt werden wir gleich den Hasen sehen«, sagte meine Mutter, und im selben Augenblick flitzte ein Hase voller Angst vorbei und lief in Richtung der Pflanzung. Herankamen die Hunde, sie überwanden das Steilufer, sprangen über den Bach und jagten über das Feld, gefolgt von den Jägern. Sechs oder acht Männer setzten mit ihren Pferden sauber über den Bachlauf, den Hunden dicht auf den Fersen. Der Hase versuchte, durch den Zaun zu entwischen, er war aber zu eng, daher machte das Tier kehrt, um zur Straße zu laufen, doch da war es schon zu spät: Mit wildem Gekläff stürzten sich die Hunde auf ihn. Wir hörten ein schrilles Quieken, und das war das Ende des Hasen. Einer der Jäger ritt heran und vertrieb mit seiner Gerte die Hunde, die den Hasen jeden Moment in Stücke gerissen hätten. Dann hielt er den Hasen an der zerfetzten, blutenden Hinterpfote hoch, und die Herrschaften schienen allesamt zufrieden zu sein.
Was mich betraf, ich war so erstaunt, dass ich zunächst gar nicht mitbekam, was unten am Bachlauf passierte, aber als ich dann hinsah, bot sich mir ein trauriger Anblick: Zwei schöne Pferde waren zu Boden gegangen, eins versuchte, sich im Bachlauf aufzurappeln, das andere lag stöhnend im Gras. Einer der Reiter watete soeben aus dem Wasser, voller Matsch und Dreck, der andere lag reglos da.
»Er hat sich das Genick gebrochen«, sagte meine Mutter.
»Geschieht ihm recht«, meinte eines der Fohlen.
Ich dachte dasselbe, aber meine Mutter war nicht unserer Meinung.
»Hm, nein«, sagte sie, »so etwas dürft ihr nicht sagen. Doch obwohl ich ein altes Pferd bin und schon eine Menge gesehen und gehört habe, habe ich nie begriffen, warum die Menschen so erpicht auf diesen Sport sind. Oft verletzen sie sich dabei, reiten gute Pferde zuschanden und zerwühlen die Felder, und alles nur wegen eines Hasen oder Fuchses oder eines Hirschs, die sie leichter auf andere Weise kriegen könnten. Doch wir sind ja nur Pferde und verstehen davon nichts.«
Während meine Mutter dies sagte, standen wir da und schauten zu. Viele der Reiter waren zu dem jungen Mann gegangen, aber mein Herr, der die Geschehnisse verfolgt hatte, war der Erste, der den Mann aufrichtete. Sein Kopf sackte zurück und seine Arme hingen schlaff herab, und alle blickten sehr ernst drein. Es herrschte kein Lärmen mehr, selbst die Hunde waren still und schienen zu wissen, dass etwas nicht stimmte. Sie brachten ihn zum Haus unseres Herrn. Später erfuhr ich, dass es sich um den jungen George Gordon handelte, den einzigen Sohn des Gutsbesitzers; er war ein wohlgeratener großer junger Mann, der ganze Stolz der Familie.
Die Männer ritten dann in alle Richtungen davon, zum Arzt, zum Hufschmied, und zweifellos auch zu Squire Gordon, um ihm die Nachricht bezüglich seines Sohnes zu überbringen. Als Mr. Bond, der Hufschmied, kam und nach dem schwarzen Pferd sah, das stöhnend im Gras lag, tastete er es überall ab und schüttelte den Kopf: Eins der Beine war gebrochen. Dann lief jemand zum Haus unseres Herrn und kehrte mit einem Gewehr zurück. Kurz darauf gab es einen lauten Knall und ein furchtbares Kreischen, und dann war es still. Das schwarze Pferd regte sich nicht mehr.
Meine Mutter wirkte sehr bekümmert, sie sagte, sie habe dieses Pferd seit Langem gekannt und dass es Rob Roy heiße; es sei ein gutes Pferd gewesen, ohne jedweden Makel. Von da an ging sie nicht mehr in jenen Bereich der Wiese.
Einige Tage später hörten wir, wie die Kirchenglocke lange geläutet wurde, und als wir über das Gatter schauten, erblickten wir eine längliche seltsame schwarze Kutsche, die mit schwarzem Stoff bespannt war und von schwarzen Pferden gezogen wurde. Dieser Kutsche folgte eine andere, danach kamen noch eine und noch eine, und alle waren sie schwarz gehalten, während die Glocke läutete und läutete. Sie brachten den jungen Gordon zum Kirchhof, um ihn zu bestatten. Er würde nie wieder reiten. Was sie mit Rob Roy gemacht haben, habe ich nie erfahren. Aber all das für einen kleinen Hasen.
3. KAPITEL
Wie ich eingeritten wurde
Ich wuchs allmählich zu einem stattlichen Pferd heran, mein Fell war fein und weich geworden und schillerte schwarz. Ich hatte einen weißen Huf und auf der Stirn einen hübschen weißen Stern. Man hielt mich für sehr gutaussehend. Mein Herr wollte mich nicht vor vier Jahren verkaufen, er sagte, Jungen sollten nicht wie Männer arbeiten und Fohlen nicht wie Pferde, bis sie richtig ausgewachsen seien.
Als ich vier Jahre alt war, kam Squire Gordon, um mich zu begutachten. Er untersuchte meine Augen, mein Maul und meine Beine, er tastete sie von oben bis unten ab, und dann musste ich vor ihm im Schritt gehen und traben und galoppieren. Er schien mich zu mögen und meinte: »Wenn er gut zugeritten ist, wird er sich sehr gut machen.« Mein Herr sagte, er werde mich selbst einreiten, da er nicht wolle, dass ich Angst bekomme oder verletzt werde, und damit verlor er auch keine Zeit, denn schon am nächsten Tag fing er an.
Womöglich weiß nicht jeder, was einreiten heißt, deshalb will ich es beschreiben. Es bedeutet, einem Pferd beizubringen, sich einen Sattel und Zaumzeug anlegen zu lassen und einen Mann, eine Frau oder ein Kind zu tragen; dorthin zu gehen, wo die Menschen hinwollen, und das auf ruhige Art und Weise. Abgesehen davon muss ein Pferd lernen, ein Kummet, einen Schweifriemen und ein Hintergeschirr zu tragen und stillzustehen, wenn ihm diese Dinge angelegt werden. Dann muss es sich daran gewöhnen, dass ein Karren oder Einspänner hinter ihm befestigt wird, so dass es nicht mehr laufen oder traben kann, ohne das Gefährt hinter sich herzuziehen: Und es muss schnell und langsam damit laufen können, gerade so, wie der Kutscher es möchte. Es darf sich nie vor dem erschrecken, was es sieht, noch darf es mit anderen Pferden sprechen, weder beißen noch ausschlagen, es darf auch keinen eigenen Willen haben, sondern muss immer dem Willen seines Herrn gehorchen, selbst wenn es sehr müde oder hungrig ist. Aber das Schlimmste von allem ist: Sowie das Geschirr angelegt ist, darf das Pferd weder vor Freude springen noch sich vor Müdigkeit hinlegen. Ihr seht also, dass dieses Einreiten eine große Sache ist.
Natürlich war ich schon lange an ein Halfter und einen Strick gewöhnt, an denen ich ruhig über das Feld und die Wege geführt wurde, aber jetzt sollte ich ein Zaumzeug samt Trense bekommen. Mein Herr gab mir wie gewöhnlich etwas Hafer, und nach langem gutem Zureden schob er mir das Stangengebiss ins Maul und konnte das Zaumzeug befestigen, aber das war vielleicht ein blödes Ding! Wer noch keine Trense im Maul hatte, kann sich nicht vorstellen, wie unangenehm sich das anfühlt: Ein großes Stück kalter, harter Stahl, so dick wie der Finger eines Menschen, wird einem ins Maul geschoben, zwischen die Zähne, über die Zunge, und die Enden gucken aus den Winkeln des Mauls heraus und werden dort mit Riemen gehalten; diese Riemen verlaufen über den Kopf, unterhalb der Kehle, um die Nase und unter dem Kinn, so dass man das blöde harte Ding um nichts in der Welt loswerden kann. Das ist sehr schlimm! Ja, wirklich schlimm! Jedenfalls empfand ich das so. Aber ich wusste, dass meine Mutter immer eine Trense trug, wenn sie ausfuhr, und alle Pferde machten es so, wenn sie erwachsen waren. Und so geschah es, dass ich mit dem leckeren Hafer, dem aufmunternden Klopfen meines Herrn, den freundlichen Worten und der wohlmeinenden Art meine Trense und Zaumzeug bekam.
Als Nächstes folgte der Sattel, aber das war nicht halb so schlimm. Mein Herr legte ihn mir sehr sanft auf den Rücken, während der alte Daniel meinen Kopf hielt, dann zog er die Gurte unter meinem Leib fest und tätschelte mir unter gutem Zureden die ganze Zeit das Fell. Kurz darauf bekam ich etwas Hafer, danach führte er mich ein bisschen herum, und so machte er es jeden Tag, bis ich mich schon sehnsüchtig nach dem Hafer und dem Sattel umsah. Eines Tages stieg mein Herr auf meinen Rücken und ritt mit mir auf dem weichen Gras über die Wiese. Das fühlte sich in der Tat seltsam an, aber ich muss sagen, ich war ziemlich stolz, meinen Herrn zu tragen, und als er damit fortfuhr, jeden Tag ein wenig auf mir zu reiten, gewöhnte ich mich bald daran.
Die nächste unangenehme Prozedur war das Anlegen der Hufeisen, auch das war anfangs sehr hart. Mein Herr brachte mich selbst zur Schmiede, um sicherzugehen, dass ich nicht verletzt wurde oder Angst bekam. Der Hufschmied nahm meine Hufe in die Hand, einen nach dem anderen, und schnitt etwas vom Huf weg. Es tat nicht weh, daher stand ich still auf drei Beinen, bis er mit allem fertig war. Dann nahm er ein Stück Eisen, so groß wie mein Huf, legte es auf und schlug Nägel durch das Eisen bis in den Huf, so dass es auch fest saß. Meine Hufe fühlten sich sehr steif und schwer an, aber mit der Zeit gewöhnte ich mich auch daran.
Und als wir so weit gekommen waren, fing mein Herr an, mich an das Zuggeschirr zu gewöhnen, es gab also wieder neue Dinge, die zu tragen waren. Zuerst ein steifes Kummet um den Hals, dann kam das Zaumzeug mit großen Seitenstücken vor den Augen, die Scheuklappen genannt werden, und es waren wirklich Klappen, mit denen ich auf beiden Seiten nichts mehr sehen konnte, sondern nur noch geradeaus. Als Nächstes folgte ein kleiner Sattel mit einem unangenehm steifen Riemen, der direkt unter meinem Schweif verlief: Das war der Schweifriemen. Ich hasste diesen Riemen – mein langer Schweif wurde angehoben und durch diesen Riemen gezwängt, das war fast so schlimm wie die Trense. Nie hatte ich mehr Lust auszuschlagen, aber natürlich konnte ich einen so guten Herrn nicht treten, und so gewöhnte ich mich mit der Zeit an alles und konnte meine Arbeit so gut wie meine Mutter verrichten.
Ich darf nicht vergessen, einen Teil meiner Ausbildung zu erwähnen, den ich immer als großen Vorteil betrachtet habe. Mein Herr schickte mich für vierzehn Tage zu einem benachbarten Farmer, der eine Weide hatte, an deren einer Seite die Bahntrasse verlief. Dort gab es ein paar Schafe und Kühe, und ich wurde zu ihnen gebracht.
Ich werde nie den ersten Zug vergessen, der vorbeifuhr. Ich graste friedlich in der Nähe der Zaunpfähle, die die Weide von der Bahntrasse trennten, als ich aus der Ferne einen seltsamen Laut hörte, und ehe ich wusste, woher er kam – mit einem Rauschen und einem Rattern und einer Wolke aus Qualm –, flog ein langes, schwarzes Ungetüm an mir vorbei und war bereits wieder verschwunden, ehe ich Luft holen konnte. Ich warf mich herum und galoppierte, so schnell ich nur konnte, zum anderen Ende der Weide, und dort blieb ich stehen und schnaubte vor Verblüffung und Angst. Im Verlauf des Tages kamen viele andere Züge vorbei, einige davon langsamer. Diese hielten am Bahnhof in der Nähe und gaben manchmal ein furchtbares Quietschen und Ächzen von sich, ehe sie ganz zum Stehen kamen. Ich fand das furchtbar, aber die Kühe grasten friedlich weiter und hoben kaum die Köpfe, wenn das schwarze schreckliche Ding qualmend und knirschend vorbeifuhr.
Die ersten Tage konnte ich nicht in Ruhe fressen, aber als ich merkte, dass dieses schreckliche Ungetüm nie auf die Weide kam und mir nichts anhaben konnte, achtete ich nicht mehr groß darauf, und schon bald scherte ich mich genauso wenig um den vorbeifahrenden Zug wie die Kühe und die Schafe.
Seither habe ich viele Pferde gesehen, die beim Anblick oder bei den Geräuschen einer Dampflokomotive erschrecken und unruhig werden, aber da mein Herr sich so gut um mich kümmerte, habe ich an Bahnhöfen genauso wenig Angst wie in meinem eigenen Stall.
Also, wenn jemand ein junges Pferd gut einreiten will, auf diese Weise gelingt es.
Mein Herr fuhr mit mir oft im Doppelgespann mit meiner Mutter, da sie Ruhe ausstrahlte und mir besser als ein fremdes Pferd beibringen konnte, wie ich laufen sollte. Sie erklärte mir, je besser ich mich benähme, desto besser würde ich behandelt, und dass es am klügsten sei, immer das Beste zu geben, um meinen Herrn zufriedenzustellen; »Aber«, sagte sie, »es gibt so viele verschiedene Menschen. Es gibt gutmütige, besonnene Männer wie unseren Herrn, denen jedes Pferd mit Stolz dienen wird, und es gibt böse, grausame Menschen, die niemals ein Pferd oder einen Hund ihr Eigen nennen sollten. Daneben gibt es viele törichte Menschen, die eitel, ignorant und nachlässig sind und sich nie die Mühe machen, richtig nachzudenken. Diese Leute verderben mehr Pferde als alle anderen, nur weil sie keinen Verstand besitzen. Es ist zwar nicht ihre Absicht, trotzdem tun sie es. Ich hoffe, dass du in gute Hände gerätst, aber ein Pferd kann nie wissen, wer es womöglich kauft oder wer es vor die Kutsche spannt; es ist für uns alle Zufall. Aber ich sage dennoch, tue dein Bestes, wo immer du auch sein wirst, und mach deinem guten Namen Ehre.«
4. KAPITEL
Birtwick Park
Zu dieser Zeit stand ich meistens im Stall, und jeden Tag wurde mein Fell gestriegelt, bis es wie die Schwinge einer Saatkrähe glänzte. Es war noch früh im Mai, als ein Mann von Squire Gordon kam, der mich zum Gutshaus brachte. Mein Herr sagte: »Auf Wiedersehen, Darkie. Sei ein braves Pferd und gib immer dein Bestes.« Ich konnte nicht auf Wiedersehen sagen und legte ihm daher meine Nase in die Hand. Er tätschelte mir liebevoll das Fell, und so verließ ich mein erstes Zuhause. Da ich einige Jahre bei Squire Gordon lebte, kann ich auch gleich ein wenig von dem Ort erzählen.
Das Anwesen von Squire Gordon grenzte an das Dorf Birtwick. Man betrat das Gelände durch ein großes, schmiedeeisernes Tor, an dem die erste Pförtnerloge stand, und dann trottete man weiter auf einem ebenen Weg, vorbei an Gruppen hoher alter Bäume, danach folgten ein weiteres Pförtnerhaus und noch ein Tor, das zum Gutshaus und zu den Gärten führte. Dahinter lagen die Koppel, der alte Obstgarten und die Stallungen. Dort war Platz für viele Pferde und Kutschen, aber ich brauche lediglich den Stall zu beschreiben, in den ich geführt wurde. Dieser war sehr geräumig, mit vier ordentlichen Boxen; ein großes Fenster, das zum Hof aufschwang, machte den Raum angenehm und luftig.
Die erste Box war groß und rechteckig und wurde mit einem hölzernen Gatter verschlossen. Bei den anderen handelte es sich um gewöhnliche, ganz passable Boxen, die aber nicht annähernd so groß waren. In der ersten Box standen eine niedrige Raufe für Heu und eine niedrige Krippe für Getreide. Man nannte sie Laufboxen, weil das Pferd, das man dort unterbrachte, nicht angebunden wurde, sondern herumlaufen konnte, wie es wollte. Es ist wunderbar, wenn man eine Laufbox hat.
In dieser schönen Box brachte mich der Stallknecht unter, sie war sauber, angenehm und luftig. Nie war ich in einer besseren Box als dieser, und die Wände waren nicht so hoch gemauert, so dass ich alles, was um mich herum geschah, durch die Eisenstäbe sehen konnte, die darauf angebracht waren.
Der Mann gab mir ausgezeichneten Hafer, klopfte mir aufs Fell, sprach freundlich zu mir und ging dann wieder.
Nachdem ich mein Getreide gefressen hatte, sah ich mich um. In der Box neben meiner stand ein kleines, dickes graues Pony, das eine dichte Mähne und einen dichten Schweif hatte, dazu einen sehr hübschen Kopf und eine kecke kleine Nase.
Ich brachte meinen Kopf nah an die Eisenstangen oben an meiner Box und sagte: »Guten Tag. Wie heißt du?«
Das Pony drehte sich zu mir um, soweit es sein Halfter zuließ, hob den Kopf und sagte: »Ich heiße Merrylegs2: Ich sehe sehr gut aus. Ich trage die jungen Damen auf meinem Rücken, und manchmal fahre ich unsere Herrin in der niedrigen Kutsche aus. Sie halten große Stücke auf mich, übrigens auch James. Wirst du jetzt in der Box neben mir leben?«
Ich sagte: »Ja.«
»Also dann«, sagte Merrylegs, »ich hoffe, du bist gutmütig. Ich mag nämlich niemanden nebenan haben, der beißt.«
In diesem Augenblick tauchte der Kopf einer Stute aus der Box dahinter auf. Sie hatte die Ohren zurückgelegt, und in ihrem Auge lag ein ziemlich übellauniger Ausdruck. Es war eine hochgewachsene Fuchsstute mit einem langen wohlgeformten Hals. Sie sah zu mir herüber und sagte:
»Du bist das also, der mich aus meiner Box verjagt hat. Das ist sehr ungewöhnlich für ein Fohlen wie dich, einfach herzukommen und eine Dame aus ihrem Zuhause zu vertreiben.«
»Entschuldige mal«, sagte ich, »ich habe niemanden vertrieben. Der Mann, der mich herbrachte, hat mich hier untergestellt, ich hatte damit nichts zu tun. Und wenn du mich für ein Fohlen hältst: Ich bin vier geworden und jetzt ein ausgewachsenes Pferd. Ich habe mich noch nie mit Pferden oder gar Stuten gestritten, und ich möchte auch weiterhin in Frieden leben.«
»Nun gut«, sagte sie, »wir werden ja sehen. Ich werde mich jedenfalls nicht mit so einem jungen Ding wie dir herumstreiten.« Dazu sagte ich nichts mehr.
Am Nachmittag, als sie nach draußen kam, erzählte mir Merrylegs alles.
»Die Sache ist die«, sagte er, »Ginger hat die schlechte Angewohnheit zu beißen und zuzuschnappen. Deshalb nennen sie sie auch Ginger3, und als sie in der Laufbox war, schnappte sie oft zu. Einmal hat sie James in den Arm gebissen, dass er blutete, und deshalb hatten Miss Flora und Miss Jessie, die mich beide sehr mögen, Angst, den Stall zu betreten. Sie haben mir immer leckere Sachen mitgebracht, einen Apfel oder eine Möhre oder ein Stück Brot, aber seitdem Ginger in dieser Box untergebracht war, trauten sie sich nicht mehr hierher, und ich vermisste sie sehr. Ich hoffe, dass sie bald wiederkommen, solange du nicht beißt oder zuschnappst.«
Ich sagte ihm, ich hätte noch nie in etwas anderes als Gras, Heu und Getreide gebissen und könne mir nicht vorstellen, was Ginger daran gefiel.
»Nun, ich glaube nicht, dass es ihr gefällt«, sagte Merrylegs, »es ist bloß eine schlechte Angewohnheit von ihr. Sie meinte, niemand sei je freundlich zu ihr gewesen, und wieso solle sie dann nicht beißen? Natürlich ist das eine sehr schlechte Angewohnheit, aber ich bin mir sicher, wenn all das stimmt, was sie sagt, dann muss sie sehr schlecht behandelt worden sein, ehe sie hierhergekommen ist. John lässt nichts unversucht, damit sie sich hier wohlfühlt, und James tut auch, was er kann, und unser Herr greift nie zur Peitsche, wenn ein Pferd sich ordentlich benimmt. Daher denke ich, dass sie hier ausgeglichen und gutmütig sein könnte. Weißt du«, fügte er mit weisem Blick hinzu, »ich bin jetzt zwölf Jahre alt. Ich weiß eine ganze Menge, und ich kann dir sagen, dass es für ein Pferd keinen besseren Ort im ganzen Land gibt als diesen hier. John ist der beste Stallknecht, den es je gab, er ist seit vierzehn Jahren hier. Und nie hast du einen freundlicheren Jungen als James gesehen, daher ist es ganz allein Gingers Schuld, dass sie nicht in dieser Box bleiben durfte.«
5. KAPITEL
Ein gelungener Einstand
Der Kutscher hieß John Manly. Er hatte eine Frau und ein kleines Kind, und sie wohnten im Cottage des Kutschers ganz nah bei den Stallungen.
Am nächsten Morgen führte er mich auf den Hof und striegelte mich ausgiebig, und gerade als ich zurück in meine Box ging, das Fell weich und glänzend, kam der Squire, um einen Blick auf mich zu werfen. Er wirkte zufrieden. »John«, sagte er, »ich wollte das neue Pferd heute Morgen probereiten, aber ich muss erst noch andere Dinge erledigen. Nach dem Frühstück kannst genauso gut du mit ihm ausreiten. Nimm den Weg über die Gemeindewiese und durch Highwood, danach zurück über die Wassermühle und am Fluss entlang, dann sehen wir, wie er läuft.«
»Sehr wohl, Sir«, sagte John. Nach dem Frühstück kam er und legte mir das Zaumzeug an. Er achtete sehr genau darauf, die Riemen so anzubringen, dass sie mir bequem am Kopf lagen. Dann brachte er den Sattel, der aber nicht breit genug für meinen Rücken war; das sah er sofort und holte einen anderen, der genau passte. Zuerst ritt er mich langsam, dann im Trab, darauf im leichten Galopp, und als wir auf der Gemeindewiese waren, tippte er mich leicht mit der Gerte an, und wir fielen in einen prächtigen Galopp.
»Ho, ho, mein Junge!«, rief er, während er mich zügelte, »mir scheint, du würdest am liebsten gleich den Jagdhunden nachsetzen.«
Als wir wieder auf dem Gelände von Birtwick Park waren, trafen wir auf den Squire und auf Mrs. Gordon, die gerade einen Spaziergang machten. Sie blieben stehen, und John sprang ab.
»Und, John, wie macht er sich so?«
»Erstklassig, Sir«, erwiderte John. »Er ist flink wie ein Reh und hat ein ruhiges Wesen. Die leichteste Berührung der Zügel reicht, um ihn zu führen. Unten auf der Gemeindewiese stießen wir auf einen dieser fahrenden Händler, dessen Karren übervoll beladen war mit Körben, Teppichen und derlei Sachen. Sie wissen ja, Sir, viele Pferde werden unruhig, wenn sie diese Karren passieren. Aber er hat einmal einen Blick drauf geworfen und ist dann weitergelaufen, so ruhig und angenehm, wie es nur geht. In der Nähe von Highwood machten sie Jagd auf Kaninchen, und ganz in der Nähe wurde ein Schuss abgefeuert. Er ist kurz stehengeblieben und hat sich umgeschaut, ist aber kein Stück nach rechts oder links ausgewichen. Ich habe die Zügel ruhig gehalten und ihn nicht gedrängt, und ich bin der Meinung, dass er nicht eingeschüchtert oder schlecht behandelt wurde, als er jung war.«
»Gut so«, sagte der Squire, »ich werde es morgen selbst mit ihm versuchen.«
Am nächsten Tag wurde ich zu meinem Herrn gebracht. Ich erinnerte mich an die Ratschläge meiner Mutter und meines früheren Herrn, also versuchte ich, genau das zu tun, was er von mir verlangte. Ich stellte fest, dass er ein sehr guter Reiter war und auch Rücksicht auf sein Pferd nahm. Wir kehrten nach Hause zurück, und die Dame wartete an der Tür, als der Squire auf das Gutshaus zuritt.
»Und, mein Lieber«, sagte sie. »Wie gefällt er dir?«
»Er ist genau so, wie John es gesagt hat«, antwortete er. »Ich hätte mir kein umgänglicheres Geschöpf zum Aufsitzen wünschen können. Wie sollen wir ihn nennen?«
»Wie wäre es mit Ebony?«, meinte sie. »Er ist so schwarz wie Ebenholz.«
»Nein, nicht Ebony.«
»Möchtest du ihn vielleicht Blackbird nennen, wie das alte Pferd deines Onkels?«
»Nein, er sieht doch viel besser aus als der alte Blackbird.«
»Ja«, sagte sie, »er ist wirklich eine Schönheit, und er hat ein so liebes, gutmütiges Gesicht und so feine, kluge Augen – was hältst du davon, wenn wir ihn Black Beauty nennen?«
»Black Beauty – nun, ja, ich denke, das wäre ein sehr guter Name. Wenn du möchtest, soll er fortan so heißen«, und so war es beschlossen.
Als John in den Stall kam, erzählte er James, dass der Herr und die Herrin einen guten und vernünftigen englischen Namen für mich ausgesucht hätten, der auch etwas bedeutete, anders als Marengo, Pegasus oder Abdallah. Sie mussten beide lachen, und James meinte: »Wenn es nicht alte Erinnerungen wachrufen würde, hätte ich ihn Rob Roy genannt, denn mir sind nie zwei Pferde untergekommen, die einander so ähnlich sahen.«
»Kein Wunder«, sagte John, »wusstest du nicht, dass die alte Duchess vom Farmer Grey die Mutter von beiden ist?«
Das war mir noch nicht zu Ohren gekommen. Demnach war der arme Rob Roy, der bei der Jagd ums Leben gekommen war, mein Bruder! Ich wunderte mich nicht mehr, dass meine Mutter so bekümmert gewesen war. Es hat den Anschein, als hätten Pferde keine Verwandten. Zumindest erkennen sie einander nicht wieder, nachdem sie verkauft wurden.
John schien sehr stolz auf mich zu sein: Er pflegte meine Mähne und meinen Schweif, dass sie fast so weich wurden wie das Haar einer Dame, und er redete viel mit mir. Natürlich verstand ich nicht alles, was er sagte, aber nach und nach begriff ich, was er meinte und was er von mir wollte. Ich mochte ihn sehr gern, er war so liebenswürdig und freundlich. Er schien genau zu wissen, wie sich ein Pferd fühlt, und wenn er mich striegelte, wusste er, wo meine empfindlichen und die kitzeligen Stellen waren. Wenn er meinen Kopf bürstete, strich er so behutsam über meine Augen, als wären es seine eigenen, und niemals verbreitete er schlechte Laune.
James Howard, der Stallbursche, war auf seine Art ebenso freundlich und angenehm, also fand ich, es ginge mir gut. Da gab es noch einen Mann, der im Hof aushalf, aber er hatte kaum etwas mit Ginger und mir zu tun.
Wenige Tage später musste ich zusammen mit Ginger die Kutsche ausfahren. Ich fragte mich, wie wir miteinander auskommen sollten, aber abgesehen davon, dass sie die Ohren zurücklegte, als ich zu ihr geführt wurde, benahm sie sich sehr gut. Sie kam ihrer Arbeit bereitwillig nach und tat ihren Teil, und ich könnte mir keinen besseren Partner im Zweiergespann wünschen. Wenn wir eine Anhöhe erreichten, verlangsamte sie das Tempo nicht, sondern stemmte sich mit ihrem ganzen Gewicht ins Kummet und zog geradewegs weiter. Bei der Arbeit legten wir beide eine ähnliche Beherztheit an den Tag, und John musste uns häufiger mäßigen als antreiben. Bei keinem von uns musste er zur Peitsche greifen, auch unsere Gangarten waren einander recht ähnlich. Mir fiel es leicht, beim Traben mit ihr Schritt zu halten, was die Sache angenehm machte, und unserem Herrn gefiel es immer, wenn wir gut miteinander Schritt hielten, genau wie John. Nachdem wir zwei- oder dreimal zusammen ausgefahren waren, hatten wir uns recht gut angefreundet und aneinander gewöhnt, so dass ich mich wie zu Hause fühlte.
Was Merrylegs betraf, so wurden er und ich schon bald gute Freunde. Er war so ein fröhlicher, beherzter ausgeglichener kleiner Bursche, dass er bei allen beliebt war, vor allem bei Miss Jessie und Miss Flora, die oft auf ihm durch den Obstgarten ritten und lustige Spiele mit ihm und ihrem kleinen Hund Frisky spielten.
Unser Herr hatte noch zwei weitere Pferde, die in einem anderen Stall untergebracht waren. Eines war Justice, ein Rotschimmel, der zum Reiten oder für den Gepäckkarren benutzt wurde. Das andere war ein altes braunes Jagdpferd, das Sir Oliver hieß. Dieser Hengst war aus dem Arbeitsalter heraus, aber unser Herr hatte ihn ins Herz geschlossen und ließ ihn frei im Park des Anwesens herumlaufen. Manchmal zog er noch kleinere Lasten auf dem Gutshof oder trug eine der jungen Damen, wenn sie mit ihrem Vater ausritten. Denn er war sehr sanftmütig, und man konnte ihm ein Kind genauso anvertrauen wie Merrylegs. Der Rotschimmel war ein kräftiges, gut gebautes ausgeglichenes Pferd, und gelegentlich hielten wir ein Schwätzchen auf der Koppel, aber natürlich war ich mit ihm nicht so eng befreundet wie mit Ginger, die im selben Stall untergebracht war wie ich.
6. KAPITEL
Freiheit
Ich war glücklich in meinem neuen Zuhause, und wenn es doch etwas gab, das ich vermisste, darf man nicht glauben, dass ich unzufrieden war. Alle, die mit mir zu tun hatten, waren gut zu mir, und ich hatte einen hellen luftigen Stall und bekam das beste Futter. Was wollte ich noch mehr? Freiheit natürlich! Für dreieinhalb Jahre meines Lebens hatte ich alle nur erdenklichen Freiheiten genossen, doch jetzt musste ich Woche um Woche, Monat um Monat und zweifellos Jahr um Jahr Tag und Nacht in einem Stall stehen, außer wenn man mich brauchte, und dann musste ich genauso sicher und ruhig laufen wie jedes andere Pferd, das schon zwanzig Jahre gearbeitet hat. Riemen hier und Riemen dort, ein Gebiss im Maul und Scheuklappen vor den Augen. Nun, ich will mich nicht beklagen, weil ich weiß, dass es so sein muss. Ich will damit nur sagen, dass es für ein junges Pferd voller Kraft und Elan, das an offene Felder oder weite Ebenen gewöhnt ist, wo es den Kopf zurückwerfen, den Schweif hochstellen und in gestrecktem Galopp dahinjagen kann, dann eine Runde und mit einem Schnauben zu den Gefährten wieder zurück – ich will sagen, dass es hart ist, wenn man nie ein bisschen mehr Freiheit hat, um das tun zu können, was man tun möchte. Manchmal, wenn ich weniger Auslauf gehabt hatte als gewöhnlich, war ich so voller Leben und Feuereifer, dass ich nicht richtig stillhalten konnte, wenn John mich zum Ausreiten nach draußen führte. Ich konnte nicht anders, es schien, als müsste ich springen oder hüpfen oder tänzeln, und bestimmt habe ich ihn oft ganz schön durchgeschüttelt, vor allem zu Anfang. Aber er war immer gutmütig und geduldig.
»Nur ruhig, mein Junge«, sagte er dann, »warte noch ein bisschen, dann haben wir freie Bahn, und dann wird es dir nicht mehr in den Hufen jucken.« Kurz darauf, sobald wir das Dorf hinter uns gelassen hatten, ließ er mich ein paar Meilen in flottem Trab laufen, und danach brachte er mich zurück so frisch wie zuvor, nur ohne dieses Gezappel, wie er es nannte. Temperamentvolle Pferde, die nicht genug Bewegung bekommen, werden oft ungebärdig genannt, obwohl sie doch nur verspielt sind. Und einige Pferdeknechte bestrafen sie dann dafür, aber das tat unser John nicht, er wusste, dass es nur mein lebhafter Charakter war. Dennoch, er gab mir auf seine Weise durch seinen Tonfall oder die Zügel zu verstehen, was er wollte. Wenn er sehr ernst und entschlossen war, merkte ich ihm das immer an der Stimme an, und das bewirkte bei mir mehr als alles andere, denn ich hatte ihn sehr gern.
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass wir manchmal für ein paar Stunden unsere Freiheit hatten, meist an schönen Sonntagen im Sommer. Die Kutsche wurde an Sonntagen nämlich nie benutzt, weil die Kirche nicht weit entfernt lag.
Für uns war es ein besonderes Vergnügen, zu Hause auf die Koppel oder in den alten Obstgarten gelassen zu werden. Das Gras fühlte sich so kühl und weich unter den Hufen an, die Luft war so rein und es war so angenehm, die Freiheit zu haben, das zu tun, was uns gerade gefiel: galoppieren, hinlegen, auf den Rücken rollen oder das leckere Gras knabbern. Dann war das genau die richtige Zeit zum Plaudern, wenn wir im Schatten der hohen Kastanie zusammenstanden.
7. KAPITEL
Ginger
Eines Tages, als Ginger und ich allein im Schatten standen, unterhielten wir uns länger. Sie wollte wissen, wie ich aufgezogen und eingeritten worden war, und ich erzählte ihr alles.
»Tja«, meinte sie, »wenn ich so aufgezogen worden wäre wie du, dann hätte ich vielleicht auch so eine ruhige Gemütsart wie du, aber ich glaube nicht, dass ich je so werde.«
»Wieso nicht?«, fragte ich.
»Weil bei mir alles so anders gelaufen ist«, antwortete sie. »Ich hatte nie jemanden, weder Mensch noch Pferd, der nett zu mir war oder dem ich hätte gefallen wollen. Es ging nämlich schon damit los, dass man mich von meiner Mutter trennte, kaum dass ich entwöhnt war, und zu vielen anderen Fohlen steckte: keinem von ihnen lag etwas an mir, und mir lag nichts an ihnen. Ich hatte keinen freundlichen Herrn wie