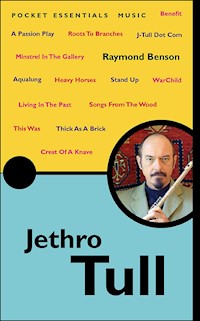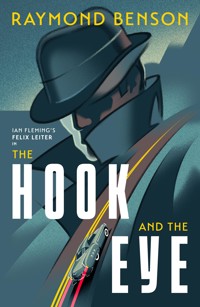Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Black Stiletto
- Sprache: Deutsch
"Sollten Sie BLACK STILETTO bisher noch nicht auf dem Schirm gehabt haben, stimmt vielleicht etwas mit Ihrem Schirm nicht." [Lee Child, New York Times Bestseller-Autor der Jack-Reacher-Romane] Zu ihrer Zeit war BLACK STILETTO eine Legende; eine Untergrund-Heldin, die während der späten Eisenhower-Ära und den frühen Jahren unter Kennedy in New York City einige Berühmtheit erlangte. Obwohl sie gesucht wurde und eingesperrt worden wäre, wenn man sie gefasst oder ihre Identität gelüftet hätte, war die BLACK STILETTO eine kompetente und höchst erfolgreiche Verbrechensbekämpferin. Doch irgendwann in den 1960er-Jahren verschwand sie von der Bildfläche, und man hörte nie wieder von ihr. Die meisten Menschen glaubten, sie wäre gestorben, und niemand erfuhr je, wer hinter der Kostümierung steckte. Bis heute blieben viele Fragen unbeantwortet: Wer war sie? Ist sie noch am Leben? Und wenn ja, wo? Als Martin eine Reihe von Tagebüchern mit den Aufzeichnungen seiner Mutter findet, ist er überwältigt. Sie soll die Untergrund-Heldin vergangener Tage gewesen sein? So steht es zumindest bis ins kleinste Detail in diesen Tagebüchern geschrieben: Wie es dazu kam, dass sie zu einer Kämpferin für die Gerechtigkeit wurde, warum sie sich dazu entschloss, außerhalb des Gesetzes zu agieren, all ihre Heldentaten als berühmt berüchtigte Superheldin, und wie sich ihr Ruf plötzlich ins Gegenteil verkehrte. Kurzum - wie sich alles zutrug. Konnte das wahr sein? Talbot ist voller Zweifel und Unglauben. Doch dann tritt ein alter Erzfeind von BLACK STILETTO auf den Plan, welcher gnadenlos Rache nehmen will, und damit nicht nur ihr eigenes, sondern auch das Leben ihres Sohnes und ihrer Enkelin gefährden könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Black Stiletto
Das erste Tagebuch - 1958
Raymond Benson
übersetzt von Peter Mehler
für Randi
Copyright © 2011 by Raymond Benson Die Originalausgabe erschien 2011 bei Oceanview Publishing, USA, unter dem Titel »The Black Stiletto«. Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de).
The original edition was published in 2011 at Oceanview Publishing, USA, under the title »The Black Stiletto«. This book was arranged by erzähl:perspektive Literary Agency, Munich (www.erzaehlperspektive.de)
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: THE BLACK STILETTO Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Peter Mehler
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-163-9
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Für weitere spannende Bücher besuchen Sie bitte
unsere Verlagsseite unter luzifer-verlag.de
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen und senden Ihnen kostenlos einen korrigierten Titel.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
Danksagungen
Der Autor möchte sich bei den folgenden Personen für ihre Hilfe bedanken: Michael Adkins, Tasha Alexander, Brian Babendererde, Michael A. Black, Michael Colby, Brad Hansen, Jeff Knox, Alisa Kober, Ganita Koonopakarn, Toby Markham, Christine McKay, James McMahon, Henry Perez, Heather La Bella, Justine Ruff, Pat und Bob, Frank, Susan, und jedem bei Oceanview Publishing, sowie Peter Miller und den lieben Menschen bei der PMA Literary & Film Management, Inc.
Anmerkung des Autors
Obwohl alles unternommen wurde, um die Stadt New York und das westliche Texas der 1950er korrekt darzustellen, sind das Second Avenue Gym bzw. das Shapes sowie das East Side Diner frei erfunden. Was die Architektur des Algonquin Hotels, des Plaza Hotels und des New York Athletic Jacht Klubs anbelangt, finden sich dort ein paar Freiheiten, doch die meisten der vorliegenden Beschreibungen sind sehr nah an den tatsächlichen Gegebenheiten während der geschilderten Zeitperiode.
1| Martin
Gegenwart
Meine Mutter war die maskierte Rächerin, bekannt als Black Stiletto.
Das habe ich heute erst herausgefunden, und ich bin seit achtundvierzig Jahren ihr Sohn. Ich wusste mein ganzes Leben lang, dass sie ihre Geheimnisse hatte, aber es ist wohl unnötig zu sagen, dass das ein kleiner Schock für mich ist.
Zuerst dachte ich, es wäre ein Witz. Ich meine, mal im Ernst. Meine Mutter? Eine kostümierte Kämpferin für Recht und Gesetz? Schon klar, guter Witz. Und dann ausgerechnet die Black Stiletto? Kein Mensch würde mir das glauben. Ich bin ja noch nicht einmal sicher, ob ich es selbst glaube, obwohl ich eindeutige Beweise dafür hier vor mir habe.
Die Black Stiletto. Eine der berühmtesten Personen auf diesem Planeten.
Und sie siecht dahin. In einem Pflegeheim.
Oh. Mein. Gott.
Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich davon halten soll.
Ganz sicher war es nicht das, was ich erwartet hatte, als mich Onkel Thomas an diesem schönen Nachmittag im Mai in sein Büro bestellte. Er ist nicht wirklich mein Onkel, eher ein Freund der Familie. Ich vermute, dass er und meine Mutter früher mal was miteinander hatten, als ich noch ein Kind war, aber sie waren Freunde geblieben, und später trat er als ihr Sachverwalter auf. Sie müssen wissen – meine Mutter, Judy Talbot, ist zweiundsiebzig Jahre alt. Und sie hat Alzheimer. Das ist eine furchtbare Krankheit, und sie schlug unerbittlich zu. Schlich sich nicht einfach langsam an, wie sie das bei den meisten Erkrankten tat. Es war beinahe so, als ging es ihr den einen Tag noch gut, und dann konnte sie sich schon nicht mehr an meinen Namen erinnern. Fünf Jahre später, nachdem die Krankheit bei ihr ausgebrochen war, musste ich sie ins Woodlands North bringen. Das war unangenehm, aber nötig, und ohne Onkel Thomas hätte ich es nicht geschafft. Die Ironie an der Sache ist, dass es ihr körperlich noch ziemlich gut geht. Sie war schon immer gut in Schuss, trotz der Trinkerei und der Depressionen. Doch dann, eines Tages, schaltete ihr Gehirn ab, und sie konnte sich nicht mehr um sich selbst kümmern. Die körperlichen Beschwerden, mit denen sie jetzt zu kämpfen hat, sind schlicht Begleiterscheinungen des Pflegeheims, in dem sie seit zwei Jahren verkümmert. Ja, sie stirbt, einen langsamen und schlimmen Tod. Die Ärzte wissen nicht, wie lange ihr noch bleibt. Bei Alzheimer weiß man das nie.
Das Büro von Onkel Thomas befindet sich in Arlington Heights, Illinois. Das ist ein Vorort im Nordwesten von Chicago. Ich bin da aufgewachsen. Ich wohnte mit meiner Mutter in einem Haus in der Nähe des Zentrums, von wo aus wir einen Pendelzug nehmen konnten, wenn wir in die große Stadt wollten.
Arlington Heights war früher ein flippiger, malerischer kleiner Ort, in dem nicht viel los war, als ich dort in den Sechzigern und Siebzigern aufwuchs. Heutzutage haben sie ihn zugebaut und zu einem Ausgehviertel gemacht, mit Kinos, trendigen Restaurants, Nachtklubs und Geschäften. Aber ich lebe da nicht mehr.
Ich wohne jetzt etwas weiter nördlich, in einem Ort namens Buffalo Grove. Ich lebe allein, obwohl ich eine Tochter habe. Sie wohnt bei ihrer Mutter – meiner Ex-Frau – in Lincolnshire. Diese Orte liegen alle nah beieinander. Deshalb ist es kein großer Umstand, bei Onkel Thomas vorbeizuschauen, oder meine Mutter in Woodlands zu besuchen, das in Riverwoods liegt. Und das tue ich. Also, meine Mutter besuchen, meine ich. Wenigstens einmal die Woche. Abgesehen von meiner Tochter, die sie ab und an besuchen kommt, bin ich der Einzige, den sie noch hat – auch wenn sie die meiste Zeit keine Ahnung hat, wer ich bin.
Janie, Onkel Thomas' Sekretärin, begrüßte mich herzlich, als ich ins Büro kam. Wir tauschten ein paar kurze Nettigkeiten aus und dann meinte sie, dass ich zu ihm hinein kann. Er saß an seinem Schreibtisch und brütete über einem Stapel Dokumente. Onkel Thomas ist etwa so alt wie meine Mutter und arbeitet immer noch acht Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Er sah auf, lächelte und erhob sich. Wir gegrüßten uns, schüttelten einander die Hände, dann bot mir einen Sessel an. Er lief um seinen Schreibtisch herum und schloss die Tür, damit wir ungestört waren.
»Also, was gibt's?«, fragte ich. Am Telefon hatte er sich ziemlich geheimnisvoll angehört.
»Martin, ich habe hier etwas, dass ich dir geben soll.« Er deutete auf seinen Tisch und auf eine schwarze, metallene Schatulle, eine von der Art, in der man Dokumente oder Wertsachen aufbewahrt. Daneben lag ein A4-großer Umschlag mit meinem Namen und meiner Adresse darauf.
»Was ist das?«
»Das ist von deiner Mutter.« Als ich die Stirn runzelte, fuhr er fort. »Sie hat das schon vor langer Zeit vorbereitet. Vor fünfzehn Jahren, um genau zu sein. Für den Fall, dass sie stirbt oder nicht mehr geschäftsfähig ist, sollte ich dafür sorgen, dass du diese Dinge bekommst. Diesen Brief, und diese Schatulle.«
»Wo war das die ganze Zeit?«, fragte ich.
»Ich hab es aufbewahrt. Treuhänderisch, sozusagen.«
»Weißt du, was drin ist?«
»Nein, Martin, das weiß ich nicht. Deine Mutter hat sehr deutlich gemacht, dass der Inhalt privat und vertraulich ist. Ich habe einige Zeit mit mir gerungen, wann ich es dir geben soll. Ich denke, der Zeitpunkt ist gekommen, wo man sich eingestehen sollte, dass deine Mutter tatsächlich nicht mehr Herr ihrer Sinne ist. Sie wird sich von dieser furchtbaren Krankheit nicht mehr erholen, es sei denn, man erfindet noch ein Wundermittel, und die Chancen stehen schlecht, dass sie das erleben wird. Nun, deshalb sind wir jetzt hier. Tut mir leid, dass ich so lange gewartet habe.«
Ich war nicht sauer auf ihn. Ich konnte die Zwickmühle verstehen, in der er steckte, aber viel mehr interessierte ich mich für das Zeug auf dem Tisch. Was konnte sie besitzen, dass diese Geheimniskrämerei rechtfertigte?
»Na, dann wollen wir mal sehen.« Ich hielt ihm die Hand entgegen, und er gab mir zuerst den Umschlag. Es fühlte sich so an, als würde er – logischerweise – einen Brief enthalten und etwas Schwereres aus Metall. Vielleicht der Schlüssel für die Schatulle?
Ich öffnete den Umschlag, und tatsächlich viel ein kleiner Schlüssel in meinen Schoß. Ich legte ihn erst einmal beiseite, zog den Brief heraus und las ihn.
Der Brief war auf der alten elektrischen Schreibmaschine geschrieben worden, die wir früher besaßen. Meine Mutter hatte handschriftlich das Datum hinzugefügt und am unteren Ende mit »Judith May Talbot« unterschrieben.
Ich musste ihn drei Mal lesen, um zu verstehen, was da geschrieben stand.
Onkel Thomas musterte mich gespannt. »Du brauchst mir nicht zu sagen, was darin steht, wenn du es nicht willst«, erklärte er. Dennoch sah ich ihm an, dass er vor Neugier platzte.
Für eine Weile saß ich in dem Sessel und war wie vor den Kopf geschlagen. Mir war nach Lachen zumute, und ich glaube, ich habe tatsächlich gelacht. Ich fragte Onkel Thomas, ob das ein Scherz sein sollte. Er antwortete, dass es kein Scherz sei und fragte, wie ich darauf käme.
»Schon gut«, antwortete ich.
Dann las ich den Brief noch einmal. Schüttelte den Kopf.
Es war ein Geständnis. Darin gab meine Mutter zu, dass ihr Name in Wirklichkeit Judith May Cooper lautete, und dass sie die Black Stiletto gewesen war. Sie hatte dieses Geheimnis seit den Sechzigern für sich behalten, als sie ihr Kostüm an den Nagel hängte, ihren Namen änderte und versuchte, ein normales Leben zu führen. Meine Zweifel ahnte sie voraus und wies darauf hin, dass mich der Inhalt der Schatulle überzeugen würde. Außerdem sicherte sie mir die Rechte an ihrer Lebensgeschichte zu. Kurzum, sie überließ es mir, ob ich mit ihrem Geheimnis an die Öffentlichkeit gehen wollte oder nicht.
Ich faltete den Brief zusammen und schob ihn zurück in den Umschlag. Dann nickte ich in Richtung der Schatulle. »Dann schau ich da mal rein.« Onkel Thomas reichte sie mir, und ich benutzte den kleinen Schlüssel, um sie aufzuschließen. Ich war nicht sicher, ob es mir recht war, wenn er sah, was sich darin befand, und er schien das zu bemerken.
»Vielleicht sollte ich dich kurz damit allein lassen?«
»Wenn es dir nichts ausmacht, Onkel Thomas?«
»Überhaupt nicht. Ruf mich einfach, wenn du mich brauchst.«
Er verließ den Raum und schloss die Tür hinter sich. Ich öffnete den Deckel und fand ein zusammengefaltetes Stück Papier, drei Schlüssel an einem Schlüsselring und ein paar andere Kleinigkeiten darin. Ich nahm den Zettel heraus, faltete ihn auseinander und blickte auf eine Art Grundriss. Für eine Weile studierte ich den Plan, bis mir dämmerte, dass es der Grundriss unseres Kellers war. In dem Haus, wo ich aufwuchs. Wo seit zwei Jahren niemand mehr lebte. Es stand zum Verkauf, aber niemand interessierte sich auch nur ansatzweise dafür. Die Maklerin, Mrs. Reynolds, fand dafür immer wieder die gleichen Ausflüchte – die Marktlage sei schlecht, die Wirtschaft sei schuld, an dem Haus müsste etwas gemacht werden und so weiter.
Wofür also waren die Schlüssel? Zwei von ihnen waren grau und und schienen dafür gedacht, Türen zu öffnen. Der Dritte war klein und goldfarben.
Ich sah mir den Grundriss noch einmal an, und dann fiel mir ein Raum auf, den es eigentlich nicht hätte geben dürfen.
Moment mal!
Eine Wand trennte diesen Raum vom restlichen Keller ab – eine Wand, von der ich bisher nicht wusste, dass man hindurchgehen konnte. Der Plan deutete an, dass sich eine Tür in der Wand befinden musste. Ich hatte dort nie eine Tür gesehen. Einer oder beide der Schlüssel waren für sie bestimmt. Und wenn das stimmte, wofür war dann der goldene Schlüssel gedacht?
Noch rätselhafter waren die anderen Gegenstände, die ich nacheinander inspizierte.
Ein herzförmiges Medaillon an einer Kette, anscheinend versilbert.
Ein Anstecker für die Kennedy/Johnson-Präsidentschaftswahlen von 1960.
Und eine kleine Blechbüchse mit einer 8mm-Filmrolle darin.
Ich packte alles wieder schnell zurück in die Schatulle, stand auf und trug sie ins angrenzende Büro. Onkel Thomas stand an der Kaffeemaschine und Janie saß noch immer an ihrem Schreibtisch.
»Fertig?«, fragte er.
»Ja. Äh, danke.«
»Kann ich noch etwas für dich tun?«
»Das weiß ich noch nicht.«
»Du siehst etwas blass aus. Stimmt etwas nicht? Was war in der Kiste, Martin? Als Anwalt deiner Mutter kann ich dir versichern, dass ich …«
»Ich weiß. Und ich weiß das zu schätzen. Vielleicht komme ich darauf zurück. Ich muss das erst mal verarbeiten. Ich ruf dich später an, okay?«
»Gerne doch, Martin. Hättest du gern ein Glas Wasser?«
Das Angebot nahm ich an.
Das einstöckige Vierzimmer-Farmhaus an der Chestnut Street stammte noch aus der Zeit vor dem Krieg und hatte schon mal besser ausgesehen. In den Siebzigern war es sicher mal recht hübsch gewesen. Damals, als meine Mutter und ich dort einzogen. Da war ich acht Jahre alt gewesen. Davor waren wir überall zuhause gewesen. Ich wurde in Los Angeles geboren, aber die ersten Jahre meines Lebens waren wir ständig auf Achse. Ich erinnere mich an nicht mehr viel aus dieser Zeit, aber ich habe verschwommene Erinnerungen daran, dass wir viel im Auto unterwegs gewesen waren, in vielen Hotels übernachteten, hier und da in Appartements wohnten und schließlich nach Illinois kamen. Ich weiß noch, dass wir in einer kleinen Wohnung in Arlington Heights wohnten, bevor wir das Haus bezogen, und ich erinnere mich noch an den Tag, als meine Mutter mir das Haus zeigte. Sie holte mich von der Schule ab – die zweite Klasse – und sagte, dass sie eine Überraschung für mich hätte. Wir rumpelten in ihrem 64er Bonneville die Straße hinunter, und da war es. Ein richtiges Haus.
Unglücklicherweise war Mutter nicht gerade die beste Hausfrau der Welt. Sie verbrachte nur wenig Zeit mit Putzen oder damit, das Haus in Schuss zu halten. Ich hatte nicht bemerkt, wie schnell sich sein Zustand verschlechtert hatte, bis ich mit der High-School fertig war, aufs College ging und Anfang der Achtziger zu Besuch nach Hause kam. Zu dieser Zeit hatte Mutter begonnen, mehr als gewöhnlich zu trinken. Aber sie schien trotzdem okay zu sein. Sie war keine Säuferin, zumindest nicht in meiner Gegenwart. Und ich konnte auch wenig dagegen tun. Aber sie trieb Sport, ging Joggen und sah fit aus. Mutter besaß einen Sandsack, der im Keller an der Decke hing, und ich schwöre, dass sie jeden Tag hinunter ging und ihn für eine halbe Stunde bearbeitete. Sie mochte vielleicht eine Alkoholikerin sein, aber das hielt sie nicht davon ab, im Training zu bleiben.
Während ich mir so vorstellte, wie sie auf den Sandsack einschlug, immer und immer wieder, Tag für Tag, erschien mir diese Black-Stiletto-Sache nicht mehr ganz so abwegig.
Nun, jedenfalls fuhr ich von Onkel Thomas' Büro aus direkt zu dem Haus. Ein Zu-Verkaufen-Schild stand immer noch im Vorgarten, doch offenbar hatte Mrs. Reynolds es ausgetauscht. Das alte Schild war alt und verrostet gewesen, weil es schon ein paar Jahre draußen stand.
Ja, das Haus war hässlich. Es hätte in den Neunzigern bereits einen neuen Anstrich gebrauchen können, und wir schrieben jetzt 2010. Die Maklergesellschaft kümmerte sich darum, den Rasen zu mähen, aber überall sprießte das Unkraut. Die Jalousien an den Fenstern waren eingeschlagen. Das Dach hatte Löcher. Kein Wunder, dass es sich nicht verkaufte. Ich musste wirklich meinen Arsch hochkriegen und jemanden für ein paar Reparaturen anstellen.
Ich benutzte den Schlüssel meiner Mutter an der Vordertür. Drinnen roch es modrig, so wie es alte Häuser eben tun. Es war leer, denn wir hatten die meisten Möbel und Mutters Sachen vor langer Zeit weggebracht. Jetzt war nichts mehr da, außer einem fleckigen Teppich und ein oder zwei Stühlen.
Mrs. Reynold hatte ein paar Werkzeuge in der Küche deponiert, weshalb ich mir eine Taschenlampe schnappen konnte, bevor ich in den Keller ging. Der Keller war dunkel, kalt und feucht. Ich knipste die einzelne Glühbirne an der Decke an und bemerkte so etwas wie Tierköttel auf dem Betonboden. Eichhörnchen wahrscheinlich, hoffentlich keine Ratten. Ein paar leere Pappkartons lagen herum. Mutters Sandsack hing noch immer in der Mitte des Raums. Ich lief zu der fraglichen Wand und untersuchte sie. Für mich sah sie wie eine ganz normale Wand aus. Sie war Teil des Fundaments, direkt unter der Treppe. Da gab es keine Tür. Nur zwei Flecken aus Dichtungsmasse. Einer auf Augenhöhe, der andere ein paar Zentimeter darunter. Sie schienen alt und trocken und bündig mit dem Beton. Ich berührte einen davon und spürte, wie die Masse etwas nachgab. Mit den Fingerspitzen kratzte ich sie von der Wand – tatsächlich war es ein Stück Putz! Diese verspachtelten Flecken verdeckten etwas, denn darunter befanden sich Schlüssellöcher. Schnell holte ich die Schlüssel aus der Schatulle und steckte einen davon in das obere Schloss. Er ließ sich leicht herumdrehen. Auch der zweite graue Schlüssel funktionierte, und sobald die Tür unverschlossen war, sprang der Rahmen um einen halben Zentimeter auf, und ich konnte ihn mit den Fingerspitzen öffnen.
Ich glaube, ich habe aufgehört zu atmen, als ich mit der Taschenlampe in die kleine, schrankartige Öffnung leuchtete.
An der hinteren Wand hingen zwei Kostüme. Zwei Ausführungen des berühmtesten Kostüms der Welt, würde ich mal sagen.
Black Stiletto.
Ich trat hinein und berührte sie.
Beide Teile, sowohl die Hosen als auch die Oberteile, waren aus dünnem schwarzen Leder gefertigt. Eines der Kostüme bestand aus einem etwas dickeren Material als das andere, aber ansonsten waren sie identisch. Darunter standen kniehohe schwarze Stiefel. Ein Rucksack lag daneben. Die einzelne Maske war dafür gemacht, nur den oberen Teil des Kopfes zu verdecken, mit Öffnungen für die Augen, aber mich erinnerte sie schon immer an diese Sado-Maso-Geschichten, die man in Sex-Shops sah. Der Black Stiletto haftete schon immer etwas Domina-artiges an, und das lange, bevor dieser Look in den Medien populär wurde.
Das legendäre Messer – das Stiletto – steckte in seiner Scheide und hing direkt neben den Kostümen an der Wand.
Verrückt. Einfach unglaublich.
Auf Regalbrettern, die an der Seite des Wandschranks angebracht waren, stapelten sich Zeitungen, Fotografien und Comic-Hefte in Schutzfolien. Black-Stiletto-Comics – nicht viele, aber ein paar der ersten Ausgaben. Ich schätzte, dass die mittlerweile einiges an Wert haben mussten. Offenbar hatte sie diese gekauft, als sie das erste Mal erschienen waren.
In einem anderen Fach lag ein Holster mit einer Pistole darin. Ich nahm sie heraus und schaute sie mir genauer an. Ich hatte nicht viel Ahnung von Waffen, aber ich wusste, dass das so eine Art halbautomatischer Waffe sein musste. Eine Smith & Wesson, wie man der seitlichen Gravur entnehmen konnte. Neben dem Holster standen Schachteln mit Munition in dem Regal.
Und dann waren da noch die kleinen Bücher. Tagebücher. Eine ganze Reihe davon. Jedes von ihnen war mit einer Jahreszahl versehen, beginnend mit 1958.
Heilige Scheiße!
Was hatte ich da entdeckt? Was hatte meine liebe Mutter mir hier vermacht?
Wer zum Teufel war meine Mutter überhaupt?
Ich nahm das erste Tagebuch an mich und ging nach oben. Ich brauchte frische Luft. Das war alles ein bisschen viel auf einmal.
Draußen setzte ich mich auf die hölzerne Veranda und hielt das Buch in der Hand. Was würde ich erfahren, wenn ich es las? Vielleicht die Wahrheit über meinen Vater? Mom hatte mir immer erzählt, dass seine Name Richard Talbot und er zu Beginn des Vietnamkrieges gestorben war. Ich hab ihn nie kennengelernt. Das Seltsame an der Sache war, dass es nirgendwo im Haus Bilder von ihm gab. Überhaupt keine. Ich wusste nicht einmal, wie er aussah. Als ich als Teenager meine Mutter danach fragte, meine sie nur, dass sie es nicht mehr ertragen hatte, sein Gesicht zu sehen, nachdem er gestorben war. Sie hatte alle Fotografien vernichtet. Ich fragte sie über seine Familie – meine Großeltern oder irgendwelche Onkel, Tanten oder Cousins väterlicherseits – und sie antwortete, dass es keine gab. Das Gleiche bei ihrer Familie. Wir waren ganz allein.
Ich nahm das alles für bare Münze.
Ich blätterte durch das Tagebuch und hatte Angst, es zu lesen.
Meine Mutter war die Black Stiletto.
Ich war immer noch nicht darüber hinweg. Das war groß. Größer als alles, was ich mir vorstellen konnte. In etwa damit vergleichbar, die Wahrheit über das Attentat auf JFK herauszufinden oder die Identität des Green River Killers zu lüften. Black Stiletto war eine weltberühmte Legende, eine internationale Ikone für die Macht der Frau. Und niemand wusste, wer sie war, außer sie selbst. Und nun ich.
Ihre Existenz war der Ursprung für Mythen gewesen, so wie bei dem Pin-up-Model Betty Page, die in den Fünfzigern für Nacktfotografien und -filme posierte und dann plötzlich verschwand. In den Achtzigern und Neunzigern wurde Page von der Popkultur »wiederentdeckt«, und ihre Bilder tauchten überall auf – doch die Frau selbst war nicht ausfindig zu machen. Die Medien schlachteten ohne ihre Erlaubnis ihre Aufnahmen in Filmen, Comics und Magazinen aus, und dann gab sie sich schließlich zu erkennen. Das gealterte ehemalige Model lebte ruhig und zurückgezogen, ohne etwas von der medialen Aufmerksamkeit rund um ihre Person mitzubekommen, bis sie ein Freund darauf hinwies. Erst in den letzten Jahren ihres Lebens sah Page etwas von dem Geld, dass mit ihrem jugendlichen Bild verdient wurde.
Das Gleiche war mit Black Stiletto passiert.
Sie war in den letzten Jahren der Eisenhower-Ära und Anfang der Sechziger aktiv gewesen, eine Untergrund-Heldin, die sich als Kämpferin für Recht und Gesetz einen Namen gemacht hatte. Sie war eine fähige und erfolgreiche Verbrechensbekämpferin gewesen, auch wenn die Polizei ihr auf den Fersen war und man sie eingesperrt hätte, wenn man ihrer habhaft geworden wäre oder ihre geheime Identität aufgedeckt hätte. Sie kämpfte gegen gewöhnliche Gauner, kommunistische Eindringlinge, die Mafia, und war für ihre Gefangennahme oder in manchen Fällen auch deren Tod verantwortlich. Die Stiletto operierte anfänglich in New York City, doch als die Polizei ihr zu nahe kam, zog sie nach Los Angeles.
Wo ich geboren wurde.
Und dann verschwand sie auf unerklärliche Weise. Niemand hörte je wieder etwas von ihr. Niemand schien zu wissen, wer sie in Wirklichkeit war, und die meisten Leute gingen davon aus, dass sie wohl gestorben war. Warum auch nicht? Sie war in gefährliche, höchst riskante Situationen verstrickt gewesen. Es machte durchaus Sinn, dass sie tödlich verunglückte oder man sie verhaftet und ins Gefängnis gesteckt hatte, ohne dass die Behörden wussten, wen sie da wirklich eingebuchtet hatten. Eine Zeit lang war das eines der großen Rätsel wie »Wer erschoss JFK?« Was wurde aus der Black Stiletto? Wo ist sie jetzt? Lebt sie noch? Wer war sie wirklich?
Es verging ein Jahrzehnt und so langsam vergaßen die Menschen sie, bis Mitte der Achtziger ein findiger unabhängiger Comicbuch-Verleger damit begann, eine frei erfundene Serie über die kostümierte Rächerin zu publizieren. Die Comics erwiesen sich als überaus populär und wurden in die ganze Welt verkauft. Der History Channel brachte Anfang der Neunzigerjahre eine halbbiografische Dokumentation über sie heraus, die, wie ich mich erinnere, aber zum größten Teil nur Spekulationen enthielt. Es gab zumindest eine Biografie über sie, aber natürlich wusste auch diese nichts über das persönliche Leben der Stiletto zu berichten. Es war eher eine simple Aufzählung aller Begebenheiten, die über sie in den Zeitungen standen. Dann kamen das Spielzeug und das Merchandise – Actionfiguren, Videospiele, Brettspiele, Halloweenkostüme und so weiter. Eine ganze Reihe von Herstellern verdiente Millionen mit Black Stiletto, aber niemand vertrat ihre Interessen.
Ende der Neunziger erschien ein Spielfilm mit Angelina Jolie in der Hauptrolle, bevor die Schauspielerin ein großer Star wurde. Der Film war ein Erfolg, hatte aber nur wenig mit der echten Black Stiletto zu tun. Alles frei erfunden, mit jeder Menge Schießereien, Explosionen und unglaublichen Stunts. Die echte Black Stiletto bediente sich einfacherer Techniken, als man es in den Filmen zeigte. Trotzdem regte es die Fantasie der Zuschauer an. Es gab Pläne für eine Fernsehserie, aber daraus wurde nie etwas.
Wie die meisten Menschen war auch ich von der Black Stiletto begeistert. Wäre ich jünger gewesen, als die Comics erschienen, hätte ich sie sicher gekauft und gelesen.
Wenn man die kleine Sammlung von Andenken in dem Schrank bedachte, war sich meine Mutter allem Anschein nach sehr wohl bewusst über den Rummel um ihre Person. Aber sie sagte nie ein Wort. Sie hätte Gewinn aus ihrer Vergangenheit schlagen und ein kleines Vermögen machen können. Doch stattdessen lebte sie bis zum Beginn ihrer Krankheit unauffällig und zurückgezogen in den Außenbezirken von Chicago.
Ich konnte nicht länger warten. Ich öffnete das erste Tagebuch und fing an zu lesen.
2| Judys Tagebuch
4. Juli 1958
Liebes Tagebuch, ich denke, ich sollte vielleicht damit anfangen, alles niederzuschreiben. Als kleines Kind führte ich mal ein Tagebuch. Ich schrieb, glaube ich, für etwa drei Jahre hinein. Keine Ahnung, was aus ihm geworden ist. Ich schätze, es ist immer noch in Odessa und liegt in einer Schublade in meinem alten Zimmer. Sofern mein altes Zimmer noch existiert.
Ich werde von allem berichten, was mir in der letzten Zeit widerfahren ist, nur für den Fall, dass mir etwas passiert. Ich bin nicht sicher, ob ich will, dass die Wahrheit herauskommt, aber hier ist sie. In den letzten sechs Monaten ist so viel passiert. Auf gewisse Art bin ich berühmter als der Bürgermeister von New York City. Also, nicht ich, Judy Cooper. Aber die Black Stiletto. Niemand weiß, dass Judy Cooper Black Stiletto ist, und ich hoffe, dabei bleibt es auch.
Interessant, ich kann Elvis seinen neuen Song »Hard Headed Woman« irgendwo in einem Radio in der Ferne singen hören. Der Song könnte von mir handeln, haha. Wem auch immer das Radio gehört, er muss es furchtbar laut aufgedreht haben, denn ich sitze in diesem Moment auf dem Dach des Second Avenue Boxklubs und schaue mir das Feuerwerk über dem East River an. Oder es liegt daran, dass mein Gehör besser ist als das der meisten Menschen. Das ist manchmal schwer zu sagen.
Der Boxklub ist ein Zuhause, und das jetzt schon seit einer geraumen Weile. Er gehört Freddie Barnes. Freddie ist der Trainer und selbst ehemaliger Boxer. Er wohnt über dem Klub, so wie ich. Er überlässt mir jetzt seit ein paar Jahren ein Zimmer über dem Klub, und ich bezahle ihn, indem ich aushelfe, wo ich kann. Angefangen habe ich als Hausmeisterin und putzte die widerlichen Toiletten in der Herrenumkleide. Dann beförderte er mich zur Kassiererin und zur stellvertretenden Chefin. Jetzt helfe ich auch beim Training, denn ich bin ziemlich gut im Ring. Nicht viele Frauen sind das. Nicht viele Frauen machen so einen Sport. Mir macht es Spaß. Ich mag es. Eines Tages will ich ein eigenes Selbstverteidigungsprogramm für Mädchen auf die Beine stellen. Ich will nicht, dass irgendjemand als Opfer aufwächst. Niemand sollte erleben müssen, was mir als Dreizehnjährige widerfuhr.
Ich bin jetzt zwanzig Jahre alt. Am 4. November werde ich einundzwanzig. Ich lebe in New York City, seitdem ich vierzehn bin. Ich denke, man kann sagen, dass mein Leben erst hier so richtig begann, denn davor war es die Hölle – der ich zum Glück entfliehen konnte.
Ich vermute, ich sollte dieses Tagebuch damit beginnen, die Vergangenheit aufzurollen. Ich werde die nächsten Tage damit zubringen, meine Geschichte aufzuschreiben, und dann, wenn ich den 4. Juli 1958 erreicht habe, kann ich täglich oder wöchentlich regelmäßige Einträge verfassen – oder wann immer mir danach ist.
Tja, liebes Tagebuch, dann mal los. Das hier ist mein Leben, und ich muss dich warnen – manches davon ist nicht sehr schön.
Wie gesagt, ich wurde am 4. November im Jahre 1937, in Odessa, Texas, geboren. Meine Eltern tauften mich auf den Namen Judith May Cooper. Mein Vater, George Cooper, war ein Oilman, ein Ölbohrarbeiter, was während der Depression der einzige Job war, den er kriegen konnte. Er arbeitete auf den Ölförderanlagen. Ich kann nicht sagen, wie gut er darin war. Er zog nach West-Texas, als man dort 1926 Öl fand. Meine Mutter, Betty, ging Putzen. Da erging es ihr nicht besser als den farbigen Frauen, die dasselbe taten. Ich denke sogar, dass sie mehr Geld nach Hause brachte als mein Dad. Es war eine harte Zeit. Wir lebten am unteren Ende der Mittelklasse, oder vielleicht auch am oberen Ende der Unterschicht. Ich weiß nur noch, dass wir in einer Hütte am Stadtrand lebten. Und dort gab es eine Menge Menschen, die gar keinen Job hatten.
Ich hatte zwei Brüder – John war fünf Jahre und Frank drei Jahre älter als ich. Mit zwei Brüdern aufzuwachsen machte mich von Anfang an zu einem rechten Wildfang. Ich wollte die ganze Zeit über nur mit ihnen zusammen sein und Jungssachen machen – Ball spielen, Sport, Cowboy und Indianer spielen – na, du weißt schon, echte Jungssachen eben. Eines unserer Lieblingsspiele war »Amerikaner vs. Japaner«, in denen wir abwechselnd Army, Navy oder die Marines waren, und das andere Team die Japsen übernahm. Ich war besonders gut darin, mich an die japanischen »Bunker« heranzuschleichen und sie zu überrumpeln. Ich denke, in dem Spiel habe ich immer gewonnen. Von daher, ja, mit den Jungs zusammen zu sein war genau mein Ding. Wann immer ich mit Mädchen spielte, langweilte ich mich zu Tode. Wenn ich Puppen besaß, machte ich sie entweder kaputt oder überließ sie meinen Brüdern als Ziele, wenn sie mit ihren Luftgewehren trainierten. Manchmal schoss ich auch auf sie, haha. Wir hatten keine Haustiere, aber es gab eine streunende Katze, die hin und wieder vorbeikam und die ich fütterte. Aber sie mochte mich nicht wirklich. Einmal wollte ich sie streicheln, da fauchte sie mich an und rannte davon. Ich hörte auf, sie zu füttern, und sie kam nicht wieder.
Meinen Dad habe ich kaum gekannt. Als der Krieg begann, meldete er sich freiwillig. Das war 1942, kurz nach Pearl Harbor. Er trat der Navy bei. Ich war damals noch ziemlich jung – gerade mal vier – und das letzte Bild, dass ich von ihm im Kopf habe, ist, wie er uns zuwinkte, bevor er in den Bus stieg, der ihn in die Stadt brachte. Von da kam er in ein Ausbildungslager und wurde dann irgendwo in den Pazifik verschifft. Nur ein paar Monate später war er tot. Einer von dreihundert oder mehr Amerikanern, die in der Schlacht um Midway umkamen. Und so sah ich ihn nie wieder.
Von da an gingen die Dinge für uns bergab. Mom versuchte ihr Bestes, uns über die Runden zu bringen, aber wir versanken immer mehr in Armut. Rückblickend verstehe ich, wie schlimm es war, aber zu der Zeit war ich nur ein altkluges kleines Mädchen, das immer in Schwierigkeiten steckte, sich mit ihren Brüdern und deren Freunden prügelte und so ziemlich jeden in den Wahnsinn trieb. Als ich in die erste Klasse der South Side Elementary ging, hätte ich es mit so gut wie jedem Jungen der Nachbarschaft aufnehmen können, wenn ich das gewollt hätte. Ich war ein zäher kleiner Teufelsbraten.
Zu der Zeit, als ich mit der Schule anfing, wohnten wir nahe der Ecke Whitaker und 5th Street. Die Schwarzen lebten nur ein paar Querstraßen weiter südlich von uns, hinter den Gleisen. Ich war zu jung, als dass mich das stören würde. Ich lief mit meinen Brüdern zur Schule. John war in der sechsten Klasse, als ich eingeschult wurde, und Frank in der vierten. Es war eine miese Schule, so viel steht mal fest. Alle, die dort hingingen, waren Kinder von Ölfeld-Arbeitern. Niemand von besonderer Klasse, wenn du verstehst. Ich hatte nicht viele Freunde in der Schule. Ich war ein Außenseiter. Den Mädchen war ich zu jungenhaft, und den Jungen zu wild, haha.
Meine besten Freunde waren meine Brüder, obwohl sie mich irgendwann auch komisch fanden. Schon lustig, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, aber ich liebte meine Brüder. Für gewöhnlich traten sie für mich ein, wenn ich in Schwierigkeiten steckte, und das passierte ziemlich oft. Unglücklicherweise waren sie nicht für mich da, als ich sie am dringendsten gebraucht hätte, und ich weiß nicht, ob ich ihnen das je vergeben kann.
Ich denke, man könnte sagen, dass ich ein zorniges Kind war. Ich weiß gar nicht, worauf ich so zornig war. Ich zettelte einfach gern Schlägereien an. Da waren eine ganze Menge Aggressionen in mir, eine Wut, die von einem Moment auf den nächsten ausbrechen konnte. Das habe ich immer noch. Ich bin damit auf die Welt gekommen und brauchte eine Art Ventil dafür. Meine Mom machte das wahnsinnig, oder zumindest trieb sie das zum Alkohol. Nun, vielleicht war es nicht komplett meine Schuld, aber ich hatte sicher meinen Anteil daran, obwohl sie mit dem Trinken bereits anfing, als Dad starb. Es machte nicht viel Spaß, mit ihr zusammen zu sein.
Trotz allem war ich eine gute Schülerin. Das Lernen fiel mir leicht. Ich war nicht allzu gut in Mathe, aber ich mochte die Naturwissenschaften und Geschichte. In Lesen und Schreiben war ich besonders gut, weshalb ich wohl auch eine Weile ein Tagebuch führte. Ich merkte, dass ich gern Bücher las, und wenn ich nicht draußen mit den Jungs Fußball spielte, verzog ich mich nach drinnen mit den neuesten Abenteuern der Hardy Boys oder Nancy Drew. Aus Comics machte ich mir nicht viel, meine Brüder hingegen schon. Hin und wieder sah ich mir ihre Superman-Comics an, aber irgendwie waren die nichts für mich. Ich fand sie blöd. Ich mag es, wenn meine Abenteuergeschichten in der wirklichen Welt spielen und etwas glaubhafter sind. Anfangs hatte ich mit dem Lesen an sich Probleme, weshalb meine Mutter mich zu einem Arzt brachte und meine Augen untersuchen ließ. Ich weiß noch, dass sie nicht allzu glücklich darüber war, Geld für eine Brille ausgeben zu müssen, aber ich denke, damals brauchte ich sie eben. Von da an erkannte ich alles wunderbar – sah aber eben aus wie ein Idiot. Ich hasste es, eine Brille tragen zu müssen, und das führte nur zu mehr Schlägereien in der Nachbarschaft, wenn die anderen Kinder mich deswegen aufzogen.
So verlief das Leben ziemlich gleichförmig, bis ich zwölf wurde. Als die Pubertät losging, passierten mir seltsame Dinge. Ich meine jetzt nicht die üblichen ungewöhnlichen Dinge, die allen Mädchen passieren – du weißt schon, die erste Periode, dass einem die Brüste wachsen und so was – aber andere Dinge, die nicht normal waren. Zum Beispiel stellte ich fest, dass ich meine Brille nicht mehr benötigte. Ich konnte ohne sie sehen. 100-prozentige Sehschärfe. Tatsächlich war mein Sehvermögen außergewöhnlich. Ich konnte Straßenschilder in einer Entfernung entziffern wie sonst niemand. Und ich konnte Kleingedrucktes ohne Lupe lesen. Was sich auch veränderte, war mein Gehör. Vor der Pubertät hörte ich gut, doch danach klang alles wie verstärkt. Ich konnte Menschen am anderen Ende eines Zimmers flüstern hören. Das war echt schräg. Ich verstand Unterhaltungen in anderen Räumen. Ich konnte sie durch die Wände hindurch hören, beinahe so, als würden sie sich im gleichen Raum wie ich befinden. Eines Tages ging ich zur Schulkrankenschwester, um sie deswegen zu befragen. Sie riet mir, meine Ohren von einem Arzt untersuchen zu lassen, aber das tat ich nie. Ich machte mir deswegen ja keine Sorgen oder so. Eigentlich fand ich es großartig. Ich konnte die anderen Kinder im Speiseraum belauschen, in dem es für gewöhnlich ziemlich laut zuging, und verstand jedes Wort. Im Stille-Post-Spielen war ich nicht zu schlagen!
Eine andere Sache änderte sich ebenfalls, und das bekam ich erst etwas später mit. Wenn hinter mir etwas vor sich ging, wusste ich, was es war. Kennst du die Redewendung: Augen am Hinterkopf haben? So fühlte sich das an. An mich konnte sich keiner heranschleichen. Ich konnte einfach spüren, wenn jemand hinter mir stand. Und wenn ich die Straße entlangging, wusste ich bereits vorher, ob jemand hinter der nächsten Ecke stand. Was ziemlich oft der Fall war.
Eine weitere Fähigkeit, die ich entwickelte (wenn man das so nennen kann), war ein feines Gespür. Irgendwie wusste ich einfach, wenn meine Brüder wegen einer Sache flunkerten – und erwischte sie dabei auch. Ich sagte dann: »Frank, du lügst. Ich sehe es dir an.« Dann stritten wir für eine Minute, aber ich wies auf die Mängel in seiner Argumentation hin, und schließlich gab er dann zu, dass er gelogen hatte. Genauso verhielt es sich, wenn jemand ehrlich war. Ich brauchte nur ein paar Minuten mit einem Fremden reden und wusste, ob er oder sie ein guter oder schlechter Mensch war. Wenn jemand ein gutes Herz hatte, spürte ich das. Und wenn jemand Hass oder Zorn in sich trug, spürte ich das auch. Ich hätte nach Las Vegas gehen und Glücksspieler werden sollen. Wahrscheinlich hätte ich ein Vermögen gemacht, haha!
Zu der Zeit wusste ich nicht, ob mit mir etwas nicht stimmte. Ich hatte Angst, meiner Mutter davon zu erzählen. Sie hätte sich nur darüber aufgeregt, wieder mit mir zu einem Arzt gehen zu müssen. Und es war ja auch nicht so, dass ich Schmerzen oder dergleichen gehabt hätte. Ich merkte, dass ich speziell war. Ich war anders, und das gefiel mir. Wenn ich jetzt mit zwanzig auf die zwölfjährige Judy zurückblicke, weiß ich, dass diese verstärkten Sinne bei mir einzigartig waren. Ich kenne sonst niemand, der so etwas hat. Diese Fähigkeiten kommen mir natürlich zugute, wenn ich die Stiletto bin. Ohne dieses ausgeprägte Bewusstsein könnte ich nicht dieses Kostüm anziehen und so klettern und springen und kämpfen, wie ich es eben tue. Ich las darüber in Büchern über Anatomie und Psychologie, aber ich konnte nichts finden. Schließlich schob ich es auf die Pubertät und darauf, dass ich ein weibliches Tier bin. Wie eine Löwin oder eine Tigerin, die ihre Jungen beschützt. Ich weiß, das klingt albern, aber es ist doch so – all diese Sinne, die ein Muttertier in der Wildnis einsetzt, um ihre Jungen und sich selbst zu beschützen, sind die gleichen, wie ich sie habe. Sehen, Hören, Wachsamkeit, Instinkt.
Ich denke mal, ich würde die perfekte Mutter abgeben, haha! Na ja, irgendwann vielleicht. Ganz sicher nicht in naher Zukunft.
Nun, dieses ganze neue Zeug machte mich nur noch seltsamer, wie du dir vorstellen kannst. Meine Mutter und meine Brüder merkten natürlich, dass ich anders war, aber sie schoben es einfach darauf, dass ich erwachsen wurde. Trotzdem kam es mir so vor, als würden sie mich meiden. Ein bisschen zumindest. Ich war ein seltsamer Vogel. Ein Freak. Und so wurde das Leben zuhause immer unangenehmer und eigentümlicher. Nun war ich nicht nur in der Schule ein Außenseiter, sondern auch daheim.
Wie auch immer, als das alles anfing und ich merkte, dass ich es kontrollieren konnte, begann ich, mehr Sport in der Schule zu treiben – und ich war verdammt gut darin. Ganz besonders mochte ich Turnen. Kaum dass ich der Schulmannschaft angehörte, war ich beinahe besser als jede andere. Der Stufenbarren schien wie geschaffen für mich. Ich schwebte quasi darüber hinweg. Der Trainer war begeistert und wollte, dass ich an Wettbewerben teilnahm. Aber ich war jähzornig und flippte aus, wenn ich nicht im Mittelpunkt stand. Ich war ein echtes Miststück, muss ich sagen, und so hielt es die Mannschaft nicht lange mit mir aus. Also trainierte ich für mich allein, bis ich mit meinen Aufschwüngen, Handständen, Abgängen und Saltos mit den Besten mithalten konnte. Auf dem Schwebebalken war ich wie eine Katze. Ich war beweglich, leicht, und konnte meinen Körper wie eine Brezel verbiegen. Von daher, doch, ich war eine Athletin – und eine gute dazu. All das waren zweifellos Pluspunkte, als ich zur Black Stiletto wurde.
Im Herbst 1950, als ich noch zwölf Jahre alt war, trug sich etwas zu, dass vielleicht ausschlaggebend für meine Entscheidung gewesen war, später eine kostümierte Verbrechensbekämpferin zu werden. Ein Ereignis, an dem all diese Sinne zusammentrafen und in mir die Ahnung auslösten, dass ich anders war und die »Kräfte« einsetzen könnte, um Menschen zu helfen.
Es war Wochenende, weshalb ich nicht zur Schule ging. Ich mochte es, allein zu den Ölfeldern raus zu laufen. Meistens nahm ich den Bus aus der Stadt und ging dann einfach zu Fuß. Ich mochte es, den Ölpumpen zuzusehen, wie sie vor und zurück wippten. Die Kräne wirkten majestätisch und ragten wie riesige Wächter vor dem flachen Horizont auf. Es war abgeschieden und auf gewisse Weise tröstlich. Es war ein Ort, an den ich mich von der Unbehaglichkeit zuhause zurückziehen konnte.
Egal, ich wanderte also gedankenverloren vor mich hin, als ich etwas hörte, dass wie ein schreiendes Baby klang. Ich spitze die Ohren, und das meine ich wortwörtlich, denn ich spürte, wie sich die Muskeln an den Seiten meines Gesichts spannten. Draußen in den Feldern war es für gewöhnlich schwer, herauszufinden, woher ein Geräusch kam. Wegen dem Wind und weil alles so flach war, schienen die Geräusche von allen Seiten gleichzeitig an einen heran zu dringen. Aber nicht für mich. Ich wusste genau, wo sich das Baby befand. Der Säugling war über hundert Yards entfernt, in der Nähe einer der Pumpen.
Was machte ein Baby auf den Ölfeldern?, fragte ich mich. Hatte einer der Arbeiter sein Kind mit zur Arbeit gebracht und es unbeaufsichtigt gelassen? Ich war zu jung, um zu begreifen, dass jemand sein Kind tatsächlich aussetzen könnte. Das kam mir nicht in den Sinn.
Jedenfalls rannte ich dem Geräusch entgegen. Meine Augen waren starr auf eine Gruppe von Mesquitebüschen gerichtet, und ich wusste, dass das Kind dort sein würde. Mein ganzer Körper fühlte sich so lebendig an wie noch nie zuvor, meine Haut kribbelte. Es war die Aufregung der Entdeckung, das Wissen, dass ich genau ausmachen konnte, wo das Kind war, und jeder Nerv in meinem Körper lenkte mich, es zu retten. Ich konnte nichts dagegen tun. Da war wieder dieser tierische Mutterinstinkt. Ich hatte keine andere Wahl, als das Kind zu finden.
Tja, und das tat ich. Es war leicht. Da stand ein Körbchen unter einem Mesquitestrauch, und darin lag ein Junge, eingewickelt in eine Decke. Keine Notiz, kein Hinweis auf seine Identität. Keine Flasche.
Ich stand da und starrte auf eine der Ölpumpen, weitere hundert Yard oder so entfernt. Drei Männer arbeiteten dort. Ich ließ das Baby, wo es war, und rannte, so schnell ich konnte. Als ich die Pumpe erreichte, wendete ich mich an den erstbesten Mann und erzählte ihm, was ich entdeckt hatte. Zuerst muss er geglaubt haben, dass ich mir das ausgedacht hatte, aber schließlich konnte ich ihn davon überzeugen, mit mir mitzukommen und sich die Sache selber anzusehen. Er und ein anderer Arbeiter folgten mir zurück zu dem Mesquitestrauch. Sie waren genauso überrascht wie ich.
Nun, sie riefen die Polizei, und es stellte sich heraus, dass man das Baby tatsächlich bei den Ölfeldern zum Sterben ausgesetzt hatte. Ich verstand nicht, wie Eltern so etwas tun konnten. Es traf mich wie ein Vorschlaghammer – in dieser Welt existierten böse Menschen.
Meine Mom war nicht allzu erfreut, als sie in die Polizeistation kommen und mich abholen musste. Der Polizist war freundlich und brachte mich hinein, damit ich meine Geschichte erzählen konnte. Und das tat ich. Ich sagte einfach, dass ich allein auf den Ölfeldern herumgelaufen war und das Baby schreien gehört hatte. Das war die Wahrheit. Der Polizist meinte, ich sei ein »braves Mädchen« gewesen und hätte das Richtige getan. Was aus dem Baby wurde, weiß ich nicht – ich nehme an, dass man es in ein Waisenhaus brachte.
Aber ich wusste, dass ich sein Leben gerettet hatte. Und das fühlte sich gut an.
3| Judys Tagebuch 1958
Als ich dreizehn war, im Frühling 1951, heiratete meine Mutter ein zweites Mal. Sie hatte sich einen anderen Bohrarbeiter namens Douglas Bates geangelt, und so wurde aus Betty Cooper eine Betty Bates.
Von dem Moment an, als ich den Kerl zum ersten Mal sah, wusste ich, dass er Schwierigkeiten bedeuten würde.
Das war diese seltsame Intuition, die ich besaß. Er kam bei ihrem ersten Date durch die Tür, mit diesem schmierigen Lächeln im Gesicht und einem Funkeln in den Augen, von dem ich eine Gänsehaut bekam. Rückblickend denke ich, dass er mehr an mir als an meiner Mutter interessiert war. Er konnte es gar nicht erwarten, ein junges Teenager-Mädchen in die Finger zu bekommen, also heiratete er schnell eine Frau, die ihn eigentlich gar nicht interessierte, um so seine Beute einkreisen zu können.
Douglas war zehn Jahre älter als meine Mutter. Davor war er schon einmal verheiratet gewesen, dann geschieden, und hatte mit einer ganzen Reihe von Frauen angebändelt, bevor er schließlich in einer Bar meine Mutter traf. Ich kenne die Umstände seiner ersten Ehe nicht, aber ich gehe jede Wette ein, dass seine Frau ihn verlies. Höchstwahrscheinlich, weil er sie zusammengeschlagen hat. Denn das tat er auch gern mit meiner Mutter.
Oh, natürlich, zu Anfang war er freundlich und half im Haushalt. Meine Brüder schienen ihn von Anfang an zu mögen. Sie waren selten da, gingen zur High-School, und John würde im Mai seinen Abschluss machen. Meine Mutter schwärmte einfach nur für Douglas, weil er ein Mann war und sich für sie interessierte. Aber mich legte er keine Sekunde rein. Ich traute ihm nicht. Er war ein Lügner und ein Kriecher.
Da gab es dieses eine Wochenende, gleich als die Sommerferien begannen. Meine Mutter war auf Arbeit, putzte bei jemand das Haus, und meine Brüder waren irgendwo draußen unterwegs. Ich war allein in meinem Zimmer und las ein Buch. Ich dachte, ich hätte meine Ruhe. Aber der gute alte Douglas arbeitete an diesem Tag nicht, also klopfte er an meine Tür und wollte hereinkommen. Eigentlich wollte ich das nicht, aber er war mein Stiefvater, also ließ ich ihn herein. Zumindest war er sauber – er musste gebadet haben, bevor er anklopfte. Was aber auch bedeutete, dass er etwas vorhatte.
Er fing an, mir Komplimente zu machen, beinahe so wie meiner Mutter. Meinte, wie süß und schön ich doch sei und wie groß ich doch schon geworden war. Ja, genau. Wo er mich doch erst seit fünf Monaten kannte.
»Sieh mal, was ich habe«, sagte er. »Eine Überraschung!«
Und dann besaß er die Dreistigkeit, einen Flachmann mit Whiskey hervorzuholen! Dazu zauberte er zwei Plastikbecher hervor, goss in jeden ein wenig ein, und dann hielt er mir einen davon hin! Ich war dreizehn Jahre alt, Herrgott noch mal! Ich lehnte natürlich ab.
»Komm schon, Judy«, bettelte er. »Du wirst es mögen. Damit fühlt man sich gleich besser.«
Genau. Ich hatte gesehen, was das Zeug mit meiner Mutter anstellte.
»Wo liegt das Problem? Bist dir zu fein dafür, kleine Miss Saubermann?«
»Ich versuche, zu lesen. Lass mich bitte allein.«
Und dann sagte er: »Weißt du, Judy, du wirst jetzt erwachsen, und du wirst dich bald für Jungs interessieren. Und ich meine nicht, mit ihnen Fußball zu spielen. Du wirst wissen wollen, wie man das so macht.«
Ich sah ihn an, als wäre er einfach nur verrückt geworden. Aber er redete weiter.
»Ich will dir nur helfen, weißt du? Ich könnte dir ein paar – Sachen beibringen. Dinge, die dein Freund mögen wird. Was meinst du?«
»Nein. Verschwinde.«
»Nun, Judy …«
Und dann schrie ich ihn an. »Verschwinde! Lass mich in Ruhe!« Ich schnappte mir eines der Bücher und warf es nach ihm. Es traf ihn mitten im Gesicht. Junge, Junge, das machte ihn wütend. Er lief rot an und stürmte auf mich zu, als wollte er mich windelweich prügeln. Doch dann hörten wir, wie die Haustür zuschlug. Frank rief, um zu sehen, ob jemand zuhause war.
»Frankie!«, schrie ich.
Douglas zog sich in den Türrahmen zurück und versuchte, locker zu wirken. Frank erschien und fragte: »Was macht ihr hier?«
»Nichts«, antwortete Douglas. »Ich wollte nur nachsehen, ob deine Schwester etwas zu Essen haben will.«
»Nun, ich könnte was vertragen«, sagte Frank. Er schöpfte keinen Verdacht.
Douglas funkelte mich böse an und zog dann mit Frank von dannen. Ich schlug die Tür zu. Unglücklicherweise besaß die Tür kein Schloss, um sie zu verriegeln.
Von da an wurde Douglas unleidlich. Er schrie meine Mutter oft an, und die beiden stritten viel. Mom gab für gewöhnlich schnell nach, besonders dann, wenn er sie schlug. Einmal passierte das, als wir drei Geschwister dabei waren. Wir waren entsetzt, und John baute sich vor dem Widerling auf.
»Hör auf, meine Mutter zu schlagen!«, sagte er, so bedrohlich, wie man mit achtzehn Jahren nur sein konnte. John hätte einen beachtlichen Gegner abgegeben, aber mein Stiefvater war ein großer Mann. Er hatte mit Sicherheit mehr Erfahrung in handfesten Auseinandersetzungen als John.
Douglas sagte ihm nur, dass er die Klappe halten sollte, und verließ das Haus. Mom fing an zu weinen, und wir versuchten, sie zu trösten.
»Du solltest ihn verlassen«, riet ich ihr.
Sie sah mich an, als hätte ich den Verstand verloren. »Was fällt dir ein?«, fragte sie. »Wie könnte ich so etwas tun? Wovon sollen wir dann leben? Wo kommt dann Geld her? Wir haben gerade erst geheiratet. Ich kann keinen Mann verlassen, den ich gerade erst geheiratet habe.«
Ich zuckte als Antwort nur mit den Schultern und starrte meine Brüder an. Die Blicke, die wir austauschten, verrieten, dass sie meine Meinung teilten. Aber sie würden sich nicht zwischen Mom und unseren Stiefvater stellen.
John hatte Glück. Er verließ uns, sobald er die High-School beendet hatte. Wie mein Dad ging er zum Militär, nur dass er sich bei der Army und nicht in der Navy einschrieb. Lieber freiwillig melden als eingezogen werden, sagte er. Der Korea-Krieg tobte, und er wollte wirklich dorthin und seinem Land dienen. Mom wollte nicht, dass er geht – das wollte keiner von uns, außer Douglas. Der Bastard war froh, dass er das älteste Kind loswurde. Ein Hindernis weniger auf seinem Weg zum Ziel – mir. John kam ins Ausbildungslager und wurde wohl von da nach Korea geschickt. Während ich diese Zeilen schreibe, habe ich keine Ahnung, was aus ihm geworden ist, ob er noch lebt oder nicht.