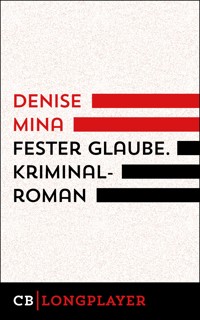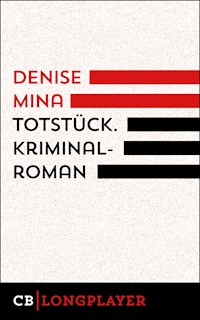13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Iain Fraser stammt aus Helensburgh. War lange weg, eine Haftstrafe absitzen. Jetzt ist er zurück. Und muss tun, was sein Boss von ihm erwartet, egal wie, egal was. Aber eine arglose Frau zu töten ist verdammt finster. Das wird Iain nicht mehr los. Inzwischen steht Detective Inspector Alex Morrow vor einem Rätsel. Die von der Polizei überwachte Roxanna Fuentecilla ist verschwunden – sehr peinlich, zumal die Spanierin in einen Fall von Wirtschaftskriminalität verwickelt ist, der dem frisch verschlankten Budget der zuständigen Ermittlungsabteilung helfen sollte. Die Leiche, die im Loch Lomond treibt, ist jedoch nicht die der Gesuchten. Morrow hat also zusätzlich einen Mordfall am Hals. Und der führt sie nach Helensburgh … Denise Mina, in Großbritannien als Queen of Tartan Noir gefeiert, schreibt raffiniert verflochtene Pageturner mit Ecken und Kanten. Blut Salz Wasser wechselt zwischen den Perspektiven des Täters, der Ermittlerin und von Nebenfiguren und knüpft ein komplexes Panorama sozialer Wirklichkeit: eine schottische Kleinstadt kurz vor dem Referendum, eine Welt für sich – doch zugleich eine verblüffend repräsentative literarische Welt, die tiefe Einblicke in die moderne Gesellschaft gewährt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2017
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Titel der englischen Originalausgabe
Blood Salt Water
© 2015 by Denise Mina
Printausgabe: © Argument Verlag 2017
Lektorat: Else Laudan
Covergestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: April 2018
ISBN 978-3-95988-119-7
Über das Buch
Iain Fraser stammt aus Helensburgh. War lange weg, eine Haftstrafe absitzen. Jetzt ist er zurück. Und muss tun, was sein Boss von ihm erwartet, egal wie, egal was. Aber eine arglose Frau zu töten ist verdammt finster. Das wird Iain nicht mehr los.
Inzwischen steht Detective Inspector Alex Morrow vor einem Rätsel. Die von der Polizei überwachte Roxanna Fuentecilla ist verschwunden – sehr peinlich, zumal die Spanierin in einen Fall von Wirtschaftskriminalität verwickelt ist, der dem frisch verschlankten Budget der zuständigen Ermittlungsabteilung helfen sollte.
Die Leiche, die im Loch Lomond treibt, ist jedoch nicht die der Gesuchten. Morrow hat also zusätzlich einen Mordfall am Hals. Und der führt sie nach Helensburgh …
Denise Mina, in Großbritannien als Queen of Tartan Noir gefeiert, schreibt raffiniert verflochtene Pageturner mit Ecken und Kanten. Blut Salz Wasser wechselt zwischen den Perspektiven des Täters, der Ermittlerin und von Nebenfiguren und knüpft ein komplexes Panorama sozialer Wirklichkeit: eine schottische Kleinstadt kurz vor dem Referendum, eine Welt für sich – doch zugleich eine verblüffend repräsentative literarische Welt, die tiefe Einblicke in die moderne Gesellschaft gewährt.
Über die Autorin
Denise Mina, Jahrgang 1966, brach nach einer rastlosen Kindheit in Glasgow, Paris, London, Invergordon, Bergen und Perth die Schule ab, jobbte halbherzig in einer Fleischfabrik, in Bars, als Köchin und als Krankenpflegehelferin, qualifizierte sich per Abendschule fürs Jurastudium an der Universität Glasgow. Statt danach wie geplant in Kriminologie und Strafrecht zu promovieren, begann sie Kriminalliteratur zu schreiben. 2014 aufgenommen in die Crime Writers’ Association Hall of Fame. Sie hat 12 Romane publiziert, außerdem verfasst sie Shortstorys, Bühnenstücke, Graphic Novels und macht TV- und Radiosendungen. Denise Mina lebt in Glasgow.
Denise Mina
Blut Salz Wasser
Kriminalroman
Wir alle haben exakt denselben Salzgehalt in unseren Venen, wie es ihn auch im Ozean gibt, und deshalb haben wir Salz in unserem Blut, in unserem Schweiß, in unseren Tränen. Wir sind mit dem Ozean verbunden. Und wenn wir uns ans Meer begeben – ob nun zum Segeln oder um es zu betrachten –, kehren wir dorthin zurück, woher wir gekommen sind.
John F. Kennedy
Vorbemerkung von Else Laudan
Denise Minas Kriminalromane erzählen unzweifelhaft von Schottland, und zwar sinnlich und ausgefuchst, drastisch und poetisch. Umwerfend sind ihre Figuren, von denen nur ein Teil dem in der Literatur sonst oft dominanten bürgerlichen Mittelstand angehört. Ganz nah kommen wir an sie heran, fühlen ihre Vorbehalte, ihren Hochmut, ihren Schmerz. Denn eine Ermittlungsgeschichte fördert bei Mina nicht bloß zutage, was alles an Verbrechen geschah, sondern ganz beiher auch, wie Leute zu ihrer Meinung kommen, zu ihren Narben, ihrem Verhältnis zu sich selbst, zu anderen, zum Leben. Das ist verdammt komplex und doch so treffsicher und treibend erzählt, als wäre es ganz einfach.
Die Werkschau der mit so vielen Nominierungen und Preisen geehrten »Queen of Tartan Noir« ist im Deutschen etwas unübersichtlich, bisher erschienen der 1., 2. und 4. Fall der Glasgower Kriminalermittlerin Alex Morrow. Uns bei Ariadne ist es eine große Ehre und ein Genuss, die außergewöhnliche Autorin ab jetzt zu verlegen. Blut Salz Wasser ist der fünft e und neueste Morrow-Roman, den dritten werden wir noch nachholen.
Glücklicherweise lässt sich jedes von Denise Minas Büchern als Solitär lesen: Ihr bestechend kluger dunkler Realismus nimmt sofort Gestalt an und Fahrt auf, wenn sie loslegt und mal brutal, mal erschütternd, mal trocken oder verschmitzt, immer packend von Mord, Unrecht, Gewalt sowie all den kleinen und großen Kämpfen echter Menschen erzählt. Lasst euch von ihr entführen und bereichern. Sie schreibt tief im Herzen des Genres sezierende Literatur.
1.
Sie war in den zwei Tagen, in denen sie sie festgehalten hatten, so folgsam gewesen wie ein Kalb. Sie kam bereitwillig mit, als sie sie mit dem Transporter abholten. Sie bat um keinen Gefallen, bettelte nicht um Gnade, während sie darauf warteten, dass Wee Paul das letzte Wort sprach: Tötet sie oder lasst sie laufen.
Anfangs gefiel es Iain, dass sie so passiv war. Er hatte noch nie eine Frau zu etwas zwingen müssen. Dann fragte er sich, woran es lag. Sie schien überhaupt nicht ängstlich, sie lächelte sogar manchmal. Nur einmal sagte sie etwas, sie fragte: Wie lange dauert es noch? Langsam wurde ihnen klar, dass sie völlig missverstanden hatte, worum es ging.
Tommy grinste, als er es merkte, er nickte Iain hinter ihrem Rücken zu, lachte über sie. Iain fand es nicht lustig. Je länger es sich hinzog, desto mieser ging es ihm damit. Es war ehrlos, aber er konnte sie schlecht warnen oder laufenlassen. Er fühlte sich durch diesen Betrug an ihr so unbehaglich, dass er während der langen letzten Nacht zweimal versucht war, einfach aufzustehen und zu gehen. Das konnte er nicht. Er musste den Job durchziehen, um seine Schulden zu bezahlen. Arschbacken zusammenkneifen und durchziehen.
Nachdem Wee Paul morgens angerufen und Tommy seine Entscheidung mitgeteilt hatte, konnte Iain sie nicht mehr ansehen. Sie steckten sie wieder in den Transporter und fuhren von Helensburgh an den Loch Lomond.
Raus aus dem Transporter unter einen regenschwangeren Himmel, dessen tiefhängende graue Wolken alle Farben der Berge dämpften. Sie gingen im Gänsemarsch durch hohe Sanddünen, Tommy voran, sie in der Mitte, Iain dahinter, folgten einem Zickzackpfad bis zum Seeufer.
Die Dünen waren für einen Golfplatz bestimmte industrielle Haufen, neongelb und sehr hoch. Sie drehte sich nach dem schimmernden Sand um, und Iain sah, wie ein kleines Lächeln ihre Wangen hob. Woran dachte sie? Vielleicht an warme Urlaube an gelben Stränden. Blaues Meer. Sonnenbräune. Sie hatte immer noch nicht die leiseste Ahnung. Iain steckte seine Hand in die Tasche und berührte den Schlagstock. Er würde ihr nicht ins Gesicht schlagen, sie hatte ein nettes Gesicht. Er würde dafür sorgen, dass es schnell ging.
Ein schneidender Windstoß, der vom Wasser kam, ließ sie zusammenzucken, als sie ans Seeufer trat. Dann sah sie auf. Beim Anblick des Boots geriet sie ins Straucheln. Ihre Knie wurden weich, sie hob den Kopf und stieß einen schnarrenden Tierlaut aus, der in den Ohren wehtat, weil er so nah war.
Tommy wirbelte herum, wollte ihr die Hand auf den Mund legen, damit sie aufhörte, aber sie ruderte wild mit den Armen und kreischte immer wieder kurz und rau »NEIN!«. Die beiden staunten über den Widerstand, der in ihr steckte. Sie drehte sich um, kegelte Tommy mit der Schulter aus dem Gleichgewicht, versuchte an ihm vorbeizukommen. Tommy schwenkte auf den Fersen herum und griff noch im Fallen nach ihr. Seine Hand rutschte an ihrer Hüfte ab, er plumpste auf die Knie, und sie entwischte.
Mit zwei großen Schritten war sie an ihm vorbei, jagte den Bootssteg entlang und hielt auf die dichte Baumreihe zu.
Iain war ein großer Mann mit beträchtlicher Reichweite. Er packte sie am Oberarm, zog den Schlagstock aus der Tasche und drehte sie zu sich. Er schlug ihr so fest er konnte auf den Kiefer.
Ihr Kopf schnappte zurück. Ihre Augen verdrehten sich. Sie glitt zu Boden, als wäre sie mit Sand gefüllt. Dann lag sie da auf dem Steg, reizlos über eines ihrer Beine gefaltet.
Ein alter Gefängnistrick. Man mochte noch so hart zuschlagen, wenn man den anderen falsch erwischte, konnte er gleich wieder auf einen losgehen, wütend und zu allem bereit. Für ein K.o. musste der Kopf ruckartig herumpeitschen. Dann knallte das Hirn innen gegen den Schädel. Wenn man den Kopf nur schnell genug schleudern ließ, konnte man fast garantieren, dass der andere zu Boden ging.
Iain und Tommy starrten auf sie runter. Tommy keuchte vor Schreck. Es überraschte Iain, dass er es sich so deutlich anmerken ließ. Sie kannten sich nicht besonders gut, hatten vorher noch nicht zusammengearbeitet. Sie waren noch dabei, ihre Rollenverteilung zu klären. Tommy machte auf Fernsehschurke, fluchte und knurrte. Iain gab sich wie die furchterregendsten Typen im Knast: ausdruckslose harte Knochen, die ohne Vorwarnung angriffen.
Als er die bewusstlose Frau betrachtete, dachte Iain an die Männer, die so waren. Er hatte sie beneidet. Sie schienen nie etwas zu empfinden. Jetzt fragte er sich, ob ihr leerer Blick Verzweiflung verbarg, die so tief saß, dass sie ihnen die Luft abschnürte. Ob ihnen der Selbstekel wie ein Stein im Magen lag. Wahrscheinlich nicht.
Sie sahen zu, wie sich an ihrem Kinn eine eiförmige Beule bildete. Ihr Brustkorb hob und senkte sich unregelmäßig. Ihre Augen flatterten hinter den Lidern. Bewusstlos, aber nicht tot. Der Plan hatte vorgesehen, sie hierherzubringen, ins Boot zu treiben, sie möglicherweise sogar weit hinaus aufs Wasser zu schaffen und dann erst zu töten.
Tommy knurrte: »Lass sie da nicht einfach so liegen. Bring’s verdammt noch mal zu Ende.«
Er hatte recht. Sie könnte aufwachen, und das wäre mehr als grausam, weil es dann immer noch getan werden musste, aber sie würde es mitkriegen.
Iain beugte sich schnell hinab. Das war ein Fehler, aus Mitleid geboren. Ein brennend heißer Nadelstich in der Lendenwirbelsäule ließ ihn aufstöhnen. Verlegen richtete er sich auf. Er versuchte es aufs Neue, hielt den Rücken gerade, beugte ein Knie, als wollte er sich zum Ritter schlagen lassen. Er ging ganz runter und brachte sich in Position, bewegte vorsichtig sein Becken, vor und zurück, probierte aus, wo die Grenzen waren. Dass er den Rücken kaputt hatte, war neu, die Schmerzen ungezielt, noch nicht verortet.
Er knirschte mit den Zähnen, hob den Schlagstock über seinen Kopf und schlug zu, immer wieder, so wie er früher als Junge Fische erlegt hatte. Er zielte auf ihre Schädeldecke oberhalb des Haaransatzes, so dass er ihr Gesicht nicht zertrümmerte. Es war die einzige Gnade, die er ihr gewähren konnte. Ganz egal, was sie getan hatte oder wie sehr Iain diesen Job brauchte, sie verdiente es, ihr Gesicht zu behalten.
Tommy sah weg, tat desinteressiert, starrte das Boot an. Er zeigte auf das sich pellende 12-Fuß-Dinghy, das auf dem unruhigen grauen See gegen den Steg klatschte. Die Sea Jay II machte nicht viel her. »Schau dir an, in was für einem beschissenen Zustand das Ding ist«, sagte er und übertrieb sein Interesse am Zustand des Boots, weil er nicht zusehen konnte. »Überall blättert die scheiß Farbe ab.«
Tommy wusste einen Dreck über Boote. Das Boot war tadellos.
Es war erledigt. Ein scharlachroter Heiligenschein erstrahlte um ihren Kopf. Iain merkte, dass er keuchte, und sein Knie tat fürchterlich weh. Es wurde von seinem gesamten Körpergewicht auf den geriffelten Beton gedrückt.
Er lehnte sich über den Körper der Frau, um sich aufzurichten, bildete dadurch einen Windschutz. In dem Vakuum warf er einen Blick auf ihr Gesicht, dem er nah genug war, um es ohne das geschwollene Kinn und die blutige Wunde am Kopf zu sehen. Mit einem Mal sah er sie als Frau, vielleicht eine, die er mal gekannt oder geliebt hatte, er konnte sie nicht einordnen, aber sie wurde zu einer Person, und das war sie bis gerade eben nicht gewesen. Bis gerade eben war sie eine lästige Aufgabe gewesen. Eine von der Sorte, die man erledigen musste, über die man aber so gar nicht nachdenken wollte.
Er stützte sich mit der Hand auf und beugte den Ellenbogen, um sich hochzustemmen, aber dadurch kam er ihr noch näher. Spürte die Wärme, die von ihrer Wange abstrahlte. Der mütterliche Tau ihres Atems legte sich auf seine Lider. Sein Ohr war nur Zentimeter von ihrem Mund entfernt. Er hätte sie sonst nicht gehört. Tief aus ihrem Inneren kam ein Laut: Sheila. Der Name seiner Mutter.
Erschrocken fuhr er zurück. Gerade als sein Mund auf einer Höhe mit ihrem war, rang er nach Luft und saugte ihren warmen, feuchten letzten Atemzug ein. Zog ihn tief in seine Lunge.
Iain rappelte sich hoch. Trat zurück, die Hände erhoben, ergab sich. Nein. Das war dumm. Shee-lah. Nicht der Name seiner Mutter. Nur Laute. Von einer Leiche. Nicht Sheila. Shee-lah. Nicht real. Aber seine Lippen waren feucht von ihr, seine Atemwege gefüllt mit ihren Schreien.
Der See krallte sich an den Steg. Möwen kreischten empörte Trauergesänge hoch über seinem Kopf. Eine Handvoll Sand legte sich über ihr Gesicht, der klagende Wind hatte ihn gebracht.
»Hast du’s?« Tommy hielt seinen Blick auf das Boot gerichtet. »Bist du jetzt fertig?«
Iain öffnete den Mund, um etwas zu sagen, machte ihn aber wieder zu. Er wollte nichts sagen, weil er nicht wusste, was aus ihm herauskommen würde. Alles, was sie an Widerstand in sich gehabt hatte, alles von ihr war in ihn übergegangen. Es war aufgestiegen, hatte ihren Körper verlassen, und er hatte es aufgesogen. Ihre Seele.
Jetzt war sie in ihm gefangen. Sie wand sich und schlug um sich und war wütend, und sie würde sich ihren Weg durch seine Eingeweide brennen.
2.
Auf dem Beifahrersitz klingelte laut und schrill Alex Morrows Diensthandy.
»Roxanna wird vermisst, Ma’am«, sagte McGrain, einer ihrer DCs. »Wir haben gestern beim Abliefern vor der Schule den Sichtkontakt verloren und konnten sie nicht wiederfinden. Gerade ist sie durch einen anonymen Anruf als vermisst gemeldet worden.«
»Was? Von wem kam der Anruf?«
»Wissen wir nicht. Es war eine Kinderstimme. Englischer Akzent.«
»Eins von ihren Kindern?« Morrow hielt das Handy am Lenkrad und brüllte hinein. Sie verstieß gegen das Gesetz, aber das war nicht der Grund, warum sie brüllte. Das Schicksal von Roxanna Fuentecilla lag ihr persönlich am Herzen. »Er war’s, oder? Scheiße. Ihr verfickter Freund.«
»Na ja, wir wissen nicht, wer angerufen hat. Es klang aber nach einem der Kinder.«
»Ich bin in zehn Minuten da.« Sie drückte ihn weg und beeilte sich, durch den morgendlichen Verkehr zur London Road Police Station zu kommen.
Der Parkplatz war voll, aber für sie war ein Stellplatz reserviert. Sie stieg aus und schloss ab, ging schnell durch den Hintereingang, hielt sich selbst eine Standpauke. Sie sollte sich beruhigen. Sie kannte Fuentecilla nicht mal. Was Morrow an ihr auch bewundern mochte, es beruhte lediglich auf Annahmen. Sie hatte sich eine Menge Überwachungsmaterial angesehen, aber das ergab noch längst kein vollständiges Bild. Sie war eine Kriminelle. Denk dran. Wir und die.
Durch den Hintereingang rein, vorbei am Zugang zu den Arrestzellen, ein knappes Nicken und ein Hallo für den diensthabenden Sergeant. Morrow eilte durch die Umkleideräume und durchquerte das Foyer. Sie öffnete die Tür zu ihrem Büro, kegelte ihre Tasche gegen den Schreibtisch, ging zurück über den Flur zum Lagezimmer und fand McGrain. Er lehnte an einem Schreibtisch, nippte an seinem Tee und hörte DC Thankless zu, einem kahlen, muskulösen, unangenehmen Mann. Morrow mochte ihn nicht.
»Heilige Scheiße.« McGrain stand stramm, als er sie sah. »Das ging aber schnell.«
»Komm mit.«
McGrain folgte ihr in ihr Büro und machte die Tür hinter sich zu.
»Das ist keine Kantine.« Sie sah auf die Teetasse, die er noch in der Hand hielt.
Beschämt verdrückte er sich, stellte sie auf den nächstbesten Tisch im Lagezimmer und huschte zurück in ihr Büro. »Tut mir leid, Ma’am.«
»Setz dich.« Sie deutete auf einen Stuhl. »Und jetzt sag mir, was passiert ist.«
Also sagte er es ihr: Sie hatten gestern Sichtkontakt mit Roxanna Fuentecilla verloren, nachdem sie ihre Kinder zur Schule gebracht hatte. Sie fuhr immer zur selben Zeit vom Büro nach Hause, aber gestern Abend hatte niemand sie ins Haus gehen sehen. Ansonsten gab es nichts Verdächtiges: Die Lichter waren wie üblich angegangen, im Wohnzimmer, in der Küche und in ihrem Schlafzimmer. Ihr Auto war auch nicht zu sehen, aber sie parkte manchmal in einer Seitenstraße, wenn es sehr voll war.
Sie beobachteten sie seit drei Wochen; manchmal hatten sie sie aus den Augen verloren, sich aber nichts dabei gedacht. Es wäre zu teuer, ihr persönlich zu folgen, Etatkürzungen zwangen sie bereits dazu, ihre Ablage selbst zu machen und die Kugelschreiber zu rationieren, also mussten sie sich auf Überwachungskameras verlassen. Sie sahen sich eine Menge CCTV-Material an. Bei Fuentecilla war man nicht von Fluchtgefahr ausgegangen, weil sie Kinder hatte. Sie waren vierzehn und zwölf und gut in der Schule, sauber und wohlgenährt und bestens entwickelt. Sie betete sie ganz offensichtlich an.
Über Nacht waren die Aufnahmen aus allen üblichen Quellen überprüft worden. Von gestern gab es kein einziges Bild, auf dem Fuentecilla zu sehen war. Dann war um sieben Uhr morgens der Anruf gekommen, anonym aus einer Telefonzelle von der Central Station. Eine Stimme, leise und jung, meldete Roxanna Fuentecilla als seit gestern vermisst. Als man in der Notrufzentrale nachfragte, ob die anrufende Person eine Idee hätte, wo sie sein könnte, hieß es, man wisse nicht, »wohin die sie gebracht haben«, was nach mehr als einer Person klang, also nicht nach dem blindwütigen Freund. Dann brach das Gespräch abrupt ab.
»Eins ihrer Kinder«, sagte Morrow.
»Ja. Der englische Akzent klang vornehm, irgendwie affektiert. Das wird’s hier oben nicht so häufig geben.«
»Videomaterial von der Telefonzelle in der Central Station?«
»Angefordert, ist unterwegs.«
»Gut. Schick mir den Mitschnitt von dem Anruf. Sag im Büro vom Chief Bescheid. Die werden ein Meeting einberufen.«
»Ja, Ma’am.« Und weg war McGrain.
Sie machte die Tür zu und schaltete ihren Computer ein. Er fuhr langsam hoch. Sie empfand die schon gewohnte Vorfreude, den Serotoninschub der allmorgendlichen Erwartung, Roxanna Fuentecilla zu überwachen, korrigierte dann aber ihre Körperchemie: Heute gab es kein Material. Roxanna war verschwunden. Es fühlte sich an, als hätte man ihre Lieblingsfernsehserie abgesetzt.
Für sie war der Fall zu einer Seifenoper geworden, einer Geschichte um viel Geld und supergutaussehende Leute, die tolle Sachen machten und sich stritten. Fuentecilla war umwerfend streitsüchtig. Sie kam aus Madrid, entstammte einer reichen Familie, die ein Vermögen verprasst hatte. Aus vielerlei Gründen, nicht alle selbstverschuldet, hatte Fuentecilla ohne einen Penny dagestanden und schien nun einen mysteriösen Betrug auszuhecken, bei dem es um sieben Millionen Pfund ging, die nicht ihr gehörten. Sie hätte sich unauffällig verhalten sollen, aber ständig zerschlug sie Konservengläser in Läden, die ihren Zorn auf sich zogen, schrie ihren Freund im Supermarkt zusammen oder brüllte andere Eltern vor der Schule auf Spanisch an, weil sie verantwortungslos parkten. Die Beziehung mit ihrem Freund, mit dem sie zusammenwohnte, war turbulent. Auch wenn noch nichts über Gewaltausbrüche bekannt war, schienen sie unausweichlich. Fuentecilla hatte so ihre Probleme mit Streitschlichtung. Trotzdem, sieben Millionen waren kein Spaß, und es war anzunehmen, dass sie mit Leuten zusammenarbeitete, die keinen Spaß verstanden. Eigentlich sollte Morrow sie nicht sympathisch finden.
Der Rechner war endlich hochgefahren. Trübsinnig warf sie einen Blick auf die neuen Dateien mit Material aus den Überwachungskameras. Normalerweise klickte sie sie zuerst an, aber heute wäre das sinnlos. Stattdessen öffnete sie ihre Mails. Die Datei mit dem Notruf war bereits angekommen. Sie schloss ihre Kopfhörer an, klickte drauf und horchte.
Es war eine Kinderstimme mit einem vornehmen englischen Akzent. Sie klang erst ruhig und wurde fast vom Hintergrundbrausen des Bahnhofs übertönt. Als die Person in der Telefonzentrale darum bat, den Namen »Roxanna Fuentecilla« zu buchstabieren, geschah dies äußerst flüssig, und ihre Wohnanschrift samt Postleitzahl folgte ohne Zögern.
»Sie ist seit gestern Morgen verschwunden«, sagte die Stimme. »Ich habe Angst, dass man sie vielleicht umgebracht hat.« Bei dem Wort »umgebracht« geriet sie ins Stocken und klang für den Rest des Gesprächs außer Atem.
Die Zentrale fragte, ob die anrufende Person eine Ahnung hätte, wo Fuentecilla sein könnte. »Ich weiß es nicht … Ich weiß nicht, wohin sie sie gebracht haben.«
Die Zentrale fragte erneut: »Würden Sie mir Ihren Namen und Ihre Adresse nennen?« Aber diesmal wurde einfach aufgelegt.
Morrow war überzeugt, dass eins der Kinder angerufen hatte. Ihr fiel der Vorfall in der Bäckerei ein. Nicht der Junge, bitte nicht der kleine Junge.
Police Scotland war nur in die Bäckerei gegangen, um herauszufinden, was geschehen war, weil Fuentecilla von dort mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme gebracht worden war. Verdacht auf einen gebrochenen Knöchel, aber er war nur sehr schwer verstaucht. Morrow und ihr Team hatten sich die Kameraaufzeichnungen von hinter der Theke immer wieder angesehen, nur zur Unterhaltung: Mutter und Sohn kamen herein, der Junge kleinlaut, die Mutter wütend, er musste etwas Schlimmes angestellt haben. Roxanna kaufte und bezahlte eine Biskuittorte, nahm sie aus der Schachtel und klatschte sie ihm ins Gesicht. Mutter und Sohn standen im Laden und lachten sich kaputt, Tortenreste glitten ihm von den Wangen und fielen auf den gekachelten Boden. Dann wischte sich der Junge einen dicken Klecks von der Wange und warf ihn ihr ins Gesicht, und sie musste so schrecklich lachen, dass sie auf den mit Sahne bekleckerten Fliesen ausrutschte und sich verletzte. Morrow dachte an die mit Sahne und Marmelade verschmierten Gesichter, an die Lachtränen auf seinen Wangen. Bitte nicht dieser kleine Junge.
McGrain stand in ihrer Bürotür. »Wir haben die Aufnahmen von der Central Station. Ich kann sie dir nicht schicken, ohne sie zu komprimieren, willst du einfach mitkommen und sie dir ansehen?«
»Klar.«
Wie bei so vielen technischen Dingen wusste Morrow nicht so genau, was »komprimieren« bedeutete. Sie hatte Angst, ihre Autorität zu untergraben, wenn sie das eingestand, deshalb folgte sie ihm zu seinem Schreibtisch.
3.
Boyd Fraser zerhackte frische Minzblätter mit einem großen doppelschneidigen Wiegemesser. In Italien waren Wiegemesser das Werkzeug der Beiköche, die nicht mit Messern umgehen konnten, aber hier wusste das niemand. In Helensburgh, einem putzigen schottischen Küstenstädtchen, war das Wiegemesser eine niveauvolle Novität.
Jemand von den Gästen im Café schien ihn zu beobachten, weshalb Boyd länger hackte, als es die Minze nötig hatte, in den rollenden Rhythmus eintauchte, das grüne Minzöl in das große Olivenholzbrett einarbeitete. Er wollte den Blick heben und sich vergewissern, dass er wirklich beobachtet wurde, tat es aber nicht. Vielleicht stimmte es ja gar nicht. Vielleicht war das Gesicht nur in seine Richtung gedreht. Wie auch immer, er brauchte keine Scheißanerkennung, von niemandem, um ein Taboulé zusammenzurühren.
Er wusste, dass viele Leute herkamen und die hohen Preise bezahlten, weil es einfach mehr beinhaltete, im Paddle Café zu essen. Bio, Regio, Bauernmarkt. Verwertung von der Nase bis zum Schwanz. Saisonprodukte. Die ganzen leeren Positivwörter, um die er sich früher einen Dreck geschert hatte. Als Boyd damit anfing, war es noch eine Untergrundbewegung. Damals hatte er sich mit derselben fieberhaften Bestimmtheit darin versenkt wie sein Vater, der Pastor, in seinen Glauben. Die Ketzerei der Vergangenheit, pflegte sein Vater zu sagen, war die Orthodoxie der Gegenwart: Die Ernährungsrevolutionäre von einst fanden sich nun in der Rolle der unfreiwilligen Hohepriester eines faden neuen Konformismus.
Seine Frau Lucy hatte sich auf der Hochzeit einer Freundin mal ganz fürchterlich betrunken. Kurz bevor sie in ein Rhododendrongebüsch kotzte, das älter war als ihre Großmutter, sagte sie, dass ein Café mit einer Philosophie völliger Schwachsinn war. Boyd mochte sie an diesem Abend. Er liebte sie nicht bloß – er liebte sie immer –, sondern er hatte sie richtig gern. Hätten sie sich erst an jenem Abend kennengelernt, er hätte sich auf der Stelle in sie verliebt.
Die Philosophie des Cafés war in der Speisekarte des Paddle abgedruckt. Sogar auf der Speisekarte zum Mitnehmen stand die Philosophie drauf. Wir verwenden Bio-Eier blablabla. Wir unterstützen unsere regionalen blablabla. Er wusste, dass das Blabla ihre Gewinnspanne ausmachte. Die Gäste zahlten nur fünffünfzig für sechs Eier wegen des Blablas.
Boyd riskierte einen Blick. Die zudringliche Person hielt ihren Blick noch immer durch die Glastheke auf ihn gerichtet. Eine ältere Frau, aber in dieser Stadt waren alle alt. Ein stilvoller graumelierter Bob, kornblumenblaue Augen, teurer Pullover aus senfgelbem Kaschmir. Sie hatte eine sehr lange, gerade Nase, die spitz zulief. Ihren blauen Schal hielt eine viktorianische Brosche mit Opalen und Diamanten zusammen, wohl ein Erbstück. Sie lächelte ihn an, ihre Brauen hoben sich, als würde sie ihn kennen. Er kannte sie nicht.
Der kurze Blickkontakt war ihr Stichwort. Sie stand auf und schlängelte sich an einem Präsentationskorb mit regionalen, saisonalen Biotomaten vorbei.
»Boyd. Ich bin’s, Susan Grierson.«
Als er ihre Stimme hörte, taumelte er. »Miss Grierson? Um Himmels …« Er stolperte um die Theke herum zu ihr, war wieder ein kleiner Junge, begeistert, seine alte Pfadfinderleiterin wiederzusehen, seine allererste Segellehrerin. Mit beiden Händen nahm er ihre Hand, wollte sie umarmen, wusste aber nicht, ob das zu viel wäre. »Sie sind wieder da!«
»Das bin ich«, sagte sie mit einem Lächeln, so warm wie seins. »Meine Mutter ist gestorben.« Boyd hatte davon nichts gehört, dabei wusste er so etwas normalerweise: Das Café war das Zentrum der Lokalnachrichten.
»Oh, das tut mir leid«, sagte er. »Ich kenne das. Mein Vater.«
»Dein Vater? Na, das muss eine gut besuchte Beerdigung gewesen sein.« Sie meinte die Gemeinde seines Vaters, nicht seine Freunde und ganz sicher nicht die Familie. Tatsächlich waren nur wenige gekommen. Die meisten von ihnen sehr alt. »Die Beerdigung meiner Mutter war erbärmlich.«
Miss Grierson sah trübselig zu Boden, erbebte ein wenig, als hätte sie ihre Mutter gezwungen, alt und einsam zu sein, indem sie in die Welt hinauszog. Viele Leute kamen nach einem Todesfall hierher zurück. Trauer und Entwurzelung wirkten sich ganz verschieden aus, aber alle fühlten sich schuldig. Traurig und schuldig. Was gar nichts brachte.
Boyd versuchte, ihr da herauszuhelfen. »Also, wo waren Sie denn so?«
»USA. Ich habe zwanzig Jahre lang in den Hamptons gelebt.«
»Wie ist es da?«
»Eigentlich so ziemlich wie in Helensburgh. Reizende, freundliche Leute. Obwohl es sich sehr verändert hat.« Sie sah traurig aus, legte aber Munterkeit in ihre Stimme, als versuchte sie, ihre Laune zu heben. »Dann eine Weile in London.« Die Traurigkeit blieb und paarte sich mit einem feuchten, ängstlichen Blick. »Tja …«
»Ach, ich war auch in London«, sagte Boyd freundlich. »Fünfzehn Jahre lang. Sind Sie froh, dass Sie das hinter sich haben?« Er gab ihr die Möglichkeit, London schlechtzumachen, wie es viele taten, die dort weggezogen waren. Üblicherweise munterte es die Leute auf, aber sie biss nicht an.
»Wo in London hast du gewohnt, Boyd?«
»Crouch End.«
»Ich hab’s gewusst!« Sie schmunzelte und sah sich im Paddle Café um. »Hamble and Hamble?«
»Aha.« Boyd grinste keck. »Sie haben mich erwischt.«
»Ich hab’s gewusst! Ich habe gleich nebenan in Highgate gewohnt. Als ich hier reinkam, wusste ich gleich, dass es eine Kopie ist. Schon wegen des Kults um regionale Produkte auf der Speisekarte.«
»Ich kann Sie mir gut im Hambles vorstellen.«
»Du hast sogar dieselbe Farrow & Ball-Farbe benutzt.« Sie nickte in Richtung der Wände. »Haben die nichts dagegen?«
»Na ja …« Er sah zu den Holzregalen, auf denen die Retro-Ölfässchen standen, zu dem schräggestellten Trommelkorb mit dem Sauerteigbrot und zu den braunen Papiertüten, die an einer Schnur von einem blanken Nagel hingen, der in die Wand gehauen war. »Die wissen ja von nichts. Sie würden es merken, wenn sie herkämen, aber das tun sie nicht.« Weil hier niemand herkam – jedenfalls niemand, für den sich Boyd sonderlich interessierte.
»Ich bin so froh, dass ich jetzt wieder da bin, rechtzeitig zum Unabhängigkeitsreferendum …«
Da wusste Boyd, dass sie gerade erst zurück sein konnte. Drei Wochen vor der Wahl war sonst niemand froh. Wer für die Unabhängigkeit war, hielt das Warten kaum noch aus, und die Gegenseite wollte es einfach nur hinter sich bringen. Miss Grierson hob die Augenbrauen und wartete darauf, dass er sagte, ob er dafür oder dagegen war. Boyd sagte nichts. Er führte verdammt noch mal ein Geschäft. Er konnte es sich nicht leisten, öffentlich Position zu beziehen und dadurch die Kundschaft der anderen Seite zu verprellen. Er hob seinerseits die Augenbrauen, und sie wechselte das Thema:
»Und ich habe mich so gefreut, als ich gesehen habe, dass du glutenfreies Brot hast …« Miss Grierson bekam diesen Ausdruck sanften Martyriums in den Augen, den Boyd als Vorbote einer Allergiebiografie kannte. Er schaltete bei den Details gedanklich ab, aber sie schien alle wichtigen Erzählereignisse abzuhaken.
»… kam dann raus, dass ich keine richtige Zöliakie hatte, aber trotzdem eine sehr starke Reaktion auf …«
Boyds Gedanken schweiften wieder ab. Er dachte darüber nach, die glutenfreie Sparte ganz aufzugeben. Ein großer Waitrose hatte ganz in der Nähe eröffnet, und sie führten die Sachen billiger. Er wollte sich diese Geschichten nicht mehr dreimal am Tag anhören. »Allergiebastarde« nannte er sie in Gedanken und Lucy gegenüber. »Allergiebastarde haben heute das gesamte Brot gekauft«, sagte er dann immer, wenn sie fernsahen. Oder »Ich musste das ganze glutenfreie Zeug wegwerfen, weil nicht genügend Allergiebastarde vorbeigekommen sind.« Es schien diesen Leuten nicht möglich, ihren Kram zu kaufen, ohne ihm von ihrem persönlichen Damaskuserlebnis zu erzählen. Er hatte eine Marktlücke entdeckt. Das hieß noch lange nicht, dass er über ihre Darmfunktionen Buch führen wollte.
Miss Grierson hatte aufgehört zu reden. Sie sah ihn fragend an, bemerkte seine Abwesenheit.
»Und«, sagte er, »wie lange sind Sie schon wieder hier, Miss Grierson?«
Sie zögerte, wollte ihm vielleicht anbieten, sie Susan zu nennen, entschied sich aber aus irgendeinem Grund dagegen. »Ganz kurz. Ich muss ihre Sachen durchsehen.«
»Traurig?«
Sie sah traurig aus. »Nein. Sie war sehr alt. Im Haus ist allerdings viel zu tun. Der Garten ist ein einziges Chaos.«
Der Garten der Griersons war ein riesiges Grundstück mitten in der Stadt, dreitausend Quadratmeter groß. Ein kleines Landgut eigentlich. Als Teenager war er im Sommer immer daran vorbeigelaufen. Riesige Kiefern mit Stämmen in der Farbe von Ingwerwaffeln. Dreißig Meter Wiese, und hinten ein großer, umfriedeter Gemüsegarten. Vor kurzem erst war er wieder vorbeigekommen, wenn er lief oder mit Jimbo ging, aber die Mauern waren hoch und die Lücken in der Hecke zugewuchert. Er konnte nicht mehr hineinsehen.
»Tja«, sagte er, »Sie wissen bestimmt schon, dass die meisten so großen Gärten aufgeteilt und einzeln als Bauland verkauft worden sind. Behalten Sie das im Hinterkopf, wenn Sie es verkaufen …«
»Oh, ich verkaufe nicht. Ich ziehe wieder her.«
Boyd lächelte. »Sogar ich bin wieder hergezogen.«
»Wir ziehen alle wieder her, was? Die alte Truppe.«
»Sieht so aus. Ich sehe viele alte Bekannte hier.«
Sie berührte ihn kameradschaftlich am Ellenbogen. »In unserem Alter …« Obwohl er erst fünfunddreißig war, mindestens fünfzehn Jahre jünger als sie.
Mit einem Mal wurde ihm bewusst, was vor dem Mittagessen noch alles erledigt werden musste. Boyd verlagerte sein Gewicht, schob sich langsam hinter die Theke. »Segeln Sie noch?«
»Nein, unser Bootshaus steht jetzt leer. Mutter hat alles verkauft, als ich in die Staaten gegangen bin.«
»Wir haben ein Boot, falls Sie mal rausfahren wollen.« Kaum hatte er das Angebot ausgesprochen, wünschte er sich schon, er könnte es wieder zurücknehmen. Er sah, wie ihre Augen größer wurden, wie sie nachdachte, die Einladung abspeicherte für eine mögliche spätere Annahme. Boyd segelte nicht, um Gesellschaft zu haben. Ihm graute jetzt schon davor, dass seine Jungs mal alt genug sein würden, um mit ihm rauszufahren.
»Vielleicht irgendwann mal«, sagte sie. »Danke, Boyd, das ist sehr nett von dir.«
Er wollte das Thema wechseln. »Waren Sie drüben in den Staaten auch Pfadfinderleiterin?«
»Nein«, sagte sie. »Nach dem Umzug habe ich damit aufgehört. Bis dahin habe ich es aber wirklich geliebt. Es hat mich selbstsicher gemacht.«
»Als Leitwölfin?«
»Ach, weißt du, ich hab’s nicht so mit dem Anführen.« Sie erwärmte sich für die Erinnerung. »Ich hatte dadurch den Mut, einfach rauszugehen und etwas zu tun. Eine tolle Sache für eine junge Frau, dieses Selbstvertrauen zu haben. Das tat mir gut. Meine Mutter überredete mich dazu, weil ich nicht mit meinen Freundinnen an die Uni ging. ›Tu was, Susan!‹« Miss Grierson erging sich in langweiligen Erinnerungen an die Ratschläge ihrer Mutter, wie gut diese Ratschläge waren oder so, aber Boyd hörte nicht mehr zu. Er nahm das Wiegemesser auf, hielt es locker in der Hand. Es war ihr Stichwort, sich zu verabschieden, doch sie redete weiter, ohne auf den Zuhörer zu achten, suhlte sich in der Geschichte zur eigenen Erbauung, wie es alte Menschen eben taten.
Boyd hob langsam das Wiegemesser und wartete auf das Ende der Geschichte. Sie redete aus, sah auf das Messer und blickte sich dann im Laden um.
»Also«, sagte sie unbestimmt, »hast du Arbeit für mich?«
Sehr amerikanisch. Unverblümt und schamlos. Ziemlich unattraktiv.
»Ihnen geht’s wohl kaum ums Geld?« Er sah die Kellnerinnen im Teenageralter an, die gerade Schicht hatten, und senkte deutlich die Stimme. »Miss Grierson, ich zahle echt beschissen.«
Sie lächelte. »Bitte, nenn mich Susan. Nein, aber ich brauche eine Beschäftigung. Ich ertrage den Gedanken nicht, in einem Wohlfahrtsladen zu arbeiten. Da sind nur Leute in meinem Alter. Ich mag es lieber gemischt.«
Boyd grinste sie an: Jedes zweite Geschäft in der Stadt war ein Wohlfahrtsladen. Dort arbeiteten Rentnerinnen auf freiwilliger Basis ein paar Stunden pro Woche. Die meisten Sachen, die sie verkauften, kamen aus Haushaltsauflösungen und aus den Altenheimen, die einen Kreis um die Stadt bildeten. Schmuckstücke und persönliche Gegenstände, die die Familien nicht mehr haben wollten, nachdem.
Er beugte sich zu ihr und flüsterte: »Die Halbtoten verkaufen den Schnickschnack der Toten an die fast Toten.«
Beide kicherten, sie aus Schock über seine Böswilligkeit, er aus Unbehagen. Er hatte es schon oft gesagt, wünschte aber, er hätte es jetzt nicht gesagt. Es war ziemlich fies, und sie war anständig, deshalb spielte es eine Rolle.
»So reden die Leute hier eben.« Er log. Der Spruch war von ihm.
Sie sah ihn unbehaglich an. »Das ist schon ein bisschen gemein!«
Boyd tat so, als würde er zum ersten Mal darüber nachdenken. »Stimmt, das ist tatsächlich ein bisschen gemein. Morgen Abend könnte ich eine Aushilfe gebrauchen, wenn Sie Zeit haben?«
Das schien sie zu verwirren, und sie sah sich im Café um. »Hast du abends geöffnet?«
»Nein. Wir machen das Catering für ein Tanzdinner in den Victoria Halls. Eine Benefizveranstaltung. Es wird Geld für ein Kinderhospiz gesammelt. Ich brauche jemanden, der mit einem Klemmbrett rumsteht und die Tische abhakt, bei denen serviert wird, und alles zeitlich so abstimmt, dass niemand zu lange zwischen den Gängen warten muss. Was glauben Sie, können Sie das?«
Er sah, wie sich ihre Finger um den Rand eines eingebildeten Klemmbretts legten. »Ja«, sagte sie. »Ich denke, das bekomme ich hin, ja.«
»Alles klar, Miss Grierson. Dann sehen wir uns hier um halb sechs. Und ziehen Sie was Schwarzes an.«
»Bitte, Boyd, nenn mich Susan.«
»Nein«, sagte er mit Nachdruck. »Mir gefällt ›Miss Grierson‹.«
4.
Im Transporter, auf der Rückfahrt.
Tommy und Iain kehrten aus der Wildnis nach Helensburgh zurück, auf einer Straße, die durch das Postkartenschottland führte. Auf den hohen, schroffen Hügeln hängte sich Nebel über die kleinen Seen, und Regen verdunkelte die Felswände.
Iain hatte einen Widerhaken in seinem Hals. Die Frau, die tote Frau, ihr Atem steckte dort fest, nur einen Huster entfernt. Warum war sie mit ihnen mitgegangen? Was hatte sie gedacht, was passieren würde? Iain spürte, wie der Haken in seiner Kehle pulsierte und sich verengte, als wollte sie es ihm erklären. Er versuchte sich aus diesem Zustand herauszuwinden. Es war eine gute Sache, sagte er sich. Jetzt ist es erledigt, und die Schulden sind bezahlt. Aber das Gift tief in ihm drin verschwand nicht.
»Du bist so still.« Tommy beschleunigte in einer engen Kurve, das Fahrgestell des alten Transporters stöhnte. »Hat dich das fertiggemacht?« In seinem Mundwinkel zuckte ein Lächeln.
Tommy geilte sich daran auf, einen auf Gangster zu machen, aber er war keiner. Er war noch nie im Knast gewesen. Iain wusste, wie er sich dort aufgeführt hätte: Bei Zusammenkünften hätte er sich in seiner Zelle zusammengekauert, und um Schutz zu erhalten, die Unterhosen irgendeines Verbrechers mit der Hand gewaschen.
Iain hatte lange eingesessen. Er war immer der Schläger für einen wichtigeren Mann gewesen und hatte seine Zeit mit Würde abgesessen. Er war jetzt seit acht Monaten draußen, aber im Kopf immer noch Seifenspender. Seifenspender: ein Gefangener, dem man anvertraute, Hygieneartikel und Stifte zu verteilen. Seifenspender standen irgendwo zwischen Schließern und Gefangenen. Sie waren der moralische Kompromiss, der das gesamte System am Laufen hielt. Sie waren die geschmähten Bewahrer der Ordnung. Jeder fühlte sich ihnen überlegen, das wusste Iain, aber jeder fügte sich in den Kompromiss, weil jeder etwas wollte.
Die Ordnung zu bewahren hieß nicht, eine Frau zu töten. Das war etwas anderes.
»Ist es so?«, fragte Tommy. »Hat es dich fertiggemacht?«
Iain schüttelte den Kopf.
»Sag mal, sie wird doch nicht etwa am Strand von Loch Lomond Shores beim Kinderkarussell angespült werden, oder?«
Das würde sie nicht. Loch Lomond war stellenweise Kilometer tief. Es gab nur eine Richtung: runter. Segler ohne Schwimmwesten, Schwimmer und Wochenendkanuten wurden von der Strömung hinabgezogen und durch die Kälte des tiefen Wassers gelähmt. Sie tauchten wochenlang nicht wieder auf. Manchmal tauchten sie nie mehr auf.
Iain starrte auf seine Hände. Ihr Blut klebte verdünnt an seinen Ärmelaufschlägen und unter seinen Nägeln. Das war nun einer der wenigen brauchbaren Ratschläge, die ihm Sheila jemals mitgegeben hatte, und er hatte ihn vergessen, als es darauf ankam: Salzwasser löst Blut, nur Salzwasser. Das hier war ein Süßwassersee.
Nachdem sie sie über den Bootsrand geworfen hatten, sah Iain seine blutigen Finger. Er wollte sauber sein und tauchte sie ins Wasser. Er rechnete damit, dass es warm sein würde, ein Gefühl, wie wenn man die Hände an einem kalten Wintermorgen unter die Decke steckt, aber das Wasser war stechend kalt. Er riss seine brennenden Hände heraus, die sich zu Klauen zusammengezogen hatten, und keuchte vor Schock, während ihm das blutige Wasser an den Unterarmen herunterlief. Seine Hände sahen fremd aus, als gehörten sie nicht zu ihm. Und jetzt trockneten die Ärmel in der Heizungsluft des Transporters und verkrusteten.
Sie fuhren weiter, überholten einen Waitrose-Lieferwagen.
»Ich war mal in so ’nem Waitrose-Laden. Keine Ahnung, was alle daran finden.« Tommy war wild entschlossen zu plaudern. »Kommst du zum Tanzdinner?«
Iain sah ihn an.
»Morgen Abend?« Tommy leckte sich den Mundwinkel, hielt den Blick auf die Straße gerichtet. »Hast du schon ’ne Karte?«
Iain nickte.
Das Kinderhospiz-Tanzdinner. Iain hatte es vergessen. Er hatte tatsächlich eine Karte. Jeder hatte eine Karte. Mark Barratt stellte klar, dass sie alle da hinmussten. Er wollte, dass jeder teilnahm, weil seine Nichte krank war und weil es für einen guten Zweck war. Wee Paul, Marks Nummer zwei, nervte ununterbrochen, bis ihm alle belegten, dass sie eine Karte hatten. Alle taten, was Mark wollte. Mark selbst ging nicht hin. Er war in Barcelona, während die Sache mit der Frau erledigt wurde. Alibi. Das Privileg des Managements, sagte er.
»Hey, hast du dir schon Gedanken über ›Ja‹ gemacht? ›Babys statt Bomben‹, na? Schon drüber nachgedacht?« Tommy versuchte ständig, das Unabhängigkeitsreferendum ins Spiel zu bringen und auf »Ja« zu drängen. Der Flottenstützpunkt in der Nähe bedeutete, dass es gut einen Kilometer die Küste runter Atombomben gab. Das Unabhängigkeitslager hatte versprochen, dafür zu sorgen, dass sie wegkamen, und das Geld stattdessen in so was wie Kinderkrippen zu stecken.
»Darum geht’s uns. Die Zukunft. Hoffnung, ja?«
Iain nickte. Er pflichtete jedem einfach bei. Er ging nie zu Wahlen. Er hatte sich nicht mal dafür registriert. Mark sagte, sie sollten alle dagegen stimmen. Er sagte, Unabhängigkeit würde seinen Geschäften in Europa schaden.
»Kriegst den Mund nicht auf, Kumpel?«
Iain sagte nichts. Ihm war so elend, dass er nicht wusste, ob er sprechen konnte.
»Ach, vielleicht bist du einfach nur müde.«
Einfach nur müde. Seltsam, dass Tommy sich so ausdrückte, es so sagte wie Sheila früher. Iain dachte eigentlich gerade nicht an sie, aber er hatte den Eindruck, dass er kurz davor gewesen war. Was er geglaubt hatte, die Frau sagen zu hören, war dumm, aber es schien, als sei Sheila entschlossen, sich zurück in seinen Kopf zu kämpfen, und diesmal über Tommy.
Einfach nur müde.
Als Iain jung war und mit blutigen Fäusten oder einem zerschlagenen Gesicht oder einer Tasche mit Sachen, die er eigentlich nicht haben sollte, nach Hause kam und ihr nicht erzählen wollte, was oder warum, dann sagte sie immer, vielleicht sei er »einfach nur müde«, und machte ihm ein Tässchen Tee.
Sheila starb so jung, dass er in ihr immer nur seine Mutter gesehen hatte. Er hatte nie Gelegenheit gehabt, sie als etwas anderes wahrzunehmen. Das einzige Mal, wo er sie als eigenständige Person betrachtete, die mehr als nur ihn hatte und bei der es um mehr als nur ihn ging, war bei ihrer Einäscherung. Irgendein Typ sprach über Jesus. Kein Pfarrer, obwohl ihr das gefallen hätte. Hinter geschlossenen roten Vorhängen kündigte ein quietschendes Rädchen an, dass der Sarg heruntergelassen wurde. Iain fragte sich, was mit den Metallplatten in ihrem Kopf geschehen würde. Bei welcher Temperatur verbrannten sie ihren Körper? Würde das Metall schmelzen, oder würde nur alles drumherum verbrennen? Er stellte sich vor, wie der Schädel, an dem sie befestigt waren, wie ein Stück Butter in der Pfanne schmolz und die Platten aufeinanderstürzten, müde Wände eines Hauses. Einfach nur müde.
Metallplatten in Kopf und Kiefer. Der Kerl, der sie geschlagen hatte, war nicht Iains Vater, er war einfach nur ein Kerl. Schon früh im Leben hatte Sheila eingesehen, dass sie Pech in der Liebe hatte, nur um sich dann ein Arschloch nach dem anderen auszusuchen.
Jedes Mal, wenn Iain einen Neuen kennenlernte, selbst wenn der Typ nett schien oder ihm Süßigkeiten mitbrachte, wusste er, dass er sich in ein Arschloch verwandeln würde. Da gab es diesen Kerl, der versucht hatte, ihn anzufassen, und Iain fehlten die richtigen Worte, um darüber zu sprechen, aber Sheila fand es irgendwie raus. Sie wandte sich an die Schläger im Ort, und sie brachen dem Mann Arme und Beine. Er kam nie wieder zurück in die Stadt. Schläger waren für Iain Helden. Sie sorgten für Ordnung und Gerechtigkeit, wie er fand. Sie waren die Seifenspender von Draußen.
Iain durfte sie im Krankenhaus besuchen, nachdem die Platten eingesetzt worden waren. Ihr Kopf war bandagiert, der Kiefer verdrahtet. Sie saß aufrecht im Bett und konnte nicht sprechen. Iain war exakt sieben Jahre und drei Monate alt. Er wusste das so genau, weil es von seinem Anwalt sehr viel später in irgendeiner Verhandlung als mildernder Umstand vorgebracht wurde – »schwere Kopfverletzung«. Sieben Jahre und drei Monate, als ihn die Sozialarbeiterin zur Intensivstation brachte und in der Tür zu dem Zimmer stehen blieb, aufpasste, ob er klarkam, nicht zu verängstigt war von den Apparaten oder Sheilas Verbänden und ihrem verdrahteten Kinn. Iain hatte damit keine Probleme. Er war nur dort, um vor den anderen Pflegekindern angeben zu können. Er hatte ein Elternteil, das ihn sehen wollte, und sie brauchten für seinen Besuch keine Aufsicht vom Jugendamt. Seine Mama wollte ihn nicht schlagen. Seine Mama mochte ihn wirklich und konnte ihm was zu essen machen und mit ihm abendessen und seine Klamotten waschen und das alles. Die anderen Kinder im Pflegeheim kotzten vor Neid.
Sheilas Augen leuchteten vor Freude, als sie ihn sah, und Iain rannte an ihr Bett. Sie konnte nicht sprechen. Sie hielt eine Hand hoch, warnte ihn davor, ihr Gesicht oder ihren Kopf zu berühren. Sie rollte mit den Augen, um ihm zu zeigen, dass alles wehtat: Uff! Sie machte das Geräusch in ihrem Hals, weil sie die Lippen und die Zunge nicht bewegen konnte. Dann lächelte sie mit den Augen, um zu sagen, dass es okay war. Iain umarmte ihre Zehen, blieb so weit von ihrem Kopf weg, wie er konnte. Er drückte ihre Zehen und küsste sie durch die raue Krankenhausdecke, und Sheila sah ihm zu und kniff die Augen zusammen, um ihm zu bedeuten, dass es ihr gefiel. Dann luden ihre Augen ihn ein, sich zu ihr aufs Bett zu setzen und sich anzukuscheln und mit ihr fernzusehen, und das tat er. Er legte seinen Kopf auf ihren Bauch, und sie streichelte ihm träge übers Haar, und er lauschte, zum Teil dem Gluckern ihres Bauchs, zum Teil den Nachrichten im Fernsehen.
Als später die Drähte herausgenommen wurden, behielt es Sheila bei, nicht viel zu reden. Sie hob die Schultern, was gab es schon zu sagen? Sie hatte recht.
Iain sah durch das Fenster des Transporters auf die gewaltigen Hügel, die schneebedeckten Gipfel und die Nebelschleier, hörte in einem Ohr Sheilas Bauch gluckern, im anderen Tommys nasales Atmen.
»Dann hau ich uns mal Mucke rein«, sagte Tommy, ein bisschen beleidigt, weil Iain nicht sprach. Er drückte auf den Play-Knopf, und Fiddys »I’m Supposed to Die Tonight« quoll in die Fahrerkabine. Der Bass rüttelte an den schlecht schließenden Fenstern. Tommy nickte im Takt mit dem Kopf.
Iain wurde klar, dass dies nichts Neues war. Er hatte schon zuvor so etwas empfunden, diese Distanz zur Welt. Er musste an Andrew Cole denken, weil der damals dabei gewesen war. Iain und Andrew waren zusammen im Bau gewesen und hatten keine Gemeinsamkeiten. Andrew war Oberschicht und las die ganze Zeit, aber er sagte nette Dinge zu Iain, als es darauf ankam. Du schaffst das schon. Versuch einfach, dich ganz normal zu benehmen. Freundlichkeit in Zeiten der Verzweiflung. Die Worte und die Zuwendung blieben an Iain hängen, eine Gefängnistätowierung, Tinte in einer vernarbten Wunde.
Benimm dich einfach ganz normal. Er lauschte auf die Musik und versuchte dem Lauf der Melodie zu folgen, aber er kam aus dem Takt, bewegte seinen Kopf im falschen Rhythmus, als wollte er üben, sein Gesicht aufs Armaturenbrett zu knallen. Er hörte damit auf, abgelenkt von einer winzigen Veränderung: Der Haken saß nicht mehr in seiner Kehle. Sie hatte sich abwärts bewegt, tief hinunter in die Dunkelheit. Es gab keinen anderen Weg als nach unten. Aber sie war nicht von der Kälte gelähmt. Er spürte, wie sie sich bewegte, wie sie sich im Dunkeln streckte.
Das Gesicht zum Fenster gewandt, damit Tommy ihn nicht sehen konnte, schloss Iain seine brennenden Augen und hob resigniert eine Schulter. Sie würde sich durch seine Brust nach draußen nagen. Sie würde sein Tod sein, aber es war ihm egal. Die Schulden waren bezahlt, und er war am Ende. Er konnte sich die Mühe sparen, es selbst zu tun.
5.
Von der Central Station bekamen sie zwei Dateien mit Bildmaterial, jeweils anderthalb Stunden lang. McGrain klickte bei beiden vor bis 07:03:32 Uhr morgens, zehn Sekunden bevor der Anruf eingegangen war. Er holte die erste Datei in den Vordergrund. Eine sehr weitwinklige Aufnahme von der Bahnhofshalle und fünf Bahnsteigen, die Reihe der Telefonzellen war unten rechts in der Ecke des Bildschirms zu sehen. Ein Wald aus etwas, das nach steil aufgerichteten grauen Pfeifenreinigern aussah, erschwerte den Blick auf die Telefone. Morrow blinzelte.
»Was ist das?«
McGrain berührte den Bildschirm. »Blöd. Taubenspikes. Damit sie dort nicht landen. Die sind von dem Bahnhofsdreck ganz verfilzt.«
»Sind die anderen Aufnahmen aus einem besseren Winkel?«
»Die zeigen in die falsche Richtung.«
»Ich hoffe echt, dass es nicht der kleine Kuchenjunge ist«, sagte sie leise.
McGrain nickte eifrig. »Verdammt, ich auch.«
Einen Moment schwiegen sie, lächelten traurig den Bildschirm an, während sie an die Mutter und das Kind und den Kuchen und das ansteckende stumme Gelächter dachten. Morrow riss sich als Erste von der Erinnerung los. Sie deutete auf den Bildschirm. »Dann mach mal.«
McGrain klickte auf Play.
Grobkörnig verwischte Bewegungen, Menschen, die vorbeigingen, vor der riesigen Infotafel stehen blieben. Das Bild war grau bis auf die orangefarbenen Signallampen, die auf einem Elektrowagen in der Ferne blitzten. Die Kamera hing über einem Ladeneingang.
Eine kleine Gestalt in einem grünen Parka, die fellumrandete Kapuze hochgeschlagen, lief am unteren rechten Rand ins Bild. Sie ging direkt auf eine Telefonzelle zu, nahm den Hörer ab und warf eine Münze ein. Die Person, nach der sie suchten, hatte die kostenlose Notrufnummer angerufen, weshalb Morrow nicht sicher sein konnte, dass es sich um ihren Anrufer handelte, aber dann griff die Kapuzengestalt in den Münzschacht für das Rückgeld. Sie sprach in den Hörer.
»Teenager«, sagte Morrow und sah auf die grauen Skinny-Jeans unter dem weiten Parka.
»Ein Junge«, sagte McGrain und zeigte auf die Gesäßtaschen, die tief unter dem Hintern hingen.
Die Gestalt wurde nervös, sah nach links, trat von einem Fuß auf den anderen. Mit einem Mal legte sie auf, um 07:04:09 Uhr, auf die Sekunde genau gleich mit dem Audiomitschnitt. Sie zögerte, ließ eine Hand auf dem Hörer ruhen, und dann huschte sie davon, den Kopf unter der Kapuze eingezogen, als würde sie weinen.
McGrain klickte auf Pause, und sie starrten beide auf den Bildschirm. Man konnte schwer sagen, ob es sich um den Jungen handelte. Sie wussten nicht genau, wie groß er war, und sie hatten noch nie seine Stimme gehört. Die auf dem Band klang eher nach einem Mädchen, aber die Jeans wirkten jungenhaft.
Die zweite Datei mit Bildmaterial zeigte denselben Vorgang, nur weniger deutlich.
»Hast du nach anderen Kameraperspektiven gefragt? Vielleicht kriegen wir das Gesicht?«, fragte Morrow.
»Ich kenne einen von den Jungs dort, er hat die drei Ausgänge in dieser Richtung überprüft. Er hat die Stelle gefunden, wo der Anrufer weggeht, immer noch die Kapuze auf. Er ist dann in ein Taxi gestiegen, das dort gewartet hat, aber wir können das Nummernschild nicht lesen.«
»Warum nicht?«
»Weil die Kamerahaube kaputt ist. Sie hängt vor der Linse.«
Morrow nickte. »Typisch.«
Es musste der Kuchenjunge sein. Sie konnten sein Gesicht nicht sehen, aber Roxanna hatte einen Jungen im Teenageralter, und ein Teenager hatte angerufen. Sie sollten sich sofort mit den Kindern unterhalten, aber das konnten sie nicht. Sie konnten gar nichts tun. Sie brauchten erst die Genehmigung.
»PINAD«, sagte McGrain.
Morrow nickte. »Scheiß PINAD.«
Sie ging zurück in ihr Büro und wartete auf Anweisungen, darauf, dass sich das Büro des Chief Superintendent die Mühe machte, sie anzurufen. Es ging ihr beschissen, und sie wollte trotz allem die CCTV-Aufzeichnungen überprüfen, auch wenn sie wusste, dass Roxanna nicht darauf zu sehen sein würde. Sie fragte sich, warum diese Frau sie so beschäftigte, fragte sich, ob Roxanna den Raum in ihrem Kopf einnahm, den sonst Danny ausfüllte.
Danny McGrath war Morrows Halbbruder. Er war ein allseits bekannter und gefürchteter Gangster in Glasgow gewesen, bis er wegen Anstiftung zum Mord zu acht Jahren verurteilt wurde. Morrow fand ihn weder lustig noch niedlich, er weckte keine widerwillige Bewunderung in ihr, nicht so wie Fuentecilla, aber er beschäftigte sie ganz ähnlich. Ein- oder zweimal täglich kam er ihr in den Sinn, und diesen Raum in ihren Gedanken füllte allmählich Fuentecilla aus. Eine große Gemeinsamkeit, das war ihr klargeworden, bestand darin, wie machtlos sie sich beiden gegenüber fühlte. Sie durfte nicht einmal das PINAD-Team über das Verschwinden der Frau unterrichten, solange sie keine Genehmigung von ganz oben hatte. Sie widmete sich Formularen und Berichten zu anderen Fällen und wartete.
Der PINAD-Fall hatte vor sechs Monaten über sechshundert Kilometer entfernt mit einem Schuss ins Blaue angefangen. Die Metropolitan Police überwachte eine feuchtfröhliche Park Lane-Benefizauktion mit Verdacht auf Geldwäscheaktivitäten. Guter Anlass, wenn man auf der Suche nach Leuten war, die Geld verprassten: Reiche prahlten vor anderen Reichen, während Alkohol in Strömen floss. Die Neugier der Met war angestachelt, als ein Barkeeper und seine arbeitslose Freundin vierundsechzigtausend Pfund für Vitrine – eine Larkin & Son-Designikone hinblätterten. Im PINAD-Lagezimmer hing davon ein Bild an der Wand. Laut Beschreibung im Auktionskatalog war sie aus handgearbeitetem Rosenholz, mit Walnuss- und Ebenholzmarketerie, von Meisterhand gefertigt. Vierundsechzigtausend Flocken für ein hässliches Wandmöbel, so sah Morrow das.
Die Met leitete eine oberflächliche Überprüfung des Pärchens ein. Es stellte sich heraus, dass der Mann, Robin Walker, als Barkeeper in einem privaten Dining Club in Belgravia arbeitete. Roxanna Fuentecilla hatte kein Einkommen. Sie hatte nicht geerbt. Sie hatte nie gearbeitet.
Robin Walker war nicht der Vater der Kinder. Er war erst vor gut einem Jahr mit Roxanna Fuentecilla zusammengezogen, in Folge einer stürmischen Romanze. Der leibliche Vater, Miguel Vicente, stammte aus einer absurd reichen ecuadorianischen Familie. Drei Jahre zuvor hatte er das gemeinsame Heim mit einer Reisetasche verlassen und war zurück nach Ecuador geflogen. Einen Monat später heiratete er eine ebenso absurd reiche Ecuadorianerin: Sie hatte eine schönheitsoperierte Sprungschanzennase und einen Zoo im Garten. Das Paar erwies sich auf den Fotos von Online-Gesellschaftsmagazinen als bizarrer Anblick für schottische Augen: Ihre Zähne sahen aus, als hätten sie sie einem Kind gestohlen, beide hatten gezupfte Augenbrauen, beide hatten glänzende, faltenfreie Haut. Einen Monat nachdem er sie verlassen hatte, stellte Vicente den Unterhalt für Roxanna und die Kinder ein.
Robin Walker war gutaussehend, ziellos und Ende zwanzig. Er wohnte mit seiner neuen Familie in einer möblierten Wohnung mit Zimmerservice in Belgravia. Trotz ihrer beschränkten Möglichkeiten überwinterten sie in St. Lucia. Roxanna brachte ihre Kinder weiterhin zusammen mit dem Botschafternachwuchs auf eine exklusive spanischsprachige Schule mitten in London. Die Met roch Geld, und die Untersuchung wuchs sich aus.
Das Paar ohne Einkommen wurde in Gesellschaft eines kolumbianischen Botschaftsattachés und dessen Frau gesichtet. Rückfragen ergaben, dass Maria und Juan Pinzón Arias für den Zehnertisch bei der Benefizauktion bezahlt hatten, Robin und Roxanna waren ihre Gäste, aber das wohlhabende Paar bot auf keins der Stücke selbst.
Die Kinder der Arias’ gingen zur selben spanischen Schule wie die von Roxanna. Die vier Kids waren nicht direkt befreundet, sie waren in unterschiedlichen Jahrgangsstufen, aber Maria und Roxanna waren sehr plötzlich sehr dicke miteinander. Roxanna verreiste häufig mit Maria Arias, zumeist waren es Übernachtungen in Barcelona, einem bekannten Umschlagplatz für Kokain. Man vermutete Schmuggel. Bei ihrem dritten Ausflug verglichen die Ermittler der Met das Gewicht von Roxannas Fluggepäck vom Hinflug (dreiundzwanzig Kilo) mit dem vom Rückflug (dreiunddreißig Kilo). Die Differenz war verdächtig präzise.
Maria Arias benutzte eine Diplomatentasche, die weder durchsucht noch gewogen werden konnte. Die Untersuchung intensivierte sich erneut, diesmal wurde es aufgrund der diplomatischen Implikationen ernst.