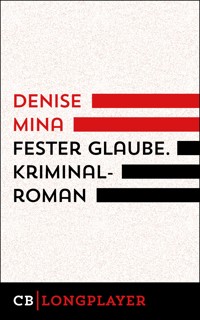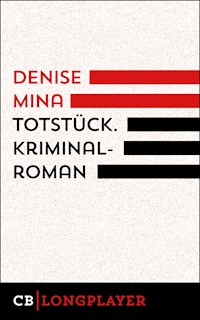9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Für Leserinnen und Leser von Val McDermid, Zoë Beck und Ian Rankin
Ein unmöglicher Mord. Ein wohlhabender Pakistaner wurde getötet. Am Tatort die Fingerabdrücke des Straftäters Michael Brown. Doch der sitzt im Gefängnis. Alex Morrow beginnt zu ermitteln und arbeitet sich durch einen Sumpf aus internationaler Korruption, macht die Bekanntschaft von hochrangigen Beamten in Polizei und Staat, die skrupellos bestechen, Beweise fälschen und auch vor Mord nicht zurückschrecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Ähnliche
DENISE MINA
DASVERGESSEN
Kriminalroman
Aus dem Englischen vonHeike Schlatterer
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
ZUM BUCH
Als nach dem Mord an dem wohlhabenden Pakistaner Aziz Balfour am Tatort die Fingerabdrücke des im Gefängnis sitzenden Straftäters Michael Brown gefunden werden, beginnt Detective Alex Morrow, die eigentlich nur gegen Brown aussagen sollte, zu ermitteln. Sie arbeitet sich durch einen Sumpf aus internationaler Korruption, macht die Bekanntschaft von hochrangigen Beamten in Polizei und Staat, die skrupellos bestechen, Beweise fälschen und auch vor Mord nicht zurückschrecken.
ZUR AUTORIN
Denise Mina, geboren 1966 in Glasgow, studierte Jura und spezialisierte sich auf den Umgang mit psychisch gestörten Straftätern. 1998 erschien ihr erster Roman. Für ihr Werk wurde sie mit dem Dagger Award und dem Barry Award ausgezeichnet, 2012 und 2013 gewann sie den Theakstons Crime Novel of the Year Award. Mehr Informationen unter www.denisemina.co.uk
LIEFERBARE TITEL
In der Stille der Nacht
Blinde Wut
Der letzte Wille
Die Originalausgabe THE RED ROAD erschien 2013 bei Orion Books, an imprint of The Orion Publishing Group Ltd.
Vollständige deutsche Erstausgabe 11/2014
Copyright © 2013 by Denise Mina
Copyright © 2014 by Wilhelm Heyne Verlag, Münchenin der Verlagsgruppe Random House GmbH
Printed in Germany 2014
Redaktion: Dr. Katja Bendels
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, Münchenunter Verwendung von shutterstock/isoga
Datenkonvertierung E-Book: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ePub-ISBN: 978-3-641-14523-1
www.heyne.de
1
1997
Rose Wilson war vierzehn, sah aber aus wie sechzehn. Sammy meinte, es sei eine Schande.
Sie saß allein in seinem Wagen in einer dunklen Straße im Stadtzentrum. An den Geschäften und Pubs waren die Rollläden heruntergelassen. Eine leichte, sommerliche Brise blies die Überreste einer Samstagnacht vor sich her, hob Pappschachteln an und ließ leere Dosen rollen. Rose beobachtete einen gelben Burgerkarton, der wie eine Krabbe aus einer dunklen Gasse auftauchte und vorsichtig den Gehweg Richtung Bordsteinkante überquerte.
Sie wartete darauf, dass Sammy sie zurückfuhr. Es war eine lange Nacht gewesen. Eine schlimme Nacht. Drei Partys in verschiedenen Wohnungen. Sie sagte sich immer, dass sie Glück hatte, nicht draußen auf der Straße frieren zu müssen, aber heute war sie sich da nicht so sicher. Er vereinbarte bereits Termine für die nächste Woche. Jede Menge Kohle, sagte er mit glänzenden Augen.
Rose lehnte den Kopf an die Scheibe. Sammy laberte nur Scheiße – sie verdienten nicht viel Geld damit. Sie schloss die Augen. Es ging überhaupt nicht ums Geld. Er machte es, weil er wollte, dass andere Männer ihn mochten, damit er etwas von ihnen bekam, das er haben wollte. Und sie ließ sie für etwas bezahlen, das sie sich sowieso nahmen. Aber sie und Sammy taten so, als ob sie richtig viel Geld damit verdienten, dass sie minderjährig war. Er sagte, sie bekämen weniger Geld, als er ihr versprochen hatte, weil sie aussah wie sechzehn, aber das sei doch nicht so wild, oder? Sie hätte ja noch genug Zeit, Geld zu verdienen. Es ging den Männern nicht um ihr Alter. Das waren keine Perverse. Rose wusste nur zu gut, dass sich diese Typen auch mit einer blöden Junkie-Kuh mit sechs Bälgern einließen und sich dann kostenlos bedienten. Die Männer, mit denen Sammy sie zusammenbrachte, waren ganz normale Männer. Es gefiel ihnen, dass sie jung war, weil sie wussten, dass niemand ihr glauben würde. Nichts einfacher, als eine Minderjährige zum Schweigen zu bringen.
Aber Sammy musste sich etwas vorlügen, musste so tun, als ob er ein Geschäftsmann oder so wäre. Er würde das Geld sparen, behauptete er, und wenn sie volljährig wäre, würden sie zusammenziehen. Es ging ums Geld, und er liebte sie, sie liebten einander. Wenn er das sagte, sah er ihr immer tief in die Augen, wie der Hypnotiseur, den sie einmal im Pavilion Theatre gesehen hatte.
Vor dem Tod ihrer Mutter war Rose so gut wie nie ausgegangen. Sie ging auch kaum zur Schule. Schließlich konnte sie ihre Mutter nicht mit den Kleinen alleine lassen. Andauernd döste sie ein und ließ brennende Zigaretten fallen, und außerdem ließ sie alle möglichen Typen in die Wohnung. Aber das eine Mal war Rose doch weggegangen, weil sie Ida nicht hängen lassen wollte. Ida T. war ihre Nachbarin. Ida war anständig. Sie wusste, dass es Probleme gab, mehr als üblich. Da sie annahm, der Mutter von Rose ginge es ähnlich wie ihr, dachte sie, ihr würde ein bisschen mehr Spaß im Leben guttun, ein bisschen was zum Lachen. Also kaufte sie zwei Tickets für die Spätvorstellung der Hypnoseshow. Aber als Ida Rose’ Mum abholen wollte, schlief die bereits und sah so aus, als ob sie sich nicht mehr groß rühren würde. Also zog Rose ihren Mantel an und ging an ihrer Stelle mit.
Als die Lichter ausgingen und die Show begann, forderte der Hypnotiseur alle Zuschauer auf, die Hände zusammenzupressen, als ob sie beten würden, und dann sagte er ihnen, jetzt würden sie ihre Hände nicht mehr auseinanderkriegen.
Im dunklen Theater lösten sich Rose’ kleine Hände problemlos voneinander. Die von Ida auch. Beide dachten, der Trick hätte nicht funktioniert, aber dann sahen sie, wie die anderen Zuschauer aufstanden, die Hände wie im Gebet nach oben gerichtet, lachend, verblüfft. Sie hielten die Handflächen weiter aneinander gepresst, während sie über Knie und Handtaschen kletterten, um sich zum Gang vorzukämpfen. Sie liefen zur Bühne, versammelten sich dort und machten sich einen Spaß daraus, den Allmächtigen mit ihren zusammengeklebten Händen anzubeten.
Der Hypnotiseur befahl ihnen, irgendwelche dummen Sachen zu machen, und das übrige Publikum lachte darüber. Manche hatten Sex mit einem Stuhl, zogen sich aus, knutschten mit unsichtbaren Filmstars. Manche waren gar nicht hypnotisiert, das sah Rose sofort. Sie taten nur so als ob, damit sie auf die Bühne kamen, sich albern aufführen konnten und im Mittelpunkt standen. Eine Lüge, auf die sich alle geeinigt hatten.
Wenn Sammy ihr tief in die Augen sah und sagte, sie würden damit viel Geld machen, tat sie so, als ob sie hypnotisiert wäre. Ich liebe dich auch. Aber Rose konnte ihre Handflächen im Dunkeln voneinander lösen. Sie wartete nur, bis sich eine Gelegenheit ergab, von ihm wegzukommen, bis sie jemand anderen fand, jemanden, den sie nicht anlügen musste. Man brauchte jemanden, um sich an ihm festzuhalten, das wusste sie.
Sie sah hinaus auf die Straße mit den Pubs und Clubs, wo sich Kumpels, Cousins, Schwestern und Kollegen getroffen und den Abend miteinander verbracht hatten. Ihre eigenen Brüder und Schwestern waren in alle Winde zerstreut. Verschiedene Familien unten in England hatten sie adoptiert. Das war noch gar nicht so lange her, aber sie konnte sich nicht mehr richtig an ihre Gesichter erinnern. Die Verantwortung für sie fehlte ihr nicht, die ganze Last. Sie war erleichtert gewesen, als sie gingen. Sie würden sie nicht vermissen, da war sie sich sicher. Wo immer sie auch waren, es würde ihnen dort besser gehen als hier. Vielleicht schlugen sie sich in einer neuen Umgebung ja ganz gut. Sie ließ sie gehen. Rose war damals zwölfeinhalb gewesen, zu alt für eine Adoption, sie wusste das. Die Leute wollten frische, unverdorbene Kinder adoptieren, und das war sie nicht.
Alle hatten irgendjemanden. Und sie waren nicht einmal dankbar dafür. Meistens beschwerten sie sich sogar. Rose hasste die Kinder in der Schule, die über ihre Eltern jammerten. Die sich beklagten, weil die Eltern wissen wollten, wo sie sich die ganze Nacht herumgetrieben hatten, die wütend wurden, wenn sie mit blauen Flecken heimkamen und nach Kotze und Sperma stanken.
Sie tat sich selbst leid und spürte, wie ihre Laune in den Keller ging. Das kannte sie schon. Sie konnte es nicht kontrollieren und auch nicht abschwächen, weil sie so müde war, es war schon Morgen, und im Heim erwartete sie eine Diskussion mit den Erziehern, weil sie die ganze Nacht weg gewesen war. Sie ging im Kopf den Dienstplan der Erzieher durch: Die Neue war dran, die große, deshalb konnte Rose nicht einmal auf den alten Trick zurückgreifen, sich während der Standpauke einfach nackt auszuziehen. Ein männlicher Betreuer musste dann sofort den Raum verlassen. Die Erzieher ließen sich nie aus der Fassung bringen, sie hasste das. Sie wurden nie laut, regten sich nicht auf, schrien sie nie an, denn sie bedeutete ihnen nichts. Sammy schrie und brüllte. Seine Stimmung schwankte, sprang von einem Extrem ins andere. Dadurch war er ihr überhaupt erst aufgefallen. Er hatte sie auf dem Weg zur Schule angehalten und ihr gesagt, sie sei schön, und ihr war das peinlich und sie sagte ihm, er solle sich verpissen. Am nächsten Tag war er wieder da, wartete auf sie, aber jetzt war er wütend und sagte ihr, sie sei total eingebildet, wach auf, blöde Schnepfe, dein Arsch ist so groß wie ganz Partick. Und am nächsten Tag tat es ihm leid, das sah man ihm richtig an. Er wollte nur reden. Er spürte diese Verbindung zwischen ihnen, deshalb war er noch einmal gekommen. Rose hielt den Blick gesenkt, seit ihre Mutter gestorben war. Als sie zum ersten Mal wieder aufsah, war es wegen Sammys blödem Gehabe.
Ihre Stimmung verschlechterte sich weiter, sank tiefer und tiefer, war schon jenseits von Wut. Willkürliche Erinnerungen, passend zu ihrer miesen Laune, gingen ihr durch den Kopf: Wie sie in einem Flur voller Müllsäcke ihr Höschen auszog; ein schmuddeliges olivgrünes Badezimmer mit gelben Brandflecken von Zigaretten; vier Männer, die in einem Wohnzimmer saßen und zu ihr hochschauten.
Ihrem Psychologen gegenüber würde sie es zwar nie zugeben, aber sie nutzte tatsächlich manche Techniken, die er ihr gezeigt hatte: Sie schloss die Augen, holte tief Luft und dachte an Pinkie Brown.
Pinkie, wie er ihre Hand hielt, seine große Hand über ihrer kleinen. Pinkie, wie er in einem Topf mit Essen rührte. Pinkie in ihrer gemeinsamen sauberen kleinen Wohnung. Pinkie mit einem Baby im Arm, ihrem Baby vielleicht.
Es funktionierte. Das Atmen und die Bilder verdrängten ihre pechschwarze Stimmung. Der Psychologe hatte gesagt, man könnte immer nur einen Gedanken im Kopf haben und sie könnte sich aussuchen, welcher das war. Es wäre nicht einfach, sagte er, aber sie könnte wählen.
Pinkie auf der Couch, wie er sich ein Fußballspiel im Fernsehen ansah, in Jogginghosen und Unterhemd. Pinkie, wie er sich mit der Hand über seinen Bürstenhaarschnitt fuhr.
Dabei kannte sie Pinkie Brown gar nicht richtig. Sie hatte ihn ein paar Mal gesehen, wenn sie gegen die Kinder von Cleveden gekämpft hatten, einem anderen Kinderheim in der Nähe. Er überragte die anderen um einen Kopf, hatte sich aber im Hintergrund gehalten. Er war anders. Er hatte das Kommando. Einem weinenden Kind hatte er tröstend die Hand auf den Arm gelegt; seinem Bruder Michael, wie sich herausstellte. Er konnte gut mit Kindern umgehen, das wusste sie sofort. Zweimal fiel er ihr auf, einmal auf der Straße, einmal vor der Schule. Ein Mädchen in der Schule sagte, Pinkie hätte nach Rose gefragt.
Pinkie Brown ging ihr nicht mehr aus dem Kopf, und sie fing an, sich Geschichten über ihn auszudenken: Pinkie war ihre Sandkastenliebe. Klar, sie waren beide im Heim aufgewachsen, aber sie wussten, was Familie bedeutet, genau wie die kleinen Mädchen mit den schlechten Zähnen im Heim: Ihre Mutter ging zu Fuß durch die ganze Stadt, um sie zu besuchen, sie sparte sich das Geld für die Busfahrkarte, um ihnen Süßigkeiten zu kaufen.
In Rose’ Fantasie wuchsen sie und Pinkie zusammen auf. Sie blieben einander treu. Sobald sie alt genug waren, kauften sie sich ihr eigenes kleines sauberes Haus und hatten ein Baby. Sie trugen passende Ringe aus dem Kaufhaus.
Ihm war völlig egal, was sie früher gemacht hatte. Er verstand das, sie hatte gutes Geld verdient. Vielleicht würde sie damit aufhören, wenn sie älter war und es sich leisten konnte. Vielleicht würde sie aufs College gehen und Sozialarbeiterin werden, nicht wie ihre Sozialarbeiter, sondern eine richtig gute, die wirklich wusste, was los war, und die dafür sorgte, dass Kindern wie ihr nicht solche Sachen passierten.
Schon besser. Ein Gefühl der Wärme nahm der düsteren Stimmung die Schärfe. Sie wurde schläfrig, aber sie riss sich zusammen und setzte sich aufrecht hin, biss sich in die Wange, um wach zu bleiben. Sie musste wach bleiben, denn nachher im Heim musste sie bestimmt gleich ins Büro und wurde ausgefragt, wo sie die ganze Nacht gewesen war. Sie durfte kein Wort über Sammy oder die Partys sagen. Sie würden sie umbringen. Sie drohten ihr nie, aber sie hörte sie reden. Das Einfachste der Welt, ein Mädchen loszuwerden, das niemand vermisste. Außerdem waren da noch die Erzieher: Sie wollte nicht, dass sie von dieser anderen Welt erfuhren. Die anderen im Heim sagten alle, sie würden die Erzieher hassen, aber manche hatten wirklich etwas Rührendes mit ihrer Hoffnung, sie könnten einem helfen. Rose wollte es ihnen nicht verderben.
Also öffnete sie die brennenden Augen und richtete sich auf. Und sah Pinkie Brown.
Er kam aus einer dunklen Gasse neben dem Pommes-Pakora-Kebab-Imbiss. Er sah direkt zu ihr herüber. Sie spürte, wie ihr Puls am Hals pochte. Er war gekommen, als ob sie ihn durch ihre Sehnsucht aus der schmutzigen Dunkelheit heraufbeschworen hätte.
Er trat aus dem Schatten und ging auf das Auto zu, den Blick fest auf sie gerichtet. Im Licht der Straßenlaternen erkannte sie, dass sein dunkles T-Shirt am Saum aufgerissen und vorn ganz nass war. Er beugte sich vor, öffnete die Beifahrertür. »Rosie vom Turnberry.« Er war außer Atem, seine Haut glänzte vor Schweiß und Panik. »Komm.«
Freudig stieg Rosie aus, aber dann sah sie die roten Spritzer auf seinem Hals, seinem Unterarm. Sein T-Shirt war blutgetränkt.
Er schloss die Autotür und zog sie tief in die dunkle Gasse. Durch die schweren Frittierfettschwaden stach der aufdringliche Geruch von Pisse.
»Ist das dein Blut?«, fragte sie. Es war der erste Satz, den sie im echten Leben zu ihm sagte.
»Nein.« In der Gasse war es dunkel. »Ein paar Typen aus Drumchapel sind auf uns los. Haben unseren Michael verprügelt.« Der Junge, den er getröstet hatte: sein Bruder – er fühlte sich für ihn verantwortlich. »Hab dafür gesorgt, dass sie ihn in Ruhe lassen.«
»Typen aus einem anderen Heim?«
»Nö.« Er sah sie prüfend an. Sie verstand. Die Mitglieder der Gangs, die nicht aus dem Heim kamen, waren hinter ihnen allen her. Cleveden oder Turnberry bedeuteten ihnen nichts. Für sie waren sie alle Abschaum aus dem Heim. Sie wussten, dass man ihnen alles anhängen konnte, sie sowieso an allem schuld waren.
»Rose.« Pinkie streckte ihr eine Hand entgegen. »Nimmst du das?«
Kein Ring von Argos. In seiner offenen Hand lag ein Rambo-Messer mit gebogener Klinge und Sägezähnen. Der Griff war mit silbrigem Gaffaband umwickelt und mit Blut verschmiert.
»Steck das in deinen Strumpf, ich hol es später, okay?« Er hob die Hand, berührte fast ihr Gesicht. »Versteckst du das für mich? Die Polizei durchsucht Cleveden auf jeden Fall. Ich brauch das Messer noch, aber die Bullen dürfen es nicht bei mir finden.«
Das blutige Messer war nur wenige Zentimeter von ihrer Nase entfernt.
Er sah sie erwartungsvoll an, aber Rose rührte sich nicht. Tränen brannten in ihren Augen. Sie starrte weiter auf das verschmierte Messer.
Sie blinzelte. Wenn sie die Augen schloss, sah sie gelbe Brandflecken auf einer grünen Badewanne. Sie öffnete die Augen, eine Träne löste sich und tropfte auf die schmutzige Klinge: Ein sauberer silbriger Spritzer auf dem Rot.
»Hab keine Angst«, sagte er, aber Rose weinte nicht aus Angst. »Du magst mich doch, oder?«
Rose hob langsam die Hand und nahm das Messer beim Griff. Er war klebrig und feucht. Egal. Sie hatte schon Schlimmeres angefasst.
Pinkie lächelte und flüsterte: »Jetzt sind deine Fingerabdrücke drauf.«
Eine Falle. Acht Männer in einer Wohnung, nicht nur ein einziger Freund von Sammy. Besoffene Männer, ein schmutziges Bett, Wodka, mit dem sie sich den Mund spülte. Ihre Hand umklammerte den Griff fester, durch das Gaffaband drang Blut, wie Schlamm, der zwischen den Zehen hervorquillt.
Er spürte ihren Stimmungsumschwung und versuchte sie zu beruhigen. »Ich mag dich doch auch, Rose.« Aber er sagte es ausdruckslos, wie »nett, dich kennenzulernen« oder »alles nur zu deinem Besten« oder »wir wollen doch nur helfen«.
Pinkie Brown wollte sie reinlegen, so wie sie Freier mit Bargeld und einem Gewissen reinlegte. Sie erkannte Schuldgefühle wie andere Kinder verschiedene Geschmacksrichtungen bei Chips. Und Pinkie Brown kannte ihre Gefühle. Er würde nie ihre Hand halten, nie in einem Topf rühren oder ein Baby in den Schlaf wiegen. Das saubere kleine Haus war leer. Es gab gar kein Haus. Wenn sie sich die Geschichten über ihn ausgedacht hatte, hatte sie die Handflächen zusammengepresst und sich eingeredet, sie könnte sie nicht mehr lösen. Tja, jetzt hatten sie sich gelöst.
Es gab nichts anderes. Dreck und der Gestank nach Pisse und Sammy und Schmutz. Sie schloss ganz fest die Augen.
»Rose, ich hab dich in der Schule gesehen.« Pinkies Schatten war über ihr, sein Atem in ihrem Gesicht.
Voller enttäuschter Hoffnungen schubste sie ihn weg.
Zumindest dachte sie das.
Sie wollte ihn schubsen, mit der Hand kurz und grob gegen seine Schulter stoßen. Aber er hatte sich bewegt und sie hatte vergessen, dass sie das Messer in der Hand hatte. Sie spürte, wie sich die Zähne im Fleisch verfingen. Warme Nässe bespritzte ihre Brust. Voller Ekel und Entsetzen riss sie die Hand abrupt nach unten, hielt aber das Messer umklammert und säbelte weiter, wenn es sich irgendwo verfing. Weiter und weiter, bis sich das Messer endlich löste. Sie ließ es fallen, hörte das Klirren des Metalls auf Stein. Sie kniff die Augen noch fester zu und presste die Lippen zusammen, damit ihr nichts in den Mund spitzte.
Sie spürte den Luftzug, als er mit seinem ganzen Gewicht zu Boden ging. Fühlte den Aufprall, hörte sein überraschtes Grunzen. Ein Plätschern auf dem Kopfsteinpflaster. Das Quietschen seiner Turnschuhe, die Gummisohlen, die über das Pflaster rieben. Dann war es still.
Sie konnte nicht hinsehen. Das warme Blut auf ihrem Gesicht kühlte langsam ab.
Vorsichtig öffnete sie ein Auge; das Auge, das dicht an der Mauer war. Alles normal. Dunkle, stinkende Nacht. Der Geruch von Pisse und Fett. Sie sah nach unten. Das Kopfsteinpflaster war nass.
Pinkie lag auf dem Boden, daneben das Messer. Er war auf die Seite gestürzt, mit ausgestreckten Armen, die Augen halb geöffnet. Er lag völlig still, nur an seinem Hals pulsierte etwas, in dem sich das silberne Licht fing.
Allmählich wurde das Pochen langsamer. Rose stand da, wagte kaum zu atmen, sah aus wie sechzehn, fühlte sich wie zwölf. Langsam wurde ihr klar: Eine Tür hatte sich geschlossen. Damit würde sie nie davonkommen. Die würden sie zerstückeln und in einem Müllsack liegen lassen.
Sie stützte sich mit einer Hand an der Mauer hinter ihr ab, beugte sich vor, griff nach dem Messer und steckte es in ihren Strumpf, wie Pinkie es gesagt hatte. Dann richtete sie sich, an die Mauer gelehnt, wieder auf. Ihre Finger waren klebrig, ihre Jeans und Strümpfe mit Blut verschmiert.
Rose blinzelte und schaltete alle körperlichen Empfindungen ab, sie konnte das. Rückwärts tastete sie sich aus der Gasse, eng an der Mauer entlang, wobei sie überall verschmierte, blutige Abdrücke hinterließ.
Sie ging zurück zum Auto, sah sich nicht einmal um, ob jemand sie beobachtet hatte. Sie stieg ein, verriegelte die Tür, schnallte sich an und saß reglos, blickte mit leerem Blick durch die Scheibe.
Sobald Sammy sah, was sie getan hatte, war sie tot. Wie ihre Mutter. Ein Mann lag auf ihr. Ein dicker, erdrückender Mann auf ihrer Mum in der dunklen Küche, die Füße ihrer Mutter strampelten, ein dicker Mann auf ihr. Sie strampelte weiter, als ob das etwas bringen würde. Trat mit den Füßen in die Luft, suchte nach etwas, das sie treffen konnte. Rose schloss die Tür des Schlafzimmers und lehnte sich dagegen, schaute auf die Kleinen, betete, dass sich keins von ihnen bewegte oder aufwachte und schrie. Sie stand hinter der Tür, bis der Mann weg war. Ein betrunkener, fetter, unbeholfener Mann, der auf dem Weg nach draußen die Wände streifte und nie wieder gesehen wurde, nie gefunden wurde. Ihre Mum hatte oft versucht, sich umzubringen, und es nicht geschafft. Sie hatte sich selbst dafür bemitleidet, und doch hatte sie beim Sterben gestrampelt und in die Luft getreten.
Rose saß in Sammys Wagen und hing eine Stunde oder einen Tag oder eine Minute ihren Gedanken nach, sie wusste es nicht. Schließlich kam Sammy die Straße entlanggeschlendert. Er ging direkt zum Auto, schaute nicht in die Gasse.
Als er den Schlüssel ins Türschloss steckte, presste sich sein Bauch gegen das Seitenfenster. Er würde sie umbringen. Oder sie zu den Männern bringen, die sie umbringen würden. Sobald er das Blut an ihr sah, war sie so gut wie tot. Aber er stieg ins Auto, ohne sie anzusehen.
Sammy hatte mit gerade mal vierundzwanzig schon eine Glatze. Und fett war er auch. Für sie sah er aus wie fünfzig. Sie sah aus wie sechzehn, aber er sah aus wie scheißfünfzig, ekelhaft.
»Du glaubst nicht, was passiert ist«, sagte er und schaute nach vorn durch die Windschutzscheibe, seine Stimme normal, laut und fröhlich.
»Was?«, fragte Rose wie betäubt.
»Prinzessin Diana ist tot.« Er gab ein schnaubendes Lachen von sich. »Stell dir das mal vor! Starb bei einem Autounfall in Paris.«
Rose verstand nicht, was daran so wichtig sein sollte. »Leck mich«, sagte sie mechanisch.
Er lächelte und ließ den Motor an. »Aye. Bei einem Autounfall.«
»Verdammte Scheiße«, sagte Rose.
Sammy schaltete die Scheinwerfer ein und fuhr aus der Parklücke hinaus auf die menschenleere Straße.
»Mann«, sagte er beim Fahren. »Da kommt man schon ins Grübeln.« Ihn schien die Geschichte wirklich zu beschäftigen. »Sie war zu jung zum Sterben. Denk doch nur an die Jungs. Was glaubst du, was Charles dazu meint?«
Rose war es nicht gewohnt, sich über aktuelle Ereignisse oder irgendein anderes Thema mit Sammy zu unterhalten. Dass er so kumpelhaft drauf war und tat, als ob sie immer über solche Sachen reden würden, ließ die Nacht noch seltsamer wirken.
Als sie die Bath Street entlangfuhren, stupste er sie mit seinem fetten Ellbogen an. »Was denkst du? Charles: Wie fühlt er sich?«
»Keine Ahnung.« Sie musste etwas sagen. »Fix und fertig?«
»Das glaubst auch nur du.« Lächelnd bog er an einer Ampel ab. »Er ist froh. Jetzt kann er endlich die andere heiraten.«
Sammy schwatzte weiter, über die Queen und Prinz Charles. Rose schaltete einfach ab. Sie hatte keine Ahnung von Politik. Sie war so hundemüde, dass sie Pinkie Brown vergaß. Sie konnte sich nur noch daran erinnern, dass er tot war und überall Blut war. Der Tod drängte sich in ihr Bewusstsein, nahm sie völlig in Beschlag, als ob sie Schmerzen hätte.
An der Einmündung der Turnberry Avenue beugte sie sich vor und kratzte sich gedankenverloren am Knöchel. Als sie die Feuchtigkeit an ihren Fingerspitzen spürte, fiel es ihr wieder ein: Ihre Haut juckte, weil überall an ihr Pinkie Browns Blut klebte. Sie hatte ihn getötet. Sie erstarrte und beugte sich noch weiter vor, berührte mit den Fingerspitzen den Fußraum des Wagens, als ob sie ein Sprinter in den Startblöcken wäre.
Das Kinderheim war in einer großen viktorianischen Villa inmitten des schicken West End untergebracht. Sammys Blick huschte durch die Straße, er wollte nicht von Erziehern oder sonstigen Zeugen gesehen werden.
»Braves Mädchen«, sagte er, weil er dachte, sie würde sich seinetwegen hinunterbeugen.
Er parkte zweihundert Meter vom Heim entfernt, im tiefen Schatten eines hohen alten Baumes. Ein Ast hing unter dem Gewicht seiner Blätter tief hinunter auf die Straße, schaukelte im Wind, die Blätter drehten und wendeten sich, silbern, schwarz. Dazwischen blinkten die orangefarbenen Lichter der Straßenlaternen, doch es dämmerte bereits. Rose blieb unten.
Sammy plapperte weiter, wahrscheinlich hatte er einen Joint geraucht oder etwas eingeworfen, während sie im Auto auf ihn gewartet hatte.
Er sagte: »Eines Tages wirst du mich verlassen, weißt du? Du lebst dein junges Leben weiter, aber mich wirst du hoffentlich in guter Erinnerung behalten. Ich halte sehr viel von dir, das weißt du doch?«
Er wartete auf die übliche Lüge – ich werde dich nie verlassen, Sammy, du bist der einzige auf der Welt, der sich um mich kümmert –, aber Rose sagte kein Wort. Sie dachte an strampelnde Beine, die in die Luft traten. Das hätte sie jetzt auch gern getan.
Ihr Blick fiel auf die teuren Wohnungen draußen, die dunklen Fenster mit den zugezogenen Vorhängen. In solchen Wohnungen schliefen Anwälte und Studenten und Zahnärzte, erholten sich in einem warmen, gemütlichen Bett. In ein paar Stunden würden sie aufwachen, in aller Ruhe frühstücken und sich dann einen gemütlichen Sonntag machen. Sie würden sich anziehen und Briefe an die Stadt schreiben, um sich zu beschweren, dass das Kinderheim die Immobilienpreise ruinierte.
»Was wünschst du dir für dich, Rose?«, fragte Sammy, im selben Ton, aber in einer anderen Stimmung. »Was erwartest du vom Leben?« Und dann zog er die Handbremse an, bereit für ein langes Gespräch.
»Kohle«, sagte sie zum Fußraum. Sie konnte sich nicht aufrichten. Er würde sonst das Blut sehen.
»Tja, dann bist du auf dem richtigen Weg, Kleine.« Er lachte leise. »Was machst du eigentlich da unten?« Jetzt sah er direkt zu ihr, gaffte sie mit seinem großen dummen Gesicht an.
Was machte sie da unten? Die Frage gellte laut in ihrem Kopf. Was machte sie da ganz unten? Warum war immer sie ganz unten? Die Ungerechtigkeit wurde ihr mit einem Mal so deutlich und vollständig klar, dass sie blinzeln musste. Warum konnten andere Mädchen jetzt einfach schlafen? Warum trugen sie gebügelte Kleider und machten sich Sorgen wegen ihrer fetten Oberschenkel, lernten Klavier spielen und lackierten sich die Fingernägel, während sie selbst ganz unten war?
Rose wandte ihm das Gesicht zu. Ihre Finger krochen an ihrem Bein entlang und schoben die Jeans hoch, bis sie das Gaffaband spürte.
»Du bist heute so komisch drauf – was ist denn da unten …«
Ruckartig richtete sie sich auf, stach mit dem Messer in seinen Hals, zog es heraus, stach abermals zu. Sie hatte dabei mit den Beinen gestrampelt, aber jetzt schloss sie die Augen, zog die Knie hoch bis ans Kinn und drückte sich gegen die Beifahrertür.
Nasses Keuchen und Zappeln. Tropfen im Auto. Sammy trat um sich, die Füße strampelten gegen die Pedale. Er packte sie an den Haaren und zerrte sie auf seine Seite.
Doch langsam lockerte sich sein Griff, seine Hand rutschte an ihrem nassen Arm hinunter und verschwand.
Rose wartete, bis das Zappeln langsamer wurde. Wie bei ihrer Mutter waren es auch bei Sammy die Beine, die zuletzt Ruhe gaben. Das einzige Geräusch im Auto war ein nasses Gurgeln.
Sammy sackte zusammen und sank auf das Lenkrad. Ein dröhnendes Hupen ertönte.
Rose konnte sich nicht im Heim verstecken, sie war völlig blutverschmiert.
Sie konnte nicht weglaufen. Wenn die Polizei die Leiche von Sammy dem Perversen fand, würde sie zuerst im Heim suchen, und dann würde sofort auffallen, dass sie fehlte. Und selbst wenn sie der Polizei entkam, die Männer würden sie finden. Sie würde nie davonkommen.
Sie öffnete die Augen und sah aus dem Fenster, das ein Muster aus Blutspritzern zierte. Das schrille Hupen hörte sie gar nicht.
In den Wohnungen ringsum gingen die Lichter an. Vorhänge wurden zurückgezogen. Wütende Gesichter sahen nach dem Auto, dessen Hupe die Stille des Sonntagmorgens zerriss. Rose sah zu, wie sich die Straßenlaternen der Morgendämmerung ergaben und eine nach der anderen ausging.
Sie saß im blutverschmierten Auto und wartete auf die Polizei.
2
Alex Morrow hasste es, wenn sie so nervös war. Sie hasste es. Hinter der Tür scharrte ein Stuhl über den Boden, und ihr Magen sandte ein säuerliches Stresssignal. Sie biss die Zähne zusammen, bis es schmerzte, wütend auf sich selbst. Sie wusste, dass sie nervös war, weil sie ungern vor vielen Menschen sprach und Michael Brown wiedersehen musste, aber das half ihr auch nicht weiter. Tief Einatmen genauso wenig. Sie hatte Bananen gegessen und auf Kaffee verzichtet, aber das hatte auch nicht geholfen. Sie hasste es.
Der Warteraum für Zeugen strahlte öde Langeweile aus. Eine gelbliche Kiefervertäfelung an den Wänden, marineblauer Teppichboden. Sechs Stühle, ebenfalls aus Kiefernholz, mit marineblauem Bezug, dazu ein niedriger Tisch mit ein paar Zeitschriften, die niemand lesen wollte. Ein leerer Wasserspender setzte in der Ecke Staub an. Morrow stellte sich vor, wie ein verunsicherter Zeuge hier wartete, einen Becher Wasser nach dem anderen trank, um das trockene Gefühl im Mund loszuwerden, und dann aufs Klo musste, sobald er in den Zeugenstand gerufen wurde. Ihr Mund war ebenfalls trocken. Sie biss sich auf die Zunge. Wenn es ihr sonst so ging, fragte sie sich normalerweise, warum sie sich das antat. Aber heute saß sie liebend gern mit klopfendem Herzen hier; wenn es sein musste, ein ganzes Jahr lang jeden Tag, falls dadurch ein höheres Strafmaß für Michael Brown heraussprang. Sie wollte diesen Scheißkerl nie wieder verhören müssen. Er drohte ihr bei den Verhören. Er bedrohte Brian. Er sagte, er kenne Pädophile, die dafür bezahlen würden, ihre Kinder zu missbrauchen. Er kannte ihre Privatadresse, verhöhnte ihr Sexleben, hatte sogar vor ihr die Hose heruntergelassen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!