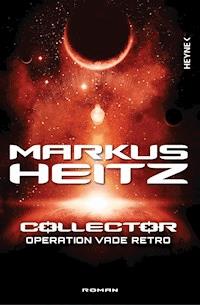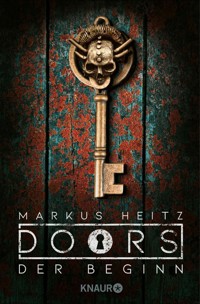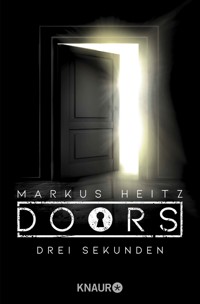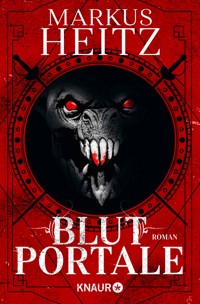
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Pakt der Dunkelheit
- Sprache: Deutsch
Als die Fechterin Saskia bei einem Turnier gegen den geheimnisvollen -Levantin antritt, ahnt sie nicht, dass er ein Dämon ist und seit Jahrhunderten auf sie wartet – denn tief in ihr schlummert eine Gabe, die nur er erwecken kann. Levantin will, dass Saskia für ihn die Blutportale öffnet, damit er in seine Heimat zurückkehren kann. Doch Saskia ist nicht auf ihr dunkles -Talent vorbereitet. Und so stößt sie unbeabsichtigt Türen auf, die nie geöffnet werden sollten … Blutportale von Markus Heitz: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 883
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Markus Heitz
Blutportale
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
»Es ist eine reinigende Handlung. Duellieren reinigt die Seele, man wird alle Rachegelüste, den ganzen Hass los dabei. Das ist das Wunderbare am Duellieren.
Heutzutage ist Duellieren verboten, und trotzdem, täuschen Sie sich nicht, es wird immer noch praktiziert.«
Rudi van Oeveren, Maître (Fechtmeister),Ex-Fechtchampion
Prolog
Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster.
Diese Zeilen waren das Erste, was ihr einfiel, als sie zu sich kam. Allgegenwärtige, undurchdringliche Schwärze umgab sie; obwohl sie die Augen weit aufgerissen hatte, erlaubte ihr die Dunkelheit keinen Blick.
In ihren Ohren rauschte es wie nach einem zu lauten Konzert. Sie fühlte Benommenheit, ein Ziehen in den Schläfen, das Atmen fiel ihr schwer. Ihre Gedanken ließen sich nicht richtig anordnen, sie schwirrten durcheinander. Bilder und Erinnerungen aus den Stunden zuvor, die sie einfach nicht in die korrekte Reihenfolge bekam. Als würde man einen Diavortrag betrachten, bei dem jemand die Rähmchen durcheinandergebracht hatte; der Projektor jagte gnadenlos eines nach dem anderen durch, zog zwei auf einmal ein und schuf noch Verwirrenderes: eine Party, dichtgedrängte, lachende Menschen, indische Dekoration, Kellner in einheitlicher Kleidung, ein üppiges Büfett und bunte Cocktails, eine Tänzerin, ein gutaussehender Mann mit kurzen blonden Haaren, der sie über die Köpfe der anderen hinweg betrachtete …
Die hektischen, tonlosen Bilder jagten ihr Furcht ein. Sie versuchte, sich davor zu schützen, indem sie die Augen fest zusammenkniff, doch es nutzte nichts; aufstöhnend hob sie die Lider wieder und starrte verzweifelt in die Dunkelheit. Erst als das Bombardement aus aufgeschnappten Eindrücken endlich zu verblassen begann, wichen der Schwindel und das Ziehen aus ihrem Kopf.
Ihr wurde bewusst, dass sie am Boden lag, auf dem Rücken. Um sie herum war es schwülwarm, beinahe tropisch. Sie verspürte einen tonnenschweren Druck auf dem Brustkorb, atmete hektisch ein und musste husten, gleich danach würgen; es roch nach Eisen, nach Rasierwasser, nach Erbrochenem, nach verdunstetem Alkohol, nach Essen und nach Exkrementen. Eine schreckliche Mischung. Noch dazu fühlte sie sich, als habe sie sämtliche Drogen der Welt in einer Nacht zu sich genommen.
Aber das hatte sie nicht, so viel wusste sie.
Etwas Licht würde die Angst vertreiben, zumindest mindern. Sie musste nur in ihre Tasche greifen, um den Schlüsselanhänger mit der kleinen Taschenlampe daran herauszuziehen! Doch sosehr sie es auch versuchte, es war ihr nicht möglich, sich schnell zu bewegen; sie stöhnte leidvoll auf. Die Kontrolle über ihre Hand kostete sie enorme Kraft und Konzentration.
Zu ihrem Entsetzen spürte sie, wie die Finger über zerfetzte, feuchte Kleidung glitten, eine nackte Hüfte streiften und schließlich auf ihren nackten Oberschenkel trafen. Kein Schlüsselanhänger. Keine Lampe.
Die Erkenntnis, dass sie halbnackt und zur Regungslosigkeit verdammt dalag, war neue Nahrung für ihre Angst; mehr Adrenalin wurde ausgeschüttet – und schwemmte endlich die Langsamkeit aus ihr heraus. Ihr Körper erwachte.
Sie spürte einen Luftzug, ein leises Quietschen erklang.
»Hilfe …«, murmelte sie und hob den Kopf.
Eine Tür war spaltbreit nach innen aufgedrückt worden. Durch den Schlitz flackerte gelbliches Licht und beleuchtete … einen Körper, der quer über ihr lag! Der Druck auf ihrer Brust!
»Nein, nein!«, keuchte sie, stemmte ihre Arme gegen die Last, schob sie mit Mühe von sich und spürte die warme Luft auf ihrer klebrigen, feuchten Haut.
Der Körper des Mannes fiel nach links … doch sein abgetrennter Kopf rollte über ihren schlanken Bauch hinweg und landete zwischen ihren Beinen auf dem Boden.
Kreischend fuhr sie hoch und wollte sich so schnell wie möglich mit den Fersen rückwärtsschieben, weg von der Leiche. Dabei rutschte sie mehr als einmal aus, der schlüpfrige Untergrund bot nicht genügend Halt.
Als sie eine Wand an ihrem Rücken spürte, starrte sie immer noch nach vorn, unfähig, den Blick abzuwenden. Der Kopf war mit dem Gesicht nach oben zum Liegen gekommen und zeigte ihr ein bekanntes Profil, das im unregelmäßigen Aufblitzen erschien und verschwand, erschien und verschwand. Die Augen waren weit geöffnet, die Gesichtszüge zeigten das Grauen, das den Mann im Moment des Todes befallen hatte. Das flackernde Licht verstärkte den Schrecken.
Aus den wirren Erinnerungen und durch das immense Entsetzen wühlte sich ein Name bis an die Oberfläche ihres Verstands: »Patrick«, schrie sie mit überschlagender Stimme, ein Ruck ging durch ihren Körper – und doch konnte sie sich nicht überwinden, nach vorn zu kriechen. Mit dem Rücken gegen die merkwürdig warme Wand gepresst, hockte sie da und atmete viel zu schnell.
Es war der Gestank des Todes, der sie schließlich von ihrer Erstarrung befreite; er klebte überall an ihr, und sie riss sich die blutgetränkte Kleidung panisch vom Leib. »Hilfe«, brüllte sie verzweifelt. »Hilfe! Ist denn niemand hier?« Der Hall gab ihrer Stimme etwas Fremdes, Unheimliches. Sie hatte plötzlich das Gefühl, nicht allein in der Dunkelheit zu sein.
Wieder war es die Angst, die sie antrieb. Sie sprang unbeholfen auf, rannte in einem Bogen an dem zerstückelten Leichnam vorbei und riss die Tür auf, um in die zuckende Helligkeit zu treten. Eine der vollgesogenen Mullkompressen, die mit Tape an ihrem Oberkörper befestigt waren, löste sich. Sie beachtete es nicht.
Sie stand in einem fensterlosen Gang, der etwa zwei Meter breit war; an den Wänden hingen abstrakte Bilder. Das Grün darauf bildete einen Kontrast zu den zahlreichen dunklen Blutspritzern, die sich auf dem beigefarbenen Putz abzeichneten und daran herabliefen. Die getönten Lampen im Gang flackerten und erzeugten dieses gewitterartige Licht.
Sie hielt unwillkürlich den Atem an, als sie nicht weit vor sich einen Mann und eine Frau auf dem Boden liegen sah, der Herr im Smoking, die Dame im hellgrünen Abendkleid. Die Körper waren wie mit einem gigantischen Skalpell in mehrere Teile geschnitten worden.
Ihr erster bizarrer Gedanke war, dass das Blut die beiden umgab wie ein unvollständiger Soßenspiegel aus Erdbeersirup. Dann strömte unsagbares Entsetzen in sie hinein. Sie rannte wimmernd in die entgegengesetzte Richtung davon, weg vom surrealen Tod, strauchelte, rutschte und musste sich immer wieder abstützen. Sie nahm nicht wahr, dass sie von Kopf bis Fuß mit Blut beschmiert war, doch ihre Handabdrücke blieben an den Wänden und Türrahmen haften.
Unvermittelt stand sie in der Küche, die derart sauber und weiß vor ihr lag, dass sie ungläubig und hysterisch auflachte. Das Zimmer war aufgeräumt, alles stand an seinem Platz und wartete darauf, von einem Koch benutzt zu werden. Auf der Anrichte stand ein mit Zellophan umhülltes Tablett voller Canapés.
Die Sauberkeit der weißen Kacheln und der Anrichte täuschte Unberührtheit vor, als hätte das Verderben vor der Schwelle haltmachen müssen. Es war ein anderes Universum. Mit einem Mal hatte sie das Gefühl, in Sicherheit zu sein, und das Gefühl ließ sie ebenso straucheln wie kurz zuvor noch das Entsetzen.
Die Polizei, zuckte ein Gedanke durch ihren Kopf, ich muss die Polizei rufen, damit sie mich aus diesem Alptraum befreit. Sie wollte keinen Schritt mehr aus der rettenden Küche tun.
1-1-0.
1-1-0.
Zwei kleine Ziffern, dreimal tippen. Es klang so einfach.
Aber ihr Handy war dort, wo sich ihre Kleider befanden. In dieser Kammer …
Schluchzend wankte sie weiter in die Küche hinein und sank an einem Schrank nieder, legte die Hände schützend vors Gesicht – und atmete dadurch den Geruch, der von ihren Fingern ausging, intensiv ein: den metallenen Duft genommenen Lebens.
Sie schreckte davor zurück, stieß sich dabei den Kopf am Schrank, ohne es zu bemerken, und betrachtete ihre Hände: Sie waren tiefrot und glitzerten feucht. Patricks Blut!
Würgend übergab sie sich, immer und immer wieder, bis nichts mehr kam. Hustend und weinend zog sie sich an der Arbeitsplatte in die Höhe. Noch immer weigerte sich ihr Verstand, Informationen aus den vergangenen Stunden preiszugeben. Wollte sie die überhaupt noch?
Erst jetzt bemerkte sie die Geräusche, die aus der Welt des Grauens zu ihr in die schützende Helligkeit der Küche drangen: Telefone läuteten mit verschiedenen Melodien und aus unterschiedlichen Entfernungen. Die Töne gingen ineinander über und schwebten verhallend durch den Raum.
Sie zuckte mit einem unterdrückten Schrei zusammen, riss die Augen weit auf und lauschte mit angehaltenem Atem. Die Rettung!
Ein nostalgischer Schellenton war ihr am nächsten. Er befand sich außerhalb der sicheren Küche, doch jedes Rrring lockte und gab ihr Hoffnung auf Erlösung – wenn sie den Hörer abnahm und ihre Ängste hineinschrie.
Dazu musste sie den Raum verlassen. Den sicheren weißen Raum … Sie atmete wieder schneller, roch das Blut. Das nächste Klingeln ließ sie losrennen, den Blick nach unten gerichtet, damit sie so wenig wie möglich von dem Horror um sich herum mitbekam, und immer dem Ton folgend.
Es ging durch einen Korridor in ein weiteres, großes Zimmer, mehr eine Vorhalle, wie sie annahm. Der Teppich, über den sie lief, war sehr dick und musste teuer sein; das aufwendige Muster war hübsch, und sie versuchte, sich darauf zu konzentrieren, um all das Schreckliche, was sie um sich herum vermutete, ausblenden zu können. Doch dann unterbrach etwas die Unendlichkeit des Musters: Blutspuren, Spritzer und verschieden große Flecken bildeten eigene Formen, die gegen das Teppichmuster verliefen.
»Mein Gott«, ächzte sie, wich dem schrecklichen Hindernis aus und folgte dem Klingeln stolpernd bis zu einer angelehnten Tür.
Dahinter war das Telefon!
Sie schluckte, stand zögernd vor der Klinke und schaute sich selbst zu, wie sie die Hand danach ausstreckte, obwohl alles in ihr Nein schrie. Sie traute sich nicht, auf die andere Seite zu gehen. Welcher Anblick wartete dort auf sie? Würde sie noch mehr ertragen können?
Ein Zittern breitete sich in ihr aus, ihr wurde schlagartig kalt. Sie konnte das Beben nicht länger unterdrücken; jede ihrer Gliedmaßen vibrierte in hoher Frequenz.
Rrrring!
Sie müsste lediglich die Tür öffnen, über die Schwelle treten und abnehmen … den Anrufer anflehen, um Beistand bitten und warten, bis die Helfer kamen …
Rrrring. Das Telefon klingelte noch immer.
Ihre Finger krampften sich um die Klinke, die sich in ihrer Hand erwärmte.
Sie erstarrte, als das nächste Klingeln ausblieb; stattdessen erklang ein elektronisches Klicken, und eine melodische, tiefe Männerstimme sagte: »Sie haben meine Nummer gewählt, aber anscheinend bin ich gerade beschäftigt. Hinterlassen Sie Ihre Nachricht und Ihre Nummer. Vielen Dank.«
Dann piepste es.
»Nein, nein! Dranbleiben! Dranbleiben!« Die Aussicht, dass der Anrufer auflegen könnte und sie wieder allein in diesem Haus war, verschaffte ihr den nötigen Mut, die Tür aufzustoßen und hineinzustürmen.
Nach zweieinhalb Schritten musste sie stehen bleiben: Was sie sah, folterte ihren Verstand. Wo auch immer sie hinschaute, überall erwartete sie ein Anblick, der sie zum Schreien brachte und einen Würgereflex hervorrief.
Sie richtete den Blick schnell weg vom Erdgeschoss, von den Greueln hinauf zur rettenden Decke. Das riesige Zimmer war acht Meter hoch, eine geschwungene Freitreppe aus hellem Marmor führte in den oberen Bereich, von dem aus man wie von einem herrschaftlichen Balkon nach unten blicken konnte.
Sie wusste unvermittelt: Dort hatte der DJ seine Mischpulte und seine ganze Ausrüstung aufgebaut, eine kleine Bar befand sich ebenso da oben wie ein Chill-out-Bereich in weißem Leder. Als sie sich zwischen den Gästen im ersten Stockwerk bewegt hatte, waren etwa zehn Leute dort gewesen. Jetzt sah sie lediglich eine Hand zwischen den hölzernen Gitterstäben der Empore herausragen. Am Zeigefinger haftete eine rote Blutperle, die sich beharrlich der Schwerkraft widersetzte.
Gebannt verfolgte sie, wie der Tropfen lang und länger wurde, bis er wie in Zeitlupe schließlich doch nach unten stürzte und mit einem überdeutlich vernehmbaren Geräusch in einer Blutlache einschlug. Die sanften Wellen, die er durch sein Eintauchen auslöste, zitterten gegen eine verstümmelte Leiche – eine von so unendlich vielen in diesem Raum!
Es fiepte laut, und sie schrak zusammen.
»Vielen Dank«, sagte die Männerstimme. »Ich rufe Sie vielleicht zurück, wenn Sie gutes Karma haben. Die Götter seien mit Ihnen.«
Während die letzten Worte verklangen, wurde ihr Blick von etwas zu ihrer Linken angezogen. An der Wand erhob sich eine zwei Meter hohe Statue, die einige rote Spritzer abbekommen hatte, und schaute ungerührt aus den Bronzeaugen auf die Toten hinab. Kali, erkannte sie, die Göttin des Todes! Fast schien es, als wäre sie für dieses Massaker verantwortlich. Als sei sie von ihrem Sockel gestiegen, mit ihren vielen Armen und ihrem Dolch durch die Menge gerast und habe wahllos getötet.
Die letzten Reste ihres klaren Denkens setzten aus. Der Fluchtinstinkt ließ sie zurückweichen, zurück in die Vorhalle, dann rannte sie tränenblind und verstört durch das Haus, vorangepeitscht von blanker Panik. Auf einmal schien es um sie herum zu flackern. Alles, was sie sah, wurde in helles Blau getaucht, das waberte, wie eine Flammenwand wallte und auch ihr entgegenbrandete, um sie lautlos zu umspielen.
Sie kreischte und wimmerte, schlug um sich und versuchte, die allgegenwärtige Farbe zu verscheuchen. Raus! Nur raus! In ihrer Angst und Verzweiflung merkte sie gar nicht, dass sie gegen Scheiben rannte und sich Prellungen zuzog, auch nicht, dass sich tiefe Risse im Glas bildeten, die trotz der Wucht ihres Aufpralls nicht zu erklären waren. Sie hämmerte gegen verschlossene Türen – und hinterließ tiefe Kratzer im Holz. Sie stieß schmerzhaft gegen Möbel und stürzte, um sofort wieder aufzustehen und weiterzujagen, so gut es ihr noch möglich war, ohne zu bemerken, wie Schubladen und Türen zerbarsten.
Plötzlich stand sie vor einer uralten hölzernen Tür, die eher in ein Schloss als in ein modern eingerichtetes Haus gepasst hätte – und ihre Sicht klarte auf. Die rasend machende Kopflosigkeit zerfloss, das wogende Indigo, in dem sie gerade noch gefangen schien, war verschwunden.
Sie blickte auf polierte Eisenbeschläge, dicke Nieten, eingebrannte Symbole und Zeichen im dunklen Holz, mit denen sie nichts anfangen konnte, schimmernde Zierelemente aus Silber und Gold in halbkreisförmigen Mustern. Der angelaufene Silberknauf war dem Kopf und Hals eines Fabelwesens nachempfunden, einer Mischung aus Bär und Ziege, mit weit aufgerissenen Augen, herausgestreckter Zunge und vier Hörnern auf dem Schädel.
Das Portal stand zu einem Viertel offen, und als sie den Blick nach unten sinken ließ, auf ihre blutigen, zerkratzten Schienbeine und Füße, erkannte sie blutige Abdrücke, die aus der Kammer herausführten.
Ihre Abdrücke!
Hier hatte ihr Fluchtversuch begonnen.
Dahinter lag Patrick. Zerstückelt.
Und abrupt erinnerte sie sich, in dieser Nacht schon einmal vor dieser Tür gestanden zu haben.
Die Bilder einer Vitrine stiegen in ihrem Geist auf. Danach verblasste die Erinnerung wieder – bis auf den heißen Schmerz, den sie unvermittelt wie Flammen am ganzen Körper empfunden hatte und der von ihren frischen Verletzungen ausgegangen war. Sie lagen unter der dünnen Schicht aus Mull und Tape verborgen.
Sie senkte den Kopf und betrachtete ihren Bauch, tastete nach dem Klebestreifen und zog ihn ab. Der feine Gazestoff, der sich mit Patricks Blut vollgesogen hatte, löste sich, und darunter kamen ihre Wunden zum Vorschein.
Ein Laut, in dem ihre ganze Ungläubigkeit lag, drang aus ihrem Mund: Aus den rötlichen Schnitten waren pechschwarze, eingebrannte Bahnen geworden, als habe jemand sie mit einem Brandeisen nachgezogen. Und wenn sie sich nicht täuschte, war der Schnitt, den sie als Letztes erhalten hatte, gerade eben silbrig aufgeglüht!
An der Tür blitzte es ebenfalls. Sie hob den Kopf und sah, dass die Symbole auf dem Kammereingang schimmerten.
Knarrend und ohne dass sie sich gerührt hatte, schwang die Tür zurück. Sie blickte auf die Vitrine.
Sie war leer.
I.Buch
En Garde
I.Kapitel
31. OktoberDeutschland, Hamburg, Ohlsdorf
Aber finden Sie nicht, dass rosafarbene Rosen ein bisschen zu schwul aussehen?« Der Mann in dem sehr teuren dunkelgrauen Anzug betrachtete den Blumenstrauß mit Perlenschnüren und Federn. Ein atemberaubendes Werk vollendeter Floristikkunst.
Will seufzte und wischte sich die Finger an seiner schwarzen Schürze ab. Eine Stunde hatte er damit verbracht, die Anordnung zu überdenken, und sich Mühe gegeben, den Ansprüchen des anstrengenden Kunden gerecht zu werden. Und dann das! »Sie wollen zu einer gleichgeschlechtlichen Hochzeit, Herr Trenske. Und als ich Sie fragte, welche Farbe Ihr Bräutigam …«
»Ja, ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Und dass ich mir Perlen und Federn wünsche.« Trenske zog hilflos die Schultern hoch, das weiße Hemd und der hellgelbe Schlips verrutschten leicht. »Aber ich bin mir nicht mehr sicher.«
»Rosafarbene Rosen stehen für Jugend und Schönheit«, beruhigte ihn Will.
Trenske sah auf die Uhr. »Mein Gott! Noch eine Stunde, bevor ich zum Standesamt muss.« Unglücklich betrachtete er den Strauß. »Was machen wir denn jetzt?«
Will hasste solche Aussprüche. Mit »wir« meinte der Kunde ihn, und es war die kaum versteckte Aufforderung, alles neu zu arrangieren. Aber er zwang sich zu einem Lächeln. »Ich denke, dass wir bei den Perlenschnüren zurückschrauben sollten. Machen Sie sich keine Sorgen, das geht ganz schnell.« Will nahm seine Kreation, drehte sich um und eilte durch den Laden.
Das India erinnerte durch seine verwinkelte Anordnung mehr an einen Garten als an einen Blumenladen. Will hatte seine Pflanzen- und Blumenauswahl in Regalen, Vitrinen und Hängekästen so arrangiert, dass der Kunde immer etwas Neues entdecken konnte. Ein Farben- und Geruchsmeer mit bunten Inseln; lediglich die Rosen und andere Schnittblumen lagerten geordnet in Eimern, damit er sie schneller greifen konnte.
Will entfernte die Perlen, integrierte mit geschickten Handgriffen verschiedene weiße Blüten, gab etwas Grün und ein feines Gazeband dazu und schaffte es innerhalb von fünfzehn Minuten, dem Strauß eine neue Ausrichtung zu geben.
Seinen eigenen Ansprüchen wurde das Werk nicht zu einhundert Prozent gerecht, aber hier handelte es sich schließlich um einen Notfall. »Bitte sehr. Vierzig Euro, Herr Trenske.«
Trenske sah nun sehr zufrieden aus, legte einen Fünfziger und einen Zehner auf den Tisch. »Hier, für Ihre Kosten und Ihre Zeit. Sie können ja nichts dafür, dass ich ein unentschlossener Mensch bin. Aber Sie sind und bleiben eben mein Lieblingsflorist, Herr Gul. Sie haben Wundervolles geleistet!« Er schnupperte an den weißen Rosen und den Lilien. »Ich könnte so etwas nie.«
»Deswegen sind Sie der Investment-Banker und ich der Florist«, gab Will zurück und begleitete den Mann zur Tür. »Beehren Sie mich bald wieder, und dann möchte ich Fotos von der Hochzeit sehen, Herr Trenske. Und von der Torte.«
»Es wird ganz zauberhaft«, seufzte Trenske und trat hinaus auf den Gehweg. »Schönen Tag, Herr Gul!«
»Ihnen auch!« Will entbot ihm den Gruß mit den zusammengelegten Handflächen vor der Brust. Dann kehrte er in den Laden zurück, nahm die Thermoskanne aus einer Schublade unter der Theke und goss sich seufzend Chai in seinen Becher. Es roch nach grünem und schwarzem Kardamom, Nelken und Zimt. Der Duft entspannte ihn sofort und passte hervorragend in das Blütenbouquet des Ladens, den er seit vier Jahren führte.
Will setzte sich auf seinen Hocker, nippte am Becher und betrachtete zufrieden sein Geschäft. Er drückte den Play-Knopf des MP3-Spielers; leise erklang So soll es bleiben von Ich&Ich.
»Lord Ganeesha, auf dich«, murmelte er dem elefantenköpfigen Gott des Wohlstands zu, hob seinen Becher und versprach ihm in Gedanken weitere Opfer, um sich seine Zuneigung zu erhalten. Gegen Geld auf dem Konto war nichts einzuwenden. Jetzt vielleicht noch eine nette Frau …
Der schwarze Tee, der mit Gewürzen, Milch und Honig gekocht worden war, floss warm und süß seine Kehle hinab. Will fühlte, wie sich Ruhe in ihm ausbreitete.
Er fuhr sich mit der rechten Hand durch die nackenlangen schwarzen Haare, um sie nach hinten zu streifen. Danach betrachtete er sein Gesicht in der spiegelnden Vitrine gegenüber. Er hatte den Eindruck gehabt, dass Trenske ihm auffällig lange auf den kurzen Bart geschaut hatte, der schwarz um Mund und Unterkiefer stand. »Shit!« Hatte er es doch geahnt: Er war schief rasiert.
Will stand auf, stellte den Becher ab, nahm sein schärfstes Messer und ging in das kleine Arbeitszimmer, wo er Gestecke und Sträuße komponierte. Vor dem Spiegel über dem Handwaschbecken korrigierte er mit geübten Bewegungen die Linie des Bartschnitts. Er hasste es, wenn etwas nicht symmetrisch war, keine Ordnung hatte.
Die Türglocke erklang.
»Ich komme«, rief Will, stutzte eine letzte Kontur und ging hinaus. Allerdings sah er niemanden, der darauf wartete, von ihm bedient zu werden.
»Kann ich etwas für Sie tun?« Er ging langsam durch sein verwinkeltes Geschäft und suchte nach demjenigen, der die Schelle hatte erklingen lassen. Doch er war allein, wie er bald darauf feststellen musste. Er hatte selbst im entlegensten Winkel niemanden entdecken können.
Ein sehr ungeduldiger Kunde, dachte er schulterzuckend, nahm die Sprühflasche und benetzte damit die Umgebung der Orchideen, damit sie sich mit ihren Luftwurzeln das Wasser ziehen konnten.
»Ach, hier stecken Sie«, sagte plötzlich eine Frauenstimme hinter ihm.
Will zuckte erschrocken zusammen und machte einen Schritt zur Seite, während er herumfuhr und instinktiv einen Arm zur Abwehr hob.
»Hoppla«, lachte ihn eine blonde, etwa vierzigjährige Frau an, die in einem schicken hellbraunen Kostüm steckte. Um ihren Hals trug sie eine Doppelkette aus runden schwarzen Edelsteinen. Sie sah auf seinen halberhobenen Arm. »Wollen Sie mich etwa schlagen?«
»Verzeihen Sie«, sagte er und stellte die Sprühflasche ab. »Ich trainiere wohl zu viel.«
»Ach ja, was denn? Karate?«
»Nein. Kalari.«
Sie schaute erstaunt. »Kalahari? Hat das etwas mit Beduinen zu tun?«
Will lächelte, auch wenn er sich dazu zwingen musste. Er kannte diese Reaktion, und er hasste sie. »Nein, es ist eine Abkürzung und hat nichts mit der Kalahari zu tun.« Meistens äußerte er sich nicht genauer dazu, welchen Kampfsport er betrieb, aber sein Gegenüber sah ihn so auffordernd an, dass er um eine Antwort nicht herumkam. »Die vollständige Bezeichnung lautet Kalarippayat. Es ist eine indische Verteidigungskunst, mit und ohne Waffen«, erklärte er. »Man sagt, dass es der Ursprung aller asiatischen Kampfsportarten ist, und es dient mit seinen zahlreichen Übungen vor allem der mentalen Stärke.«
»Aha. Für Meditation sind die Inder ja bekannt. Die ganzen Gurus, dazu noch ein paar Drogen, und schon geht man ins Nirwana ein.«
Will fasste nicht, was er da hörte; sie lächelte übertrieben, als sei das, was sie von sich gegeben hatte, witzig. Solche Leute mochte er nicht.
Die Dame musste schon einen sehr großen Strauß haben wollen, um diesen Fehlstart vergessen zu machen. »Wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte er frostig.
»Verzeihen Sie den flapsigen Scherz über Ihr … Kalaharidings.« Sie räusperte sich verlegen. »Wie war die Bezeichnung noch mal?«
»Kalarippayat.«
»… Kalarippayat. Davon habe ich noch nie gehört«, räumte sie ein und streckte die Hand aus. »Mein Name ist Mira Hansen. Ich bin Maklerin. Immobilienmaklerin.«
Er schlug ein und spürte, dass ihre Haut gepflegt und weich war. »Was kann ich Gutes für Sie tun?«, fragte er deutlich freundlicher. »Blumen für einen Kunden?« Er deutete auf den Tresen, um sie dazu zu animieren, in den helleren, geräumigeren Teil des Geschäfts zurückzukehren.
Sie bewegte sich nicht und betrachtete stattdessen die Orchideen. »Nein, es geht mir nicht um Blumen.«
Will kniff die Augen zusammen. »Sind Sie von der Hausverwaltung? Wenn es sich um eine Mieterhöhung dreht, dann …«
»Nein, nein«, wehrte sie erheitert ab und nahm eine Visitenkarte aus ihrer kleinen schwarzen Handtasche. »Es geht um etwas anderes. Um Ihr Haus.«
»Mein Haus? Ich habe kein Haus.«
»Ihr Haus … im weitesten Sinne.« Sie nickte und versuchte sich an einem gewinnenden Lächeln. »Die Villa. Ich weiß, dass Sie als Verwalter eingestellt wurden und dafür kostenlos dort wohnen dürfen. Deswegen komme ich heute zu Ihnen, um im Auftrag meines Mandanten ein lukratives Angebot zu unterbreiten.«
»Sie wollen es kaufen?«
»Mein Auftraggeber hat sich zuerst an einen anderen Makler gewandt, aber der hat ihn hängenlassen«, erklärte sie. »Ich hingegen bin niemand, der so schnell aufgibt, Herr Gul. Sie wissen, dass Ihr Arbeitgeber ein sehr scheuer Mensch ist, den man nur schwer erreicht. Aber ich vermute, mit Ihnen tritt er in Kontakt, um über die Belange der Villa zu sprechen, oder nicht?«
»Fragen Sie bei der Anwaltskanzlei nach, die ihn vertritt.«
»Da war ich schon. Aber man zeigte sich dort nicht … kooperativ. Anwälte scheinen genug zu verdienen, um sich nicht durch Geld beeindrucken zu lassen.«
Will blickte sie missbilligend an. »Sie denken, dass es bei mir gelingt?«
Sie merkte, dass sie schon wieder einen Fehler begangen hatte. »Ich möchte, dass Sie dem Besitzer von unserer Absicht berichten und positiv auf ihn einwirken. Und für dieses Entgegenkommen möchte mein Auftraggeber sich bei Ihnen erkenntlich zeigen. Wir werden Ihnen natürlich kurzfristig ein eigenes Haus zur Verfügung stellen, damit Sie weiterhin ein Dach über dem Kopf haben, und darüber hinaus auch … etwas Taschengeld, das ein Mann wie Sie doch sicher gut gebrauchen kann.«
Er fixierte sie. Zuerst riss sie schlechte Witze, dann gestand sie die versuchte Bestechung eines Juristen, und schließlich machte sie ihm ein Angebot, das vor Herablassung nur so strotzte: Taschengeld? Hätte nur noch Scheißblumenverkäufer gefehlt, um die Beleidigung perfekt zu machen. Sollte er so etwas ernst nehmen? »Eigentlich steht es nicht zum Verkauf«, sagte er herablassend.
»Eigentlich heißt, dass es Ausnahmen gibt«, sagte Hansen fröhlich. Sie schien irritierenderweise guter Dinge zu sein, ihr Ziel zu erreichen. »Zudem müssen Sie das nicht entscheiden. Es geht uns darum, dass Sie Ihren Arbeitgeber kontaktieren und ihn … empfänglich machen.«
Will musste über so viel Ignoranz lachen. »Ich habe mich falsch ausgedrückt, verzeihen Sie. Es steht gar nicht zum Verkauf. Das weiß ich ziemlich genau. Der Sir liebt das Anwesen … und ich auch.«
Hansens Laune sank sichtbar. »Es macht Ihnen gar nichts aus, dort zu leben, wo ein Mensch ermordet worden ist und in der Vergangenheit einige andere ihr Leben gelassen haben?«
Will hob die Augenbrauen. »Von dem Selbstmord, der vor einem halben Jahr passiert ist, wusste ich. Aber Mord? Was ist denn geschehen?«
»Sie sehen plötzlich neugierig aus.« Sie wandte sich mit einem siegessicheren Lächeln zum Tresen, und er folgte ihr. Anscheinend war sie noch immer der Ansicht, ihn bestechen und zu ihrem Fürsprecher machen zu können.
Hansen schnupperte und fächerte sich mit der rechten Hand Luft zu. »Was riecht hier so köstlich nach Gewürzen?«
»Oh, das ist mein Chai. Möchten Sie einen?«
»Sehr gern. Da erzählt und verhandelt es sich gleich viel besser.«
Will würde sie in dem Glauben lassen, weil er die Geschichte von den Todesfällen hören wollte. Sein Gesichtsausdruck hatte ihn anscheinend verraten: Er empfand eine morbide Faszination für Geschichten über menschliche Schicksale, die mit dem Tod der Betroffenen endeten. Seine Mutter hatte dies früher immer seine »melancholische Ader« genannt, die er von seinem indischen Vater geerbt hatte.
Hansen machte es sich auf einem Hocker bequem, während er ihr einschenkte. »Danke sehr.« Sie nahm den Becher in beide Hände. »Was wissen Sie denn von dem Selbstmord?«
»Dass es die Nichte meines Arbeitgebers war. Die Polizei fand sie erhängt im Garten und ging von Selbstmord aus, aber die Zeitungen spekulierten, dass mehr dahintersteckt. Sie soll zwei Einbrechern zum Opfer gefallen sein, die sie überrascht hatte.«
»Das ist eine Theorie.« Hansen nickte. »Aber es war auch von einem Fluch die Rede …«
»Und daran glauben Sie?«, wollte Will herausfordernd wissen.
»Ich weiß nur eins mit Sicherheit: Die Arme war erst neunundzwanzig«, erklärte Hansen mit Unschuldsblick. »Und sie war nicht nur die Nichte des Hausbesitzers, sondern hat sich auch für ihn um das Anwesen gekümmert, so wie jetzt Sie.« Die Frau blies über den heißen Tee. »Ein gefährlicher Job, Herr Gul.«
Der Unterton machte Will aufmerksam. Hatte er da eben eine leise Drohung vernommen?
»Das Haus hat als einziges dem Feuersturm des Zweiten Weltkriegs getrotzt«, erzählte die Maklerin weiter. »Die einen sagten, es sei das Werk Gottes, andere betrachteten es als die schützende Hand des Teufels. Wussten Sie das?«
Will goss sich ebenfalls nach. Nein, das hatte er nicht gewusst. »Kommen jetzt Geistergeschichten, die ich meinem Chef erzählen soll, damit er nachgibt?«
»Nun, er kennt sie sicher – aber wie ist es mit Ihnen?« Sie zwinkerte Will zu. »Sie müssen wissen: Es gibt alte Aufzeichnungen, die mein Kunde gefunden hat. In denen steht zu lesen, dass jedes Jahr ein Mensch in dem Haus verschwindet, oder im Garten. Man findet immer wieder Tiere, die in der Umgebung des Anwesens verendet sind, ohne dass sie an erkennbaren Krankheiten litten. Andere wiesen Knochenbrüche auf, waren aber nachweislich nicht geschlagen worden. Das Anwesen sei verflucht, heißt es. Vielleicht ist es ein Geist oder gar noch Schlimmeres.«
Will stieß mit ihr an. »Darauf trinke ich.«
»Freut Sie das?« Hansen zeigte ihre Verwunderung offen. »Sind Sie ein Hobby-Parapsychologe?«
»Nein. Ich bin einfach nur … morbide, schätze ich.«
»Sie sehen eigentlich nicht wie jemand aus, der sich nach dem Tod sehnt.«
»So ist es auch nicht.« Er dachte nach, wie er es am besten erklären konnte. »Ich mag das Leben. Aber wo Leben ist, ist auch der Abschied. Und je brutaler dieser vonstattengeht, umso mehr interessiert er mich. Schieben Sie es auf meine indische Seite. Wir haben viele Götter, Dämonen und Geister, die für Tod und Zerstörung zuständig sind – da sind die Christen eindeutig im Nachteil.« Er lehnte sich vor. »Kann ich die Unterlagen zu lesen bekommen? Merkwürdigerweise habe ich nämlich keine toten Tiere gefunden, seit ich den Job mache. Oder«, er schaute sie herausfordernd an, »versuchen Sie etwa nur, mir mit plumpen Geistergeschichten Angst einzujagen?«
»Ich frage meinen Kunden, ob er bereit ist, Ihnen Kopien zukommen zu lassen. Aber dann wird er mich fragen, was Sie als Preis für eine Fürsprache in unserem Sinn verlangen«, gab sie zurück und schaute taxierend über den Rand ihres Bechers.
Jetzt wollte Will aus Neugier wissen, was man ihm bot. »Machen Sie mir ein Angebot«, sagte er und fügte mit einem sarkastischen Grinsen hinzu, »das ich nicht ablehnen kann.«
Hansen beugte sich nach unten und griff nach einer schwarzledernen Aktentasche, die Will zuvor nicht aufgefallen war. Wann hatte sie sie am Tresen abgestellt? Sie holte eine Unterlagenmappe heraus und schob sie ihm hin. »Dies ist der Kaufvertrag inklusive aller Formalitäten, die ich für Ihren Boss erledigen werde, wenn er unterzeichnet hat. Sie leiten die Unterlagen weiter, bringen die Sache zu einem guten Abschluss, und mein Mandant zeigt sich mit fünfzigtausend Euro erkenntlich, steuerfrei auf einem Konto Ihrer Wahl, Herr Gul. Liechtenstein, Luxemburg, irgendwelche Insel-Banken.« Gespannt betrachtete sie sein Gesicht.
Will räusperte sich, um seine Überraschung zu überspielen, und nahm einen Schluck Tee. Er überlegte schweigend. Fünfzigtausend Euro! Das war viel Geld … und weckte zwangsläufig seine Neugier. »Warum möchte Ihr Mandant denn das Haus? Wer einem Vermittler wie mir so viel anbietet, muss einen ziemlich guten Grund haben.«
»Der Grund ist ganz einfach: Sentimentalität«, antwortete sie leichthin. »Einer seiner Vorfahren hat darin gelebt. Kein direkter Verwandter leider, sonst hätte er von seinem Erbrecht Gebrauch machen können.«
»Verzeihen Sie mir, aber das hört sich doch eher nach einer etwas dürftigen Erklärung an.«
Sie musterte ihn und versuchte zu ergründen, welche Botschaft er ihr damit übermitteln wollte. Dann öffnete sie die Mappe, riss die erste Seite heraus und legte eine neue hinein, die sie aus der Aktentasche nahm. »Herr Gul, ich sehe einen sympathischen Mann vor mir, dem ich es durchaus zutraue, Menschen von Dingen zu überzeugen. Damit ich mir sicher sein kann, dass Sie das tun, erhöhe ich das Angebot an Sie: hunderttausend Euro. Zu den gleichen Konditionen.«
»Hunderttausend Euro?«, rief er beinahe erschrocken. Aus seiner Neugier wurde Misstrauen. Dazu kam, dass Hansens Art ihm immer unsympathischer wurde. Sie belog ihn, das fühlte er, um etwas Wichtiges zu verheimlichen.
»Hunderttausend Euro, Herr Gul.« Sie klappte die Mappe zu. »Ich weiß, dass Ihr Unternehmen nicht schlecht läuft. Aber eine Eins mit fünf Nullen dahinter – das ist viel Geld. Machen Sie schon! Greifen Sie zu – oder wollen Sie ein solcher Idiot sein?«
Mit jedem Euro, der ihm mehr geboten wurde, stand Wills Entschluss, seinen Arbeitgeber nicht zu beeinflussen, unumstößlicher fest. Hier stimmte etwas nicht. Und beleidigen lassen musste er sich auch nicht. »Es wäre besser, wenn Sie jetzt gehen.«
»Sie sind ein geschickter Verhandler.« Hansen öffnete den Mund ein wenig, und er sah, dass sie mit der Zunge gegen die Schneidezähne drückte, eine kleine Pause einlegte und sagte: »Zweihunderttausend Euro und ein kleines Haus in unmittelbarer Nähe zu Ihrem Blumenladen, damit Sie morgens nicht mehr so weit fahren müssen.«
»Nein, Frau Hansen!«, wies er entschieden, aber halbwegs freundlich zurück, auch wenn ihm das Angebot noch in den Ohren klingelte. »Sagen Sie Ihrem Kunden, dass es mir sehr leidtut, aber dass ich keine Rücksicht auf seine … Sentimentalitäten nehmen kann.«
Sie sah ihn beleidigt an. »Ab welchem Betrag kommen wir ins Geschäft, Herr Gul?« Hansen nahm erneut Anlauf, und ihrer kalten Stimme nach zu urteilen, war es das letzte Angebot. »Ich rate Ihnen, es nicht zu übertreiben.«
»Bei keinem Betrag«, kam es rasch über seine Lippen. »Es tut mir leid, aber Sie beißen bei mir auf Granit. Wenn Sie meinem Arbeitgeber das Haus abkaufen möchten, versuchen Sie es direkt bei ihm.«
»Sie wissen, dass das nicht funktionieren wird. Er reist durch die Weltgeschichte, und lediglich Sie haben seine Nummer.«
»Da haben Sie recht – Pech für Sie und Ihren Kunden.« Da er sich stets bemühte, sein Karma positiv zu beeinflussen, fügte er hinzu: »Seien Sie mir nicht böse.« Er nahm zwei weiße Rosen aus dem großen Bündeleimer und streckte sie ihr entgegen. »Hier, als kleine Entschädigung.«
»Ich bin Ihnen nicht böse.« Die Frau sah ihm über die Blumen hinweg direkt in die Augen. »Aber mein Auftraggeber ist es nicht gewohnt, zu verlieren.«
»Einmal ist immer das erste Mal, Frau Hansen – und dieses Mal hat er verloren.«
»Glauben Sie das wirklich? Mein Besuch ist, nun … nennen wir es die erste Runde«, warf sie ein. »Ich habe Ihnen ein Angebot gemacht, das Sie nicht überzeugen konnte – nun werden wir den Einsatz erhöhen müssen.«
Will seufzte und deponierte die Rosen vor ihr auf der Theke. »Haben Sie immer noch nicht verstanden, dass Sie mit Geld nicht bei mir weiterkommen?«
»Ihnen wird das Prinzip von Zuckerbrot und Peitsche bekannt sein?«, fragte Hansen und leerte ihren Becher. »Die neue Offerte wird natürlich eher Ihren Neigungen entsprechen. Meinem Auftraggeber ist es nicht nur wichtig, Sie finanziell abzusichern – sondern auch, Ihr Geschäft vor Schaden zu bewahren …«
Jetzt war es genug! Und er schiss auf sein Karma. Er atmete tief ein. »Drohen lasse ich mir nicht! Das haben schon ganz andere nicht geschafft. Raus!«
Sie lächelte. »Sie scheinen ein netter Mann zu sein. Deswegen habe ich Sie gewarnt. Ihr Geschäft ist viel zu schön, um zu Bruch zu gehen. So viel Glas …«
Will konnte kaum glauben, was ihm die Frau da unverblümt ins Gesicht sagte. »Ich fürchte mich nicht vor Schlägern.« Er kam um den Tresen herum und griff nach ihrem Ellbogen, um sie auf die Straße zu setzen.
Sie machte einen Schritt zurück. »Das wäre aber besser. Mein Auftraggeber hat einige Angestellte, die Sie um zwei Köpfe überragen und wenigstens zwanzig Kilo mehr Muskelmasse auf die Waage bringen als Sie. Ihr Kalahari wird Ihnen nichts nützen.« Hansen nickte ihm zu, bevor er etwas erwidern konnte. »Ich verabschiede mich jetzt, Herr Gul. Wenn ich meinen Fuß über die Schwelle gesetzt habe, bleibt Ihnen eine Stunde, es sich zu überlegen und sich bei mir zu melden. Danach muss ich meinem Mandanten Bescheid geben, wie es sich mit Ihrer Vermittlungsbereitschaft verhält.« Hansen schnappte die Rosen und ging betont langsam zur Tür; sie gab ihm die Gelegenheit, seine Meinung doch noch zu ändern.
Doch Wills Widerstand war aus vielen Gründen geweckt. Er hatte das Geschäft aus eigener Kraft aufgebaut, es mit viel Schweiß zu einem wahrlich blühenden Laden gemacht. Er kam von ganz unten, und er wusste, was Herausforderungen waren. »Ich bin vor der hiesigen Schutzgeldmafia nicht eingeknickt, da werde ich es auch nicht vor Ihren Leuten tun«, sagte er. »Mit Shivas Beistand werde ich allem trotzen, wenn es nötig ist.«
Mit ernstem Gesicht verfolgte er, wie die Maklerin das India verließ und ihm durch die Scheibe einen mitleidigen Blick zuwarf, an den Rosen roch und zur Uhr über dem Tresen deutete. Dann stieg sie in einen geparkten Porsche 911. Sekunden darauf war sie weggefahren.
Will schaute zur Statue des Gottes Ganeesha neben der Uhr. »Ist das eine deiner Prüfungen für mich, mein Lord«, fragte er und überlegte, was er tun sollte, während er ein ganzes Bündel Räucherstäbchen vor dem Figürchen entzündete.
Polizei? Nein, das wollte er selbst regeln. Ein paar Freunde aus dem Kalari-Club anrufen? Schon eher. Das Angebot doch annehmen? Niemals!
»Eine Stunde.« Will betrachtete den kräuselnden Rauch und sandte Gebete an Kali, Shiva und Ganeesha. Danach goss er sich neuen Chai ein und betrachtete die weißen Lilien ihm gegenüber. Lilien. Todesblumen.
Er dachte an die von Hansen angerissene Geschichte des Anwesens. Wie viel davon hatte sie erfunden? Vor dem Teufel, der das Haus angeblich schützte, fürchtete er sich jedenfalls nicht. Der christliche Teufel war für ihn nicht mehr als ein böser Geist; vor seinem Einzug hatte er ein indisches Reinigungsritual im Anwesen und im Garten zelebriert, um solche zu verjagen und der Seele der verstorbenen Nichte Ruhe zu geben. Dennoch blieb er auf der Hut und achtete auf kleine Anzeichen für ungewöhnliche Vorgänge. Bemerkt hatte er nichts, auch nicht die von Hansen erwähnten Kadaver.
Will erinnerte sich daran, wie er zur Anstellung als Housesitter gekommen war: Vor der Eröffnung des India hatte er einige Zeit für verschiedene Landschaftsarchitekten gearbeitet. Das feste Einkommen fehlte ihm schmerzhaft, als der Laden nicht gleich so erfolgreich anlief, wie er sollte. Das über einen seiner alten Auftraggeber und eine Anwaltskanzlei vermittelte Angebot war genau im richtigen Moment gekommen – und selbst wenn er das Geld nicht dringend gebraucht hätte: Beim Anblick des prächtigen Anwesens und des Gartens war an ein Nein gar nicht zu denken gewesen. Das Haus hatte wirklich etwas von einem Palast – und war zudem größtenteils in einem üppigen, indischen Stil eingerichtet, in dem Will sich sofort ausgesprochen wohl fühlte. Es war fast so, als wäre das alles extra für ihn hergerichtet worden, auch wenn dies natürlich nicht sein konnte. Zudem waren die Konditionen beinahe unanständig gut.
Seufzend machte sich Will wieder an seine Arbeit; er musste noch einen Grabschmuck fertigstellen, der am späten Nachmittag abgeholt werden sollte. Dabei konnte er sich auch eine Taktik zurechtlegen, was beim Auftauchen der Schläger zu tun war. Klein beigeben würde er nicht. Will nahm einen grünen Steckschaumstoffblock und fing an, das Gesteck zusammenzusetzen, das er vor seinem inneren Auge sah. Dabei verblasste alles andere, seine Konzentration galt allein seiner Kunst; indische Farbenlehre, Ikebana, sein ganz eigenes Bauchgefühl und deutsches Handwerk flossen ineinander. Schlicht und stilvoll zugleich erwuchs aus Tannenzweigen, zarten Ranken, weißen Lilien und dezenten blauen Trockenbeeren ein letzter Gruß der Arbeitskollegen an Arnold Wengert, sechsundfünfzig Jahre alt, gelernter Busfahrer. Auf dem schwarzen Trauerband, das er von Hand mit schönster Kalligraphie und weißem Lackstift verzierte, sollte der Spruch stehen: Rechts vor links – wo immer du bist, Arnold! Kopfschüttelnd schrieb Will. Nachdem er das Ausrufezeichen gemalt hatte, streckte er sich, blickte auf die Uhr – und erstarrte: Die Stunde, die ihm Hansen eingeräumt hatte, war viel zu rasch verstrichen. Die Türglocke schrillte; und noch einmal, und gleich darauf erneut. Schließlich ein viertes und fünftes Mal.
Will merkte, wie ihm ein Schauer über den Rücken lief. Er spähte aus dem kleinen Zimmer über den Arbeitstisch in den Verkaufsraum.
Vor dem Tresen standen fünf breitgebaute Männer, die alle schwarze Anzüge, weiße Hemden und Sonnenbrillen trugen. Eindeutig nicht die Trauergäste von Arnold Wengerts Beerdigung, die erschienen, um das Gesteck abzuholen.
Der Mann in der Mitte hielt einen Schnellhefter in den behandschuhten Fingern. Handschuhe gegen Abdrücke, schoss es Will durch den Kopf. Er stand auf, wischte sich die Finger an einem Tuch ab und behielt es in der rechten Hand. Durch die Scheibe sah er einen dunkelgrünen Transporter mit getönten Fenstern vor dem Laden stehen.
Sein Kalarippayat betrieb er in erster Linie wegen des meditativen Charakters, weniger zur Verteidigung. Gebraucht hatte er diese Kunst in einem echten Kampf bisher nur einmal, gegen die beiden Typen mit den Baseballschlägern, die vor einiger Zeit versucht hatten, Schutzgeld von ihm zu erpressen. Die hier waren zu fünft, aber immerhin unbewaffnet.
»Guten Tag. Was kann ich für Sie tun, meine Herren?«
Der Mann legte den Schnellhefter vor sich, dann schob er ihn langsam auf Will zu. »Sie können etwas für sich selbst tun, Herr Gul«, bekam er zur Antwort. »Leiten Sie den Kaufvertrag weiter, und wir sind wieder verschwunden.« Dann grinste er, die Drohung blieb unausgesprochen, schwebte aber so deutlich im Laden wie der Qualm der Räucherstäbchen.
Will lächelte und wusste, dass es nicht echt aussah. Seine Mundwinkel fühlten sich vollkommen verkrampft an, als würden sie mit Plastikhaken nach hinten gezogen. »Gehen Sie.«
»Das werden wir, Herr Gul«, der Mann tippte auf die Mappe, »aber nicht ohne eine Antwort.«
»Verschwinden Sie!«
Sein Gegenüber legte den Kopf etwas schief, erwiderte nichts, sondern steckte die Hände in die Taschen. »Brauchen Sie eine Entscheidungshilfe?«
Ein zweiter Mann trat vor, nahm die schwere elektronische Kasse mit beiden Händen – und schleuderte sie, ohne hinzuschauen, hinter sich. Sie krachte in eine Standvitrine und brachte sie zum Einsturz. Die darin präsentierten Deko-Artikel polterten zu Boden.
»Hey, nein!«, rief Will und langte nach den Unterlagen, ohne nachzudenken. »Ich mache es, bevor Sie meinen Laden vollständig zerlegen«, sagte er, um Zeit zu gewinnen. »Wie viel bekomme ich?«
Der Schlägerboss fasste unter sein Jackett und reichte ihm gönnerhaft einen silbernen Umschlag. »Dreißigtausend Euro. Hier habe ich eine kleine Anzahlung für Sie und eine Entschädigung für die Folgen unseres … Gesprächs. Mehr werden Sie von Frau Hansen erfahren. Ihre Nummer haben Sie. Und jetzt, Herr Gul, unterschreiben Sie hier die Erklärung, dass Sie unseren Auftraggeber mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen werden.«
So viel zum Thema Zeit gewinnen. Er würde ganz sicher nicht durch eine Unterschrift bezeugen, dass er sich einschüchtern ließ. Also lief es doch auf eine körperliche Auseinandersetzung hinaus – und zwar jetzt.
Eine Strategie war ihm beim Gesteckanfertigen nicht eingefallen, also musste er improvisieren. Er benötigte einen Vorteil, um es mit der Übermacht aufnehmen zu können. Bei fünf Männern, die wahrscheinlich genügend Erfahrung im Geschäft des professionellen Überredens besaßen, würde er rasch an seine Grenzen gelangen, wenn er sie nicht überraschend ausschaltete. Sein Herz schlug schneller.
»Ein gutes Geschäft. Aber vorher«, sagte er, wandte sich um und nahm ein neues, unterarmdickes Bündel Räucherstäbchen zur Hand, das er mit einem Minigasbrenner entzündete, »möchte ich erst noch das Wohlwollen Ganeeshas herbeirufen.« Will schwenkte die glimmenden Enden derart, dass ihn der Rauch einnebelte – dann stieß er unvermittelt zu, zielte auf das Gesicht des Anführers und traf, wie er am Schrei und am Zischen hörte.
Will ließ die Stäbchen los, flankte mit einem Mutschrei über den Tisch, trat dabei nach zwei Gegnern, die er am Kinn und gegen die Brust traf. Beide gingen zu Boden, während der Anführer im Gang tobte und sich das verbrannte, mit zahlreichen schwarzen Punkten übersäte Gesicht hielt. Seine Sonnenbrille hatte ihn vor der Blindheit bewahrt.
Wills Puls raste, trotzdem war er hochkonzentriert. Kalarippayat allein würde ihm nicht helfen; er trainierte vorwiegend Tritt- und Kampfstock-Techniken, weil er im Laden viel mit den Händen arbeitete und es sich nicht leisten konnte, sie zu verletzen. Sein Kampfstock lag zu Hause, Tritte waren dank der Schürze, die er immer noch trug, nur eingeschränkt möglich – und abgesehen davon, ging es gerade auch nicht um den meditativen Charakter eines Sports, sondern um Selbstverteidigung. Zum Glück konnte sich Will auf seine Reflexe und sein Improvisationstalent verlassen; als der Fausthieb des Angreifers, der rechts von ihm stand, auf ihn zuraste, griff Will instinktiv nach der langen Holzlatte, die er normalerweise benutzte, um Geschenkpapier gerade abzureißen. Ein guter Kampfstockersatz! Er wehrte die heranfliegende Hand mit der Latte ab, rammte dem Gegner zuerst das Knie in den Magen und trat ihm dann, als der Kerl ächzend zusammenbrach, frontal auf das Kniegelenk. Dann drosch er mit der Latte gegen den Kopf des linken Feindes, der den Hieb zwar blockte, dafür aber einen weiteren gegen die Brust erhielt, der ihn keuchend zu Boden sinken ließ, wo er ohnmächtig wurde.
Will keuchte und riss den Knoten der Schürze auf, die seine Bewegungsfreiheit zu sehr einengte. Noch war die Gefahr nicht gebannt. In der Zwischenzeit hatten sich die anderen zwei Schläger, die er nach dem Anführer angegriffen hatte, wieder hochgerappelt und zogen ihre Waffen. Sie sahen aus wie abgesägte Pistolengriffe mit einem dicken, kastenförmigen Ende plus Abzug. Es knallte. Will spürte einen Stich in der Brust, dann schien sie zu explodieren – und sein Körper wurde zu einem einzigen Krampf. Gurgelnd kippte er um, ließ die Latte fallen und rutschte am Tresen entlang, bevor er aufschlug. Das Brennen in seiner Brust blieb, und er meinte zu sehen, wie sich dünne Kabel von seinem Oberkörper bis zu der merkwürdigen Waffe spannten.
»Was sagst du zu dem Taser, Arschloch?«, höhnte der Mann, der sie hielt. »Steck dir deinen Kung-Fu-Scheiß sonst wo hin!«
Ein unkontrollierbares Zucken, das vom Kiefer bis zu den kleinen Zehen reichte, setzte Will außer Gefecht. Das geschundene, pünktchengezierte Gesicht des Anführers tauchte vor ihm auf. »Du scheiß Reiskocher!«, schrie er, schnappte sich eine Vase und goss sich das Wasser ins Gesicht, um die Asche der Räucherstäbchen abzuspülen. Danach schmetterte er das Gefäß mit Wucht auf Will nieder. Der Aufprall auf der Hüfte tat verflucht weh und überlagerte fast den Schmerz, den der Strom verursachte. »Indischer Wichser«, wurde er angebrüllt. »Du hast ein Scheißglück, dass wir genaue Anweisungen haben, wie mit dir zu verfahren ist, sonst würdest du …« Der Anführer ballte die Hände zu Fäusten und rang mit der Beherrschung. »Der Vertrag liegt auf dem Tresen. Ruf die Hansen an, wenn du ihn übergeben hast.« Er nickte und hieß einen seiner Mitarbeiter, sich um den ohnmächtigen Kameraden zu kümmern; die anderen zwei zertrümmerten routiniert die Regale, bis alles, was einmal gestanden hatte, zerborsten auf der Erde lag. Die Hängekästen landeten ebenfalls auf dem Boden, sogar die Schaufenster gingen zu Bruch.
Will kauerte auf dem Boden, die Kabel verbanden ihn nach wie vor mit dem Taser. Der Mann, der ihn bediente, hielt die Hand am Regler, als Drohung, die Voltzahlen jederzeit wieder hochjagen zu können. Schließlich endete das Brennen in Wills Brust und das Muskelzucken; der Taser war abgeschaltet worden.
»So, Inder, du weißt Bescheid. Wir kommen so oft vorbei, bis du das machst, was man von dir erwartet.« Der Anführer beugte sich zu ihm herab und riss ihm mit einem brutalen Ruck die dünnen Widerhaken aus dem Körper.
Will holte tief Luft und konnte sich immer noch nicht rühren. Menschen mit schwachem Herzen würden einen Taserangriff wohl nicht überleben. Er atmete tief ein und aus, richtete seinen Oberkörper behutsam auf und hielt sich ächzend die Brust, in der sein Herz raste.
»Wenn du nun so freundlich wärst, hier zu unterschreiben«, sagte der Anführer und hielt ihm ein Blatt Papier unter die Nase.
»Ve… verpiss dich!«, stieß Will hervor.
»Aber gerne doch«, hörte er zu seinem Erstaunen. »Dann haben wir doch direkt einen Grund mehr, dich noch einmal besuchen zu können.«
Der muskulöseste der Schläger packte Will und schleuderte ihn in das nächste Regal, das daraufhin zusammenbrach und ihn mit Orchideen bedeckte.
Passanten blickten schaulustig herein, einer telefonierte dabei; hoffentlich rief er die Polizei und erzählte nicht nur einem Freund, was er gerade Cooles beobachten konnte. Will lehnte den schmerzenden Kopf gegen ein Regalbrett. »Scheiße«, flüsterte er und musste husten. Mit Qualen im ganzen Leib zog er sich in die Höhe, während die Männer bis auf den Anführer abrückten; der Kräftige nahm grinsend einen Behälter mit roten Rosen mit. Einer nach dem anderen stiegen sie durch die Schiebetür in den Transporter. Die Passanten machten einige Schritte zur Seite, manche flüchteten vorsichtshalber auf die andere Straßenseite. Der Chef riss seelenruhig einen großen Bogen Klarsichtfolie von der Rolle ab und legte sie über den Vertrag auf dem Tresen. »Schönen Tag, Inder«, sagte er und steckte den Umschlag mit dem Geld ein, ehe er zum Transporter ging. Glas knirschte und knackte unter seinen dicken Sohlen.
Will wischte sich das Blut, das ihm ins rechte Auge lief, mit dem Finger weg und wunderte sich über die Folie. Was sollte das nun wieder?
Eine Flasche mit einer Flüssigkeit darin und einem brennenden Lappen im dünnen Hals flog in einem flachen Bogen aus dem Transporter und zerschellte im Eingang. Sofort loderten Flammen auf und leckten über die zerstörten Regale, über die Blumen und anderen Pflanzen.
Der VW donnerte davon, als der Rauchmelder anschlug. Gleich darauf setzte sich die Sprinkleranlage in Betrieb und durchnässte Will mit eiskaltem Wasser. Nun begriff er auch, was die Klarsichtfolie über der Mappe zu bedeuten hatte.
11. OktoberRussland, Sankt Petersburg, Theaterplatz, Mariinski-Theater
Andreji Smolska, ein zweiunddreißigjähriger Nachwuchssänger, der aussah wie ein junger Peter Hofmann mit schwarzen Haaren, hatte mit seiner eindrucksvollen Bassstimme ein Lied nach dem anderen geschmettert. Nun wartete er im Schutz eines künstlichen Hügels auf seinen nächsten Einsatz, wie ein König, dessen Erscheinen das einfache Volk herbeisehnte.
Smolska beherrschte die Massen, verzauberte sie mit seiner Stimme, dem Timbre und dem Ausdruck seines Gesangs. Er dosierte sein Können sehr genau, gewährte den Zuschauern seine Gunst und gab ihnen doch immer das Gefühl, Bittsteller zu sein. Er bekam jeden Menschen dazu, dankbar für jeden einzelnen Ton zu sein, der ihm über die Lippen kam. Er war eine Ausnahmeerscheinung, und er wusste dies zu seinem Vorteil einzusetzen.
Die zweitausend Zuschauer verfolgten gebannt den vierten Akt der Oper Ein Leben für den Zaren, die von dem Kämpfer Sussanin handelte, der im Jahre 1613 durch eine heldenhafte Täuschung eine Truppe polnischer Angreifer in die Irre geleitet und den schutzlosen Zaren vor ihnen gerettet hatte. Smolska hatte selbstverständlich die Rolle des Sussanin übernommen.
Die Petersburger hatten Glinkas Stück aus dem neunzehnten Jahrhundert immer schon gern gesehen, und damit das so blieb, hatte der neue Intendant des Mariinski-Theaters die Inszenierung kräftig modernisiert. Auf der Bühne wurde nun mit rasanten Säbelkämpfen und filmtauglichen Prügeleien reichlich Action geboten. Aus dem Klassiker war beinahe ein Musical geworden, ohne aber seinen Charme zu verlieren.
Smolska betrachtete das Theater stolz, seine Augen kamen mit dem schummrigen Licht hervorragend zurecht. Auch wenn der prachtvolle Saal nicht ihm gehörte, war es doch seine Welt, sein Ersatzreich, in dem er unangefochten mit seiner Stimme und seiner Präsenz herrschte.
Der herrlich dekorierte, mehrstöckige Zuschauerraum mit seinen Logen war beinahe noch original erhalten. Die leuchtend weißen Skulpturen, das blitzende Gold überall, die hellblauen Polster und Gardinen machten das Mariinski zu einer Art kleiner Zeitmaschine. Wenn er zur Zarenloge hinaufsah, rechnete er fast damit, jeden Moment einen der glorreichen Herrscher aus der Vergangenheit dort zu erblicken. Er selbst würde auch sehr gut in diese Loge passen, dachte er. Eines Tages, am Ende einer seiner Arien, würden sie ihn freiwillig dorthin tragen und ihm huldigen.
Manche behaupteten, es sei der romantischste Theatersaal der Welt. Für Smolska war er weit mehr als das.
Jetzt stand der Höhepunkt an: Sussanin würde den polnischen Feinden ihre Täuschung eingestehen und nach einem langen Zweikampf mit dem Anführer sein Leben verlieren. Ein Leben für den Zaren.
Smolska zog den stumpfen Säbel, sein Blick richtete sich ein letztes Mal auf die prächtige dreistufige Deckenleuchte in Form der Monomachkrone der russischen Monarchen, die unter der italienisch gestalteten Decke schwebte. Tausend Kristallhängeleuchten glänzten und funkelten daran. Wenn nun noch die Besucher andere Kleidung trügen, wäre die Illusion, sich in einem anderen Jahrhundert zu befinden, perfekt.
Wie gern hätte er zu dieser Zeit gelebt, als gefeierter Bass und hochbezahlt. Nicht wie heute. Aber noch viel lieber wäre er an einem anderen, weit entfernten Ort …
Smolska überprüfte die Spitze seiner Theaterklinge, die sich bei leichtem Druck einzog und federte. Er dachte an die guten alten Errol-Flynn-Streifen, in denen sie ebenso gekämpft hatten wie er: heroisch, fürs Auge und abseits vom echten Degen- oder Säbelkampf, den er in seiner Freizeit praktizierte. Doch dem Publikum gefiel es.
Sein Einsatz kam. Es war an der Zeit, dem Volk einen wahren König zu zeigen. Smolska schritt aus seinem Versteck, ganz langsam und getragen. Der Spot beleuchtete ihn, und sofort brandete ekstatischer Zwischenapplaus auf. So etwas hatte es in einem Theater noch niemals gegeben. Er genoss es, lächelte dem Publikum zu, freundlich, doch selbstherrlich, wie es sich für ihn gehörte, ehe er mit seinem Spiel begann.
Smolska lief vor dem Kulissen-Unterholz hin und her, bedachte die polnischen Kämpfer mit Beschimpfungen und sang dann sein Gänsehaut erzeugendes Loblied auf Russland und den Zaren, während die Musiker im Orchestergraben dazu aufspielten und die Lautstärke immer weiter anschwellen ließen; aufnehmen konnten sie es mit ihm und seiner bombastischen Stimme nicht. Smolska war immer zu hören und dominierte alles. Er war ein Souverän.
Laut Regieanweisung stand jetzt das Gefecht gegen mehrere Gegner an, das für Sussanin zunächst siegreich verlaufen sollte. Smolska legte los und sprang den ersten falschen Polen an, von dem er wusste, dass er Paranov hieß und aus Moskau stammte. Er sang konzentriert und plänkelte mit seinem Gegner zwischen den falschen Bäumen herum, bis er Paranov den Todesstoß versetzte und sich dem nächsten Feind zuwandte.
Atemlos vor Glück, verfolgte das Publikum Gesang und Gefecht.
Smolska schaute über die Schulter und eilte seinem zweiten Feind entgegen. Sein Kontrahent war viel schneller als erwartet heran. Das Klingenkreuzen begann, während Smolska sang … und nach dem zweiten Schlag realisierte: Die zustoßende, peitschende Dreikantklinge seines Gegners war solide und ohne einfahrende Spitze! Außerdem lag die Geschwindigkeit der Hiebe bei weitem über der eines Bühnengefechts. »Sie hätten die Forderung nicht zurückziehen sollen«, raunte ihm sein Gegner unerwartet zu. Trotz der Musik und des Gesangs verstand Smolska ihn sehr deutlich. Das Gesicht unter dem Schlapphut und dem falschen Bart kannte er nicht, aber die Frage des Mannes erklärte, um wen es sich handelte.
»Sie wagen es, mich in meinem Reich herauszufordern?«, gab er während einer kurzen Pause im Lied so zurück, dass nur sein Gegner ihn hören konnte. Noch unterbrach er sein Spiel nicht für eine Sekunde; das hätte dem anderen das Gefühl geben können, dass er Angst hatte. Und allein dieses Wort existierte für ein Wesen wie Smolska nicht.
»Es macht Ihnen doch sicher nichts aus, wenn wir unser Gefecht auf der Bühne nachholen?«, wisperte der Mann und langte mit der anderen Hand auf den Rücken, um einen zweiten Degen zu ziehen und ihn Smolska zuzuwerfen. »Sich vor Publikum zu duellieren, ist mir eine willkommene Abwechslung.«
Smolska fing die Waffe. Die Forderung hatte er auf Anraten seines besten Freundes zurückgezogen. Dieser hatte ihn vor seinem Gegner gewarnt, besser gesagt, vor den Fertigkeiten des Mannes, dessen Ursprünge sie erst näher ergründen wollten, bevor er ihm gegenübertrat.
Smolska schleuderte seine Attrappe davon – und musste sich so auf die überschnellen Bewegungen seines Gegenübers konzentrieren, dass er unwillentlich verstummte. Kalte Wut überfiel ihn. Diesen Einbruch in seine Domäne, noch dazu mitten in seinem Stück, würde er nicht verzeihen! Das Orchester spielte weiter, um dem Sänger die Möglichkeit zu geben, den Part wieder aufzunehmen; der Souffleur fuchtelte aufgeregt mit den Armen und pochte gegen das Skript. Die Statisten sahen erstaunt zu Smolska hinüber, und im Zuschauerraum begann das Tuscheln. Bühnentricks und Kämpfe waren schön und gut, wenn die Qualität des Gesangs nicht darunter litt – und ganz abbrechen durfte er erst recht nicht!
»Hochverehrtes Publikum«, sagte Smolska laut in den Zuschauerraum und zeigte auf seinen Gegner, »wir bieten Ihnen ein kleines, eigens für den heutigen Abend einstudiertes Duell, zu Ehren der fünfundzwanzigsten Aufführung in diesem Theater. Behalten Sie Platz, verehrte Herrschaften, und genießen Sie, wie Sussanin seinen Herausforderer tötet.« Er blitzte seinen Feind an und grüßte. Der Mann tat es ihm nach, dann griff er an.
Die Attacken, gegen die sich Smolska zur Wehr setzen musste, wichen natürlich von den üblichen Säbelbühnenfuchteleien ab. Er erkannte die klassischen Manöver einer Parade Riposte, eines Klingenschlags oder einer Flèche, des Laufangriffs. Es handelte sich hier um einen Meister des Fechtens. Smolska schwitzte.
»Das Komitee mag es nicht, wenn Vereinbarungen einseitig und ohne Absprache gebrochen werden«, sagte sein Gegner leise und doch verständlich. Er sprang unvermittelt vor, täuschte mehrere Angriffe an, bis er – den rechten Arm ausgestreckt und mit der Spitze auf Smolskas linke Schulter zielend – sprang. »Übrigens: Ich auch nicht!«
»Sie handeln nicht mit Wissen des Komitees!« Smolskas Parade war zu schwach und richtete nichts gegen die brachiale Wucht des anderen aus, die nicht allein von körperlicher Kraft herrühren konnte. Gleich darauf brannte es in seinem Gelenk, als der dünne Stahl durch sein Fleisch in den Knochen fuhr und stecken blieb. Sofort darauf hörte er das lauteste Geräusch, das er bislang in seinem Leben vernommen hatte: seinen eigenen Schrei.
Viele der Kristallleuchten an der Decke barsten durch den Schall, die glitzernden Splitter regneten klirrend auf die Besucher herab. Erschrocken sprangen viele Zuhörer auf; und das Orchester brach das Stück ab. Jemand im Saal rief nach dem Sicherheitsdienst. Die Starre war gebrochen. Die ersten Schauspieler wollten Smolska zu Hilfe kommen und sich zwischen die Kämpfenden werfen.
»Halt! Wenn sich jemand einmischt, zünden ich und meine Leute die Bomben, die wir an uns tragen«, rief der Unbekannte laut und hob den linken Arm. Er zeigte den Umstehenden etwas, das an einen Fernzünder erinnerte; mit seinen Worten erhoben sich fünf Männer an verschiedenen Stellen des Saals, legten ihre Sakkos ab und zeigten Sprengstoffgürtel: rote LEDs blinkten an den Zündern. Ein Aufschrei brandete durch das Theater, doch niemand wagte mehr, sich zu bewegen. Die Drohung wirkte. »Verstanden? Niemand greift ein, oder es geht alles in die Luft!«
Smolska starrte zuerst in den Raum, dann auf seinen Kontrahenten. Und zum ersten Mal seit langer, langer Zeit beschlich ihn ein Gefühl, das er noch kurz zuvor nicht zu kennen glaubte …
Der Unbekannte riss den Degen aus der Wunde, wodurch er Smolska auf sich zuzog, bevor sich Knochen und Metall trennten. »Sie haben mich gefordert, Battuta, und ich sagte zu! Ich bin kein x-beliebiger Fechtpartner. Ihr Rückzug war eine maßlose Beleidigung. So etwas vergesse ich nicht. Niemals!« Er stieß Smolska vor die Brust, so dass er zurücktaumelte, aber sofort wieder den Arm mit der Waffe hob.
»Sind Sie verrückt?«, zischte Smolska und starrte fassungslos auf sein Blut. »Was Sie hier tun, wird man Ihnen nicht durchgehen lassen!« Er beherrschte sich, um nicht zu laut zu sprechen. Interna gingen die Besucher nichts an. »Ich werde es Ihnen nicht durchgehen lassen!«
Die Klingen schlugen gleich mehrmals rasant gegeneinander, während die Männer umeinanderkreisten. Dann belauerten sie sich, ehe sie erneut aufeinander losgingen und versuchten, den Gegner zu treffen. Für die Zuschauer war das alles nicht mehr nachvollziehbar, zu schnell und abrupt erfolgten die Bewegungen und Schläge.
Auch der Unbekannte wurde getroffen, was Smolska mit einem höhnischen Auflachen kommentierte: Die Klinge riss einen Schlitz in den Rücken des Kostüms, so dass man blanke Haut sah.