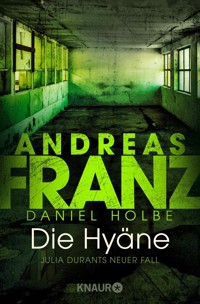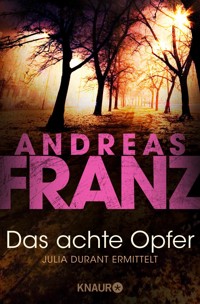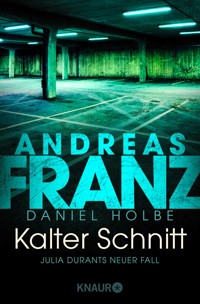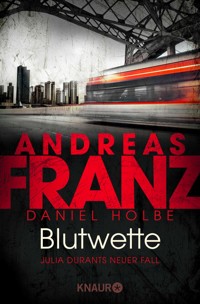
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Julia Durant ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein Selbstmord enthüllt die dunkle Seite eines Sportlers - Der 18. Fall für die Frankfurter Kommissarin Julia Durant von den Krimi-Bestseller-Garanten Andreas Franz und Daniel Holbe ist ein fesselnder Kriminalroman mit überraschenden Wendungen. Nach außen hin genoss er einen tadellosen Ruf, doch nach seinem Tod kommt die schockierende Wahrheit ans Licht: Drogen, Glücksspiel, hohe Schulden und eine bevorstehende Trennung. Kommissarin Julia Durant will den neuen Erkenntnissen auf den Grund gehen, doch immer wieder werden ihr Steine in den Weg gelegt. Durch Zufall stößt sie auf einen Jahre zurückliegenden Mord an einer Südeuropäerin, bei der Sein und Schein ebenfalls weit auseinanderklafften. Gibt es eine Verbindung zwischen den beiden Todesfällen? In Blutwette, dem 18. Band der spannenden Krimi-Reihe von Andreas Franz und Daniel Holbe, taucht Julia Durant ein in die Abgründe menschlicher Doppelleben. Ein fesselnder deutscher Kriminalroman mit packenden Wendungen und einer starken Ermittlerin, die nicht locker lässt, bis die Wahrheit ans Licht kommt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Andreas Franz / Daniel Holbe
Blutwette
Julia Durants neuer FallRoman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Frankfurt: Ein Sportler hat Selbstmord begangen. Scheinbar genoss er einen tadellosen Ruf, doch hinter der glänzenden Fassade tut sich nach seinem Ableben ein Abgrund auf: Drogen, Glücksspiel, hohe Schulden und eine bevorstehende Trennung. Julia Durant möchte diesen neuen Erkenntnissen auf den Grund gehen, doch ständig werden ihr Steine in den Weg gelegt. Durch Zufall stößt sie auf einen Mord, der Jahre zuvor an einer Südeuropäerin begangen wurde, bei der Sein und äußerer Schein auch weit auseinanderzuklaffen schien. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Toten?
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Montag
Freitag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Samstag
Sonntag
Montag
Epilog
Für Hildegard, meine Mutter
Für Julia, meine Frau
Für Eure Stärke, Euren Rückhalt und Euren Glauben an das Gute, auch dort, wo alle anderen aufgeben.
Gäbe es mehr Eltern und Partner wie Euch, gäbe es weniger Geschichten wie diese.
Prolog
Sie rannte.
Der Regen klatschte ihr auf die nackte Haut, die nur von einem Negligé bedeckt wurde. Immer wieder musste sie sich Haarsträhnen aus dem Gesicht wischen. Schweiß und verlaufene Schminke brannten ihr in den Augen.
Die Nacht war besonders dunkel, keine Lücke zwischen den schweren Wolken, kein Mondlicht, keine Straßenbeleuchtung. Keine Zeit, um sich zu orientieren. Wo war die Skyline, die man selbst durch den dichtesten Regen sehen konnte? Woher kamen die Motorengeräusche?
Sie wusste es nicht. Sie wusste nur noch eines: Hinter ihr, da kamen sie. Sie durften sie nicht kriegen, um keinen Preis. Schon hörte sie die Stimmen. Allein der Klang, auch wenn sie die Worte nicht verstand, jagte ihr einen Schauer durch den Körper. Motoren kamen näher. Doch plötzlich türmte sich dicht wucherndes Gebüsch vor ihr auf.
Die Dornen hinterließen tiefe Risse in ihrer Haut. Ihre nackten Füße schmerzten bei jedem Schritt. Und die Männer kamen immer näher.
»Wo ist sie?« – »Da hoch?« – »Quatsch. Ohne Schuhe?«
Sie versuchte, so leise wie möglich voranzukommen. Doch immer wieder knackste es, wenn sie einen der Zweige zerbrach. Und immer tiefer bohrten sich die Spitzen in ihre blutigen Sohlen.
»Wo soll sie sonst sein?«
Weiter!
Eine Taschenlampe flammte auf, und nicht weit hinter ihr durchbrach einer der Verfolger das Dickicht.
»Scheiße! Brombeeren!«
Der Lichtkegel huschte nur knapp über ihren Kopf hinweg.
»Hast du was?«
»Nur ’nen Arsch voll Dornen. Dieses Miststück!«
Weiter!
Die Motoren kamen immer näher. Die Bewegungen der Scheinwerfer. Die Spritzer aus den Wasserlachen, die sich am Fahrbahnrand sammelten.
Und dann versperrte ein Bauzaun ihr den Weg.
Er war zwei Meter hoch. Für eine Sekunde unterdrückte sie ein Schluchzen, das sich unter ihr Keuchen mischte.
Doch sie würde nicht kampflos aufgeben. Nicht dorthin zurückgehen, wo sie hergekommen war. Wie würde er ihr wohl zusetzen, wenn er sie in die Finger bekam? Betrunken, voller Kokain und zerkratzt von den Brombeerranken.
Sie suchte eine Lücke zwischen den Gittermatten. Fand eine, die aber mehrfach mit millimeterdickem Draht verzurrt war.
Also weiter.
Als er sie erreichte, war sie am Ende der Absperrung angelangt. Er leuchtete zuerst nach rechts, sie befand sich links. Der Lichtstrahl traf gerade noch ihren Unterarm, der sich um das Gitter krampfte, während ihre Füße sich bereits über den breiten Rand der Brücke tasteten. Das Metall trug dicke Nieten und war moosbewachsen. So angenehm es sich auch anfühlte, so gefährlich würde es sein, auf dem feuchten, glitschigen Bewuchs zu balancieren. Ein Spiel mit dem Teufel: unten der Asphalt und die vorbeirasenden Fahrzeuge, um sie herum Finsternis. Doch sie hatte keine Wahl. Das Baugitter versperrte den Durchgang zur Brücke, und zurück konnte sie nicht.
Er war fast da.
»Bleib stehen!«, zischte seine Stimme, und er begann, an den Metallstreben zu rütteln. Er keuchte. Wollte er darüberklettern? Oder würde er ihr auf dem gefährlichen Weg folgen?
Von unten her hupte es.
Sie verharrte nur für einen Atemzug, um sich zu konzentrieren. Um ihre zitternden Knie zu beruhigen, während sie in die Hocke ging, um auf sicheren Boden hinabzugleiten.
Es hupte schon wieder. Reifen blockierten. Dann spürte sie eine Hand, die sich um den klatschnassen Stoff ihres Hemdchens klammerte. Einen Ruck.
Und dann verlor sie den Boden unter ihren geschundenen Füßen.
Das schlimmste Übel ist nicht die Stärke der Bösen,
sondern die Schwäche der Guten.
Sie ließ das Auto weiterrollen, nachdem das Motorengeräusch verstummt war. Nur ein paar Zentimeter. Die Nacht hatte ihren Schleier längst über die Stadt geworfen. Hier draußen, in den Randbezirken, wo die Lichter weniger bunt und grell strahlten, breitete sich dunkle Einsamkeit aus.
Als sie das Schmatzen vernahm, drehte sie sich um. Er saß auf der Rückbank, Beifahrerseite, hinter einem Sonnenschutz, der mit Saugnäpfen auf der fleckigen Scheibe haftete. Sie sah ihm in die Augen. Sie schluckte einen Kloß hinunter und legte sich die Finger über die Lippen.
»Scht.« Sie nickte ihm zu, und er verstand.
Sie vergewisserte sich, dass alle Wagenfenster geschlossen waren.
Für Mai war es ungewöhnlich kalt. Sie musste an ihre Heimat denken, die in unerreichbarer Ferne zu liegen schien. Dort herrschte ein anderes Klima, doch vielleicht waren es auch bloß Trugbilder, die ihre Erinnerungen zeichneten. Nie wieder würde sie dorthin zurückkehren. Stattdessen verkaufte sie ihren Körper. Hier, in einer anonymen Großstadt, die sich nach außen hin als moderne, saubere Metropole gab.
Sie warf sich das Kopftuch über die dunklen Haare. Vermied es, sich im Innenspiegel zu betrachten. Wusste, dass ihre Augen ihr dann zurufen würden, sie solle wegfahren. So weit wie möglich. Einfach nur weg. Doch das konnte sie nicht. Oder wollte sie es nicht?
Sie schloss den Mitsubishi ab. Er war silberfarben, mit ausgeblichenem Lack. Er würde nicht weinen. Er würde einfach einschlafen, das wusste sie. Der Kleine war ein stilles, unproblematisches Kind, und sie ließ ihn nicht gerne hier zurück. Doch wo hätte er sonst hingesollt? Sie vergewisserte sich, dass man ihn von außen nicht sehen konnte. Man musste sich schon gezielt über den Wagen beugen. Dann ein schwerer Seufzer, bevor sie sich umdrehte. Sie drückte ihre Handtasche an sich und zog ihre Weste zusammen, die sie über der Bluse trug.
Die Anweisungen waren eindeutig gewesen.
Wo sie parken sollte (und wo nicht), wo sie das Gelände zu betreten hatte, wie sie sich bemerkbar machen sollte.
Und immer diese Angst.
Sie kannte die Männer, es waren fast immer die gleichen. Laute, großkotzige Typen. Genau solche Machos, wie sie in ihrer Heimat auch vorherrschten. Rücksichtslos, selbstverliebt, machtbesessen.
»Da bist du ja!«
Sie zuckte zusammen. Dann erst bemerkte sie die Glutspitze der Zigarette, die wie ein Glühwürmchen auf und ab schwang. Das Gesicht zu der Stimme blieb verborgen. Es gab weder eine Straßenlaterne in der Nähe noch sonst eine Lichtquelle.
»Wir dachten schon, du kämst nicht mehr.«
»Ich habe den Weg nicht gleich gefunden«, erwiderte sie mit devotem Unterton. Sie wollte den Mann nicht verärgern, denn er war ihr unheimlich.
»Jetzt bist du ja da.« Er winkte ab. »Gehen wir rein.«
Das Glühwürmchen zog eine hohe Bahn und landete in einiger Entfernung auf dem Asphalt.
Sie folgte ihm eine Treppe hinauf, dann einen Gang entlang. Er benutzte eine Taschenlampe. Das Gebäude schien verlassen zu sein, es roch modrig, und auf dem Boden war allerhand Unrat verstreut. Scherben, Putz, Müllreste. Doch je weiter sie gingen, desto sauberer wurde es.
Sie erreichten eine Art Vorzimmer und damit scheinbar eine andere Welt. Kerzenlicht flackerte. Leise Musik erfüllte den Raum. Es befanden sich vier nummerierte Türen an den Seiten, zwei links, zwei rechts. Sie waren geschlossen.
»Wohin jetzt?«, fragte sie verunsichert, da der Mann keine Anstalten machte, weiterzugehen. Er grinste breit und deutete auf einen Sessel mit abgewetztem Lederbezug – das einzige Möbelstück weit und breit.
»Da kannst du ablegen.« Er wandte sich um.
»Und dann?« Das mulmige Gefühl, das sie im Magen trug, kroch immer weiter nach oben. Was sollte das? Sie bediente Freier, um das Geld aufzubessern, denn ihr Vater war im Ausgeben schneller als im Reinholen. Er rauchte, er trank, und vermutlich spielte er auch – und verlor. Denn es reichte hinten und vorne nicht. Wenn sie sich aber erdreistete, nach Haushaltsgeld zu fragen, bekam ihr das nicht gut. Er war ein brutaler Mensch, doch sie ertrug es. Der Familie zuliebe. Hätte es das Baby nicht gegeben, vielleicht wäre sie längst weggelaufen. Doch dazu fehlte ihr der Mut. Und sie würde es nicht zulassen, dass die Familie ein weiteres Geschöpf zerstörte.
Das Unbehagen verstärkte sich. Die meisten der Männer kannte sie mittlerweile, und manche mochte sie sogar auf eine gewisse Art und Weise. Sie waren selbst in angetrunkenem Zustand lange nicht so brutal wie das, was sie von zu Hause kannte.
»Du entscheidest.«
Sie zuckte zusammen. Sofort galten ihre Gedanken wieder der obskuren Umgebung. Ein verlassenes Gelände. Kerzen. Ein Raum, der wie der Eingang zu einem Labyrinth war. Vier Türen. Was wartete dahinter?
Sie entschloss sich, ihre Fragen in Worte zu kleiden: »Was ist da drinnen? Oder wer ist da? Sag mir, was ich jetzt tun soll!«
Er war ein sportlicher Typ, etwa dreißig, mit auffallend breitem Oberkörper. Braun gebrannt, mit einem schweren Goldkettchen am Handgelenk. Ein Goldzahn blitzte in der Mitte der oberen Kauleiste. Die Ohren waren klein, die Augen tief sitzend und ein wenig unheimlich. Der ganze Oberkörper war tätowiert, wie sie wusste, denn auch ihn bediente sie hin und wieder. Als er nun neben sie trat und ihr an den Hintern langte, schauderte sie. Sie wusste, dass er es gerne härter hatte. Und sich niemals ein Gummi überziehen würde. Dafür steckte er ihr immer einen Fünfziger extra zu. Für das Kind, wie er sagte. Doch heute war er anders als sonst.
»Du gehst in alle«, grinste er. »Und in einem warte auch ich. Also los. Ich bin schon ganz scharf. Am liebsten würde ich dir ja die Nummer sagen, aber hm …«
Er hob verschwörerisch den Zeigefinger, und dann entdeckte sie auch schon die kleine Kamera, die an der Decke angebracht war. Mit Klebeband, wie sie feststellte. Also hatte er sie aufgehängt. Oder einer seiner Freunde.
»Ich weiß nicht«, sagte sie. »Das gefällt mir nicht.«
»Ach komm schon«, forderte der Mann, griff in seine Hosentasche und zog einen Zweihunderter hervor. »Du kennst mich doch. Und wir lassen uns alle nicht lumpen.«
Bevor sie noch etwas erwidern konnte, verließ er den Raum, und sie stand alleine da.
Im Hintergrund lief klassische Musik.
Sie öffnete ihre schwarze Tasche, die kaum größer war als ein Kulturbeutel. Zog zuerst ein schwarzes Negligé daraus hervor und legte es an. Dann erst fiel ihr das kleine Tütchen auf, das auf einem Beistelltisch neben einer Flasche Wasser und einer Flasche Cola lag. Sie näherte sich dem Tisch. Das Plastik knisterte unter dem Druck ihrer Finger. Das Tütchen war knittrig und alles andere als neu. Es waren Tabletten darin, drei Stück. Weiße, runde Tabletten.
Prompt öffnete sich die Tür, und vor Schreck ließ sie den Beutel fallen. Eine der Pillen kullerte heraus.
»Hast sie gefunden, ja?« Seine Stimme war freundlich. Und trotzdem konnte der Mann ihr die Angst nicht nehmen. Heute war es besonders schlimm, was daran liegen mochte, dass der Kleine unter Husten litt und einen unruhigen Schlaf hatte. Sie wollte raus hier, wusste aber, dass das nicht mehr ging. Also durfte sie keine Zeit mehr verlieren. Doch man hatte offenbar andere Pläne mit ihr. Heute war alles … anders.
»Ich möchte keine Drogen nehmen«, sagte sie.
Der Mann lächelte und hob die Schultern. »Kann ich verstehen. Sind aber keine Drogen. Ist so ein Muskelzeugs, Relaxer, das ist dann so, wie wenn du leicht betrunken bist.« Er senkte die Stimme. »Du solltest eine davon nehmen.«
»Warum?«
»Dann kriegst du nicht so viel mit. Die anderen haben ziemlich gekokst. Sind alle spitz wie nur was, aber romantisch wird das sicher nicht.«
»Ist mir egal«, wisperte sie. Sie wollte nicht »wie betrunken« sein. Es reichte schon, dass sie zu Hause jemanden hatte, der sich regelmäßig ins Koma soff. Dessen Ausbrüche mit jedem Schluck unerträglicher wurden, hemmungsloser, bis er endlich zusammensackte und besinnungslos auf dem Sofa lag.
»Überleg’s dir«, mahnte er und griff nach ihrer Schulter, deren Haut freilag. Eine zarte Berührung, die sie dennoch zusammenzucken ließ, als habe er einen Elektroschocker angesetzt.
»Du solltest eine nehmen. Nur eine.«
Er betrachtete sie noch für einige Sekunden, in denen sie am liebsten im Erdboden versunken wäre. Sie dachte an den Kleinen, an zu Hause, an ihr Leben. An eine Existenz, die sie sich in so vielen Punkten anders ausgemalt hatte, als sie ein junges Mädchen gewesen war. Ein anderes Leben, begonnen in einem anderen Land. Dann waren die Soldaten gekommen. Zu ihrer Mutter. Immer wieder. Und sie hatte alles mit angesehen. Seit diesen Tagen war ihre Kindheit vorbei gewesen.
Zerstört.
Die vier Männer beobachteten den Monitor, an dessen rechtem Rand eine Bildstörung für regenbogenfarbene Pixel sorgte. Sie rochen nach Alkohol. Tabakrauch hing unter der Decke.
Auf dem Bildschirm war das graustichige Bild einer Frau zu sehen, die halb nackt an einem Tisch stand. Wasser und Cola standen darauf. In ihrer Hand befand sich ein Beutel mit Diazepam.
Vor dem Monitor lagen zwei kleine Haufen mit knittrigen Geldscheinen. Grün und gelb, nichts Geringeres.
»Sie schluckt, sie schluckt!«, lallte der links außen kauernde Mann. Ein in die Jahre gekommenes Muskelpaket, dem das weiße Pulver noch im Oberlippenbart hing. Seine Hand bewegte sich gierig zum linken Geldhaufen.
»Finger weg!«, zischte ein anderer und schlug auf den Tisch.
Die Frau schien die Tabletten in der Hand zu wiegen, als wäge sie damit gleichzeitig die Konsequenzen ab, die sich aus ihrer Entscheidung ergaben.
»Schluck das Zeug!«, lallte Linksaußen gierig. »Schluck es endlich!«
Ein Dritter lachte auf. »Spar dir das für nachher, wenn sie deinen Schwanz in der Kehle hat.« Er legte einen weiteren Hunderter auf den rechten Geldhaufen. »Die bleibt clean, ich sag’s euch. Und das ist auch gut so. Wenn ich Weggetretene ficken will, die nichts mehr von allem Drumherum mitbekommen, kann ich auch ins Laufhaus gehen.«
»Das will ich sehen!«, prustete der Mann, der als Letzter in den Raum getreten war. Noch vor einer Minute hatte er vor der Frau gestanden. Er war als Einziger noch halbwegs nüchtern. »Du mit deiner ganzen Eskorte in der Kaiserstraße. Umringt von Reportern. Ein Königreich für diese Schlagzeile!«
»Leck mich.«
»Ruhe!«, polterte es wieder von links. »Schaut lieber hin! Ich sag’s euch, sie nimmt …«
Doch dann verstummte er. Fein säuberlich ließ die Frau die Tabletten zurück in die Folie rollen. Sie bückte sich, hob die heruntergefallene Pille auf und steckte sie zu den beiden anderen. Als Nächstes zog sie das Plastik glatt und legte es an die Stelle zurück, von wo sie es aufgenommen hatte.
»Fotze!«, empörte sich das Muskelpaket, von dem die meisten Scheine auf dem linken Stapel stammten.
Rechts von ihm grölte es. Nur einer hatte dagegen gewettet, ausgerechnet dieses Arschloch, und er kassierte nun die ganze Knete.
Er würde sie dafür bestrafen.
Sie würde ihre Entscheidung noch bereuen.
Den Abpfiff des Schiedsrichters bekam er nicht mehr mit. Sein Trikot roch nach Bier, die Glut seiner Zigarette hatte ein kleines Loch hineingebrannt. Er stieß fluchend mit den Ellbogen um sich, doch die anderen waren stärker als er.
»Raus hier, du Arschloch«, zischte ihm jemand ins Ohr.
»Wegen Leuten wie dir …«, nörgelte ein anderer, an dem sie ihn vorbeizerrten.
Er spuckte auf den Boden. Seine Zigarette war längst hinuntergefallen und zertreten. Das Bier verschüttet.
Sie nahmen keine Rücksicht auf seinen Schal, der die Farben der Eintracht trug. Rot-weißer Adler auf schwarz-weißem Grund. Die Farben des Kaiserreichs. Seine Farben.
Doch seit einigen Jahren waren es andere, die den Klub für sich beanspruchten. Hipster, Linke und Anzugträger.
Fans, die sich für etwas Besseres hielten. Eine neue Generation, die öffentlich verpönte, Heimspiele auf die alte Art zu feiern.
Selbst sein Stadion existierte nicht mehr.
Mit dem Abriss des alten war eine Ära zu Ende gegangen. Die Aushub- und Umbauarbeiten hatten einer überdimensionalen Beerdigung geglichen. Nichts war mehr wie zuvor, auch wenn das Endergebnis gar nicht so übel war, wie er zugeben musste.
Dann die Pyrotechnik. Früher eine Selbstverständlichkeit. Heute war sie ebenso verpönt wie die damals so obligatorischen Prügeleien mit Bayern- oder Kickers-Fans.
Und trotzdem war es immer noch seine Eintracht.
Nur, dass Walter Bortz sich jetzt außerhalb der Arena wiederfand. Auf einem Grünstreifen, wo er zu Boden gefallen war. Niemand hatte ihm aufgeholfen. Achtlos hatte man ihm sein Portemonnaie vor die Füße geworfen. Dorthin, wo auch der Schal lag. Durchnässt und mit dreckiger Sohle getreten.
Er hörte Stimmen.
Polizisten näherten sich.
Sie nahmen seine Personalien auf, die er nur mehr lallend von sich geben konnte.
Es war ein ruhmloser Tag. Die Adler hatten schlecht gespielt. Gut eine Viertelstunde nach dem Anpfiff schon der erste gegnerische Treffer. Frust. Noch mehr Alkohol als sonst, um den Frust zu ertränken. Dann endlich zwar der Ausgleich, aber der Rest des Spiels zog sich wie Kaugummi. Es gab jede Menge Gelbe Karten. Die Zeit wollte und wollte nicht vergehen. Womöglich lag aber auch das am Alkohol. Er nahm jede Bewegung nur verschwommen wahr, wie in Zeitlupe.
Dann hatte er begonnen, die Spieler zu beschimpfen.
Dann der Rauswurf. Das Letzte, woran er sich erinnerte, war der Jubel aus seinem Block, als die beiden Männer ihn aus dem Stadion zerrten.
Freudenchöre, die den ersehnten Siegestreffer begleiteten? Oder jubelten sie etwa seinetwegen?
Weil man ihn endlich aus ihrer Reihe entfernt hatte, wie einen entzündeten Zahn, wie ein gefährliches Geschwür?
Beschämend.
Walter Bortz verrichtete seine Notdurft an einem Haselstrauch und torkelte in Richtung Bahnsteig. Er stieg in den nächsten Zug Richtung Innenstadt. Noch waren die Wagen nicht überfüllt; die meisten Fans waren noch im Stadion. Er ließ sich auf eine leere Sitzbank fallen.
Die Sonne huschte an den Fenstern vorbei und tauchte die sich nähernde Skyline in ein gelbrotes Glühen.
In Sachsenhausen stieg er aus und wankte in Richtung Zuhause.
»Walter, bist du schon zurück?«, kam es leise aus der Küche.
»Wer denn sonst?«
»Schlechtes Spiel?« In der Tür erschien seine Frau. Eine Person, mit der er zwar noch dieselbe Adresse teilte, mit der ihn sonst jedoch nicht mehr viel verband.
»Was verstehst du denn schon davon?«, murrte er.
Er trat auf sie zu, um sie zu küssen. Wenn er betrunken war, schien er sich gelegentlich daran zu erinnern, dass die beiden sich einmal sehr geliebt hatten. Wenigstens dann. Sie roch den Alkohol, rümpfte die Nase und beugte sich angeekelt nach hinten.
»Mensch, was ist denn mit dir passiert? Ist das Bier?«
Längst hatte Walter sich an den sauer riechenden Fleck gewöhnt.
»Na und? Passiert eben. Zier dich nicht so.«
Er packte sie am Schlafittchen und zog sie an sich.
Hätte er nicht nach Bier gestunken, hätte er den fremden Duft vielleicht gerochen. Und wäre er nicht so blau gewesen, hätte er das verräterische Geräusch vielleicht gehört.
In seinem Schlafzimmer lag ein anderer, doch das registrierte Walter in seinem Zustand nicht. Aufgebracht, weil man ihn aus dem Stadion geworfen hatte. Enttäuscht, weil das Spiel verloren schien. Er wunderte sich also auch nicht, dass seine Frau Lippenstift trug und Rouge aufgelegt hatte.
Stattdessen glotzte er sie nur an und spürte, dass sie keinen Bock auf ihn zu haben schien. Fast genauso wenig wie er auf sie. Nach all den Jahren gab es nichts mehr an ihr, was Walter nicht kannte, und er war es leid, seine Frau mit Backpfeifen an die Erfüllung ihrer ehelichen Pflichten zu erinnern.
»Ja, hau einfach ab!«, hörte er sie im Hinausgehen keifen, nachdem er sich abrupt aus ihrer Umarmung gelöst und auf dem Absatz kehrtgemacht hatte. Um ein Haar hätte ihn dieses Manöver mit dem Kopf an die Garderobe stoßen lassen. Doch Walter hatte einen Schutzengel.
»Tu ich ja!«, schnauzte er zurück. »Ich hole mir einen Fick, wenn du’s genau wissen willst. Und zwar da, wo ich nicht erst drüber diskutieren muss.«
»Bei mir brauchst du wegen so was gar nicht mehr aufzulaufen«, erwiderte seine Frau. »Bleib doch am besten ganz bei deiner Hure!«
Walter knallte die Tür so fest ins Schloss, dass sie wieder aufsprang.
»Vielleicht mache ich das«, keuchte er. »Du wirst dich noch wundern!«
Er knallte die Tür erneut.
Etwas später im Frankfurter Nordend.
Es war ein milder Sonntagabend. Vielleicht hätte sie es sich sonst anders überlegt, denn bei Kälte oder Dauerregen war das, was sie vorhatte, kein angenehmes Unterfangen.
Julia Durant hatte halbwegs gute Laune. Es lagen ein paar Verhandlungstage hinter ihr, im Präsidium war es relativ entspannt. Die größte Aufgabe der Polizei hatte darin bestanden, am Freitagnachmittag, nach der Rushhour, die Entschärfung einer Fliegerbombe zu organisieren. Evakuierung einiger Häuser, Sperrung einer Kreuzung. Die Bombe hatte verhältnismäßig günstig gelegen, das Ganze war in drei Stunden abgehandelt gewesen. Routine mittlerweile. Denn in den letzten zwei Jahren hatte man so viele Blindgänger entdeckt wie in den zwei Dekaden zuvor nicht. Es musste mit den zahlreichen Großbaustellen zu tun haben. Überall hämmerte es, und das Stadtbild war voller Kräne, die wie Unkrautstängel zwischen den Glaspalästen hervorstachen.
Außer dem Fußball-Derby war auch der Sonntag ruhig geblieben, und das Spiel war zum einen längst abgepfiffen, und zum anderen interessierte sich Julia Durant nicht für Fußball. Sie lächelte. Wenn alles gut lief, würde sie schon ab kommendem Donnerstag dienstfrei haben. Ein langes Wochenende also, keine Bereitschaft, einfach drei Tage am Stück frei. Und mit ein wenig Glück würde ihrem Chef dasselbe Schicksal zuteilwerden. Claus Hochgräbe, Leiter der Mordkommission und außerdem Julia Durants Lebensgefährte. Für einen Moment kam der Wunsch in ihr auf, ein paar Sachen zu packen und nach günstigen Flugtickets zu googeln. Zweimal Frankfurt–Marseille und am Sonntag wieder retour. Ihre Miene verlor das Lächeln.
Man konnte eben nicht alles haben.
»Willst du das wirklich durchziehen?«
Claus hatte sich genähert, wie immer mit derart leisen Schritten, dass Julia zusammenzuckte.
»Du sollst dich nicht immer so anschleichen!«
»Ich bin eben unscheinbar.« Claus lachte, und auch Julia musste grinsen, während sie zu ihm aufsah. Die beiden küssten sich, dann wurde die Kommissarin wieder ernst. Sie wusste, dass Hochgräbe nichts davon hielt, dass sie an dieser Observierung teilnahm. Doch den Sonntagabend opferte sie gern, wenn sie dabei an das bevorstehende Wochenende dachte. Außerdem hatte sie ihren Offenbacher Kollegen Peter Brandt schon monatelang nicht mehr gesehen.
»Lass mich das nur mal machen.« Sie lächelte. »Wer weiß, wozu es gut ist. Irgendwann brauche ich was von Peter, dann kann er nicht leichtfertig ablehnen.«
»Hmm. Aber pass auf dich auf, hörst du?«
Julia rollte mit den Augen. Über zwanzig Jahre war sie bereits ein Teil dieser Stadt. Und nie hatte ihr jemand gesagt, was sie tun oder lassen sollte. Es fühlte sich seltsam an, aber auch irgendwie gut. Jemand sorgte sich um sie.
»Ich nehme an einer Überwachung teil«, betonte sie, »nicht an einer Hausstürmung.«
Zehn Minuten später startete Julia Durant ihren Wagen. Ein gigantischer Fleck Taubendreck befand sich direkt vor ihrer Nase auf der Scheibe. Sie sprühte sekundenlang Scheibenwischflüssigkeit darauf und ließ die Wischer hin- und herfliegen. Während sich ein milchig grauer Bogen über das Glas zeichnete, der nur allmählich klarer wurde, seufzte sie. Ihre Hose drückte. Die Bluse spannte. Sie fühlte sich, als habe sie zehn Kilogramm zugenommen. Wie gerne hätte sie sich ihre überschüssigen Fettpölsterchen abtrainiert, wäre joggen gegangen oder notfalls in einen Spinning-Kurs. Doch die Ärztin hatte ihr derlei Aktivitäten vehement untersagt. Und sämtliche ihrer Kollegen, Claus Hochgräbe und Frank Hellmer allen voran, achteten äußerst pingelig darauf, dass sie sich auch daran hielt.
Ein Grund mehr, mal hier rauszukommen, dachte sie bissig. Dann spürte sie ihre Hand auf dem Unterbauch. Sie musste unwillkürlich dorthin gewandert sein, wie es immer mal wieder geschah in letzter Zeit. Bei feuchter Witterung spürte sie noch immer ein Ziehen, dort, wo das Gewebe verheilen musste. Eine unsichtbare Narbe, die sich auch durch zwei Lagen Kleidung hindurch spüren ließ. Phantomschmerz? Durant schüttelte den Kopf und schnellte mit dem Zeigefinger in Richtung Autoradio. Laut, rockig, bloß nicht weich werden. Sie musste aufpassen wie ein Luchs, dass die Hormone nicht ein völlig neues Wesen aus ihr machten. Schon mischten sich Bässe über das Dröhnen ihrer Auspuffanlage, und kurz darauf manövrierte Julia ihren Opel GT Roadster aus seiner Parkbucht.
Ihr Ziel lag auf der anderen Seite des Mains. Offenbach. Präsidium Südosthessen. Observiert werden sollte eine Bande von Hehlern, die man mit einer Serie von äußerst brutalen Überfällen in Verbindung brachte. Überfälle, die sich nicht an die Präsidiumsgrenze hielten. Vor sechs Wochen war eine alte Dame auf der Schwelle ihrer Wohnung von mehreren Männern überfallen worden. Sie vegetierte mit zertrümmertem Schädel vor sich hin – und das alles wegen hundertvierzig Euro und einer Handvoll Gegenstände, die bestenfalls Flohmarktwert hatten.
Manchmal hasste Julia Durant diese gottlose Welt.
Dann aber dachte sie stets an ihren Vater, einen steinalten Pastor, der längst im Ruhestand war. Wie sagte er immer: »Es liegt in unseren Händen, wie wir die Welt gestalten. Gott hat uns alles Irdische anvertraut.«
Wie die Angehörigen der alten Dame wohl darüber dachten?
Alleine deshalb war Durant dieser Abend so wichtig. Vielleicht würde sich heute eine Spur zu den Hintermännern ergeben. Nicht aufgeben, hieß die Devise. Sie drehte das Radio laut und wippte mit, als ein Klassiker von Paul Simon gespielt wurde.
Dann klingelte das Handy.
Und obwohl sie sich vorgenommen hatte, nicht mehr mit dem Apparat in der Hand durch den Verkehr zu lenken, sagte ihr eine innere Stimme, dass sie besser drangehen sollte.
Münchner Vorwahl.
Dort gab es außer ihrem Ex-Mann nur zwei Optionen.
Die Kriminalpolizei war eine davon. Doch es war die andere.
Klinikum München. Ob sie die Tochter sei. Herr Durant habe einen Herzinfarkt erlitten.
Es sehe nicht gut für ihn aus.
Der Raum, in dem die Frau wartete, schien durch Dutzende Kerzen erleuchtet zu werden. Dass es sich dabei nur um flackernde LED handelte, fiel erst auf den zweiten Blick auf. Sie trug einen Bademantel auf ihrer sonst vollkommen nackten Haut. Von draußen drang Straßenlärm durch die geschlossenen Fenster. Sie spielte mit ihren Fingern, dann erhob sie sich und schritt zu einer der Glasscheiben. Sie drehte den Knauf, griff zu ihren Zigaretten und zündete sich einen der langen Glimmstängel an. Ihre Augen galten den Bewegungen auf der Straße unter ihr. Kleine Menschen, Fahrzeuge, ein ständiger Strom. So wie Blutkörper, die entlang ihrer Bahnen flossen und die Stadt am Leben hielten. Sie glaubte, ein Geräusch vor ihrer Tür zu hören. Ein letzter Zug, dann drückte sie die halb gerauchte Kippe hastig in den Aschenbecher und wedelte die Luft nach draußen.
Er mochte es nicht, wenn sie nach Rauch schmeckte, und sie wollte ihn nicht verärgern. Dabei rauchte er selbst wie ein Schlot, zumindest haftete der Geruch überall an ihm, ob er nackt oder angezogen war. Sie griff zwei grüne Airwave-Kaugummis und zerbiss die streng nach Menthol schmeckende Hülle. Ein Blick auf die Uhr. Er ließ sich Zeit. Dass er sich für heute angekündigt hatte, verwunderte sie. Die meisten Verabredungen liefen nach demselben Schema ab. Gleicher Tag, gleiche Uhrzeit, gleiche Nummer. Nur selten meldete er sich und fragte an, ob sie gerade frei war. Er wollte auch keine andere, nur sie. Es mussten schon Jahre sein. Heute hatte seine Anfrage nahezu verzweifelt geklungen. Und auch wenn er alles andere als ein attraktiver Mann war, hatte sie ihm zugesagt. Walter Bortz war ein recht pflegeleichter Kunde. Mit solchen verscherzte man es sich nicht. Arschlöcher und Perverse liefen genug herum.
Wenige Minuten später war er da.
Sie zog die Mundwinkel nach oben und setzte einen sinnlichen Blick auf. »Schön, dass du da bist.«
Was sollte sie auch sonst sagen?
Er zuckte mit den Schultern, und sie begann daraufhin, sich an ihm abzuarbeiten.
Setz dich! – Willst du nicht ablegen?
Dann ihre Finger, die sich den Weg in Richtung Hose bahnten. Knopf und Reißverschluss gingen auf. Die Hose war fleckig, und alles roch nach Bier. Sie verdrängte es. Ließ ihre Finger die gewohnten Kreise ziehen. Massierend. Dabei atmete sie betont schwer, als sei sie erregt. Es klang überzeugend, das wusste sie, doch nichts regte sich bei ihm. Er legte den Pullover ab. Dann das Unterhemd. Selbst seine Brusthaare rochen nach Bier. Sie zog ein paar weitere Register. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Mann unter ihren Händen keine Erektion bekam. Viele Freier standen unter einem derartigen Druck, dass er ihnen im entscheidenden Augenblick das Blut abzuschnüren schien.
Doch nun regte sich etwas, wenn auch kaum spürbar. Sofort legten sich ihre Finger um den Penis und massierten ihn.
»Na wer sagt’s denn. Da ist er ja.«
Unter ihren Fingern begann die Hitze sich anzustauen. Immer härter wurde es, während sie den Schaft nicht losließ. Sie rieb sich an ihm so lange, bis ihre Köpfe nur noch Zentimeter auseinanderlagen. So betrunken, wie Walter war, musste sie sich beeilen. Längst hatte sie ihre Scham freigelegt, bereit, sich auf ihn zu setzen. Ihn zu reiten, so wie er es mochte.
»Warst du beim Spiel?« Sie raunte ihm die Frage mit heißem Atem direkt ins Ohr, denn sie kannte Walters Fußballleidenschaft. Wenn er jetzt keinen hochkriegte, dann …
Doch schon in der nächsten Sekunde flog sie nach hinten. Ihre Brüste klatschten auf den kalten Boden, unmittelbar, bevor ihre Schläfe danebenschlug. Nur benommen wurde ihr bewusst, dass es seine Hände gewesen waren. Wie er nun, vollkommen nackt, auf ihr saß. Der Atem stank nach Alkohol und kaltem Rauch. Speichel fiel auf sie herab, während er in einer Hasstirade seinen ganzen Frust durchs Zimmer versprühte. Dabei packte er sie am Hals und schlug ihren Kopf so fest hin und her, bis das flackernde Licht der Kerzen vor ihren Augen immer matter wurde.
Irgendwann erlosch es.
Schwärze umhüllte sie.
Montag
Es stürmte.
Graupel mischte sich unter die Regentropfen, die von draußen mit lautem Trommeln gegen die Fensterflügel geweht wurden. Vorbei war es mit der lauen Abendstimmung, die vor ein paar Stunden noch in Frankfurt geherrscht hatte. Typisches Aprilwetter eben, wie man überall aufschnappen konnte. Die meisten Menschen hatten sich offenbar nicht mehr zu sagen, als über das Wetter zu reden. Dass es irgendwo im Allgäu dreißig Zentimeter Neuschnee gegeben hatte, war tatsächlich weniger beunruhigend als die weltpolitische Lage.
Im Inneren des Hauses spürte man nichts von alldem. Es war behaglich, fast schon zu warm, und die gelb getünchten Wände tauchten den Raum in ein warmes Licht. Es roch nach Desinfektionsmitteln.
Der Brustkorb des Mannes hob und senkte sich im Takt des Beatmungsgeräts. Das Brodeln und Keuchen glich dem einer Kaffeemaschine. Jeder Atemzug schien den Mann unendliche Kraft zu kosten, auch wenn die Ärztin versichert hatte, dass es nicht so sei.
»Er fühlt davon nichts.« Dabei hatte sie nach rechts geblickt. Es gab Theorien, nach denen Menschen, die lügen, die Augen nach links drehen. Die Bewegung war abhängig davon, auf welche Gehirnhälfte sie zugriffen. Fantasie oder Erinnerung. Sie wollte der Ärztin glauben. Doch was, wenn diese sich irrte, auch wenn sie von dem Gedanken überzeugt sein mochte? Was, wenn er unendliche Qualen litt und sich nach Erlösung sehnte?
Dann musste Gott entscheiden. Wie immer, wenn Menschen mit ihren Fragen alleine waren. Wenn sie machtlos dastanden, trotz aller Technik, trotz aller Medizin.
Julia Durant wusste, dass ihr Vater bald sterben würde. Sie hatte es schon lange gespürt. Seit seinem Schlaganfall, auch wenn er ihn noch halbwegs gut weggesteckt hatte. Seit seinem neunzigsten Geburtstag. Seit sie in Frankfurt ins Auto gesprungen war und es anstatt nach Offenbach direkt auf die A3 in Richtung München gesteuert hatte. Ihr Paps sei schon in der Klinik, hatte man ihr mitgeteilt. Pastor Durant lebte in der Nähe von München. Es lagen über vierhundert Kilometer zwischen Vater und Tochter. Und noch bevor Durant die Stadtgrenze hinter sich gelassen hatte, sah sie all die Baustellenschilder vor ihrem geistigen Auge vorüberziehen. Schilder, die sie mit einem »Wir bauen für Sie« zu verhöhnen schienen.
Für mich? Der Gedanke schmeckte bitter. Vielleicht fuhr sie gerade jetzt zum allerletzten Mal in ihrem Leben nach München. Wenn Paps tatsächlich starb … Tränen rannen ihr über die Wangen. Wenn er starb, das wusste sie, würde sich die Flut den letzten großen Felsen holen, der gegen die Brandung des Lebens aufbegehrte. Der ihr Halt gab, der ihr väterlichen Rat gab, ohne sich aufzudrängen. Der hinterfragte, statt zu bevormunden. Der letzte Felsen ihrer Familie. Dann blieb nur noch sie. Sie allein.
Es hatte fast fünf Stunden gedauert, bis Julia Durant schwer atmend das Krankenhaus erreicht hatte. Trotz der späten Stunde hakte es immer wieder in den zahlreichen Baustellen. Das Einzige, was stetig gerast war, war die Zeit. Zeit, die ihr niemand wiederbringen konnte. Zeit mit ihrem Vater.
Seine Augen waren geöffnet gewesen, als sie den Raum betrat. Hatte er gelächelt? Hatte er begriffen, dass seine Tochter es war, die ihm durchs Haar fuhr, die nach seinen Händen griff? Die den Kopf auf seine Brust legen wollte, aber Angst hatte, ihm die Luft abzuschnüren. Er war so dünn. So zerbrechlich. Und seine Haut fühlte sich an wie feuchtes Leder.
Es brodelte erneut.
»Er hat keine Angst. Er hat keine Schmerzen.«
Wie konnte die Ärztin sich dessen sicher sein?
Hatte sie sich selbst schon in einer solchen Lage befunden? Gab es etwa Studien von Sterbenden, die man fragen konnte? Julia wollte ihr glauben, sie musste es sogar.
Das Morphin, der Sauerstoff und all die anderen Mittel taten ihre Arbeit. Ganz gewiss. Und sicherlich hatte ihr Paps wirklich keine Angst. Denn er war ein Mann Gottes. Jemand, der sein Schicksal schon vor vielen Jahren in die Hände seines Schöpfers gelegt hatte.
Julia zog die Nase hoch und schmeckte das Salz ihrer Tränen. Es war Stunden her, als er zum letzten Mal ihre Hand gedrückt hatte. Sie hatte sich hinabgebeugt, denn er schien ihr etwas sagen zu wollen. Doch sie konnte seine Worte nicht mehr verstehen. Das Brodeln verwischte. Nur ihren eigenen Namen meinte sie herausgehört zu haben. Julia. Er wusste, dass sie bei ihm war. Dass sie warten würde, bis er losließ.
Außer ihr war niemand im Zimmer. Im Gegensatz zu den anderen Räumen war er mit nur einem Krankenbett ausgestattet. Mehr Farbe. Bilder an der Wand, die Naturmotive zeigten. Darunter ein Motiv mit Wolken. Sonnenstrahlen, die aus ihnen hervorbrechen. Gotteslicht.
Wie lange sie schon wach war, sie wusste es nicht.
Alle zwei Stunden kam eine Schwester herein, um nach dem Rechten zu sehen. Die Gesichter hatten irgendwann gewechselt. Eine neue Schicht. Man bot ihr Tee an und brachte ihr ein Kissen.
Es rasselte. Immer wieder. Und Julia Durant wartete darauf, dass es endlich aufhörte. Dass ihr Vater noch einmal ihre Hand drückte, bevor das geschah. Und dass er dann endlich gehen durfte.
Zu Gott.
Und zu seiner Frau.
Julia Durant schob den Schlüssel in den alten, verkratzten Schließzylinder der Haustür. Wie oft hatte sie als junge Frau ihren Schlüsselbund gegen diese Tür schlagen lassen? Wie oft war sie dafür gerügt worden? Die Worte ihrer Mutter klangen so deutlich, als stünde sie neben ihr. »Wenn die Lasur platzt, wird’s an dieser Stelle grün. Also pass bitte auf. Du weißt, wie sehr dein Vater diese Tür liebt.«
Ja. Pastor Durant hatte seine Haustür geliebt. Das Haus, den Garten, seine Gemeinde. Er war Pfarrer in einer Gemeinde gewesen, die im Gegensatz zu den umliegenden Dörfern einen hohen Anteil an Protestanten aufwies. Hier, im alten Ortskern, schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Es sah aus wie in Durants Kindertagen, einzig die modernen Autos und die Satellitenschüsseln auf den Dächern erinnerten daran, dass seitdem Jahrzehnte vergangen waren. Zweiundzwanzig Jahre hatte sie hier gewohnt. Schräg gegenüber der alten Kirche. Paps war im Ruhestand viel gereist, er hatte genügend Geld auf der hohen Kante gehabt, um sich das leisten zu können. Aber er war immer wieder hierher zurückgekehrt. In seine Gemeinde, seine Straße, sein Haus. Er hatte all das geliebt. Aber vor allem liebte er seine Familie.
Mit einem dicken Kloß im Hals betrat Julia den Flur. Überlegte, ob sie nach oben gehen sollte, in ihr altes Zimmer. Über die alte Treppe, deren drittletzte Stufe sie immer versucht hatte zu überspringen. Ob sie immer noch so erbärmlich knarrte? Sie schritt stattdessen geradeaus weiter. Unter ihren Schuhen knackte es, vermutlich ein kleiner Stein. Alles lag da, wie sie es seit jeher kannte. An der Garderobe ein Sakko neben einem Parka. Arbeits- und Alltagskleidung. Die Filzhausschuhe, die sie ihm vor ein paar Jahren geschenkt hatte, weil er sich über kalte Füße beklagt hatte. Und an den Wänden Fotos in abgegriffenen Holzrahmen, von denen keiner dem anderen glich. Julia, ihre Mutter, selten er selbst. Paps hatte meist hinter der Kamera gestanden. Nur auf einem war er gut zu sehen. Ein Bild von dem Tag, als er offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden war. Er lächelte gütig. Seine Kleidung war wie immer schlicht, er hielt seine Pfeife in der Rechten. Julia nahm das Foto von der Wand ab und ging in Richtung Wohnzimmer. Dort setzte sie sich auf seinen Sessel. Rückte das Kissen zurecht, das sie im Becken spürte, und ließ sich nach hinten sinken. Sie schloss die Augen, in denen sich längst schon wieder Tränen befanden. Nur für einen Moment. Und während sie verharrte, konnte sie den süßschweren Pfeifenrauch riechen, der sich überall niedergeschlagen hatte.
Er hatte die Augen noch einmal geöffnet.
Draußen war es noch tiefschwarze Nacht gewesen. Das Wetter hatte sich beruhigt. Er hatte sie erkannt und mit der letzten Kraft, die ihm verblieb, ihre Hand gedrückt. Hatte die Lippen geöffnet, um etwas zu sagen. Die Augen waren mit einem Mal hellwach, so, als könne er nicht gehen, ohne dass seine Tochter ihn verstanden hätte.
Doch es kam nur ein schwaches Flüstern, vermischt mit einem Atemstoß und einem Gurgeln.
»sich … lasse … eine« – »nicht … dass deine«
Julia Durant spürte ihr Herz, das bis zum Hals trommelte.
Was wollte er ihr sagen?
Dann löste sich seine Hand. Sank hinab, streifte ihren Bauch. »… nicht … all-eine«
War es das, was er gemeint hatte?
Wollte er sie nicht alleine lassen?
War es selbst jetzt, im Augenblick seines Todes, das, worum er sich am meisten sorgte? Dass sie nun alleine war?
Pastor Durant hatte noch einmal ausgeatmet.
Ganz tief und leise, dann hatte das Rasseln aufgehört.
Seine Tochter hatte wie versteinert neben ihm gesessen, sie hätte nicht zu sagen vermocht, für wie lange.
Jetzt war sie also allein.
Der Tag hätte schon vor vielen Jahren kommen können. Wer erreichte heutzutage noch die neunzig? Pastor Durant hatte sich eines langen und erfüllten Lebens freuen dürfen. Er hatte nicht lange leiden müssen. Doch all diese Gedankensplitter, die wirr durch Julias Kopf jagten, halfen ihr in diesem Moment nicht.
Ihre Mutter war gestorben, als sie fünfundzwanzig Jahre alt gewesen war. Krebs. Sie hätte es sich so sehr gewünscht, ein Enkelkind zu haben. War gegangen in der besten Hoffnung darauf, dass dieses sich bald einstellen würde. Durant war eine aufstrebende Kommissarin bei der Mordkommission in München gewesen. Verheiratet mit einem wunderbaren Mann. Zumindest so lange, bis er sie mit einer ganzen Reihe von Kolleginnen betrog. Sie hatte einen Schlussstrich gezogen und sich nach Frankfurt versetzen lassen. Alles auf null. Seitdem waren über zwanzig Jahre vergangen. Männer hatte es viele gegeben. Die meisten entpuppten sich als Nieten. Manche als noch Schlimmeres. Julia Durant war mittlerweile fast fünfzig. Sie hatte sich so oft in die Nesseln gesetzt, dass sie die Hoffnung auf eine eigene Familie längst aufgegeben hatte. Und dann war Claus Hochgräbe in ihr Leben getreten. Ein Kollege aus München. Ausgerechnet München. Ausgerechnet die Mordkommission. Paps hatte ihn sehr gemocht, das wusste sie. Und nach vier Jahren Fernbeziehung hatte auch Hochgräbe sich nach Frankfurt versetzen lassen.
Julia Durant schlug die Augen wieder auf.
Das Foto war ihr aus der Hand gerutscht und zu Boden geglitten. Der dumpfe Aufprall der Holzkante auf dem Teppich hatte sie hochschrecken lassen. Ihre linke Hand lag auf dem Bauch und kribbelte, weil sie eingeschlafen war.
Plötzlich glaubte sie zu verstehen, was ihr Vater hatte sagen wollen.
»Nicht das Kleine.«
Durant begann zu zittern.
Hatte er das Kind gemeint? Seinen Enkel, den er in ihrem Unterleib wähnte? Ein Kind, von dem er glaubte, es nicht mehr kennenlernen zu dürfen. Weil Gott andere Pläne mit ihm zu haben schien. Weil es nun für ihn an der Zeit war, vor seinen Schöpfer zu treten.
Ein Tränenkrampf durchschüttelte ihren Körper, während Julia zusammensackte.
Walter Bortz war nüchtern, was um diese Tageszeit nicht selbstverständlich war. Er hatte die Hände tief in den Taschen der Lederjacke vergraben. Das Auto parkte am Rand eines Feldwegs südlich des Nordwestkreuzes, dort, wo die A5 sich mit der A66 kreuzte. An der gewohnten Stelle erklomm Bortz einen Abhang, folgte einem schmalen Trampelpfad und fand sich auf dem zugewucherten Gleisbett wieder. Es handelte sich um den alten Anschluss, der von der Kronberger Bahn zum verlassenen US-Army-Gelände führte.
Bortz blieb keuchend stehen. Er zog eine Zigarette aus der Packung und verfluchte das Feuerzeug, das erst beim vierten Versuch eine kleine Flamme hervorbrachte. Dann inhalierte er tief und blickte sich um. Keine Jugendlichen. Niemand zu sehen, nichts zu hören. Keine Abenteurer, die hier im Dickicht ihren geheimen Tätigkeiten nachgingen. Keine Kombis, aus denen man Grünschnitt, alte Reifen oder Windsäcke ablud, weil es hier niemanden zu stören schien. Bortz gluckste zufrieden. Denn er konnte niemanden brauchen, der ihn störte. Das hier war sein Ritual. Sein Gang, den er in unregelmäßigen Abständen wiederholte, wann immer es ihm danach war.
Er schritt weiter. Der Asphaltschotter knirschte unter seinen Sohlen. Eine Birke stach aus den Steinen hervor. Ein Stamm, so dick wie ein Unterarm. Wie lange wuchs sie schon hier? Die Natur eroberte sich die alte Bahntrasse zurück. Unaufhaltsam. So wie das Leben nun einmal war. Es sei denn, jemand beendete es.
Bortz erreichte das Ende des Hohlwegs. Seine Augen suchten die markanten Bäume, die er nie vergessen würde. Die Zeichen, die er sich eingeprägt hatte.
Mit ein wenig Anstrengung konnte er das Absperrgitter erkennen. Die Bahnbrücke über die Autobahn war nur noch wenige Schritte entfernt. Der Motorenlärm drang sonor zu ihm, dann eine Stimme. Oder hatte er sich geirrt? War da jemand? Vielleicht ein Gassigänger? Würde jemand wagen, den Zaun zu durchdringen und den alten Eisenweg auf seiner Seite zu gehen? Er wusste, dass es eine Mutprobe war, der sich manch Frankfurter Junge schon hatte stellen müssen. Doch nichts geschah.
Wie lange würde man die ausgediente Brücke noch stehen lassen? Wann würde sich ein Investor finden, der das angrenzende Gelände dem Erdboden gleichmachte, um etwas Neues darauf zu errichten? Jeder Quadratmeter Frankfurts, der ungenutzt blieb, war ein Grab. Ein schwarzes Loch, das Geld verschlang. Das Ende der US-Ruinen war nahe, Bortz konnte es spüren, und es erleichterte ihn. Sie würden niemandem mehr wehtun. Niemanden mehr in die Verzweiflung treiben. So wie …
Zigarettenrauch traf seine Augen, vor denen ein Schleier hing. »Es tut mir leid«, wisperte Bortz, zog ein letztes Mal an dem Filter und hielt die nächste Zigarette längst bereit. Entzündete sie an der Glut der alten, so gierig, als wolle er den Rauch am liebsten verschlucken. Doch sie schmeckte ihm nicht. Und nach seinen Augen reagierte der Hals auf die Bestürztheit. Er wurde trocken und fühlte sich eng an.
Warum hatte das passieren müssen?
»Das hast du nicht verdient«, sprach Bortz weiter und richtete seinen Blick auf einen willkürlichen Punkt zwischen den Bäumen. Vor geraumer Zeit hatte er eine Handvoll Steine aufeinandergetürmt. Doch jemand hatte sie zertreten.
Wenn ihr Geist zwischen diesen Bäumen umherging, dann war er also wenigstens nicht allein.
Ein kalter Windstoß brachte den Mann zum Frösteln.
»Ich habe das nicht gewollt«, flüsterte er in den aufkommenden Wind und wischte sich eine Träne aus dem Gesicht.
So hart er auch zu anderen sein konnte: Diese Frau hatte nicht sterben sollen. Von all den unrühmlichen Dingen, die Walter Bortz im Laufe seines Lebens getan hatte, war es das eine, das Einzige, was er ändern würde, wenn es in seiner Macht stünde. Doch die Gewissheit nagte an ihm, an manchen Tagen höhlte sie ihn aus. Es war nicht zu ändern, sie war tot.
Ein Fakt, an dem keine Macht etwas ändern konnte.
Eine Tat, deren er sich schuldig gemacht hatte.
Wie oft er schon hier gestanden hatte, Bortz wusste es nicht. Verdiente er es, sich ein Herz zu fassen, das Metallgitter zu überwinden und dasselbe Schicksal zu nehmen? Ein Leben für ein anderes? Diese Frage waberte in seinem Unterbewusstsein, doch die Antwort war dieselbe wie all die Male zuvor: Nein. Er war zu feige. Er würde es nicht tun. Und vor allem nicht jetzt. Er würde weiter trinken, weiter spielen und sich dieses beschissene Leben so erträglich machen, wie es ihm möglich war.
Eine Viertelstunde später kletterte Bortz auf einen Motorroller, den er abseits des Weges abgestellt hatte. Das Knattern zerriss die Stille, blaugrauer Rauch wurde in das kleinblättrige Dickicht gestoßen, wo er sich wie dichter Nebel festsetzte und nur langsam den Weg nach oben fand.
In einem Feldweg, zweihundert Meter weiter, öffnete sich eine Wagentür. Der Mann mit der Kamera hatte Blut und Wasser geschwitzt, als drei Grundschüler mit ihren BMX-Rädern aus dem Nichts erschienen waren. Gedroht hatten, ihm allein durch ihre Anwesenheit alles zu versauen. Mit gepresster Stimme und einem gezückten Portemonnaie hatte er sie zum Abhauen bewegen können. In letzter Sekunde.
Viel zu interessant war das, was der Mann mit dem Moped an der alten Bahnüberführung getrieben hatte.
Was ihn dorthin getrieben hatte.
Schritte trappelten durch den Flur. Das Haus war hellhörig, die Absätze der Schuhe klangen, als liefen sie direkt neben Durants Kopf. Sie spürte die Vibrationen am Ohr.
»Mei! Um Himmels willen!«
Die Stimme der Haushälterin. Ein energisches, urbayerisches Original. Erst jetzt begriff die Kommissarin, dass sie auf dem Teppich vor dem Fernsehsessel lag. Sie musste eingeschlafen sein. Auf ihrem Gesicht kitzelten die Fasern, und sicher hatte sie jetzt einen Abdruck, der sich einmal quer über die Backe zog.
»Was ist denn hier los? Ich habe gerufen, ich habe geklingelt. Das Auto steht in der Einfahrt! Herrschaftszeiten, haben Sie mich erschreckt!« Dann hielt sie inne und senkte das Haupt. »Mein Beileid.«
Durant griff nach ihrer Hand und lächelte. »Er ist jetzt bei Mama. Und er war nicht allein.«
Die beiden schwiegen für einige Sekunden, dann sprach die Kommissarin weiter: »Ich muss eingeschlafen sein. Ich wollte hierher, etwas alleine sein. Ausruhen.« Sie deutete auf das Foto, das noch immer auf dem Boden lag. »Es gibt jetzt so viel zu tun.«
Es graute ihr bei dem Gedanken.
Während die Haushälterin in der Küche verschwand, um Kaffee zu kochen und eine Kleinigkeit zu essen zu machen, erinnerte sie sich an damals. Ein Foto für die Traueranzeige. Ein großformatiges Bild für die Trauerfeier. Einen Vers, den man mit dem geliebten Menschen in Verbindung brachte.
Wenn sich der Mutter Augen schließen …
Damals hatte Paps sich um diese Dinge gekümmert. Ohne Internet, ohne Google, und sie selbst hatte die Tage bis zur Beisetzung wie unter einer Glocke erlebt. Oder war das ein Trugschluss ihrer Erinnerung?
Durant wusste es nicht.
Sie wusste nur, dass sie jetzt alleine war.
Ganz alleine.
Für immer.
Zwei Wochen später
Freitag
Das Sommersemester an der Fachhochschule Frankfurt kam nur langsam in Gang, was Dina ganz recht war. Es glich einem Wunder, dass sie überhaupt hier war. Dass man sie bleiben ließ. Sie stieg aus der Straßenbahn und versuchte, so viele der trübsinnigen Gedanken wie möglich hinter den zischenden Türen des Wagens zurückzulassen. Über ihrer Schulter hing eine Stofftasche. In ihr befanden sich ein Apfel, ein Müsliriegel und eine Flasche Wasser. Außerdem ein karierter Block und einige Ausdrucke, die sie in einen Schnellhefter einsortiert hatte. Dina liebte die Ordnung, sie nahm ihr Studium sehr ernst. Mit ihren Kommilitonen, die sie häufig damit aufzogen und den Hauptinhalt in ausschweifenden Partys und Männergeschichten zu sehen schienen, konnte sie nicht viel anfangen. Manchmal – wenn sie sich mal wieder gezwungen sah, sich rechtfertigen zu müssen – erwähnte sie eine alte Geschichte, die ihr noch heute sehr zu schaffen machte. Während ihres ersten Semesters war eine Kommilitonin abgeschoben worden. Sie stammte aus einer Region Ex-Jugoslawiens, genau wie sie. Dina wusste nur nicht mehr genau, woher. Die junge Frau hatte ihre alte Heimat während des Bürgerkriegs als Kleinkind verlassen und keinerlei Bezug dazu. Sprach besser Deutsch als jede andere Sprache. Hatte einen guten Schulabschluss und wäre mit Sicherheit eine hervorragende Sozialarbeiterin geworden. Doch all das hatte ihr nicht geholfen. Von einem Tag auf den anderen war sie verschwunden.
»Und was hat das mit dir zu tun?«, musste sie sich dann anhören. »Kann dir doch nicht passieren.«
Das sagte sich so einfach. Doch Dina hatte zu viel erlebt, um ein solches Vertrauen zu besitzen.
Für eine Sekunde verschwammen ihre Augen. Das rote Haus in der Mitte des Campus schien sich im Flimmern der Hitze aufzulösen. Es war das letzte Gebäude des alten Straßenzugs, um den herum man das Hochschulgelände nach allen Richtungen erweitert hatte. Der perfekte Platz für die Fachschaft, eingekesselt, wie man sich selbst gerne wahrnahm. Wie eine letzte Bastion, die sich tapfer gegen die Bürokratisierung auflehnt. Der letzte Ort, wo man sich das Rauchen nicht verbieten ließ – manche Professoren in ihren Dienstzimmern ließen sich gewisse Angewohnheiten trotz hochsensibler Rauchmelder nicht nehmen.
Auch wenn vom Geist der Siebzigerjahre sonst nicht mehr viel zu spüren war, Dina hatte stets hierher gewollt. Soziale Arbeit studieren, etwas bewirken, die Welt ein wenig besser machen. Ihr Vater verachtete diese Entscheidung. Hatte versucht, sie mit Worten davon abzubringen. Dann mit Schlägen. Auf ihre Mutter konnte sie nicht zählen. Und dann ihr Bruder …
Der Schatten legte sich erneut auf Dinas Gesicht.
Wenn nicht für mich selbst, dachte sie im Stillen, dann wenigstens für andere. Sie wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel und griff nach dem Stoff, der Haare und Stirn bedeckte. Sie hasste das Kopftuch, und ihr Vater würde sie halb tot prügeln, wenn er wüsste, dass sie es vor den Seminaren ablegte. Dina steuerte ihre Schritte in Richtung Gebäude Nummer 2. Stapfte die Treppenstufen des Altbaus hinauf und ging zur Damentoilette. Dort entledigte sie sich des Tuches und ordnete ihre Frisur. Sie hatte langes Haar, genauso wie Schneewittchen aus dem Märchen. Schon als Mädchen hatte sie sich gefragt, weshalb man eine derartige Schönheit verstecken solle. Und schon als Kind hatte ihr ein solches Aufbegehren brutale Strafen beschert.
Das Aufschwingen der Tür riss Dina aus ihren Gedanken, und sie zuckte so sehr zusammen, dass sie ihre Tasche fallen ließ. Dann erkannte sie das Gesicht der Person, die hereinkommen wollte. Vor ihren Füßen die Wasserflasche, um ein Haar wäre sie darüber gestolpert.
»Mensch, du bist es«, lachte die junge Frau. Sie hieß Freya und war wie sie Anfang zwanzig. Hatte ein rundes Gesicht mit Stupsnase, um die sich unzählige Sommersprossen verteilten. Ihre Augen waren von einem leuchtenden Grün, dazu trug sie blonde, lange Haare mit einem leichten Rotstich. Für Dina, die in ihrem Gesicht oftmals nichts als Dunkelheit wiederfand, war Freya der Inbegriff irisch-europäischer Schönheit. Unter allen Mitstudenten war sie Dinas einzige Freundin.
Schon hatte Freya sich gebückt und nach der Flasche gegriffen, den Ordner zurück in die Tasche geschoben und das ganze Bündel aufgehoben. Da stand sie nun, mit ihrem unbeschwerten, wunderschönen Lächeln. Und Dina schaffte es gerade einmal, die Mundwinkel zu verkrampfen.
»Danke.«
Als Nächstes bemerkte sie, wie Freyas Augen ihre Schläfe taxierte. Dina wollte sich noch wegdrehen, doch es war zu spät. Nur eine Minute später, dachte sie im Stillen, und ich hätte es überpudern können.
»War er das?«
Dina bejahte, und Freya blickte grimmig drein.
»Dieses Arschloch.« Nur sie durfte Dinas Vater so nennen. Sie und Dinas Bruder, aber selbst dieser wagte das nur selten. »Warum gehst du nicht endlich weg?«
»Ich kann nicht, und das weißt du auch«, erwiderte Dina und griff nach ihrer Tasche, in der sich auch ein paar Schminkutensilien befanden.
Freya schnaubte verächtlich. »Und wenn schon! Wieso beschützt dich dein Bruder nicht? Er reißt doch sonst ständig große Sprüche. Warum lässt er so etwas zu?«
Sie zeigte auf die blaue Stelle zwischen Auge und Haaransatz.
»Du weißt, dass er es nicht kann«, murmelte Dina und drehte sich in Richtung Spiegel.
»Nicht kann, nicht kann«, redete Freya ihr nach. »Nicht will. So sieht’s mal aus.« Sie überlegte kurz. »Dann lass ihn seine Arbeit doch künftig selbst machen, seinen ganzen Bürokram. Er wird ja sehen, was er davon hat.«
Ihr Bruder Gorhan unterhielt ein kleines Restaurant mit Lieferservice. Dass er praktisch nicht lesen konnte und noch weniger von Buchhaltung und Steuererklärungen verstand, war ein Geheimnis, von dem alle in der Familie wussten, aber worüber man nicht sprach. Von Dina wurde erwartet, dass sie sich darum kümmerte. Neben ihrem Studium. Im Gegensatz zu diesem nahm man das Unternehmen ihres Bruders in der Familie sehr ernst. Natürlich. Die Einnahmen finanzierten die Familie, was zum Großteil bedeutete, dass das Geld in die Trunksucht des Vaters floss. Praktischerweise bezog er seinen Alkohol dann auch gleich im Imbiss seines Sohnes. Und versenkte seine Münzen in die einarmigen Banditen, die Gorhan aufgehängt hatte.
Es war ein beschissenes Leben, wenn sie darüber nachdachte. Doch Dina konnte nicht gehen. Noch nicht.
Freya wollte wissen, ob die Vorlesung überhaupt stattfand. In den letzten beiden Wochen war die Professorin wegen eines Fahrradunfalls nicht an die FH gekommen. Erst als sie die Frage wiederholte, riss das ihre Freundin Dina aus den düsteren Gedanken. Sie hob die Schultern: »Keine Ahnung. Ich bin ja selbst eben erst angekommen.«
»Na, wenn der Block ausfällt, könnten wir schnell zur Konsti fahren«, schlug Freya vor. Sie meinte die Konstabler Wache, die nur wenige Haltestellen entfernt lag. Dort befand sich einer der Eingänge zur Zeil, Frankfurts beliebter Einkaufsstraße.
»Warum das denn?« Dina rollte mit den Augen. Immer musste Freya ihr Geld auf der Zeil raushauen. Dabei jammerte sie nicht selten darüber, wie knapp sie bei Kasse war.
»Sag bloß, du hast die Party vergessen.«
Tatsächlich hatte Dina darauf gehofft, dass Freya dieses Thema nicht mehr ansprechen würde.
»Welche Party noch mal?«, fragte sie betont desinteressiert. Doch ihre Freundin durchschaute sie.
»Ha, ha! Als ob!« Freya knuffte sie sanft in die Seite, während sie zur Anzeigetafel schlenderten, um nachzusehen, ob dort etwas über ihre Professorin zu lesen war.
»Du weißt genau, wovon ich rede. Und ich nehme es dir außerdem übel, dass du mir nicht als Erste davon erzählt hast.«
Dina schüttelte energisch den Kopf. »Freya, bitte. Lass uns was anderes unternehmen. Ich habe dir nichts davon gesagt, das stimmt. Aber … «
»Nein, Dina!«, unterbrach Freya sie scharf. »Du musst endlich mal wieder raus aus deinen vier Wänden. So wird das doch nie was mit dir. «
Auch ohne die Gründe, die Dina in Wirklichkeit hinderten, hätte Freya es besser wissen müssen.
Dina startete einen letzten Versuch: »Es ist mein Bruder. Er wird auch dort sein. Ich kann nicht, hörst du? Außerdem – mein Vater …«
Freya schnaubte verächtlich. »Dein Vater! Wenn ich das schon höre. Der liegt um diese Zeit doch besoffen auf dem Sofa. Und das weißt du auch.«
»Ja, eben«, gab Dina zurück. »In diesem Zustand ist er am schlimmsten. Da lässt er mich niemals aus dem Haus.«
»Herrje, du bist erwachsen!« Jetzt kam diese Leier. »Hast du in Recht nicht aufgepasst? Wir leben in einem freien Land. Er kann dir gar nichts vorschreiben.«
»Er kann das da …« Dina deutete auf den überpuderten Bluterguss. »Sein Haus, seine Regeln. Meine Familie ist eben anders als deine. Da ändert dein bescheuertes Recht auch nichts dran!«
Freya schluckte und legte den Arm um sie. Einige Sekunden verstrichen, bis sie raunte: »Nein, Dina. Wir sind anders. Wir sind göttlich, das weißt du doch. Dina und Freya.«
Ganz zu Beginn ihrer Freundschaft hatten sie ihre Namen gegoogelt. Mehr zum Spaß, aber dabei hatten sie herausgefunden, dass es in mancher Deutung Engelsnamen waren. Freya war sogar ein nordischer Göttinnenname. Kindisch, wie es sich in diesem Moment anfühlte. Doch Freya hielt daran fest. »Wir beide sind Engel. Und was machen Engel?«
»Sag du es mir.«
»Wir werden uns himmlisch amüsieren.«
Doch Dina schüttelte den Kopf. »Nicht an diesem Wochenende«, erwiderte sie leise. Ihre Freundin begriff, dass diese Antwort endgültig war. Doch das Wichtigste für Dina war das, was sie nun zu sagen hatte. Sie ergriff Freyas Hände und schenkte ihr einen vielsagenden Blick.
»Du darfst da auch nicht hingehen, hörst du?«, drängte Dina. »Versprich es mir. Diese Party ist kein Ort für Engel. Du musst es mir versprechen.«
Freya schwieg eine Weile, dann aber nickte sie hastig und setzte ein unbeschwertes Grinsen auf. »Okay. Meinetwegen. Ich denke drüber nach.«
Ein Kommilitone rief Freyas Namen, und die junge Frau zog Dina leichtfüßig mit sich, um sich im nächsten Moment in belanglosen Small Talk zu stürzen.
Dina schaffte es nur schwer, auf die Themen der FH umzuschalten. Auf den Lernstoff, auf das Essen in der Mensa und auf Themen wie Fußball und das neue Album von Radiohead. Freya war nicht nur leistungsstark und gewissenhaft, was das Studium betraf. Sie war auch so unbedarft, nichts und niemand schien ihr schaden zu können. Außerdem verfügte sie über eine gewisse Erfahrung, insbesondere mit Männern. Eine Eigenschaft, die Dina an ihr besonders bewunderte. Denn Dina selbst hatte noch nie einen anderen Mann geliebt. Sie kannte Sex, aber nicht als Akt der Liebe. Doch diese Erinnerungen versuchte sie, so tief es ging, in ihrer Seele zu vergraben. Wie eine Auster, in der sich Perlmutt um tödliche Fremdkörper legt, damit sie das zarte Fleisch nicht verletzen. Doch ganz gleich, wie dick die Schutzschicht auch wuchs: Der Schmerz blieb bestehen.
Er würde für immer ein Teil von ihr sein.
Sonntag
Das Knallen der Autotür zerriss die Stille, die über der Stadt lag. Es war dämmrig, die Sonne war noch nicht aufgegangen. Julia Durant blinzelte in das fahle Licht von Straßenleuchten, die man mit LED-Technik bestückt hatte. Dazwischen die Farbtupfer der Einsatzfahrzeuge. Sie unterdrückte ein Gähnen und nippte an ihrem Pappbecher. Der Kaffee war stark und kräftig gesüßt.
Vor einer halben Stunde hatte die Kommissarin der Mordkommission noch nichts ahnend in ihrem Bett gelegen. Dann der Anruf des KDD. Eine Leiche im Westhafen. Natürliche Todesursache ausgeschlossen. Ein Fall für das Königskommissariat, wie man das K11 intern manchmal bezeichnete. Ein Fall für Julia Durant.
»Hast du sonst noch wen erreicht?«, hatte sie sich erkundigt und dachte dabei vor allem an ihren Kollegen Frank Hellmer.
Alice Marquardt, die rauchige Stimme am anderen Ende der Leitung, verneinte. »Hat nicht Kullmer Bereitschaft? Bei ihm geht nur die Mailbox ran.«
Julia Durant streckte sich gähnend. Dann hielt sie das Handy wieder ans Ohr und antwortete: »Hauptsache, ich muss das nicht alleine durchziehen. Wärst du so nett und versuchst es weiter?«
»Klar.« Marquardt machte eine Pause, dann sagte sie leise: »Mein Beileid übrigens noch. Mensch, ich habe es erst vorgestern gehört.«
»Danke.«
»Glaub mir, ich fühle mit dir. Mein Paps war achtundsechzig. Kommst du klar?«
»Schon in Ordnung. Er ist eingeschlafen, er war nicht alleine, und gelitten hat er wohl auch nicht. Das ist besser, als es den meisten ergeht.«
»Mmh.«
Gespräche über den Tod von Familienangehörigen waren das Letzte, wonach Julia Durant der Sinn stand. Der Tod überforderte die Lebenden, so war es immer gewesen, und am Ende triumphierte er. Pastor Durant war in den frühen Morgenstunden des 25. April verstorben. Er würde eine Urnenbestattung bekommen, Julia hatte sich mit allerlei Formalien herumgeärgert. Das lange Wochenende war mit einem Mal völlig unwichtig geworden. Stattdessen ging es um die Frage, was nun mit ihrem Elternhaus passieren würde. Und – das schien dem Bestatter am allerwichtigsten zu sein – wie die Traueranzeige aussehen sollte. Ein zäher Prozess, der sich am Ende darauf beschränkte, aus einem Katalog ein passendes Bild und einen Spruch auszuwählen, von dem man glaubte, dass er dem Verstorbenen gefallen würde. Durant hatte ein Bild mit einer Lilie gewählt. Ihre Familie war eine alte Hugenottenfamilie. Geflüchtet aus Frankreich. Eine Lilie erschien ihr passender als eine Getreideähre oder eine Rose. Und doch konnte kein Bild, kein Spruch ihrem Vater gerecht werden. Dem Mann, den sie so jäh verloren hatte.
Seit ein paar Tagen war Julia Durant wieder in Frankfurt. Einen Beisetzungstermin gab es noch nicht. Ihre Anwesenheit in München war nicht erforderlich. Wegen der Feiertage würde sich das Prozedere noch etwas hinziehen, hatte es geheißen. Man würde sich bei ihr melden. Bis dahin wartete der Alltag auf sie.
Und damit auch wieder der Tod.