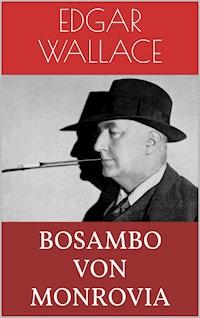
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Werk "Bosambo von Monrovia" ist ein 1926 veröffentlichter Afrikaroman von Edgar Wallace. Der Originaltitel lautet "Bosambo Of The River". Richard Horatio Edgar Wallace (geboren 1. April 1875 in Greenwich, London; gestorben 10. Februar 1932 in Hollywood, Kalifornien) war ein englischer Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur, Journalist und Dramatiker. Wallace gehört zu den erfolgreichsten englischsprachigen Kriminalschriftstellern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bosambo von Monrovia
I. Arachi, das Pumpgenie.II. Die Steuerbeitreibung.III. Der Aufstieg des Kaisers.IV. Der Sturz des Kaisers.V. Die Ermordung Olandis.VI. Der Schrittzähler.VII. Bosambos Bruder.VIII. Der Thron der N'Gombis.IX. Der Kichu.X. Das Opferkind.XI. »Sie.«XII. Die Gesandten.XIII. Hinterlader im Besitz der Akasavas!ImpressumI. Arachi, das Pumpgenie.
FVor vielen Jahren bestrafte die Regierung von Liberia einen gewissen Bosambo, einen Eingeborenen der Kruküste und daher einen geborenen Dieb, mit lebenslänglicher Zwangsarbeit. Bosambo, der anderer Meinung über diese Angelegenheit war, erhielt in der Strafniederlassung, einem Streifen Urwald im Hinterland, eine Axt und eine Säge mit dem Befehl, in Gesellschaft anderer Unglücklicher, die Bosambos Los teilten, Mahagoniholz zu fällen und zu behauen.
Um sich Bosambos Gehorsam zu sichern, setzte das Gouvernement von Liberia eine Anzahl seiner Landsleute als Wächter über ihn. Diese waren mit Waffen versehen, die bei Gettysburg gute Dienste geleistet hatten, und die ein Geschenk des Präsidenten Grant an den Präsidenten von Liberia waren. Malerisch genug nahmen sich diese Waffen aus, aber ihnen mangelte die Zuverlässigkeit, besonders in den Händen der unerfahrenen Soldaten der monrovianischen Armee. Bosambo, der seine Axt zu einem unedlen Zweck gebrauchte, indem er den »Hauptmann« Cole damit erschlug (der, obwohl schwarz, wie nur ein Neger sein kann, nach dem liberianischen »Gothaischen Kalender« von edler Geburt war), verließ die Strafniederlassung mit leidenschaftlicher Hast. Mit den Gettysburger Reliquiens machte man aus zweihundert Yards Entfernung Zielübungen auf ihn. Aber Bosambo war bereits eine Meile weit entfernt, ehe die Wachen sich Nahrung für ihre tödlichen Waffen gesichert hatten, da sie erst den Leichnam ihres toten Kommandanten nach dem Schlüssel zur Munitionskammer absuchen mußten.
Das Gouvernement setzte eine Belohnung von zweihundertundfünfzig Dollars für den toten oder lebendigen Bosambo aus. Aber, obwohl diese Belohnung von dem Halbbruder des Kriegsministers beansprucht und diesem auch gezahlt wurde, ist es eine Tatsache, daß man Bosambo niemals ergriff. Im Gegenteil, er entkam nach einem fernen Lande und wurde dort, dank seinen Talenten, Häuptling der Ochoris.
Bosambo war ein zu guter Sportsmann, um seine Verfolger in Ruhe zu lassen. Es ist kaum zu bezweifeln, daß die Krurevolte, die zu unterdrücken dem liberianischen Gouvernement achthunderteinundzwanzig Pfund Sterling und sechzehn Schilling kostete, der Aufwiegelei und Unterstützung Bosambos zu danken war. Von dieser Revolte und der Rolle, die Bosambo dabei spielte, wird vielleicht später noch zu sprechen sein.
Der zweite Aufstand war eine noch ernstere und noch kostspieligere Sache, und am Ende dieser Revolte erhob das liberianische Gouvernement Vorstellungen bei Großbritannien. Bezirksamtmann Sanders, der eine gänzlich unbeeinflußte Untersuchung vornahm, inwieweit Bosambo in diese Angelegenheit verwickelt war, berichtete, daß es keinerlei Beweise dafür gäbe, daß Bosambo, sei es direkt oder indirekt, dafür verantwortlich gemacht werden könne. Damit mußte sich das liberianische Gouvernement zufriedengeben. Aber es drückte seine Meinung dadurch aus, daß es eine Belohnung von zweitausend Dollars für den lebendigen oder toten Bosambo – lieber für den lebendigen – aussetzte. Es fügte außerdem als besonderen Hinweis für kleinere Gouvernementsbeamte und ihresgleichen hinzu, daß es – wie es in der betreffenden Veröffentlichung lautete – jeden Ersatz für ihn zurückweisen würde. Die Nachricht von dieser Belohnung lief die Küste auf und nieder und drang sehr weit ins Innere, aber seltsam genug, Arachi von den Isisis erfuhr erst viele Jahre später davon.
Arachi war Isisimann und ein großes Pumpgenie und allen Leuten stromauf- und abwärts als solches so bekannt, daß sich bereits bei seinen Lebzeiten zahlreiche Legenden um ihn bildeten. Wenn sich zum Beispiel Hokas Weib von O'takis Weib einen Kochtopf lieh, so konnte man sicher sein, daß O'takis Weib ihr den Willen tat; aber mit einem anzüglichen Scherz rief sie dem sich entfernenden Topf nach: »O du schamloser Arachi!«, und die Dorfbewohner, die den Scherz hörten, schüttelten sich vor Lachen.
Arachi war ein Häuptlingssohn; aber in einem Lande, wo die Häuptlingswürde nicht erblich war, und wo es überdies Häuptlingssöhne in Menge gab, gereichte ihm seine Abstammung nicht zu besonderem Vorteil. Auf jeden Fall war sie ihm nicht von solchem Nutzen, wie er sich einbildete, daß sie es sein müßte.
Arachi war lang und dünn, und seine Knie waren sonderbar knorrig gedreht. Er hielt seinen Kopf wichtigtuend nach einer Seite geneigt und hegte tiefe Verachtung für seine Mitmenschen.
Eines Tages kam er zu Sanders.
»Herr,« sprach er, »ich bin ein Häuptlingssohn und ungeheuer klug. Leute, die mich sehen, sagen: ›Seht, dieser junge Mann ist voll geheimer Kräfte!‹ Man sieht's mir an. Außerdem bin ich ein gottbegnadeter Redner.«
»Es gibt viele große Schwätzer im Lande, Arachi, ohne daß sie gerade zwei Tage stromabwärts fahren, um mir das zu sagen«, gab Sanders kurz zurück.
»Herr,« sagte Arachi eindrucksvoll, »ich komme zu dir, weil ich eine höhere Lebensstellung suche. Viele deiner kleinen Häuptlinge sind einfältige Kerle und überdies ihres Postens unwert. Nun bin ich doch ein Häuptlingssohn, und es ist mein Begehr, meinem Vater in seinem Amte zu folgen. Auch bitte ich dich, dich zu erinnern, daß ich zwischen fremdem Volk, zwischen den Angolastämmen, gelebt habe und ihre Sprache spreche.«
Sanders seufzte gelangweilt. »Siebenmal hast du mich darum gebeten, Arachi, und siebenmal habe ich dir gesagt, du bist kein Häuptling für mich. Ich bin deiner ewigen Bettelei in dieser Sache müde, und wenn du dich noch einmal hierher wagst, werfe ich dich zu den Affen. Und was das Angolapalaver angeht, so sollst du Häuptling werden, wenn sich, was Gott verhüten möge, das Angolavolk einmal in meinem Bezirk niederlassen sollte.«
Uneingeschüchtert kehrte Arachi in sein Dorf zurück, denn er bildete sich ein, daß Sanders ihn um seine ihm innewohnenden Kräfte beneidete. Er baute sich eine mächtige Hütte am Ende seines Dorfes, indem er sich die Dienste seiner Freunde dazu lieh. Er legte sich einen großen Vorrat von Salz und Mais an, den er sich durch kluge Zahlungsversprechungen von den Nachbardörfern zu verschaffen wußte.
Seine Hütte sah aus wie ein Königshaus; so prachtvoll nahmen sich die aufgehangenen Felle und sein Bett aus, das mit weichem Fell überspannt war. Die Leute aus seinem Dorfe brachen in ein bewunderndes »Ko« aus, weil sie glaubten, Arachi habe diese verborgenen Schätze aus der geheimnisvollen Schatzkammer seines Vaters ausgegraben, die jeder Häuptling nach dem Glauben seines Stammes besaß, und zu der Arachi als sein Sohn Zugang habe. Und erst recht waren die, die zur Erhöhung dieser Pracht beigetragen hatten, davon hingerissen und erfreut.
»Ich habe Arachi zwei Säcke Salz geliehen«, sagte Pidini, der Häuptling des Fischerdorfes Kolombolo, »und im Innersten meiner Seele zweifelte ich daran, daß Arachi sie mir zwei Tage nach der Regenzeit bezahlen würde, obwohl er es mir bei seinem Tode geschworen hatte. Nun sehe ich, daß er wirklich sehr reich ist, wie er mir selbst erzählt hat, und wenn ich mein Salz nicht wiedererhalte, dann werde ich Arachis Staatsbett mit Beschlag belegen.«
In einem anderen Dorfe jenseits des Flusses Ombili vertraute ein Vormann der Isisis seinem Weibe: »Weib, du hast doch Arachis Haus gesehen! Ich hoffe, du wirst nun mit deinem närrischen Geschwätz einmal aufhören, denn du hast in einem fort genörgelt, weil ich Arachi mein feines Bett geliehen habe.«
»Herr, ich sehe ein, das war unrecht von mir«, erwiderte das Weib demütig. »Aber ich fürchtete, er würde das Salz nicht bezahlen, wie er versprochen hatte. Nun weiß ich, daß meine Furcht grundlos war, denn ich habe viele Säcke Salz in seiner Hütte gesehen.« Das Gerücht von Arachis Reichtum verbreitete sich flußauf, und abwärts, und als das Pumpgenie die Hand Koraris, der Tochter des Häuptlings der Putanis, der Flußfischer, verlangte, kam sie zu ihm ohne viel Palaver, obwohl sie eigentlich noch zu jung war.
Sie war ein schlank gebautes Mädel, voller Reize und wohl die tausend Messingstangen und zwanzig Sack Salz wert, die der freigebige Arachi dafür beim Tode, bei allen Teufeln und einer Kollektion verschiedener Gottheiten zu bezahlen schwor, und die an ihren Vater abgeliefert werden sollten, wenn Mond und Fluß in gewisser Stellung zueinander ständen.
Nun verrichtete Arachi keinerlei Arbeit, außer daß er zu gewissen Stunden, in ein Gewand aus Affenschwänzen gekleidet, das er vom Bruder des Isisikönigs geborgt hatte, auf der Dorfstraße spazieren ging.
Er fischte nicht, er jagte nicht, noch arbeitete er auf dem Felde.
Er sprach darüber mit Korari, seinem Weibe, und erklärte ihr, warum das so sei. Er redete zu ihr von Sonnenuntergang bis zu den frühen Morgenstunden, denn er war ein unermüdlicher Schwätzer. Und besonders, wenn er auf sein Lieblingsthema, auf sich selbst, zu sprechen kam, wurde er außerordentlich beredt. Er sprach auf sie ein, bis der Kopf des armen Dinges, bis zum Verzweifeln schläfrig, von Seite zu Seite und von vorn nach hinten sank.
Er sei ein großer Mann, der geschätzte Vertraute Sandis, er habe unermeßliche Gedanken und Pläne, Pläne, die ihm ein Leben voll Bequemlichkeit und ohne die kümmerlichen Ergebnisse von Arbeit sicherten. Außerdem würde ihn Sanders schon zu richtiger Zeit zum Häuptling machen. Sie sollte es haben wie eine Königin – während sie es vorgezogen hätte, in ihrem Bett zu liegen und zu schlafen.
Obwohl Arachi kein Christ war, glaubte er an Wunder. Er hing seinen Glauben an das höchste Wunder, leben zu können, ohne irgendwelche Arbeit zu tun, und war nahe daran, dieses Wunder erfüllt zu sehen.
Aber das Wunder, das sich hartnäckig weigerte, in Erfüllung zu gehen, brachte ihm in dem Augenblick Hilfe, als seine zahlreichen Gläubiger nach Bezahlung der vielen und mannigfaltigen Dinge schrien, die sie ihm geborgt hatten.
Es ist eine unbestrittene Wahrheit, daß jede Stunde ihren Mann bringt, ganz sicher bringt sie ihren Gläubiger.
An einem unruhigen und stürmischen Tage kamen die zornigen Wohltäter Arachis im Vollgefühl ihrer Rechte zu ihm und nahmen ihm weg, was irgendwie greifbar war, und das alles angesichts der ganzen Dorfschaft, wie Korari mit großer Scham empfand. Arachi im Gegenteil, war, dank seinem Hochmut, weder beschämt noch niedergeschlagen, obwohl viele Leute ihn nicht gerade sanft behandelten.
»Du Dieb und Ratte,« sagte der erbitterte Eigentümer eines prächtigen Staatsstuhles, dessen Unterteil Arachi fertig gebracht hatte, zu verbrennen, »ist es nicht genug, daß du für die Abnutzung dieser Dinge nichts bezahlst, mußt du überdies mit meinem Prachtstuhl Feuer anmachen?«
Arachi antwortete als Philosoph und leidenschaftslos: Sie könnten ihm alle diese großartigen Dinge nehmen – das taten sie auch –, sie könnten ihn in herausforderndster Weise schmähen – auch das taten sie –, aber sie könnten ihm nicht die Hütte nehmen, die mit ihrer Hilfe und Arbeit gebaut worden sei, denn das verstoße gegen das Gesetz ihres Stammes; noch könnten sie ihm sein Vertrauen in sich selbst nehmen, denn das sei gegen die Gesetze der Natur – seiner Natur.
»Weib!« sagte er zu seinem weinenden Mädel, »solche Dinge kommen mal vor. Ich denke, ich bin das Opfer des Schicksals. Darum will ich einmal meine Götter wechseln. Die, an die ich bisher glaubte, die helfen mir nicht, und wie du dich erinnern wirst, habe ich viele Stunden im Urwald mit Gebet zugebracht.«
Arachi dachte an viele mögliche Zufälle – so zum Beispiel: Sanders würde sich erweichen lassen und ihn zu einem großen Häuptling machen. Oder er, Arachi, könne im Flußbett einen Schatz heben, wie das Ufabi, der N'Gombimann, einmal getan hatte.
Ganz und gar von dieser Idee eingenommen, ging Arachi eines Morgens vor Sonnenaufgang zu einem Platz am Flußufer und grub dort. Er hatte gerade zwei Schaufeln Erde umgegraben, als ihn eine unendliche Müdigkeit überkam und er das Suchen nach dem Schatze aufgab. Denn, überlegte er sich, wenn ein Schatz im Flußbett liegt, kann das ebensogut dort wie irgendwo anders sein. Und wenn es nicht dort ist, wo mag er dann sein? Arachi trug sein Mißgeschick mit philosophischer Ruhe. Er saß in dem nackten und geschwärzten Raume seiner Hütte und erklärte seinem Weibe, daß ihn die Leute, die ihn beraubt hätten, um der ihm innewohnenden großen Kräfte willen, haßten. Und eines Tages, wenn er ein großer Häuptling wäre, würde er ein Kriegerheer von seinen Freunden, den N'Gombis, borgen und die Hütten seiner Gläubiger verbrennen. »Borgen«, sagte er, denn er war gewohnt, in Anleihen zu denken.
Am Tage nach der Beschlagnahme kam sein Schwiegervater, in der Hoffnung, aus dem Schiffbruch etwas von der Mitgift Koraris zu retten. Aber er kam zu spät.
»O, du Sohn der Schande!« rief er bitter aus. »Ist das die Art, wie du für meine unschätzbare Tochter bezahlst? Beim Tode, du bist ein elender Schuft!«
»Hab' keine Angst, du Fischermann«, sagte Arachi von oben herab. »Ich bin ein Freund Sandis, und ich bin sicher, daß er etwas für mich tun wird, das mich hoch über die gewöhnlichen Leute stellt. Eben jetzt will ich ein langes Palaver mit ihm halten, und wenn ich zurückkehre, wirst du von sonderbaren Ereignissen hören.«
Arachi besaß die Eigenschaft aller Pumpgenies – er wußte die Leute zu überzeugen. Und er überzeugte selbst seinen Schwiegervater, also einen Verwandtschaftsgrad, der seit Beginn der Welt am allerschwierigsten zu überzeugen ist.
Arachi verließ sein Weib, und sie, das arme Wesen, froh, von der Gegenwart ihres geschwätzigen Gatten befreit zu sein, legte sich wahrscheinlich zunächst einmal zu einem Schläfchen nieder. Auf jeden Fall kam Arachi in einem für ihn sehr günstigen Augenblick am Sitz des Gouvernements an. Das Gouvernement war gerade ein bewaffnetes Lager an dem Zusammenfluß des Isisi- und Ikeliflußes. Um Sandis gewöhnliche Mühseligkeiten aufs höchste zu steigern, kam ein ungebetener Fremder zu ihm. Seine Ordonnanz kam und sagte, ein Mann wünsche ihn zu sprechen.
»Was für ein Mann?« fragte Sanders müde.
»Herr,« erwiderte die Ordonnanz, »ich habe seinesgleichen früher noch nicht gesehen.«
Sanders besah sich diesen Besucher. Der Fremde stand auf und grüßte, indem er beide Hände in die Höhe hob. Prüfend glitt Sanders' Blick über ihn hin. Es war keiner von den Stämmen, die Sanders kannte, da er nicht die Gesichtsschnitte aufwies, die seitlich die Wangen hinuntergehen, und die die Bomongos kennzeichnen. Ebensowenig war er auf der Stirn tätowiert wie die Leute vom Kleinen Fluß.
»Wo kommst du her?« fragte Sanders auf Suaheli, das die Allerweltssprache auf dem Festlande ist, aber der Mann schüttelte den Kopf. Sanders versuchte es daher nochmals, diesmal in Bomongo; er dachte, daß der Mann, nach seinen Gesichtsschnitten, vom Bokeristamm sein müsse. Aber der Fremde antwortete in einer Sanders unbekannten Sprache.
» Quel nom avez-vous?« fragte Sanders und wiederholte diese Frage auf portugiesisch. Darauf antwortete der Fremde schließlich, daß er ein kleiner Häuptling aus Angola sei und sein Land verlassen habe, um der Sklaverei zu entgehen.
»Nimm ihn zu den Leuten ins Lager und gib ihm zu essen«, befahl Sanders der Ordonnanz und schlug sich die Gedanken an ihn aus dem Kopf.
Sanders hatte wenig Zeit, sich mit fremden Eingeborenen abzugeben, die sich in sein Lager verirrten. Er beschäftigte sich gerade damit, einen Biedermann aufzusuchen, der unter dem Namen Abdul Hazim bekannt war, und der, entgegen dem Gesetz, Gewehre und Pulver an die Eingeborenen verkaufte.
»Und wenn ich ihn fange,« sagte Sanders zu dem Hauptmann der Haußas, »wird es ihm leid tun.«
Abdul Hazim teilte diese Ansicht und ging Sanders geflissentlich aus dem Wege, und zwar mit solchem Erfolge, daß Sanders nach einer weiteren Woche Herumziehens zu seinem Sitz an der Küste zurückkehrte. Sanders war damals gerade sehr niedergeschlagen, körperlich herunter von den Nachwehen des Fiebers und seelisch sehr reizbar.
Alles ging ihm damals quer. Da war ein dringender Brief vom Gouverneur angelangt, eben wegen dieses Abdul Hazim. Er hatte alles andere nötig als ein Palaver zwischen seinen Haußas selbst, und gerade da mußte es zu einer Prügelei zwischen diesen kampflustigen schwarzen Landsknechten kommen, und um das Maß vollzumachen, war der Haußaoffizier zwei Stunden später mit einer Fiebertemperatur von 104,6 zu Bett gegangen.
»Bringt die Schweine hierher!« drückte Sanders sich diesmal wenig gewählt aus, als der Haußasergeant über die Prügelei berichtete. Da wurde der fremde Mann vor ihn gebracht und ein kampflustiger Soldat Namens Kano.
»Herr,« sagte der Haußa, »bei meinem Gott, der mächtiger ist als die meisten Götter, wenn ich so sagen darf, ich verdiene keinen Tadel. Dieser ungläubige Hund wollte mir nicht antworten, als ich ihn ansprach. Dann faßte er auch mein Fleischstück mit seinen Händen an. Da schlug ich ihn.«
»Ist das alles?« fragte Sanders.
»Das ist alles, Herr.«
»Und weiter tat der Fremde nichts, als in seiner Unwissenheit dein Fleisch zu berühren und zu schweigen, als du zu ihm sprachst?«
»Weiter nichts, Herr.«
Sanders lehnte sich in seinem Richterstuhl zurück und maß den Haußa mit finsterem Blick. »Wenn sich mir irgend etwas augenscheinlicher als anderes aufdrängt,« sagte Sanders langsam, »dann ist es das, daß ein Haußa eine mächtige Person ist, ein Lord, ein König. Nun sitze ich hier, um Recht zu sprechen und weder Könige wie dich oder Sklaven wie diesen schweigenden Fremden zu berücksichtigen. Und ich richte nach dem Gesetzbuch, indem ich keinerlei Unterschied zwischen den Parteien mache. Stimmt das?«
»Herr, das ist so.«
»Nun scheint es mir, daß es gegen das Gesetz ist, seine Hand gegen irgendeinen Mann zu erheben, mag er dich noch soviel beleidigen. Der einzig richtige Weg ist der, daß du dich, den Dienstvorschriften entsprechend, beschwerst. Ist das richtig?«
»Es ist richtig, Herr.«
»Deshalb hast du das Gesetz übertreten. Ist das wahr?«
»Es ist wahr, Herr.«
»Nun geh zurück zu deinen Kameraden, gib diese Wahrheit zu und laß den Ungläubigen in Frieden. Denn beim nächsten Male gibt es für den, der das Gesetz übertritt, eine Verletzung seines Fells. Das Palaver ist aus.«
Der Haußa zog sich zurück.
»Und«, sagte Sanders, als er am nächsten Morgen mit dem vom Fieber auferstandenen Haußaoffizier darüber sprach, »ich meine, daß ich mehr als gewöhnliche Selbstbeherrschung bewies, als ich die beiden nicht mit Fußtritten zum Teufel jagte.«
»Sie sind ein großer Geist«, sagte der Haußaoffizier. »Wenn Sie sich nicht sehr in acht nehmen, wird man Ihnen demnächst den Kolonialadel bescheren.«
Sanders überging des Haußas spöttische Anspielung auf die Ritterschaft des Ordens von St. Michael und St. Georg mit Schweigen. Überdies, Ordensauszeichnungen waren nicht sehr wahrscheinlich, solange ein Abdul Hazim noch frei herumlief.
Sanders befand sich in einem ungemütlichen Gemütszustand, als Arachi hastig, in einem geborgten, von vier Paddlern geruderten Kanu, ankam; die vier Paddler hatte er bei einem Isisidorf gegen ein Zahlungsversprechen gemietet, das zu erfüllen er wohl niemals in die Lage kam.
»Herr,« begann Arachi feierlich, »ich komme mit dem Wunsche, Eurer Lordschaft Zu dienen, denn ich bin für meine Dorfschaft ein viel zu bedeutender Mann. Und wenn ich auch nicht Häuptling bin, so habe ich doch eines Häuptlings Gedanken.«
»Und eines Häuptlings Haus,« sagte Sanders trocken, »wenn alles, was man mir darüber berichtet, wahr ist.«
Arachi fuhr zusammen. »Herr,« sagte er demütig, »du kennst alle Dinge, und deine Augen schweifen umher wie die Zunge eines Chamäleons; sie sehen um die Ecke.«
Sanders überging das unschöne Bild, das Arachi andeutete. »Arachi, du kommst in einem Augenblicke, in dem du mir von Nutzen sein kannst. Da ist in meinem Lager ein fremder Mann aus einem weit entfernten Lande. Der ist in diesem Lande unbekannt, und doch möchte er es durchqueren. Da du Angola sprichst, sollst du ihn in deinem Kanu bis an die französische Grenze und dort auf seinen Weg bringen. Zu diesem Zwecke will ich deine vier Kanupaddler bezahlen, und was dich selbst anbelangt, werde ich mich deiner erinnern, wenn du es einmal nötig hast.«
Das war eigentlich nicht das, was Arachi erstrebt hatte, aber es war immerhin schon etwas.
Ehe er ging, gab Sanders ihm noch einen Rat. »Fahre auf dem Kleinen Kusufluß, Arachi!«
»Herr,« erwiderte Arachi, »auf den Stillen Wassern ist es kürzer. Diese führen nach dem französischen Gebiet und besitzen die nötige Tiefe.«
»Der eine Weg ist kurz und der andere lang«, gab Sanders grimmig zurück. »Denn da sitzt ein gewisser Abdul Hazim. Der ist ein großer Sklavenaufkäufer, und da die Angolaleute gute Gartenarbeiter sind, hat's dieser Araber auf sie abgesehen. Ziehe in Frieden!«
Arachi ging.
Es war schier persönliches Pech, daß er auf dieser Reise zwei seiner Hauptgläubiger treffen sollte. Da diese eine Forderung wegen nicht bezahlter Lebensmittel an ihn hatten, wollten sie gegen ihn vorgehen und ihm zu Leibe, aber auf seine dringlichen Vorstellungen hin vertagten sie diesmal noch die Ausführung ihrer ernsten Drohungen.
»Es scheint,« sagte der eine von ihnen, »daß du jetzt bei Sandi in Gunst stehst. Dir selbst glauben wir kein Wort von dem, was du uns gesagt hast, aber deine Paddler lügen nicht.«
»Ebensowenig dieser Schweigsame«, gab Arachi zurück, indem er auf seinen Schutzbefohlenen deutete. »Und da ich allein mich mit diesem verständigen kann, hat Sanders mich mit einer Mission an gewisse Könige betraut. Diese werden mir Geschenke geben, und bei meiner Rückkehr werde ich euch bezahlen, was ich euch schuldig bin und noch etwas darüber, aus Dankbarkeit.«
Sie ließen ihn unbehelligt weiterreisen.
Es darf hier nicht verschwiegen werden, daß Arachi, der niemand etwas lieh und niemand etwas glaubte, kein Vertrauen in das setzte, was Sanders ihm gesagt hatte. Wer der schweigsame Angola war, welches dessen Aufgabe war, warum gerade er, Arachi, zu dessen Hüter bestellt war, erriet Arachi nicht.
Er hätte leicht alles verstehen können, wenn er alles geglaubt hätte, was Sanders ihm mitgeteilt hatte. Aber das war nicht Arachis Art.
Als sie eines Nachts das Kanu auf eine kleine Insel hinaufgezogen hatten, und die Paddler dabei waren, des edlen Arachis Essen zu bereiten, fragte das Pumpgenie den Fremden: »Wie kommt es eigentlich, Fremder, daß mein Freund und Nachbar Sandi mich um die Gefälligkeit bittet, dich bis zur französischen Grenze zu bringen?«
»Herr,« antwortete der Angola, »ich bin ein Fremder und will der Sklaverei entgehen. Außerdem gibt es da einen kleinen Angola-Balulustamm, der zu meinem Volke und zu meinem Glauben gehört, und der nahe bei den französischen Stämmen sitzt.«
»Wessen Glaubens bist du denn?« fragte Arachi.
»Ich glaube an Teufel und Ju-Ju-Zauber«, antwortete der Angola einfach. »Besonders an einen namens Billimi, der zehn Augen hat und Schlangen aufpießt. Außerdem gehört es zu meinem Glauben, die Araber zu hassen.«
Das machte Arachi nachdenklich und gab ihm Anlaß, sich darüber zu wundern, daß Sanders ihm die Wahrheit gesagt hatte.
»Und was ist's mit diesem Abdul Arabi?« fragte er. »Ich denke, daß Sandi mich angeschwindelt hat, als er mir sagte, der Mann kaufe Sklaven. Denn wenn dem so ist, warum überfällt der Araber dann nicht die Isisis?«
Aber der Angolomann schüttelte den Kopf.
»Das sind Dinge, die für meinen Verstand zu hoch sind. Dennoch weiß ich, daß der Araber die Angolas raubt, weil sie gute Gärtner und sehr erfahren im Pfropfen von Bäumen sind.«
Das war ein erneuter Anlaß für Arachi, um sehr nachdenklich zu werden. Er sah, daß Abdul zum Oberfluß kommen mußte, wenn er die Leute vom Kleineren Akasava haben wollte, die auch tüchtige Gärtner vor dem Herrn waren. Er würde keine Isisis nehmen, denn diese waren als Faulenzer bekannt und starben im Handumdrehen, sobald sie auf einen fremden Boden verpflanzt wurden.
Er setzte seine Reise fort, bis er an den Ort kam, wo er hätte abbiegen müssen, wenn er den kürzesten Weg zum französischen Gebiet nehmen wollte.
Hier verließ er seine Kanuleute und seinen Schutzbefohlenen und fuhr die Stillen Wasser hinauf.
Eine halbe Tagesfahrt brachte ihn in das Lager Abduls. Des Sklavenhändlers heimliche Spione hatten am Ufer gleichen Schritt mit Arachi gehalten, und als Arachi mit seinem Kanu landete, wurde er von Leuten ergriffen, die anscheinend aus dem Boden gewachsen waren. »Führt mich zu eurem Herrn, niedriges Gesindel!« befahl Arachi. »Denn ich bin ein Isisihäuptling und komme wegen eines geheimen Palavers.«
»Wenn du ein Isisi bist, und an deiner Magerkeit und an deiner Prahlerei sehe ich, daß du einer bist, dann wird mein Gebieter Abdul schnell mit dir fertig sein«, sagte ein Häscher.
Abdul Hazim war ein untersetzter und korpulenter Mann und ein Liebhaber bequemen Daseins. Aus diesem Grunde hielt er sein Lager in einer Bereitschaft, die ihm ermöglichte, schnell aufzubrechen, sobald er einen weißen Tropenhelm oder den Tarbusch (Fez) eines Haußas sah. Denn es hätte das Ende seines Glückes bedeutet, wenn Sanders über ihn gekommen wäre.
In diesem Augenblicke saß er auf einem zartgetönten Seidenteppich vor der Tür seines kleinen Zeltes und betrachtete Arachi voll Mißtrauen. Er hörte schweigend zu, während Arachi von sich selbst erzählte.
»Ungläubiger,« antwortete Abdul, als der Mann des ewigen Dalles geendet hatte, »wie kann ich wissen, ob du nicht lügst, oder ob du etwa einer von Sanders' Spionen bist? Ich halte es für das gescheiteste, ich schneide dir die Gurgel ab.«
Arachi erklärte des langen und breiten, warum Abdul Hazim ihm nicht den Hals abschneiden solle.
»Wenn du sagst, dieser Angolamann befinde sich hier in der Nähe, warum soll ich mir ihn nicht ohne Bezahlung nehmen?« fragte der Sklavenhändler.
»Weil dieser Fremde nicht der einzige Mann in diesem Lande ist, weil ich einen großen Einfluß bei Sandi habe, und weil ich sehr beliebt bei den Leuten bin, die mir Vertrauen entgegenbringen. Ich kann noch sehr viele andere Leute zu Ihnen bringen, Herr.«
Arachi kehrte in sein Lager zurück; er schleppte ein kleines Kanu hinter sich her, mit dem ihn der Sklavenhändler versehen hatte.
Arachi weckte den Angolamann aus dem Schlaf.
»Bruder,« sagte er zu diesem, »hier ist ein Kanu und Proviant. Paddle eine Tagereise weit den Lauf der Stillen Wasser entlang und dort erwarte meine Ankunft; denn es treiben sich böse Leute umher, und ich fürchte für deine Sicherheit.«
Der Angolamann, naiv, wie er war, gehorchte.
Eine halbe Tagereise den Fluß aufwärts warteten Abduls Leute auf ihn. Arachi fuhr in derselben Nacht nach seinem Dorfe zurück. In seinem Kanu befand sich ein Vorrat von Zeug, Salz und Messingstangen, die jedes Mannes Herz erfreut hätten. Arachi kam in sein Dorf; er sang ein kleines Lied über sich selbst.
Innerhalb eines Jahres wurde er ein reicher Mann, denn es gab viele Wege, um die Bedürfnisse eines arabischen Sklavenhändlers zu befriedigen, und Abdul bezahlte pünktlich.
Arachi arbeitete stets allein oder benutzte Paddler, die er in irgendeinem versteckten Winkel des Bezirks aufgefunden hatte. Er brachte Abdul viel marktfähige Ware, meistens junge N'Gombiweiber, die furchtsam und leicht einzuschüchtern sind. Und Sanders, der das Land auf der Suche nach dem dicken Mann mit dem Fez durchsuchte, fand ihn nicht.
*
»Abdul, Herr und Gebieter,« sagte Arachi, der den Sklavenhändler eines Nachts im geheimen nahe am Ikusifluß traf, »Sandi und seine Soldaten sind wegen eines Mordpalavers nach Akasava. Nun halte ich's an der Zeit, zu tun, wie du wünschest.«
Sie unterhielten sich über die Aussichten eines Abenteuers, des schwierigsten Abenteuers, das Abdul je geplant hatte.
»Arachi,« sagte Abdul, »ich habe dich zum reichen Manne gemacht. Nun, ich sage dir, ich kann dich reicher machen als irgendein Häuptling in diesem Lande.«
»Ich bin sehr erfreut, das zu hören«, sagte Arachi. »Denn, obwohl ich reich bin, habe ich mir doch viele Dinge geborgt. Und es scheint, ich habe eine so wundervolle Gemütsverfassung, daß ich mir immer mehr borgen muß.«
»Davon habe ich gehört«, gab der Araber zurück. »Denn man erzählt sich von dir, daß du dir selbst den Mond noch borgen würdest, auch wenn du schon die ganze übrige Welt besäßest.«
»Ja, das ist das Geheimnisvolle meines Wesens«, antwortete Arachi bescheiden. »Aus diesem Grunde bin ich ein höchst bemerkenswerter Mann.«
Dann saß er und hörte geduldig dem weitschweifigen Plane Abdul Hazims zu. Denn es handelte sich um ein sehr umfangreiches Unternehmen, in dessen Hintergrunde zweitausend liberianische Dollars lockten, und für Arachi Bezahlung in Waren.
Zur gleichen Zeit wohnte Sanders in der Ochoristadt und hatte ein Palaver mit Bosambo, dem Häuptling.
»Bosambo,« sagte Sanders, »ich habe die oberen Flüsse unter deine Obhut gestellt. Und dennoch macht dieser Abdul Hazim ungestraft das Land unsicher. Das ist eine Schande für mich wie für dich.«
»Herr,« antwortete Bosambo, »es ist eine Schande. Aber der Flüsse hier herum sind so viele, und Abdul ist ein verschlagener Mann und hat Spione in Masse. Meine Leute sind auch bange vor ihm, sie fürchten sich, ihn zu kränken, weil er sie sonst ›fressen‹ oder ins Innere verkaufen würde.«
Sanders nickte und stand auf, um an Bord der »Zaire« zu gehen.
»Bosambo, mein Gouvernement hat einen Preis auf die Gefangennahme Abduls gesetzt, und ein gewisses anderes Gouvernement hat einen Preis auf dich gesetzt.«
»Wie hoch ist der Preis für Abdul, Herr?« fragte Bosambo mit erwachendem Interesse.
»Einhundert Pfund Sterling in Silber«, gab Sanders zurück.
»Herr,« bekannte Bosambo, »das ist ein guter Preis.«
Als zwei Tage darauf Arachi zu Bosambo kam, war dieser Häuptling mit der rein häuslichen Angelegenheit beschäftigt, seinen kleinen Sohn zu warten.
»Gruß dir, Bosambo!« sagte Arachi. »Dir und deinem trefflichen Sohn, der edel in Erscheinung und sehr artig ist.«
»Friede sei mit dir, Arachi! Ich habe nichts an dich zu verborgen.«
»Herr,« antwortete Arachi, »ich bin jetzt reich, reicher als Häuptlinge und – ich will nichts leihen.«
»Ko, Ko!« lachte Bosambo mit höflichem Zweifel.
»Bosambo, ich kam zu dir, weil ich dich gern habe. Und weil du nicht geschwätzig bist, sondern eher klug und verschwiegen.«
»Das alles weiß ich, Arachi«, sagte Bosambo vorsichtig, »und ich wiederhole dir, daß ich niemand etwas leihe.«
Der wütende Arachi erhob seine Augen zum Himmel.
»Herr Bosambo,« antwortete er in verletztem Tone, »ich kam zu dir, um dir von dem zu erzählen, was ich gefunden habe, und um dich zu bitten, mir zu helfen, diesen Schatz in Sicherheit zu bringen. Denn an einer gewissen Stelle bin ich auf ein großes Lager von Elfenbein gestoßen, wie es die alten Könige für die Zeit der Not zu vergraben pflegten.«
»Arachi,« bemerkte Bosambo plötzlich, »du sagst mir, du seist reich. Nun bist du ein kleiner Mann, und ich bin Häuptling, und dennoch bin ich nicht reich.«
»Ich habe viele Freunde«, erwiderte Arachi, zitternd vor Stolz, »und diese geben mir Messingstangen und Salz.«
»Das ist nichts, Arachi. Ich weiß, was Reichtum heißt, denn ich habe zwischen Weißen gelebt. Die lachen über Messingstangen und werfen das Salz den Hunden hin.«
»Herr Bosambo, ich bin auch im Sinne der Weißen ein reicher Mann. Sieh her!«
Arachi nahm aus seiner Tasche eine Handvoll Silbergeld und bot es in beiden Händen Bosambo zur Begutachtung.
Bosambo prüfte das Geld mit einer Art Hochachtung, indem er jede Münze fein säuberlich umwendete.
»Das ist richtiger Reichtum«, bemerkte er, während sein Atem etwas schneller kam und ging, als es sonst bei ihm der Fall war. »Und es ist neues Geld, es ist blank. Auch die Teufelszeichen darauf, die du nicht verstehst, sind so, wie sie sein sollen.«
Befriedigt schob Arachi sein Geld wieder in die Tasche. Bosambo saß in nachdenklichem Schweigen, sein Gesicht war unbewegt.
»Und du willst mich zu dem Platz bringen, Arachi?« fragte er zögernd. »Ko! Du bist ein großmütiger Mann, denn ich verstehe nicht, warum du mit mir teilen willst, da ich dich doch einmal verhauen habe.«
Bosambo setzte sein Kind vorsichtig nieder. Diese »Königsschätze« existierten der Überlieferung nach. Viele waren gefunden worden, und es war der Traum jedes normal veranlagten Eingeborenen, solche Schätze zu heben. Trotzdem hielt Bosambo nicht viel davon, denn im Innern war er voller Zweifel.
»Arachi, ich glaube, daß du lügst. Dennoch möchte ich die Stelle wissen, und, wenn sie in der Nähe ist, möchte ich den Schatz mit meinen eigenen Augen sehen.«
Nach Arachis Angaben sollte die Fundstelle eine Tagereise entfernt sein.
»Bezeichne mir die Stelle, Arachi!«
»Herr, wie kann ich wissen, ob du nicht hingehst und dir den Schatz für dich selber nimmst?«
Bosambo sah ihn ernst an.
»Bin ich nicht ein ehrlicher Mann? Und schwören die Leute von einem Ende der Welt zum anderen nicht bei dem Namen Bosambo?«
»Nein!« antwortete Arachi, der Wahrheit entsprechend.
Dennoch bezeichnete er schließlich den Platz. Am Fluß der Schatten, nahe beim Krokodil-Pool, wo die Fluten das Land verändert hatten.
Bosambo ging in seine Hütte, um Reisevorbereitungen zu treffen. Hinter seinem Hause, in einem großen Mattenkäfig, befanden sich viele kleine Tauben. Mühsam schrieb Bosambo in seinem schlechten Arabisch eine kurze Botschaft.
Um auf jeden Fall sicher zu gehen, denn Bosambo überließ nichts dem Zufall, sandte er im geheimen in der Nacht ein Kanu an einen gewissen Bestimmungsort.
»Und richte folgendes an Sandi aus!« befahl er seinem vertrauten Boten. »Arachi ist im Besitz vielen Silbergeldes. Und dieses Silbergeld trägt die Teufelsmarken (Prägung) von Zanzibar, wo alle arabischen Händler herkommen, wie er wüßte.«
Am nächsten Tage fuhren Bosambo und sein Führer ab. Sie paddelten den ganzen Tag über und nahmen den Weg auf einem kleineren Fluß; und nachts lagerten sie an einem Platze, der Balulu, das veränderte Land, hieß. Sie standen bei Tagesanbruch auf, um ihre Reise fortzusetzen. Aber das war überflüssig, denn in der Dunkelstunde vor der Dämmerung hatte Abdul Hazim ihr kleines Lager umringt, und der überzeugenden Mündung einer Sniderbüchse gegenüber begleitete Bosambo seine Häscher auf einem zehn Minuten langen Gange in das Gebüsch, wo Abdul ihn erwartete.
Der Sklavenhändler saß auf seinem Seidenteppich vor der Tür seines Zeltes und begrüßte seinen Gefangenen im Ochoridialekt. Bosambo antwortete auf arabisch.
»He, Bosambo! Kennst du mich?«
»Scheik, ich wüßte dich gern in der Hölle. Denn du bist der Mann, dessen Kopf mein Herr haben will.«
»Bosambo!« antwortete Abdul gelassen, »dein Kopf ist wertvoller, wie man sagt, denn die Liberianer wollen ihn auf einen Pfahl stecken und werden mich reichlich für mein Unternehmen bezahlen.«
Bosambo lachte leise. »Schluß mit dem Palaver. Ich bin bereit, zu gehen.«
Man brachte ihn wieder zum Fluß, band seinen Körper der Länge lang an einen Pfahl und legte ihn auf den Boden des Kanus. Arachi bewachte ihn.
Bosambo sah auf und bemerkte das Allerweltspumpgenie, wie dieses am Boden hockte und ihn bewachte.
»Arachi, wenn du meine Hände losmachst, will ich sanft mit dir umspringen.«
»Wenn ich deine Hände losmache,« sagte Arachi freimütig, »bin ich ein Narr und ein toter Mann zugleich. Und beides erscheint mir nicht wünschenswert.«
»Für jeden«, zitierte Bosambo, »kommt einmal ein glücklicher Zufall; wenn er ihn unbenutzt läßt, wird ihm alles andere schwer.«
Vier große Kanus bildeten eine Wasserkarawane. Abdul befand sich mit seinen Bewaffneten im größten Kanu und führte die Vorhut. Sie glitten schnell den winzigen Fluß abwärts, der breiter wurde, je mehr er sich dem Strom näherte.
Plötzlich rang Abduls Vormann nach Atem. »Sieh!« flüsterte er.
Der Sklavenhändler wandte sich um.
Hinter ihnen, langsam daherpaddelnd, kamen vier Kanus, und jedes voll von Bewaffneten.
»Schnell!« befahl Abdul, und die Paddler machten rasende Fahrt mit den Paddeln. Dann hielten sie inne.
Vor ihnen tauchte die »Zaire« auf; ein schmucker, weißer Dampfer, das Deck voll von Haußas.
»Es ist Gottes Wille«, sagte Abdul. »Diese Dinge sind vorherbestimmt.«
Er sagte nichts mehr, bis er vor Sanders stand, und der Bezirksamtmann war alles andere als mitteilsam.
»Was wirst du mit mir anfangen?« fragte Abdul.
»Das will ich dir sagen, sobald ich deine Vorräte gesehen habe. Wenn ich Hinterlader bei dir finde, solche, wie sie diese blödsinnigen Lobololeute kaufen, werde ich dich, dem Gesetz entsprechend, hängen.«
Der Araber sah zu dem zitternden Arachi hin. Die Knie des Pumpgenies schlugen einen förmlichen Triller.
»Ich verstehe,« bemerkte Abdul nachdenklich, »daß mich dieser Mann, den ich reich gemacht habe, betrogen hat.«
Wenn Abdul hastig gewesen wäre, oder sich ruckweise bewegt hätte, würde Sanders diese Tat verhindert haben. Aber der Araber griff inzwischen gelassen in die Falten seines Burnusses, als ob er eine Zigarette suche. Dann schnellte seine Hand heraus und mit ihr ein krummes Messer. Schnell stieß er damit zu, und Arachi sank winselnd auf das Deck nieder, ein sterbender Mann.
»Du Borger,« sagte der Araber – er sprach aus der Mitte von sechs Haußas heraus, die ihn fesselten, so daß er dem Blicke der auf Deck stöhnenden Gestalt entzogen war –, »ich denke, du hast das geborgt, was du schließlich doch selbst bezahlen kannst. Denn es steht geschrieben in der Sure vom Djinn, das Leben dessen, der Leben nimmt, soll wieder genommen werden, auf daß er volle Zurückzahlung leistet.«
II. Die Steuerbeitreibung.
Sanders hielt nichts für verbürgt, wenn es sich um eingeborene Völkerschaften handelte. Diese Stämme unter seiner Herrschaft besaßen eine unbegrenzte Fähigkeit, das Unerwartetste zu tun – darin lag zugleich das Gefährliche und der Reiz. Denn man konnte weder über ihre Sünde verzweifeln noch zu zuversichtlich stolz auf ihre Tugenden werden, wenn man sich vorstellte, daß die Sonne, die über der Bosheit des einen und der taubengleichen Sanftmut des anderen unterging, aufgehen mochte über den rauchenden Opferfeuern in den Straßen eines gesegneten Dorfes, um ein unverbesserliches Volk zu beleuchten, das, Staub auf den Häuptern und die Hände in Qualen von Reue ringend, vor seinen Hütten saß.





























