
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Igel Records
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Was damals tatsächlich im Wald geschah … Vor fünf Jahren, mit gerade einmal 13, ermordeten Mia und Brynn ihre beste Freundin Summer. Zumindest dachten das alle, weil die Mädchen die Tat detailliert in einer Fan-Fiction zu ihrem Lieblingsbuch aufgeschrieben hatten. In Wirklichkeit war jedoch alles ganz anders: Mia und Brynn wurden fälschlicherweise verdächtigt und haben seit damals keinen Kontakt mehr. Doch jetzt zwingt ein erstaunlicher Fund sie dazu, gemeinsam der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Denn wie die Mädchen herausfinden, hatte Summer ein dunkles Geheimnis, und der wahre Täter ist weiterhin auf freiem Fuß …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Was ist damals wirklich im Wald geschehen?
Vor fünf Jahren, mit gerade einmal 13 Jahren, ermordeten Mia und Brynn ihre beste Freundin Summer.
Warum alle wussten, dass sie schuldig waren? Sie hatten ihre Tat detailliert in einer Fan-Fiktion aufgeschrieben.
Die Wahrheit über jenen Tag ist jedoch eine ganz andere. Ein neuer Hinweis wirft Fragen über Summer auf und zwingt Mia und Brynn dazu, gemeinsam herauszufinden, was damals wirklich geschehen ist. Denn die beiden sind unschuldig und der wahre Täter ist weiterhin auf freiem Fuß …
Ein atemloser Thriller über zerstörte Unschuld und unmögliche Freundschaften von Bestsellerautorin Lauren Oliver
Für MRKDanke für die Geschichten
Bevor wir die Monster aus der Brickhouse Lane wurden –
bevor jeder von Connecticut bis Kalifornien uns unter
dieser Bezeichnung kannte, Blogs Porträtfotos von uns
veröffentlichten und die Suche nach unseren Namen
auf Webseiten führte, die unter dem Ansturm
zusammenbrachen –, waren wir einfach bloß Mädchen,
und es gab nur uns zwei.
BRYNN
Jetzt
Vor fünf Jahren, kurz nach meinem dreizehnten Geburtstag, ermordete ich meine beste Freundin.
Ich lief ihr nach und schlug ihr mit einem Felsbrocken den Schädel ein. Dann zerrte ich sie aus dem Wald auf eine Wiese und legte sie in einem Steinkreis ab, den ich vorher mit meiner anderen Freundin Mia dort aufgebaut hatte. Anschließend stachen wir ihr mit einem Messer zweimal in den Hals und fünfmal in die Brust. Mia wollte die Leiche noch mit Benzin übergießen und anzünden, aber dann ging etwas schief und wir hauten ab.
Alle wussten, dass wir schuldig waren, weil wir die Tat in einer Fan-Fiction-Fortsetzung des Buches Der Weg nach Lovelorn, von dem wir besessen waren, mehr oder weniger genau so beschrieben hatten.
Anschließend trennten wir uns. Mia ging nach Hause und verbrachte den Abend besinnungslos vor dem Fernseher, ohne sich auch nur die Mühe zu machen, ihre von Benzin durchtränkten Jeansshorts zu waschen. Ich selbst war vorsichtiger und setzte eine Maschine Wäsche in Gang – wozu ich schnurstracks in den örtlichen Waschsalon ging, weil wir zu Hause keine Waschmaschine hatten. Trotzdem konnte die Polizei Blutspuren auf meinem T-Shirt nachweisen, zwar nicht von Summer, aber ein wenig Tierblut, da wir das Messerritual vorher an einem Kater ausprobiert hatten, der ebenfalls auf der Wiese gefunden wurde.
Owen Waldmann, damals so etwas wie Summers Freund, verschwand nach dem Mord. Erst vierundzwanzig Stunden später kehrte er zurück und beteuerte, nichts über die Sache zu wissen. Wo er gewesen war, behielt er für sich.
Ganz offensichtlich log er. Er war derjenige, der die ganze Sache geplant hatte. Er war eifersüchtig, weil Summer auch mit älteren Jungs Zeit verbrachte, zum Beispiel mit Jake Ginsky aus der Footballmannschaft der Highschool. In jenem Jahr war Summer langsam erwachsen geworden, hatte die Regeln geändert und uns zurückgelassen.
Vielleicht waren wir alle ein wenig neidisch auf sie.
Als Summer versuchte zu fliehen, riss ich sie zu Boden, schlug ihr mit einem Stein auf den Kopf und zerrte sie zu Mia zurück, wo wir beide abwechselnd auf sie einstachen. Owen hatte den Benzinkanister mitgebracht und war zu blöd, ihn wegzuwerfen, nachdem wir ihn fast ganz geleert hatten. Man fand den Kanister später direkt vor Owens Garage, hinter dem Rasenmäher seines Vaters.
Owen, Mia und ich, Brynn.
Die Monster aus der Brickhouse Lane.
Die Kindermörder.
Das ist zumindest die Geschichte, die alle erzählen. Eine Geschichte, die schon so oft wiederholt und von so vielen Leuten geglaubt wurde, dass sie wahr geworden ist. Obwohl das Verfahren gegen Mia und mich über die Beweisaufnahme am Familiengericht nie hinausging. Sosehr sie es auch versuchte, bekam die Polizei die Fakten nicht unter einen Hut. Und die Hälfte der Dinge, die wir ihnen erzählten, konnte dann später vor Gericht nicht verwendet werden, weil man uns noch nicht mal über unsere Rechte aufgeklärt hatte. Obwohl Owen in einem Strafverfahren freigesprochen wurde, nicht schuldig, gehe über Los.
Und obwohl wir es nicht getan haben.
In Büchern betritt man geheime Welten in der Regel durch Türen oder mithilfe von Schlüsseln und anderen greifbaren Gegenständen. Lovelorn dagegen war keine solche Welt, sondern tauchte ganz unvermittelt auf – und nur, wenn es wollte –, mit einer kaum wahrnehmbaren Veränderung wie dem langsamen Übergang zwischen Nachmittag und Abend.
Und so kam es, dass den drei besten Freundinnen Audrey, Ashleigh und Ava eines Tages heiß und langweilig war, weshalb sie beschlossen, den Wald hinter Avas Haus zu erforschen, obwohl es dort in Wirklichkeit wenig zu erforschen gab, was sie nicht schon kannten.
Als sie jedoch an jenem Tag den Wald betraten, geschah etwas Sonderbares.
Aus: Der Weg nach Lovelornvon Georgia C. Wells, 1963
BRYNN
Jetzt
»Deine Werte sind gut.« Paulie beugt sich über meine Akte und reibt sich die Nase. Direkt über ihrem rechten Nasenloch wächst ein dicker Pickel. »Der Blutdruck ist prima, deine Leber sieht gut aus. Normale Herzfrequenz. Ich würde sagen, du bist in guter Verfassung.«
»Danke«, entgegne ich.
»Aber das Wichtigste ist, wie du dich fühlst.«
Als sie sich zurücklehnt, spannt ihre Bluse an den Knöpfen. Arme Paulie. Die Heimleiterin des Four Corners guckt immer so benommen, als hätte sie gerade einen leichten Auffahrunfall gehabt. Und sie hat einfach keine Ahnung von Mode. Sie sieht aus, als würde sie Kleidung für den Körper einer anderen kaufen – zu enge Lycrablusen oder zu große Röcke und Männerschuhe. Vielleicht containert sie ihre gesamte Garderobe.
Das hat Summer früher immer gemacht: Sie holte sich ihre Klamotten in großen Mengen von der Heilsarmee oder klaute sie einfach. Aber sie machte was daraus und an ihr sah alles gut aus. Sie kombinierte zum Beispiel ein altes XL-Shirt irgendeiner Band mit einer Fahrradkette als Gürtel und alten Chucks und schon hatte sie ein cooles Kleid. Müllmode nannte sie diesen Stil.
Sie hatte vor, mit sechzehn nach New York zu ziehen, um Model zu werden und später ihr eigenes Modelabel zu gründen. Sie würde eine berühmte Schauspielerin werden und ihre Memoiren schreiben.
Sie hatte so große Pläne.
»Ich fühle mich gut«, sage ich. »Stark.«
Paulie rückt ihre Brille gerade, ein nervöser Tick. »Sechs Therapien seit der achten Klasse. Ich würde gern glauben, dass du bereit für eine Veränderung bist.«
»Four Corners ist anders.« Ich weiche der Frage aus, von der ich weiß, dass sie sie gerne stellen würde. Von all den Therapiezentren, in denen ich war, plus den Entzugskliniken, den Einrichtungen für drogenfreies Leben und den Wohngruppen, ist Four Corners das angenehmste. Ich habe ein Einzelzimmer, das sogar größer ist als mein Zimmer zu Hause. Es gibt ein Schwimmbad und eine Sauna. Auf einem Stück verunkrautetem Rasen ist ein Volleyballplatz und im Medienraum gibt es einen Flachbildfernseher. Sogar das Essen ist gut – mit Salatbüfett, Smoothies und einer Cappuccinomaschine (allerdings nur koffeinfrei; in Four Corners ist Koffein tabu). Wenn die ganzen Therapiestunden nicht wären, wäre es wie ein nettes Hotel.
So stelle ich es mir zumindest vor. Ich war noch nie in einem Hotel.
»Das freut mich zu hören.« Paulies Fischaugen blicken groß und aufrichtig hinter der Brille hervor. »Ich will nicht, dass du in einem halben Jahr wieder hier landest.«
»Das wird nicht passieren«, sage ich, was in gewisser Weise auch stimmt. Ich werde nicht wieder in Four Corners landen. Ich gehe gar nicht erst weg.
Die Therapie gefällt mir. Ich mag das ganze Drum und Dran, die sauberen Zimmer und die Therapeuten mit den identischen Poloshirts und den identisch hilfsbereiten Mienen wie gut dressierte Hunde. Ich mag die Mottos auf Tonpapier, die überall hängen: Lass los, sonst wirst du mitgerissen; Leben und leben lassen; Gott sei Dank, du bist nicht krank. Das Leben in mundgerechten Häppchen. Miniaturweisheiten im Snickersformat.
Ich habe festgestellt, dass es nach einem ersten Entzug einfach ist, auf Therapietour zu gehen. Man muss bloß dafür sorgen, dass sie kurz vor der Entlassung bei der Urinprobe etwas finden. Dann werden Betreuer einberufen, Krankenversicherungen, Sozialarbeiterinnen und Verwandte kontaktiert und kurz darauf bekommt man eine Verlängerung. Sogar jetzt, da ich achtzehn bin und streng genommen auf eigene Verantwortung gehen kann, wird das nicht schwierig werden: Es ist erstaunlich, wie schnell sich die Leute zusammenschließen, wenn ihre Patientin unter Verdacht steht, noch vor ihrer ersten Regelblutung jemanden umgebracht zu haben.
Ich lüge nicht gern, erst recht nicht gegenüber Leuten wie Paulie. Aber ich halte mich an eine einfache und auf das Wesentliche beschränkte Geschichte – Alk und Tabletten, Schmerzmittel, die ich meiner Mutter geklaut habe –, und abgesehen vom konkreten »Ich bin süchtig«-Teil muss ich gar nicht viel dazuerfinden.
Als ich das letzte Mal zu Hause war, hat meine Mutter wirklich starke Schmerztabletten genommen, nachdem irgendein Idiot ihr mit seinem SUV hinten reingefahren war, als sie von der Spätschicht im Krankenhaus nach Hause kam, und sie zwei gebrochene Wirbel hatte.
Ich habe Albträume, Panikattacken. Mitten in der Nacht wache ich auf und glaube immer noch, nach so vielen Jahren, das helle Leuchten eines Blitzlichts vor meinem Fenster zu sehen. Manchmal höre ich eine gezischte Beleidigung, eine Stimme, die Psycho, Teufel, Mörderin flüstert. Manchmal sehe ich auch Summer, die schöne Summer mit ihren langen blonden Haaren, inmitten eines Steinkreises auf dem Boden liegen, das Gesicht angstverzerrt – oder vielleicht auch friedlich lächelnd, weil die Geschichte, an der sie so lange geschrieben hat, endlich wahr geworden ist.
Das ist etwas, worüber ich hier nicht spreche, egal wie oft Trish oder Paulie oder irgendeine der anderen Therapeutinnen mich drängen. Ich spreche nicht über Mia, Summer, Owen oder Lovelorn und darüber, was dort geschehen ist, wie wir daran geglaubt haben, wie es real wurde.
In der Therapie kann ich sein, wer ich will. Und das heißt, dass ich endlich kein Monster mehr sein muss.
Lovelorn hatte sein eigenes Wetter, genau wie seine eigene Zeit. Manchmal betraten die Mädchen Lovelorn mittags und stellten fest, dass in der Stille des Taralinwaldes überall Rosa und Purpur vorherrschten, dass die Schatten lang waren, die Grillen zirpten und die Sonne bereits den Horizont küsste. Genauso oft geschah es, dass es in der Welt kalt und regnerisch war, in Lovelorn jedoch die Sonne vom Himmel strahlte und es von Sommerbienen und fetten Mücken nur so wimmelte. Jedes Mal ließ mindestens eins der Mädchen einen Pullover, Schal oder Hut auf der anderen Seite zurück, wofür es später getadelt wurde.
Aus: Der Weg nach Lovelornvon Georgia C. Wells
MIA
Jetzt
»Muffelnde Muttergottes.« Meine beste Freundin Abby hält ein schimmeliges Stück Stoff zwischen zwei weiß behandschuhten Fingern hoch. »Was ist das?«
Was immer es früher mal gewesen ist – eine Jacke? Eine Decke? Ein Läufer? –, jetzt ist es schwarz, steif von über die Jahre angesammelten und eingetrockneten Flecken, dazu voller Löcher, wo es von einer ganzen Prozession Insekten angeknabbert wurde. Und es stinkt. Obwohl ich ein Stück weg stehe und mich riesige Berge aus Büchern und Zeitungen, Lampen und alten Klimaanlagen sowie Kartons mit Hunderten verschiedener, nie genutzter, nie ausgepackter Waren der Art, die man um Mitternacht per Teleshopping kauft – Mixer, Allzweckmesser, Kuscheldecken mit Ärmeln und sogar ein Bistro-Ofen mit Drehspieß –, von Abby trennen, treten mir von dem Gestank Tränen in die Augen.
»Frag nicht«, sage ich. »Schmeiß es einfach weg.«
Sie schüttelt den Kopf. »Hat deine Mutter hier drin eine Leiche versteckt oder so?« Als ihr bewusst wird, was sie gesagt hat, stopft sie das Teil schnell in einen Müllsack. »Tut mir leid.«
»Schon okay.« Das ist eins der Dinge, die ich an Abby mag: Sie vergisst. Sie hat nicht dauernd im Kopf, dass ich mit zwölf beschuldigt wurde, meine beste Freundin ermordet zu haben. Dass, wenn man bei Google Mia Ferguson eingibt, als erstes Suchergebnis ein beliebter Erziehungsblog mit einem Artikel unter der Überschrift »Wie aus Kindern Monster werden – wer ist schuld daran?« auftaucht.
Das liegt zum Teil daran, dass Abby erst vor zwei Jahren hergezogen ist. Sie hatte natürlich von dem Mord gehört – alle haben davon gehört –, aber aus zweiter Hand ist das etwas anderes. Für Leute außerhalb unserer Stadt war Summers Tod eine Tragödie und die Tatsache, dass drei Jugendliche die Hauptverdächtigen waren (okay, die einzigen Verdächtigen), ein unvorstellbares Grauen.
Aber in Twin Lakes war es etwas Persönliches. Selbst fünf Jahre später kann ich nicht durch die Stadt gehen, ohne dass mich alle anstarren oder furchtbare Dinge flüstern. Vor ein paar Jahren kam mal vor dem Knit Kit eine Frau auf mich zu. Ich sah mir gerade die Körbe voller flauschig bunter Wolle an und das Schild mit der Aufschrift Make Socks, Not War im Schaufenster. Sie hatte die Lippen geschürzt, als wollte sie mich küssen – und spuckte mir ins Gesicht.
Selbst meine Mutter wird beschimpft, wenn sie einkaufen geht oder Wäsche wegbringt oder zur Post muss. Vermutlich werfen ihr alle vor, ein Monster großgezogen zu haben. Irgendwann wurde es einfach leichter, zu Hause zu bleiben. Glücklicherweise – oder vielleicht auch unglücklicherweise – hat sie ihre eigene Onlinemarketingfirma. Da sie alles von Klopapier über Socken bis hin zu Milch im Internet bestellen kann, geht sie manchmal ein halbes Jahr nicht vor die Tür. Als sie vor ein paar Tagen verkündete, sie würde ihre Schwester besuchen, bekam ich beinahe einen Herzinfarkt. Es ist das erste Mal seit dem Mord, dass sie das Haus länger als eine Stunde verlassen hat.
Andererseits blieb ihr auch nicht viel anderes übrig. Nachdem sich die »Sammlungen« meiner Mutter immer weiter ausbreiteten, erst auf die Veranda hinterm Haus, dann auf die vorm Haus und schließlich bis hinaus in den Garten, zettelten unsere Nachbarn eine Kampagne an, um Mom und mich rauswerfen zu lassen. Offenbar verseucht bereits unsere Anwesenheit die gesamte Nachbarschaft und ist ganz allein dafür verantwortlich, dass die übrigen Anwohner niemals ihre Häuser verkaufen können. Die Stadt hat zwar davon abgesehen, uns zu verklagen, droht aber mit Bußgeldern für alle möglichen Umweltsünden, wenn wir nicht innerhalb von zwei Wochen aufgeräumt haben. Also ist meine Mutter zu meiner Tante gezogen, damit sie nicht im Weg steht und bei jeder gebrauchten Serviette, die ich wegzuwerfen versuche, zu schluchzen anfängt, und ich habe mich darangemacht, den Müll zu sortieren, der sich im Laufe von fünf Jahren angesammelt hat.
»Hier, guck mal, Mia.« Abby holt einen Stapel zerfetzter Zeitungen unter einer kaputten Stehlampe hervor. »Jetzt wissen wir, was« – sie blinzelt – »2014 gerade aktuell war.«
Ich hebe einen Karton vom Boden auf und verspüre eine kleine Welle der Befriedigung, als ein Stück Teppich sichtbar wird. Ich lese vor, was auf der Seite des Kartons steht: »Mit dem Allesschneider Slice & Dice wird das Kochen zum Kinderspiel!«
»Vielleicht solltest du den verkaufen. Er ist doch noch originalverpackt, oder?« Abby rappelt sich mühsam auf und stützt sich dabei an einem Fernsehmöbel ab. Abby ist dick und wunderschön. Sie hat helle Augen und dunkles Haar, die Art Lippen, bei denen man sofort ans Küssen denken muss, und eine ganz gerade, nur leicht nach oben weisende Nase.
Mit zehn eröffnete sie einen YouTube-Kanal zum Thema Mode und Schönheit. Mit fünfzehn hatte sie zwei Millionen Abonnenten, bekannte Marken als Sponsoren und ein Einkommen, das es ihrer Familie erlaubte, Garrison, Iowa, zu verlassen und nach Vermont zu ihren Großeltern zu ziehen.
Abby fährt zu so vielen Beautycons, Vidcons und Fashion Weeks, dass sie zu Hause unterrichtet wird.
So haben wir uns kennengelernt, und wenn Abby nicht gerade unterwegs ist, hören wir fünfmal die Woche vier Stunden am Tag Ms Pinner zu, die uns mit monotoner Stimme alles von der Erzähltechnik in Fiesta bis hin zu kovalenten Bindungen erklärt. Wir treffen uns drei Straßen weiter bei Abby aus dem offensichtlichen Grund, dass es bei mir zu Hause keinen Platz zum Sitzen gibt. Es gibt kaum Platz zum Atmen.
Dafür haben die Stapel gesorgt. Sie sind gnadenlos. Sie pflanzen sich fort. Sie vermehren sich über Nacht.
»Klar«, sage ich. »Wenn du dein Gemüse mit einer Schicht schwarzem Schimmel magst.« Ich klemme mir den Karton unter den Arm und bahne mir einen Weg zur Haustür, wobei ich mich an den Pfad halte, der sorgfältig zwischen den Stapeln hindurchgegraben wurde, eine endlose Schlucht aus Gegenständen – auseinandergefaltete und mit Kordel verschnürte Kartons, Rollen über Rollen abgelaufener Rabattmarken, Paketband und rostige Scheren, alte Turnschuhe, Fahrradschläuche ohne Luft und kaputte Lampen –, lauter Dinge, die meine Mutter aus unerfindlichen Gründen unbedingt behalten will.
Der Himmel draußen hat eine eigenartige Farbe. Die Wolken sind von einem seekranken Grün. Es sind ein paar üble Sturmtage vorhergesagt – vielleicht sogar ein Tornado, obwohl das kein Mensch glaubt. Hier in Vermont gibt es keine Tornados, zumindest nicht sehr oft, und in den meisten Fällen, in denen die Nachrichten einen ankündigen, geht es ihnen nur darum, höhere Einschaltquoten zu erzielen.
Ich wuchte den Karton in den Müllcontainer, der in unserer Einfahrt steht. Es ist so ein großer, industrieller, wie sie auch bei Hausrenovierungen und für Bauschutt verwendet werden, und nach nur zwei Tagen ist er bereits halb voll.
Im Haus steht Abby mit rotem Gesicht hustend da und hält sich eine Hand vor den Mund.
»Was denn?«, frage ich. »Was ist?«
»Ich weiß nicht.« Sie würgt die Worte mit tränenden Augen hervor. »Ich glaube, es ist eine alte Pizza oder so was.«
»Lass es«, sage ich schnell und versuche die beiden Rotorblätter zu ignorieren, die sich in meinem Magen in Gang gesetzt haben. »Echt jetzt. Der Himmel sieht aus, als würde er sich jeden Moment übergeben.«
»Bist du sicher?« Abby ist es offenbar peinlich, dass mir das hier peinlich ist. Wovon ich mich nur noch schlechter fühle, vor allem, weil Abby nicht der Typ ist, dem schnell etwas unangenehm ist. Sie ist der Typ, der keine großen Sweatshirts oder Jogginghosen trägt, um sich möglichst unsichtbar zu machen, sondern Federröcke und gemusterte Strumpfhosen, sich die Haare bunt färbt und dann vier Stunden lang ein Fotoshooting mit ihrem Malteser namens Krümelmonster abhält. »Wir haben noch nicht mal eine kleine Lücke zustande gebracht.«
Das stimmt nicht ganz. Ich kann mehrere leere Stellen auf dem Teppich erkennen. Im Wohnzimmer sind der Fernseher und die Spielkonsole zum Vorschein gekommen. Ich frage mich, ob unser Kabelanschluss noch aktiv ist. »Na und?« Ich zwinge mich zu einem Lächeln. »Dann haben wir morgen umso mehr zu tun. Vielleicht finden wir sogar einen vergrabenen Schatz.«
»Oder Atlantis«, sagt Abby, zieht die Handschuhe aus und lässt sie in eine der offenen Mülltüten fallen. Bevor sie geht, berührt sie mich an der Schulter. »Bist du dir auch wirklich ganz, ganz sicher? Ich finde dich morgen nicht begraben unter einem Berg schmutziger Wäsche und alter Zeitungen?«
Ich lächele wieder gezwungen. Das fürchterliche rotierende Gefühl in meinem Magen ist immer noch da und wirbelt alles durcheinander. Aber Abby will hier raus. Und ich kann es ihr nicht verübeln.
Ich will hier schon raus, solange ich denken kann.
»Geh jetzt«, sage ich und trete zur Seite. »Im Ernst. Bevor dich ein Tornado mitreißt und irgendwo jenseits des Regenbogens wieder ausspuckt.«
Abby verdreht die Augen und klatscht sich auf den Bauch. »Das soll der Tornado mal versuchen.«
»Du bist schön«, rufe ich ihr nach, als sie zur Tür geht.
»Ich weiß«, ruft sie zurück.
Nachdem Abby weg ist, stehe ich noch einen Augenblick da und hole Luft, ohne zu tief einzuatmen. Wir haben alle Fenster aufgemacht – zumindest die, an die wir rangekommen sind –, aber trotzdem stinkt es im Wohnzimmer nach ungewaschenen Polstern, Schimmel und Schlimmerem. Die zerlumpten und fleckigen Vorhänge flattern im Wind. Es ist finster für vier Uhr nachmittags und wird mit jedem Moment dunkler. Aber ich zögere, eine der Deckenlampen anzuknipsen.
Im Dunkeln sehen die Stapel übel aus, klar. Aber beherrschbar. Formlos, konturlos und geheimnisvoll. Als stünde ich mitten in einer eigenartigen außerirdischen Landschaft, einem Ort, an dem ganze Bergketten aus Kartons und Kupfer bestehen, zwischen denen sich Plastikflüsse schlängeln. Bei Licht kann man sich jedoch nichts vormachen.
Meine Mutter ist verrückt. Sie kann sich von nichts trennen. Sie weint, wenn man versucht, sie dazu zu bringen, einen Katalog wegzuwerfen, selbst wenn er sie gar nicht interessiert. Sie behält Streichholzbriefchen und Butterbrottüten, kaputte Harken und leere Blumentöpfe.
Vielleicht wäre das anders, wenn mein Vater uns nicht verlassen hätte. Früher war sie auch nicht ganz normal, aber noch nicht vollkommen durchgeknallt. Aber Dad hat uns verlassen und Mom ist zerbrochen.
Und das ist alles meine Schuld.
Abby hatte recht: Unter einem alten Lederfußhocker liegt ein zerquetschter Pizzakarton mit den Resten von etwas, das früher mal eine Pizza gewesen sein muss. (Ms Pinner hätte ihre helle Freude daran, diese Reihe chemischer Reaktionen zu erklären.) Ich mache noch ein paar Stunden weiter und fülle zehn Müllsäcke, die ich nacheinander zum Container hinausschleppe. Der Himmel wird mit der Zeit immer wilder und verdunkelt sich von einem übelkeiterregenden Grün zur Farbe eines Blutergusses.
Ich bleibe einen Moment auf der vorderen Veranda stehen und atme den Geruch von nassem Gras ein. Als kleines Kind stand ich immer genauso da und sah den anderen Kindern zu, wie sie auf ihren Fahrrädern herumfuhren oder einen Fußball über das Gras kickten und dabei laut und kreischend lachten. Spiel doch mit, sagte mein Vater dann, seine Stimme ganz spitz vor Gereiztheit. Sprich sie einfach an, in Gottes Namen. So schwer ist es doch nicht, Hallo zu sagen. Ein paar Wörter bringen dich schon nicht um.
Ich konnte nicht sprechen. Ich wusste natürlich, wie es geht, aber in der Öffentlichkeit schnürte sich mir einfach bis oben hin die Kehle zu, sodass ich beim Versuch zu sprechen würgen musste. Schon damals wusste ich, dass mein Vater sich irrte – Wörter können einen sehr wohl umbringen, auf tausend verschiedene Arten. Wörter sind Schlingen, die dich zu Fall bringen, Seile, die dich aufhängen, und Wirbelstürme, die dich verwirren und vom Weg abbringen. In der fünften Klasse habe ich sogar eine Liste angefangen mit all den Arten, auf die Wörter böse werden, dich verraten und verwirren können.
#1. Fragen, die eigentlich keine Fragen sind. Zum Beispiel: Wie geht es dir?, wenn man nur gut antworten darf. #2. Aussagen, die eigentlich Fragen sind. Zum Beispiel: Ich sehe, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich kam bis #48. Wörter, die man in die Stille hinausschreien kann, die aber nie erhört werden:
Ich bin unschuldig.
Als Kind fand ich eine andere Art, mich auszudrücken. Nachts schlich ich mich hinaus und probte auf dem Rasen meine Ballettfiguren, streckte die Arme in den Himmel und hüpfte mit nackten Füßen durchs Gras, drehte mich und sprang, verwandelte meinen Körper in einen langen Schrei. Hört zu, hört zu, hört zu.
Der Wind hat zugelegt und wirbelt einen alten Katalog die Straße entlang. Vielleicht kriegen wir doch einen Tornado. Vielleicht tost ein Sturm durch die Ahornbäume und die alte Zeder, schleudert Äste, Autos und sogar Dächer in die Luft wie Highschoolabsolventen ihre Hüte, fegt die Old Forge Road entlang, mäht unser Haus nieder und saugt die Stapel sowie die üblen Erinnerungen auf und zersplittert alles.
Zurück im Haus, bleibt mir nichts anderes übrig, als eine Lampe in der Diele anzuknipsen – eine der wenigen Stehlampen, die nicht unter einem Berg Kram vergraben sind – und mich in ihrem Schein vorwärtszubewegen, während ich versuche, nicht mit irgendetwas im Wohnzimmer zusammenzustoßen. Der Wind hat zugenommen. Zeitungen pfeifen vorbei und Plastiktüten wirbeln wie Steppenläufer durch den Raum.
Ganz plötzlich setzt der Regen ein: harter, peitschender Regen, der gegen die Fliegengitter hämmert und sie eindrückt, der wie wütende Fäuste auf Wände und Dach trommelt. Ein Donnerschlag zerreißt den Himmel – so laut, dass ich zusammenzucke und aus Versehen gegen einen Wäschekorb voller Zeitschriften stoße. Zwei ganze Stapel kippen um – eine Lawine aus ToasternRegenschirmenPlastikplanenTaschenbüchern – und ergießen sich über das gerade freigelegte Stück Teppich.
»Na super«, sage ich zu niemandem.
Meine Mutter behauptet gern, sie sammelt Dinge, weil sie nichts vergessen will. Sie hat mal aus Spaß gesagt, die Stapel seien wie ein persönlicher Wald – an ihrer Höhe könne man ihr Alter ablesen. Und es stimmt, dass hier die Geschichte unserer kleinen Zweipersonenfamilie geschrieben steht: von Feuchtigkeit gewellte und inzwischen unleserliche Postkarten aus der Zeit kurz nach der Scheidung meiner Eltern; fünf Jahre alte Zeitschriften; sogar eins meiner NwT-Bücher aus der Siebten, dem letzten Jahr, das ich an einer staatlichen Schule verbracht habe.
Aber es ist noch mehr. Es ist nicht einfach die Geschichte einer Familie, sondern die einer gescheiterten Familie. Es ist ein Buch voller Leerstellen, Wörter, die unter riesigen Bergen aus Stoff und Pappe begraben liegen.
Ich gehe in die Hocke, um weiter auszusortieren und wegzuwerfen. Dann schiebe ich einen Stapel gammeligen Druckerpapiers zur Seite und mir bleibt das Herz stehen.
Auf einem unregelmäßigen Stück Teppich liegt ein einzelnes Taschenbuch. Auf dem stockfleckigen Umschlag sind drei Mädchen zu sehen, die Hand in Hand vor einer leuchtenden Tür in einem Baum stehen. Und plötzlich brennen mir grundlos die Augen und ich weiß, dass dieses Ding, dieses kleine Bündel Seiten, der Kern von allem ist: Dies ist die Wurzel des Waldes, das Samenkorn, der Grund, dass meine Mutter jahrelang Mauern, Berge, Türme aus Gegenständen gebaut hat. Um es einzusperren. Es in Schach zu halten.
Als wäre es lebendig und gefährlich und könnte eines Tages brüllend wieder zum Leben erwachen.
Das Buch fühlt sich gleichzeitig schwer und unglaublich zerbrechlich an, als könnte es von meiner Berührung auseinanderfallen. Auf der Innenseite des Einbands steht immer noch sorgfältig mit blauer Tinte geschrieben:
Dieses Buch gehört Summer Marks.
Und darunter, in Rot, weil Brynn darauf bestand: und Mia und Brynn. Dabei erlaubte Summer uns noch nicht mal, darin zu lesen, wenn sie nicht dabei war. Es gehörte ihr, war ihr Geschenk an uns, ihr Fluch. Ich habe keine Ahnung, wie es bei mir gelandet ist. Summer muss es hier vergessen haben.
In der letzten Zeile erkenne ich meine Handschrift.
Beste Freundinnen für immer.
Ich sitze lange einfach nur benommen da, während mir alles wieder einfällt – die Geschichte, die drei Freundinnen, die Landschaft von Lovelorn selbst. Die Tage im Wald, als wir unter einem sich wandelnden Muster aus Blättern und Sonnenlicht spielten, es wäre wahr. Wie wir abends nach Hause kamen, außer Atem und übersät von Insektenstichen und Kratzern. Wie sich die Dinge in jenem Jahr veränderten, sich zu verwickeln begannen und unterschiedliche Formen annahmen. Die Dinge, die wir sahen und nicht sahen. Und wie uns nachher keiner glaubte.
Wie Lovelorn aufhörte, nur eine Geschichte zu sein, und wahr wurde.
Langsam und vorsichtig, als könnte eine zu schnelle Bewegung die Erzählung von den Seiten lösen, blättere ich das Buch durch, bemerke die Eselsohren, die mit rosa und lila Sternchen markierten Absätze, das von Feuchtigkeit und Alter gewellte Papier. Ich erhasche kurze Blicke auf vertraute Wörter und Absätze – der Fluss der Gerechtigkeit, Gregor der Zwerg, der Rote Krieg – und bin hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, es mir gemütlich zu machen und das Buch von vorne bis hinten durchzulesen, wie wir es bestimmt achtzig Mal gemacht haben, oder rauszurennen und das Buch in den Container zu werfen oder es einfach anzuzünden und zu verbrennen. Erstaunlich, dass ich auch nach all dieser Zeit ganze Passagen praktisch auswendig kann – dass ich noch weiß, wie es weitergeht, nachdem Ashleigh in die Schlucht stürzt und von den eifersüchtigen Niemanden entführt wird, und was passiert, nachdem Ava den Schatten durch ihren Gesang herausfordert. Wie wir stundenlang über die letzte Zeile und ihre mögliche Bedeutung diskutierten, im Internet nach anderen Lovelorn-Anhängern suchten und Vermutungen anstellten, warum Georgia Wells das Buch nicht beendet hatte und warum es trotzdem veröffentlicht worden war.
Tief zwischen den Seiten steckt ein Blatt Papier. Als ich es auffalte, segelt ein Kaugummipapier – Pfirsich-Mango, Summers Lieblingssorte – zu Boden. Einen Augenblick lang kann ich sie sogar riechen, den Kaugummi und das Apfelshampoo, das ihre Pflegemutter in Großpackungen im Neunundneunzig-Cent-Shop kaufte, ein Shampoo, das in der Flasche grauenhaft roch, aber an Summer irgendwie angenehm duftete.
Mein Herz klopft mir bis zum Hals. Vielleicht rechne ich mit einer alten Nachricht, einer hingekritzelten Notiz von Summer an eine von uns; vielleicht rechne ich damit, dass sie aus dem Grab auftaucht und Buh macht. Daher weiß ich nicht, ob ich enttäuscht oder erleichtert bin, als ich sehe, dass es bloß ein alter Lebenskundetest mit drei Fragen aus der Sechsten ist. Er ist überall mit den roten Anmerkungen der Lehrerin versehen und mit diversen Punktabzügen für falsche Antworten und Rechtschreibfehler. Am Fuß des Tests steht sogar eine Vorladung. Komm bitte nach der Stunde zu mir. – Ms Gray.
Ms Gray. Ich habe ewig nicht an sie gedacht. Sie war eine der ernsthaften Lehrerinnen, die zu glauben schienen, dass ihr Fach Lebenskunde unsere Lebensqualität tatsächlich verbessern würde. Als ob wir die Mittelstufe schaffen würden, wenn wir ein Kondom über eine Banane rollen und ein Gaumenzäpfchen auf einem anatomischen Schaubild zuordnen könnten.
Ich will den nicht bestandenen Test gerade zurücklegen und das Buch endgültig wegwerfen, als mich das schwache Gefühl überkommt, dass irgendetwas nicht stimmt – ein Unbehagen wie ein Steinchen im Schuh oder ein Mückenstich am Knie, der juckt und sich nicht ignorieren lässt. Irgendetwas passt nicht.
Ich gehe mit dem Buch und dem Test hinaus in die Diele, wo das Licht besser ist. Die Temperatur ist bestimmt um zehn Grad gesunken und ich schaudere, als meine Füße das Linoleum berühren. Draußen trommelt noch immer der Regen an die Fenster, als versuchte er reinzukommen.
Summer war nie eine gute Schülerin – sie hatte größeres Interesse an Rückkehr nach Lovelorn als an ihren Hausaufgaben – und ihr Pflegevater Mr Ball drohte ihr immer mit Hausarrest, wenn ihre Noten nicht besser würden. Schule war ihr einfach nicht wichtig. Ihre Zukunft war größer als der Schulabschluss, größer als die Uni, viel größer als Twin Lakes.
Aber sie war die Autorin. Sie war das Talent. Sie war diejenige, die darauf bestand, dass wir uns mindestens zweimal die Woche trafen, um an Rückkehr nach Lovelorn zu arbeiten, der Fan-Fiction, die wir zusammen erfanden, der Fortsetzung, die das schreckliche, rätselhafte, unfertige Ende des Originals beheben würde. Dann saß sie im Schneidersitz auf Brynns Bett und befahl uns, diese oder jene Szene zu ändern oder bestimmte Details hinzuzufügen. Sie verschwand eine Woche und kam dann mit sechzig Seiten zurück, in denen statt Ashleigh, Ava und Audrey wir drei die Protagonistinnen waren; und ihre Kapitel waren großartig, detailliert, eigenartig und genial, so gut, dass wir Summer dauernd drängten, sie an einen Verlag zu schicken.
Hier jedoch sind Summers Antworten alle daneben. Sie vertauscht ganz einfache Wörter und macht dumme Rechtschreibfehler wie Medchen statt Mädchen, schreibt die Hälfte ihrer Buchstaben falsch herum und verwechselt Begriffe mit anderen, die ähnlich klingen, aber etwas ganz anderes bedeuten.
Mir wird ganz heiß, als hätte ich unvermittelt Fieber bekommen. Plötzlich geht es mir auf: Summer kann diese grandiosen Seiten für Rückkehr nach Lovelorn gar nicht selbst geschrieben haben.
Was bedeutet, dass es da noch jemand anderen gab.
Der Tag wurde heller und die Schatten dunkler, die Bäume wuchsen langsam immer höher und ihre Blätter nahmen einen ganz leicht veränderten Grünton an. Ohne ein Wort zu sagen, wussten die Mädchen, dass etwas äußerst Aufregendes geschah und dass sie sich an einem neuen Ort im Wald befanden.
»Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es hier einen Fluss gab«, sagte Audrey und zog die Nase kraus, wie sie es oft tat, wenn sie verwirrt war.
»Oder ein Schild«, fügte Ava hinzu und las laut vor, was auf dem sorgfältig beschrifteten Wegweiser stand, der an einer hohen Eiche befestigt war: »›Willkommen in Lovelorn.‹«
»Lovelorn«, sagte Audrey verächtlich, denn sie strafte häufig Dinge mit Verachtung, die sie nicht verstand. »Was um alles in der Welt ist das denn?«
Ashleigh schüttelte den Kopf. »Sollen wir umkehren?«, fragte sie zweifelnd.
»Kommt nicht infrage«, erklärte Ava. Und weil Ava die Hübscheste war und außerdem die Starrköpfigste und die anderen immer taten, was sie sagte, gingen sie weiter.
Aus: Der Weg nach Lovelornvon Georgia C. Wells
BRYNN
Jetzt
Freitags veranstaltet Four Corners Filmabende und nach dem Abendessen quetschen sich alle Mädchen in den Medienraum, die Hälfte schon im Schlafanzug. Four Corners’ DVD-Sammlung ist echt jämmerlich und es gibt genau zwei Arten von Unterhaltung: »Genesungsdramen« – miese Fernsehfilme über Hardcore-Drogenabhängige, die ihren Tiefpunkt erreichen, dann irgendeine Erleuchtung erleben und nach Costa Rica ziehen, um dort die Liebe zu finden und für eine Wohltätigkeitsorganisation zu arbeiten – und die Handvoll normaler Filme, die den Four-Corners-Regeln genügen, die sich gegen Fluchen, Darstellung von Sex, Gewalt, Alkohol oder Drogen richten, also absolut alles, was einen Film sehenswert macht, außer man ist sechs Jahre alt. Der alte Tom-Hanks-Film Big ist okay. Genau wie Die Eiskönigin, angeblich, weil er dazu animiert, sich so zu akzeptieren, wie man ist. Aber ich glaube, in Wirklichkeit liegt es daran, dass Trish, eine unserer Betreuerinnen, auf die Musik steht.
Heute sind alle dafür, die Lokalnachrichten einzuschalten. Der heftige Sturm, der über den Nordosten hinwegfegt, soll uns gegen Mitternacht erreichen und alle haben Panik, dass der Strom ausfällt, das Wasser abgestellt wird und die Klimaanlage tagelang nicht funktioniert.
»Ich wusste gar nicht, dass wir auch Fernsehen haben«, sagt ein Mädchen. Sie heißt, glaube ich, Alyssa und sieht irgendwie aus wie eine Figur aus der Muppet Show mit ganz komisch orangefarbener Haut. Entweder ist sie ein Solariumfan oder in der Nähe eines Atomkraftwerks aufgewachsen und jetzt radioaktiv.
»Was für Sender gibt’s hier denn noch?«, fragt Monroe, ein anderes Mädchen. »Showtime oder HBO?« Monroe ist angeblich wegen Opiatabhängigkeit hier, genau wie ich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einfach nur abhängig davon ist, der nervigste Mensch der Welt zu sein. Immer wenn sie was erzählt, muss sie eine Referenz zu irgendeiner dämlichen Fernsehserie unterbringen. Ich habe mich gefühlt wie Arianna in der zweiten Staffel von Ärzte der Liebe, als sie im letzten Augenblick übergangen wurde, obwohl alle dachten, dass sie gewinnen würde.
»Nur Lokalnachrichten«, sagt Jocelyn, eine meiner Lieblingsbetreuerinnen. Sie drückt auf die Fernbedienung. Auf dem Bildschirm blinken die Worte Kein Eingangssignal gefunden.
»Und was ist mit ABC?«, fragt Monroe zunehmend verzweifelt, als ginge es um Leben und Tod. Als hätten wir uns in der Wüste verlaufen und sie wollte wissen, wann wir anfangen müssten, uns gegenseitig zu essen. »Oder CW?«
»Nur Lokalnachrichten, Monroe«, wiederholt Jocelyn und Monroe lässt sich aufs Sofa zurücksinken.
Jocelyn drückt noch ein paar weitere Knöpfe, worauf-hin das Fernsehbild erscheint. Es zeigt eine Reporterin, die mit der einen Hand ein Mikrofon umklammert hält und sich mit der anderen die Kapuze eines Regenmantels ins Gesicht zieht. Hinter ihr werden die Bäume vom starken Wind praktisch in die Waagerechte gedrückt; und noch während sie da steht, reißt ein Vordach vor einem der Läden hinter ihr ab und wird die Straße entlanggewirbelt.
Es dauert einen Moment, bis auch der Ton zum Bild anspringt. »… stehe hier auf der Hauptstraße von East Wellington«, sagt die Reporterin mit erhobener Stimme, damit man sie über den Wind hinweg hören kann. »Und wie Sie hinter mir sehen können, ist Tropensturm Samantha auch schon da …«
Wade wohnt in East Wellington. Das ist nur zwei Orte von Twin Lakes entfernt. Aus irgendeinem Grund fallen mir dabei nicht meine Mutter und Schwester ein, sondern Mia: Mia, die sich in ihrem großen Haus verbarrikadiert hat und hört, wie der Wind an den Fensterläden rüttelt. Obwohl ich seit fünf Jahren nicht mit ihr gesprochen habe, sie seit etwa drei noch nicht mal aus der Ferne gesehen habe, wünschte ich plötzlich, ich könnte sie anrufen, um mich zu vergewissern, dass es ihr gut geht.
»Tropensturm?« Alyssa streckt die Hand nach dem Popcorn aus. »Ich dachte, sie hätten von einem Hurrikan gesprochen.«
»Psst«, bringt ein anderes Mädchen sie zum Schweigen.
»Was ist denn der Unterschied?«, fragt wieder jemand anderes.
»Psst.« Jetzt melden sich mehrere Mädchen gleichzeitig zu Wort.
»… Meteorologen sagen, dass bisher Windböen mit höchstens 65 Stundenkilometern gemessen wurden und der Sturm deshalb nach ersten Berichten, die einen historischen Hurrikan vorhergesagt hatten, herabgestuft wurde«, erklärt die Reporterin. »Allerdings warnen Experten, dass der Sturm gerade erst begonnen habe und man damit rechnen müsse, dass er sich verschlimmert, wenn er auf die Kaltfront stößt, die vom Atlantik heranzieht. Es ist weiterhin möglich, dass wir es mit Hurrikanbedingungen zu tun bekommen – Rekordwindstärken, Überflutungen, Stromausfällen und Straßensperrungen. Kurz, ein Riesenchaos.«
Auf dem Bildschirm erscheint ein anderer Reporter, der in einem schlecht sitzenden Anzug im Studio hinter einem Schreibtisch sitzt und dessen Zähne viel zu gerade und zu weiß sind, um echt zu sein. »Liebe Zuschauer, bleiben Sie zu Hause und passen Sie auf sich auf …«
»Das war’s dann wohl mit dem Besuchstag.« Rachel schneidet eine Grimasse. Sie ist wegen Depressionen und affektiven Störungen hier und gehört damit zu einer Gruppe, die alle mit ernsthaften Suizidabsichten einschließt – also Leute, die deutlich mehr gemacht haben, als sich zum Beispiel einen Reißnagel in den Arm zu drücken, nur um zu sehen, ob es wehtut. (Das tut es.) Rachel hat das süße kantige Gesicht eines Eichhörnchens und sieht wie die Art Mädchen aus, bei dem man in der Mathearbeit abschreiben würde – bis sie ihre Ärmel hochkrempelt und all ihre Ritzernarben zum Vorschein kommen.
»Was meinst du damit?«, frage ich.
Sie zeigt mit dem Kinn auf den Bildschirm. »Wir sind von der Außenwelt abgeschnitten, siehst du? Höchste Überflutungswarnstufe.« Jetzt ist im Fernsehen eine große Landkarte zu sehen, die verschiedene Gebiete von Vermont zeigt und mit welchen Niederschlagsmengen sie zu rechnen haben. Addison County ist feuerwehrrot markiert.
»Der Wetterbericht übertreibt doch immer«, sage ich schnell. »Sie versuchen bloß, höhere Einschaltquoten zu kriegen.«
Rachel zuckt mit den Schultern. »Kann sein.«
»Wann hatten wir zum letzten Mal einen Tornado in Vermont?«
»Ungefähr vor vier Jahren«, sagt sie. »Aber was kümmert’s dich überhaupt? Dich besucht doch sowieso keiner.«
Als ich die Worte laut ausgesprochen höre, versetzen sie mir albernerweise einen komischen Stich in der Brust, als wäre mir ein Popcorn in die Luftröhre geraten.
»Mein Cousin kommt.« Das entspricht größtenteils der Wahrheit. Wade Turner ist eigentlich der Sohn der Cousine meiner Mutter und damit mein Großcousin oder Cousin zweiten Grades oder wie immer man das nennt. Seit fünf Jahren betreibt er eine Verschwörungs-Website zum Mord in der Brickhouse Lane. Aus Gründen, die ich nicht ganz verstehe, ist er davon überzeugt, dass er die Wahrheit herausfinden und meinen Namen reinwaschen kann. Für zwanzig Dollar Benzingeld – die Hälfte von dem, was meine Mutter mir im Monat an Taschengeld für Schokoriegel und Sweatshirts oder Postkarten mit Sprüchen wie »Keine Macht den Drogen« gibt – fährt er anderthalb Stunden von East Wellington nach Four Corners und bringt mir Flaschen mit kontaminiertem Pipi. Wahrscheinlich täte er das sogar, wenn ich ihm nichts bezahlen würde, nur um mich mit Fragen löchern zu können, was damals passiert ist – auch wenn ich eigentlich nie etwas Neues zu sagen habe.
Wade ist total schräg, aber er ist wenigstens jemand. Meine Mutter hat mich kein einziges Mal besucht und meine große Schwester war nur einmal da – noch in ihren Krankenhausklamotten, das Gesicht mit der gerunzelten Stirn so schmal, dass es spitz wie ein Ausrufezeichen wirkte –, um mir einen Stapel Zeitschriften zu bringen, die ich nicht haben wollte, und mir zu sagen, dass ich alle enttäuscht hätte. Und mein Vater ist schon ewig von der Bildfläche verschwunden, was mir nie besonders viel ausgemacht hat, aber immer wieder von Therapeuten, Bloggern und der Pflichtverteidigerin, die sich gegen meine Überweisung an den Strafgerichtshof aussprach, herangezogen wurde, um alles zu erklären – von meiner angeblichen jugendkriminellen Energie bis hin zu der Tatsache, dass ich was gegen Mathe habe.
Mein System mit Wade funktioniert ganz einfach. Alle zehn Tage kommt er die hundertzwanzig Kilometer von East Wellington hergefahren. Auf dem Boden seines alten Pick-ups klappert eine Flasche gelbes Gatorade – die allerdings Pipi enthält, das er in der staatlichen Klinik für Drogen- und Alkoholsüchtige, in der er arbeitet, geklaut hat. Er kommt nach Four Corners und trägt sich am Empfang ein. Dann tut er so, als müsste er nach der Fahrt dringend aufs Klo, geht auf die Besuchertoilette und versteckt die Gatoradeflasche im Spülkasten, der nur ganz selten auf Tablettentüten oder schwimmende Wodkaflaschen untersucht wird.
Später, nachdem Wade und ich unsere übliche Unterhaltung geführt haben – was mich betrifft, der schmerzlichste Teil der ganzen Aktion, weil ich so tun muss, als würde ich mich wirklich freuen, ihn zu sehen, und er bloß mit einem dämlichen Grinsen im Gesicht dasitzt wie ein Kind vor dem Weihnachtsmann in einem Einkaufszentrum –, bringe ich ihn raus, um mich zu verabschieden, und habe einen leeren Plastikbecher aus der Cafeteria mit Deckel und Strohhalm dabei. Am Empfang ist immer so viel los, weil sich Leute anmelden, durch die Sicherheitskontrolle gewunken werden oder die Betreuer vollquatschen, dass es kein Problem ist, unbeobachtet die Besuchertoilette zu benutzen. Das Pipi kommt in den Plastikbecher und später dann in den schnapsglasgroßen Behälter, auf dessen Etikett die Betreuer mit Filzstift meinen Namen geschrieben haben. Gerade rechtzeitig, um meinen Drogentest zu manipulieren und für eine weitere verschobene Entlassung zu sorgen.
Vielleicht kann ich diesmal gleich neunzig Tage bleiben.
»Danke, Ellen«, sagt der fette Typ in dem schlecht sitzenden Anzug und spricht dann mit ernster Stimme weiter. »Und nun zu weiteren Nachrichten. Die Stadt Twin Lakes bereitet sich auf die Gedenkfeierlichkeiten aus Anlass des fünften Jahrestages der Tragödie in der Brickhouse Lane vor …«
Die gesamte Luft strömt aus dem Raum. Die Hälfte der Mädchen glotzt mich an. Die anderen erstarren, als fürchteten sie, schon die geringste Bewegung könne eine Lawine auslösen.
»… in der an einem scheinbar ganz normalen Dienstagnachmittag die dreizehnjährige Summer Marks brutal ermordet wurde.«
Ein Bild von Summer erscheint und mein Herz krampft sich zusammen wie eine Faust. Sie sieht so jung aus. Sie war so jung: Unser dreizehnter Geburtstag – wir waren nur drei Tage auseinander – lag gerade erst zwei Wochen zurück, als sie getötet wurde. Aber wenn ich sie mir vorstelle und wenn sie vor meinem inneren Auge auftaucht – was sie immer noch tut, in kurzen Eindrücken blitzt sie in meinen Träumen auf oder rennt durch meine Erinnerungen, wie sie früher durch den Wald gerannt ist, plötzlich mitten im Licht und dann wieder von den Schatten verschluckt –, ist sie immer so alt wie ich. Oder vielleicht bin ich auch so alt wie sie, damals, als sie mein Ein und Alles war.
»Der Verdacht fiel schnell auf Summers damaligen Freund und ihre zwei besten Freundinnen, die von einem wenig bekannten und besonders grausamen Kinderbuch besessen waren …«
Bitte zeigt nicht das Bild. Meine Lunge fühlt sich an, als würde sie zusammengedrückt wie ein Blatt Papier. Bitte zeigt nicht das Bild.
»Mach das aus«, sagt eine der Betreuerinnen mit scharfer Stimme. Jocelyn sucht auf dem Teppich nach der Fernbedienung, die in dem Knäuel aus Beinen, Decken und Plastikbechern verschwunden ist. Aber es ist sowieso schon zu spät. Gleich darauf ist das Foto auf dem Bildschirm zu sehen, das berüchtigte Foto.
Darauf sind Mia und ich zu Halloween verkleidet wie die Sensenmänner aus Lovelorn, mit schwarzen Kapuzenpullis, jeder Menge Eyeliner, den Summer im örtlichen Drogeriemarkt geklaut hatte, und selbst gebastelten Sensen aus Besenstielen und Alufolie. Und Summer, die zwischen uns steht, ist die Heilsbringerin: ganz in Weiß, die blonden Locken hochgesteckt, die Lippen zu einem blutroten Lächeln verzogen und dazu passend eine rote Linie um ihren Hals. Die Nachrichten haben mein und Mias Gesicht wie mit einem riesigen Radiergummi unkenntlich gemacht, aber Summers grinsendes, triumphierendes Gesicht ist deutlich zu sehen.
Dabei wollte ich gar nicht als Sensenmann gehen. Ich fand, wir sollten uns als die drei Mädchen aus dem Original verkleiden – als Ava, Ashleigh und Audrey –, aber Summer sagte, das sei langweilig. Es war alles Summers Idee.
»Warte mal. Welche bist du?«, fragt Zoe an mich gewandt. Zoe ist neu. Sie ist erst vor ein paar Tagen aus dem Entzug gekommen und sitzt seitdem immer bloß mürrisch in der Gruppentherapie, wo sie auf dem Ärmel ihres Kapuzenpullis kaut oder den Ventilator an der Decke anstarrt, als wäre es der faszinierendste Gegenstand des gesamten Universums.
»Wo ist die Fernbedienung?« Die Betreuerinnen werden immer nervöser. Jocelyn schiebt die Leute weg und dreht andere Mädchen auf die Seite, um die verschwundene Fernbedienung zu finden.
»Die Anklage gegen die beiden Mädchen wurde bald fallen gelassen und Summers Freund wurde schließlich freigesprochen, vor allem aufgrund von Einsprüchen der Verteidigung, die massive Ermittlungsfehler beanstandete.« Der Nachrichtensprecher macht eine Pause und lässt diese Information einen Moment einsinken, wobei er traurig in die Kamera blickt, als wollte er sagen, dass es nicht gelungen sei, uns für den Rest unseres Lebens hinter Gitter zu bringen, sei der absolute Hohn.
Er sagt nicht, dass die Polizei uns noch nicht mal über unsere Rechte belehrte, bevor wir auf die Wache gezerrt wurden, und dass deshalb nichts, was wir dort erzählten, Bestand vor Gericht gehabt hätte. Er sagt nicht, dass Owens Verteidigung Beispiele unglaublichen Polizeiversagens aufgedeckt hat: die DNA-Probe, die angeblich sein Blut vermischt mit dem von Summer am Tatort belegte, war achtundvierzig Stunden lang hinten in einem Streifenwagen liegen gelassen worden und von der Hitze derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie nicht zugelassen wurde.
»Das bist doch du, oder?«, meldet Zoe sich erneut zu Wort und wirkt jetzt verletzt, weil ich nicht auf sie reagiere.
»Fünf Jahre später ist diese kleine verschworene Gemeinschaft immer noch erschüttert von dem unverständlichen Schrecken dieses Verbrechens und plant für Sonntag eine Gedenkfeier, um …«
Der Fernseher wird schwarz. Jocelyn hat endlich die Fernbedienung gefunden und sitzt keuchend da, wie ein Hund, der sich bei der Suche nach einem Knochen übermäßig angestrengt hat. Es herrscht angespanntes Schweigen, das fast lauter klingt als jedes Geräusch. Alle schauen mich an oder schauen mich bewusst nicht an, als hätten sie Angst, ich würde jeden Moment schreien, etwas um mich werfen oder anfangen zu weinen.
Oder vielleicht haben sie auch einfach bloß Angst.
»Okay.« Trish springt mit gespielter Fröhlichkeit auf und klatscht in die Hände. »Was soll es heute sein? Letzte Woche hat sich jemand Rapunzel – Neu verföhnt gewünscht – sollen wir den gucken?«
Niemand antwortet. Das Zimmer summt immer noch vor Spannung. Ich stehe leicht benommen auf, ohne mich darum zu scheren, dass es das sicher bloß noch schlimmer macht. Niemand sagt ein Wort, als ich mich in den Flur hinauskämpfe, über Popcorn und Plastikbecher stapfe und einem Mädchen auf die Hand trete. Sie jault auf, verstummt aber gleich darauf wieder.
Der Flur ist leer und kühl – irgendwo in der Wand brummt eine Klimaanlage. Sobald ich allein bin, fangen meine Augen an zu brennen und ich blinzele; ich weiß gar nicht genau, warum ich weine. Vielleicht liegt es an Summers Gesicht im Fernsehen – diesem wahnsinnig schönen herzförmigen Gesicht mit den großen Augen, den dichten Wimpern und dem Lächeln, als hätte sie dauernd ein Geheimnis.
In das Kartentelefon am Ende des Flurs sind die Initialen früherer Patientinnen eingeritzt. Der Hörer riecht nach Kaugummi und ist immer mit einem dünnen feuchten Film aus Schweiß und Bodylotion überzogen. Ich versuche ihn von meiner Wange fernzuhalten, als ich meine Telefonkarte raushole – die im Four-Corners-Shop direkt neben Regalen mit Stofftieren und T-Shirts mit Motivationssprüchen verkauft werden –, und tippe Wades Nummer ein.
Er nimmt beim ersten Klingeln ab.
»Ich bin’s, Brynn«, sage ich und senke instinktiv die Stimme, obwohl niemand im Flur ist, der mithören könnte. »Du kommst morgen auf jeden Fall, oder? Du hörst doch nicht auf diesen ganzen Schwachsinn über den Hurrikan?«
»Brynn! Hi!« Wade spricht immer voller Ausrufezeichen. »Ich bin noch …« Seine Stimme verhallt und ich muss den Hörer schnell vom Ohr weghalten, als ein lautes Knacken und Krachen in der Leitung explodiert.
»Was?« Ich umklammere das Telefon fester. »Ich kann dich nicht hören.«
»Tut mir leid!« Erneutes Knacken, wie wenn jemand Alufolie zerknüllt, stört die Verbindung. »Der Wind ist schon ziemlich übel. Es heißt, es soll bis zu neunhundert Millimeter Regen geben. Der Fluss wird wahrscheinlich …« Seine Stimme verhallt erneut.
»Wade«, sage ich. Ich kann ihn immer noch reden hören, aber seine Worte werden hoffnungslos verzerrt. »Wade, ich kann dich nicht verstehen. Sag mir einfach, dass es bei morgen bleibt. Versprich es mir, okay?«
»Ich kann das Wetter nicht beeinflussen, Brynn«, sagt er. Das ist noch etwas Nerviges an Wade: Er gibt absolut offenkundige Tatsachen von sich, als wären es tiefgründige Weisheiten.
»Hör zu.« Inzwischen bin ich ziemlich verzweifelt. Ich brauche Wade. Ich habe nicht vor, Four Corners zu verlassen. Ich werde nicht in eine Welt zurückkehren, in der die Leute mich anstarren oder, noch schlimmer, mich bewusst ignorieren – mich auf dem Bürgersteig abdrängen, mich im Lokal nicht bedienen, direkt durch mich hindurchsehen, als existierte ich überhaupt nicht. »Sag mir einfach, dass du kommst, okay? Ich will dir was erzählen. Es ist wichtig.« Das ist natürlich alles Quatsch und, wie gesagt, ich bin nicht gerade die geborene Lügnerin. Aber ich habe gelernt, mich um meine Interessen zu kümmern. Das musste ich.
»Was denn?« Seine Stimme klingt misstrauisch – aber auch hoffnungsvoll.
»Etwas, das mir eingefallen ist.« Ich denke mir beim Reden was aus und versuche, so unbestimmt wie möglich zu bleiben. »Es geht um Summer«, füge ich schnell hinzu, als er nicht antwortet. »Du willst mir doch immer noch helfen, oder?«
Es herrscht ein langes Schweigen, nur unterbrochen von dem entfernten Knacken und Summen in der Leitung.
»Wade?« Ich umklammere den Hörer so fest, dass meine Fingerknöchel schmerzen.
»Wenn die Straßen nicht gesperrt sind«, sagt er. Seine Stimme klingt verzerrt wie durch einen lausigen Computerlautsprecher. »Dann komme ich.«
»Sie werden nicht gesperrt sein«, sage ich und lege auf, ohne mich zu verabschieden.
Der Regen erreicht uns, kurz bevor die Lichter ausgemacht werden, und trommelt so heftig aufs Dach, dass es klingt wie eine ganze Herde aufgescheuchter Rinder. Die Hälfte der Mädchen kreischt, als ein Blitz über den Himmel zuckt und kurz darauf die Lampen flackern.
Monroe macht mich ausfindig, als ich mir gerade die Zähne geputzt habe, und stellt sich direkt vor die Badezimmertür, sodass mir nichts anderes übrig bleibt, als stehen zu bleiben.
»Hey.« Sie streicht sich den Pony aus den Augen. »Tut mir leid wegen vorhin. Diese ganze Sache mit den Nachrichten. Keine von uns wusste, wie wir …« Sie bricht seufzend ab. »Hör zu, ich persönlich find’s cool, okay?«
»Was findest du cool?«, frage ich automatisch und wünschte gleich darauf, ich hätte es nicht getan.
Sie sieht mich blinzelnd an. »Dass du jemanden umgebracht hast.«
In Four Corners gibt’s dieses Motto namens D.E.N.K. Bevor man sich äußert, soll man sichergehen, dass das, was man zu sagen hat, dringend, ehrlich, notwendig und kameradschaftlich ist. Im Prinzip eine nette Idee. Aber Prinzip und Praxis sind zwei vollkommen verschiedene Dinge.
»Du spinnst«, sage ich. »Und du stehst mir im Weg.«
Der Wind ist so laut, dass ich stundenlang wach liege. Er heult voller Verzweiflung wie jemand, der sich in der Dunkelheit verirrt hat. Aber schließlich schlafe ich ein. Und zum ersten Mal seit Jahren träume ich wieder von Lovelorn.
Mia war die Nette, aber sie war schüchtern. Summer konnte jeden dazu bringen, sie zu mögen, und hatte keine Angst vor Fremden. Und Brynn hatte dauernd mit irgendjemandem Streit, obwohl sie tief in ihrem Inneren möglicherweise die Sanfteste von allen war. (Aber das hätte sie niemals zugegeben.)
Aus: Rückkehr nach Lovelorn von Summer Marks,
Brynn McNally und Mia Ferguson
BRYNN
Jetzt
»Es sieht alles gut aus, sehr gut. Geht’s dir auch gut? Gut.« Paulie ist mit den Nerven am Ende. Es ist, als hätte ihr Gehirn auf Wiederholung geschaltet. Der Sturm hat die Büros der Verwaltung überflutet. Inzwischen ist das Wasser zwar abgeflossen, aber die Teppiche sind immer noch völlig durchnässt und müssen wahrscheinlich rausgerissen werden. »Ich weiß, dass du inzwischen alt genug bist, um deine Entlassungspapiere selbst zu unterschreiben. Den Namen der Person, die dich heute abholt, hast du uns nie genannt, aber egal … es ging die letzten Tage hier so stürmisch zu …« Sie bringt ein schwaches Lächeln zustande. »Das soll jetzt kein Wortspiel sein.«
Es ist Sonntagmorgen, und anstatt mich dank Wades Lieferung im Entzug zu entspannen, sitze ich in der Cafeteria Paulie und einem Riesenstapel Entlassungspapiere gegenüber. Zum ersten Mal seit Freitagnachmittag scheint wieder die Sonne und der Rasen ist übersät von Ästen und Müll, der von sonst wo hergeweht wurde. Männer in identischen grünen T-Shirts und dicken Gummihandschuhen stapfen durch die Pfützen und räumen auf.
Ich greife die Idee eines Versäumnisses auf. Vielleicht kann ich doch noch ein, zwei Tage rausholen. »Es kann mich niemand abholen kommen.« Der enttäuschte Tonfall fällt mir nicht schwer. Wade konnte wirklich nicht kommen. Offenbar hat ein Ast seine Windschutzscheibe durchschlagen. »Wegen des Sturms«, erkläre ich, als Paulie mich überrascht ansieht.
Ausnahmsweise war der Sturm wirklich so schlimm wie von den Nachrichten vorhergesagt. Teile des Countys sind tatsächlich von Tornados heimgesucht worden. Die Hälfte der Ortschaften zwischen Middlebury und Whiting sind von der Stromversorgung abgeschnitten. Der Otter Creek ist über die Ufer getreten und hat Autos, Gartenhäuser und sogar eine Windmühle aus dem achtzehnten Jahrhundert mit sich gerissen – er hat sie einfach verschluckt, ein paar Holzbalken wieder ausgerülpst und dann: Danke, bis zum nächsten Mal.
Den Nachrichten zufolge – seit die Generatoren am Samstagmorgen angesprungen sind, läuft der Fernseher im Medienraum praktisch ununterbrochen – ist Twin Lakes schwer getroffen worden. Ich habe Bilder des alten Kinos gesehen, dem das halbe Dach fehlte, und von Two Beans & Cream, bei dem die Fenster kaputt waren und die antike Kaffeemühle halb im Wasser stand. Telefonleitungen sprühten Funken auf der Straße und das Wasser schob sich träge zwischen geparkten Autos hindurch.
Beim Versuch, zu Hause anzurufen, hörte ich nur ein lautes Tuten. Als ich meine Schwester auf dem Handy anrief, legte sie praktisch gleich wieder auf.
»Das ist hier alles abartig beschissen«, sagte sie und ich konnte Mom im Hintergrund hören, die ihr mit hoher, besorgter Stimme sagte, sie solle sich nicht so unflätig ausdrücken. »Hör zu, ich kann jetzt nicht reden. Der Keller steht unter Wasser. Mom dreht gleich durch. Bleib trocken, okay?« Und das war’s.
Allerdings stimmt auch, dass ich weder meine Mutter noch meine Schwester gebeten habe, mich in Four Corners abzuholen, aus dem einfachen Grund, dass ich ihnen gar nicht gesagt habe, dass ich entlassen werde. Ich hatte ja gar nicht vor, entlassen zu werden.
»Ach so.« Paulie schiebt stirnrunzelnd ihre Brille hoch. »Und wer ist dann die junge Frau vorne im Foyer?«
Ich starre sie an. »Was?«
»Sie hat sich vor einer halben Stunde angemeldet.« Paulie blättert in ihren Papieren. »Hier. Audrey Augello. Sie wollte dich sehen. Ich habe einfach angenommen, sie würde dich abholen.«
Mein Gehirn setzt einen Augenblick aus. Mein erster Gedanke ist, dass es sich um einen Scherz handeln muss. Eins der anderen Mädchen hatte nach den Nachrichten die Idee, mir einen Streich zu spielen. Aber direkt danach ist mir klar, dass das unmöglich ist – in den Nachrichten war nie von Lovelorn oder einer der Figuren daraus namentlich die Rede. Das heißt: Jemand anderes, jemand, der Bescheid weiß, muss mich gefunden haben und will, dass ich die Nerven verliere.
Früher war es immer unser Spiel gewesen, so zu tun, als wären wir eins der Mädchen aus dem Original. Summer, die Schöne, die ewige Anführerin, die Ja oder Nein, Stopp oder Los sagte, war Ava; Mia, die süße kleine Mia mit den großen Augen, die an den Nägeln kaute, wenn sie nervös war, und sich sogar beim Fußballspielen im Sportunterricht bewegte wie eine Balletttänzerin, war Audrey; und ich war Ashleigh, die Laute, sarkastisch, witzig und nur ein bisschen gemein.
Wir benutzten unsere Spitznamen, wenn wir uns in der Schule Nachrichten schrieben. Mia ließ sich sogar im Internet extra Briefpapier drucken, auf dem oben in Rosa Audrey Augello stand, und immer wenn sie damit dran war, an der Geschichte weiterzuschreiben, tat sie das von Hand auf ihrem speziellen Papier. Und Summer hatte eine geheime E-Mail-Adresse, [email protected]. Die sollten wir für Nachrichten in Sachen Lovelorn benutzen. Aber dann fand Mr Ball, Summers Pflegevater, heraus, dass sie mit Jake Ginsky und seinem älteren Bruder gesehen worden war, und zwang sie, all ihre Passwörter rauszurücken, um ihre Mails, ihren Instagram- und Snapchataccount und alles andere zu kontrollieren. (Summer war überzeugt, dass er sogar den alten Familienkater Bandit darauf trainiert hatte, sie auszuspionieren und zu jaulen, wenn sie versuchte, sich rauszuschleichen.) Daher nutzten




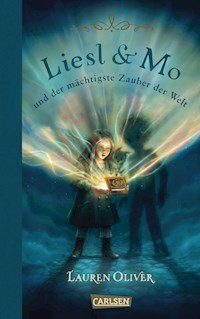













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










