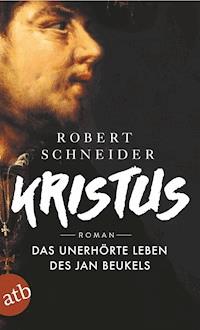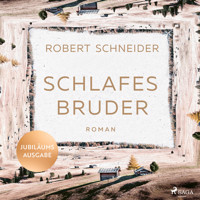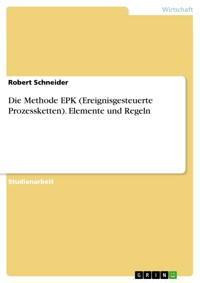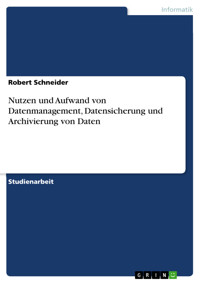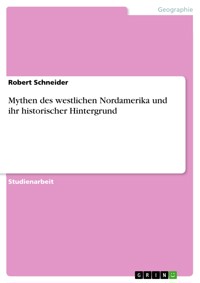Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
101 Mikromärchen, Legenden, Fabeln und Betrachtungen der Zeit. Robert Schneider schreibt unerwartet, ist kritisch, richtet den Blick auf Geschehenes oder Ersehntes. In 101 Geschichten führt uns Robert Schneider in alte chinesische Dynastien, an das südliche Ende des Central Parks in New York, zum Präsidenten aus dem Land der blauen Berge, in ein Dorf im Wallis oder im Vorarlberg, zu Schah Abbas dem Großen aus der Dynastie der Safawiden oder auch direkt ins Märchenland. Dort lässt er etwa zwei Schuhe trefflich über rechts und links streiten, und darüber, ob heutzutage diese politischen Kategorien noch taugen. Erdbeeren mokieren sich über eine ins Beet gefallene Zitrone oder Einkaufswagen debattieren über die Grenzen der kapitalistischen Wirtschaft und kommen auf Adorno zu sprechen. Schneider macht uns bekannt mit Podrhasky, der dem Tod begegnet, und mit einem Obdachlosen, der sich mittels großer religiöser Gesten Kleingeld erbettelt und einen ziemlich coolen Teenager zumindest ein wenig verunsichert oder ihm gar eine Erkenntnis vermittelt. Viele Geschichten laufen auf eine Art Fabelmoral hinaus, oder besser: Sie scheinen darauf hinauszulaufen. Denn oft, fast immer, dreht Schneider die kurzen Geschichten, lässt das Unerwartete, das Gegenläufige einbrechen und weitet so den Horizont der Texte, verschränkt Authentisches und Erfundenes. Dabei scheut er weder das Pathos noch die Ironie, die er zuweilen ins Übersteigerte und Absurde führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Schneider
Buch ohne Bedeutung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2022
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Marion Wiebel, Wallstein Verlag,
Foto: Ursula Dünser
ISBN (Print) 978-3-8353-5195-0
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-4870-7
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-4869-1
Inhalt
Ich, Verschwender
Die Wahl
Süß und sauer
Elíns Himmel
Das Antlitz
Taglied
Der Brillant
Größe
Vom Reichtum
Das immerblühende Ahornblatt
Das Taschenmesser, das Löffel sein wollte
Der Traum der Ringelwürmer
Der Aufstand der Einkaufswagen
Der Kanzler und das Mädchen
Plus und Minus
Das verstimmte H
Nicht auffindbar
Was aus Ilka geworden ist
Die Vordenker
Die mürrische Schneeflocke
Wir
Die sechzigste Perle
Perfektionisten
Blackfacing
Die Fliege
Tulu und Gebre
Kalliophon über Angst
Wie Podrhasky den Tod überlistete
Ungeliebt
Der Ahnungslose
Der Engel
Die Wahrheit über die Grimms
Pänk vor dreißig Jahren
Die Ergreifung des Rudolf Höß
Kunst der Rechtfertigung
Benno und die Atome
Die Stimme
Die Gutkuh
Sich nicht entrinnen
Liebe Nachbarn
Rechts und Links
Tolja oder Slava?
Unter uns
Katjuscha
Das Gewicht
Die Liebesbriefe der Frau Melchow
Das Gelübde von Goms
Schuhe für jeden
Gelbgold und Weißgold
Heimweh daheim
Wiederkehr
Professor Kollried
Der unbesungene Mr. Houbolt
Die Wut der Steine
Rechtsbeistand
Der schwierige Franz Kranz
Die weinenden Schornsteine
Die verstummte Prinzessin
Unser Tarek!
Die Entdeckung von Schytomyr
Die Pillendose
Der Goldmacher
Habemus Papam
Beichte
Street View
Durch dich
Die neue Zeit
Good Vibes
Der unberührte Teller
… jeder irret anders
Bildersturm
Das Kind in ihm
Nick-Nick
Ein Anderer
Der brennende Erich
Das mit dem Misstrauen
Der Festredner
Vorfreude
Ami
Schwarzweiß
Der Tannenmann
Nichts ist umsonst und alles
Die Schildkröte und das Philodendronblatt
Das Männchen
Der Experte
Der letzte Leser
Lykke
Die Diebin Adamik
Mollitzer und die Beredtheit
Italienreisende
Das Kamel
Die verhängnisvollen Fehler
Abdels Fund
Die Krämerin und der Alb
Held und Vater
Sefa und das Wünschen
109P / Swift-Tuttle
Die Sterntaler 2.0
Die neunundneunzigste Anmaßung
Das Gefühl ist ein Kind aus Deutschland
Beschluss
Den Brüdern
Blättert darin oder auch nicht
Ich, Verschwender
Seit vierzig Jahren stehe ich am offenen Fenster und blicke auf den dunklen, bewaldeten Berggrat, dahinter sich der blaue Schnee der Churfirsten bis weit in den Hochsommer hält. Ich liebe es, am offenen Fenster zu stehen und meinem Leben zuzusehen, wie es verrinnt.
»Beeile dich zu leben!«, drängt meine Frau. »Die Tage sind schneller geworden. Die Abende leerer.«
»So brandrot habe ich die Sonne noch nie hinter den Bergen vergehen sehen, Liebste. Der Schnee flammte eine Zeitlang auf«, antworte ich.
Mein alter Freund, ein weltläufiger Mann mit Einfluss und Geld für Generationen, ruft an. Am Ende steht wieder die Sorge um mein Fortkommen. »Du hast eine Familie. Was hinterlässt du deinen Kindern?«
»Ein gelungenes Jahrzehnt vielleicht, das mir bleibt«, sage ich, und: »Seit vierzig Jahren, Arthur, stehe ich am Fenster, meine, jeden Stein zu kennen, und entdecke, dass der Trampelpfad zu den Wiesen meiner Kindheit von Norden her viel kürzer ist. Ich Narr bin immer von Süden gekommen!«
Ich treffe Frau Hartung, meine Verlegerin, die mir ins Gewissen redet. »Ich fürchte, du bist bald vergessen. Warum bringst du dich nicht in Erinnerung? Ein Schriftsteller schreibt. Jeden Tag ein Satz.«
»Es ist keine Schande, Frau Hartung, vergessen zu sein. Sehen Sie den zerstäubenden Regenbogen über unseren Köpfen?«
Mein kleiner Sohn zieht auf dem Asphalt mit blauer Kreide einen Strich von hier bis nach Paris. Ich assistiere.
»Was wird das?«, fragt unser Herr Bautsch vom Nachbarhaus.
»Ein Strich von hier bis nach Paris«, antworten wir.
Er reibt sich die Nase und schließt das Fenster.
Seit vierzig Jahren vergeude ich meine Zeit. Ich erinnere mich gut. Als junger Mann, da die Zeit noch vor mir lag, fehlte sie mir. Nie wurde ich richtig fertig. Nie fing ich richtig an. Heute habe ich sie im Überfluss. Ich muss nicht mehr anfangen und auch nicht mehr fertig werden.
Am Nachmittag fällt Regen. Gegen Abend reißen die Wolken auf. Ich stehe am Fenster, und über den Waldrücken strömt für die Dauer einiger Augenblicke ein Heugelb herab, das ich so noch nie gesehen habe.
Die Wahl
Wang Xizhi war der berühmteste Schönschreiber der Westlichen Jin-Dynastie. Wie sehr seine Kunst verehrt wurde, erhellt die Anordnung, dass der Kaiser mit einer Kalligrafie des Meisters begraben werden wollte. Xizhi war Beamter, wurde aber von seinem Vorgesetzten beharrlich gekränkt, indem dieser statt der Viertelrumpfbeuge bloß mit einer Fünftelverbeugung Ehrerbietung bezeugte, weshalb Xizhi ernstlich erkrankte, aus dem Amt schied und sich nunmehr der Kunst hingab.
Er besaß eine Lehmhütte am Unterlauf des Gelben Flusses, wohin er sich mit seinen Schülern zwecks Unterweisung in Schönschrift zurückzog. Jeder waagrechte Strich ist ein Wolkenhaufen in Schlachtformation, pflegte er zu lehren, jeder Bogen ein Weingerank von hohem Alter.
An einem Sommerabend saß er mit seinem Lieblingsschüler Su Heng in der Hütte, vor sich ausgebreitet Schreibpinsel, Blocktusche, Reibstein und Reispapier. »Mein guter Su Heng«, sprach Xizhi, »ich kann dich gar nichts mehr lehren. Darum lass uns heute einen Wettstreit wagen. Wer bis zur Stunde des Ebers das schönste und makelloseste Gedicht niederlegt, soll der Meister sein.«
Su Heng willigte ein, nicht ohne sich vorher aufs Erbärmlichste herabzuwürdigen. Dann nahm jeder in einer anderen Ecke der Hütte Platz. Als der Schüler die Tusche anreiben wollte, krabbelten ihm Ameisen die Beine hoch und ärgerten ihn sehr. Im Nachbarhaus hörte er Kinderlachen, was die Konzentration empfindlich störte, weshalb er aus der Hütte lief, dem Geschrei Einhalt zu gebieten. Wieder zurück, die erste Gedichtzeile im Kopf, störte ihn der Wind in den Zweigen des Akazienbaums, worauf er sich die Ohren mit Wachs verschloss. So folgte ein Verdruss auf den anderen. Die festgesetzte Stunde brach an, und Su Heng hatte nicht ein Zeichen auf das Papier gesetzt.
»So will ich dir meine Verse vortragen«, sagte Wang Xizhi und schmunzelte.
Sein Gedicht besang die nützlichen Lebewesen, die das Erdreich von Aas reinigen, den Frohsinn der Kinder, die das Herz beglücken, das Summen des Windes in den Akazienzweigen, das den Worten Musik verleiht …
Süß und sauer
Landete eine Zitrone im Staudenbeet und wurde ohnmächtig. »Nicht gerade appetitlich für unsereins«, entrüstete sich eine überreife Erdbeere gegenüber ihrer noch grünen Nachbarin. »Pass auf, wenn sie gleich zu sich kommt, wird sie zu jammern anfangen, wie sehr sie sich doch wünschte, eine Erdbeere zu sein und keine Zitrone.«
»Es ist ein Gesetz. Die Natur ist unzufrieden mit sich und wird es immer bleiben«, äußerte die Unreife. »Dabei ist das Leben so süß.«
»Ganz meine Meinung«, antwortete die Überreife. »Die Kunst im Leben besteht darin, sich mit dem abzufinden, was man nun mal ist.«
»Gescheiter hättest du es nicht sagen können, meine Freundin. Sehe ich da einen Altersfleck?«
Die Überreife erschrak und suchte den Makel hinter einem Fruchtblatt zu verbergen. »Eine winzige Delle, nichts Schlimmes.«
»Wurmstich? Schneckenfraß?«
»Hab mich angestoßen, gestern Nacht im Sturm.«
»Schimmelbefall?«
»Werde du erst mal erwachsen und geh durch die Höllen der Staunässe und des Wurmbefalls! Du gedeihst auch nicht gerade prächtig, wenn ich das bemerken darf. Wie du am Strauch hängst, so jung und schon verwachsen. Eine Erdbeere sieht für mein Empfinden anders aus.«
»Ich wäre kerngesund, wenn die Gärtnerin nicht zu faul wäre, mich zurückzuschneiden und zu düngen.«
»Freilich. Schuld sind immer die Menschen …«
So gab eine Kränkung die andere, bis die Zitrone von der Keiferei erwachte. »Uff, mir brummt der Schädel.«
Die Erdbeeren schwiegen augenblicklich.
»Was glotzt ihr mich so an?«
»Wir sind überrascht von Ihrer Gesellschaft«, erwiderte die Überreife.
»Um nicht zu sagen irritiert«, ergänzte die Unreife.
»Ich wurde ausgequetscht und flog aus dem Küchenfenster. Mehr weiß ich nicht.«
»Jetzt wären Sie gern eine Erdbeere, süß und saftig, nicht wahr? Sie malen sich vielleicht aus, wie herrlich es wäre, mit Schlagsahne in einem Kindermund zu verschwinden«, produzierte sich die Überreife.
»Das nicht. Ich bin stolz darauf, eine Zitrone zu sein. Das Leben war sauer. Das Leben war schön. Mich ärgert nur, dass ich nicht bis zum letzten Tropfen ausgekostet wurde.
Elíns Himmel
An der Ecke Rivington und Suffolk Street hauste ein obdachloser Mann auf dem Belüftungsgitter eines U-Bahnschachts. Die er anbettelte, begrüßte er stets mit den Worten: »Wie geht’s? Ich habe den Himmel gefunden. Wollen Sie ihn sehen, Ma’am, Sir?« Die meisten runzelten die Stirn oder grinsten, weil sie die Anmache originell fanden – eine gute Show ist alles –, gaben ein paar Münzen und hetzten weiter, wie es sich für Manhattan schickt.
Er hieß Elín – sein Alter ließ sich schwer schätzen –, war von puerto-ricanischer Herkunft, groß, schlank, hatte graues, verfilztes Haar. In seiner Jugend soll er ein hoffnungsvoller Basketballspieler in Upstate New York gewesen sein. Den als liberal geltenden Anwohnern des Viertels war es mehrmals gelungen, ihn zu vertreiben, weil sich viele vor seinem Gestank ekelten oder davor, wie er die weggeworfenen To-Go-Becher aus dem Müll zog und sie ausleckte. Dennoch kehrte Elín stur an den Ort zurück, wo er den Himmel gefunden hatte.
Einmal schlenderte ein pubertierender Junge an ihm vorbei, flüsterte, damit es keiner hörte, dass man so ein Stück Scheiße einfach abknallen sollte, und spuckte zu Boden. Elín, der gelernt hatte, Kränkungen zu überhören, sprach den Jungen an, obwohl er aus Prinzip nie Kinder ansprach. »Sir, ich habe den Himmel gefunden. Wollen Sie ihn sehen?«
Der Rotzlöffel blieb stehen, zog die gelbe Kapuze über den Kopf und fragte: »Was laberst du da?«
Elín deutete mit dem Zeigefinger auf das Gitter des U-Bahnschachts. »Hilf mir, das hochzuheben.«
In einer Mischung aus Verblüffung und Neugierde half der Junge, das Gitter aus der Verankerung zu wuchten und wegzuschieben.
»Ich steige zuerst hinunter«, sagte der Obdachlose. »Dann du.«
Der Junge blickte in den Schacht, sah lediglich eine große Wasserlache. Elín kletterte die Leiter hinab. Der Junge folgte. Sie standen in der Wasserpfütze.
»Wo ist jetzt der Himmel?«, fragte der Junge.
»Du musst dich nach vorne beugen, damit du ihn sehen kannst.«
Der Junge bückte sich, sah die Spiegelung seines Gesichts, dahinter die Wolken über der Rivington Street.
Das Antlitz
In Flandern lebte ein Schilder. Er und seine fünf Söhne malten Tafelbilder, die so begehrt waren, dass sogar der Herzog von Mailand zu ihren Auftraggebern zählte. Darum gab es in der Werkstatt viel zu tun. Oft brannten die Talglichter bis zum Morgen.
Der jüngste Sohn hieß Lieven, war ein zarter Mensch, aber eine Trödeltasche, weshalb ihn die Brüder hänselten. Wenn sie zum Ufer der Schelde gingen, Rebhühner zu schießen, warteten sie nicht, bis er endlich die Stiefel übergezogen hatte, ließen ihn sitzen, weshalb er in Tränen ausbrach.
»Weine nicht«, tröstete die Mutter. »Auch die Langsamen kommen an.«
»Aus dem wird nichts«, murrte der Vater. »Der taugt nur zum Farbenreiben.«
Und so kam es. Während die Brüder mit Lapislazuli und Purpur arbeiten durften, musste er am Reibstein sitzen. Dabei hatte er ein Bild im Herzen, dazu selbst die kostbarsten Farben und feinsten Pinsel in der Werkstatt nicht getaugt hätten.
Lieven wuchs heran und lernte Merel kennen, die Tochter des Schusters, die er nicht mehr vergessen konnte. Wenn er am Ufer der Schelde lag und der Wind nicht gerade den Gestank der Färber herübertrug, träumte er davon, dieses Mädchen zu zeichnen. Es war jener Mensch, den er immer in sich getragen hatte, davon war er überzeugt.
Er begann, ein handtellergroßes Portrait von Merel zu schaffen, das in nie gesehener Genauigkeit Gottes Geheimnis abbilden sollte. Der Pinsel bestand aus einem einzigen Hermelinhaar. Obwohl Merel geduldig Modell saß, wurde das Bild nicht fertig. Lieven war unzufrieden, weil jede Regung, jeder Atemzug und Wimpernschlag ein neues Antlitz zeigte. Also übermalte er das Bildnis wieder und wieder.
Ein Unglück geschah. Merel ertrank beim Baden. Lieven weinte wie damals, als die Brüder ohne ihn weggegangen waren. Er lief zu Merels Vater und bat, ein Totenbildnis zeichnen zu dürfen. In jener Nacht gelang das Werk, und es schien Lieven, als habe er Gottes Geheimnis erfasst. Am anderen Morgen zeigte er dem gebrochenen Vater das Portrait. Der betrachtete es lange und sagte: »Beim besten Willen, aber ich sehe nichts.«
Taglied
Ein Menschenleben, mehr will ich nicht. Das wäre die Zeit, wieder von vorn zu beginnen. Ernüchtert von allen Mädchenträumen, die Mutproben unter Jungen sämtlich verloren. Zu Ende gehofft an dem, was nicht zu ändern war und heiter geworden im fortwährend Unerfüllten.
Liebe ist, was nach Abzug der Irrtümer bleibt.
Du sagst, es sind zwei große Wasser zwischen dir und mir. Ein Mal gemeint sein und meinen. Gleichlaufend, im selben Augenblick. Dich habe ich erwartet. Ohne Eifer. Du mich. Alles ist Hingabe, sagst du. Könntest vergehen und ruhen dann.
Ich war da. Just in time. Blieb jenseits der Wasser. Unser Tagwerk ist nicht Einswerden.
Nein, aber Wille, die Wasser zu hemmen.
Wann wurde aus Wille je Wirklichkeit? Nur im Verzichtbaren. Alles Wollen schwächt. Das Große ist umsonst.
Ein Menschenleben, mehr will ich nicht. Das wäre die Zeit, wieder neu zu fehlen. Alle Bestrafung hochmütig gewärtigen, nicht Gnade erbetteln. Winkelzüge der Milderung. Seraph sein, der nicht an Menschen glaubt, und den, der immer zur Rechten saß, lossprechen von den Sünden der Gerechtigkeit.
Liebe ist, dass nichts von mir bleibt.
Sagst, auf den Feldern der sieglosen Eroberung brennt noch immer dein Herzlicht. Ein Mal gleichzeitig lieben! Ein Mal Gegenwart! Wie oft bin ich zu dir gekommen im Schnee, der roch nach frischem Heu. Da das Eis trug. Und erschrak.
Gewissheit ist Einbrechen im Unwägbaren.
Ich ging dir nicht entgegen. Earth in forgetful snow. Blieb bei den raubereiften Weiden. Mich wärmte die Kindheit. Wer umfing dich?
Du hast mich gehalten in der Engführung eines langsam verdämmernden E-Dur.
Dein Werk ist die Nacht, da die vertrauten Gespenster hochwandern an Wänden, die keine sind.
Alle Angst ist Verbrechen.
Ein Menschenleben, mehr will ich nicht. Das wäre die Zeit, wieder bedürftig zu sein. Ausgesetzt den Händen der Mutter. Bilder des Zufalls hortend für ein Museum der Erinnerung, das nur mich eintreten lässt. Wörter für Bibliotheken des Vergangenen ohne Archivar.
Dass doch die Wasser versiegen zwischen dir und mir.
Liebe ist, was vom Unvermögen bleibt.
Der Brillant
Ein Stein von betörendem Feuer aber geringem Karat ging verloren. Er hatte in der zierlichen Krabbe eines Verlobungsrings aus Weißgold gehaust, umgeben von zwei Geschwisterbrillanten. Bei Sonnenuntergang hatte die Verlobte ihr langes Haar am blassroten Strand von Elafonisi getrocknet, worauf ein Steg der Krabbe sich im Badetuch verhakt hatte und gebrochen war. Raufende Kinder hatten ihn mit ihren weißen Fußsohlen noch tiefer in den Sand gedrückt. Unmöglich, den Stein jemals wiederzufinden.
Das grämte den kleinen Brillanten, als er so da lag, die Nacht über sich, die Schwärze unter sich, noch dazu in Gesellschaft von Dosenverschlüssen und den Vergesslichkeiten des Touristenstrands. War er doch die Erinnerung an das verschwiegenste Geheimnis seiner Besitzerin gewesen. »Jetzt wird sie den Ring in die Schublade legen und nicht mehr an ihr Geheimnis denken«, seufzte er. Der Stein zerknirschte sich so sehr, dass er sich zurückwünschte in die zeit- und endlose Tiefe, als er noch nicht gespalten war.
Auf der Veranda, bei Weißwein und Dakos, bemerkte die Verlobte, dass ein Stein fehlte. »Den kann ich nicht mehr tragen!«, rief sie und streifte den Ring vom Finger. Der Verlobte schwor, nach dem Urlaub den Juwelier aufzusuchen. Sie lachten wie die Kinder, liebten sich nächtens, da ein heftiger Sturm aufkam.
Anderntags bestiegen sie die Maschine. Der Ring landete in der Schublade für Krimskrams. Dem Verlobten wuchs die Arbeit über den Kopf, denn er war jung und wollte mehr. Der Juwelier musste warten. Die Verlobte auch. Ein Streit wegen Nichtigkeiten, und das gehütete Geheimnis offenbarte sich.
In der Sturmnacht am kretischen Strand aber hatte der Wind den Sand verwirbelt und den kleinen Brillanten an die Promenade gefegt, wo er in der Morgensonne brannte. Ein kleines Mädchen hob ihn auf, verleibte ihn der Sammlung von allerlei Glasscherben ein. Der Stein war entsetzt, in der Schachtel von lauter Wertlosigkeiten zu liegen. Als er sich doch in sein neues Leben schickte, fand er plötzlich Gefallen daran, niemandes Erinnerung mehr sein zu müssen.
Größe
Am südlichen Ende des Central Park, Höhe 7th Avenue, in der Nähe einer schlichten Steinbrücke, steht eine Blutbuchengruppe von imposanten Ausmaßen, die ein Zuwanderer aus Sondershausen in den zwanziger Jahren dort gepflanzt haben soll. Auf einem quadratischen und kaum mehr lesbaren Messingschild ist ein rätselhafter Satz eingraviert: Das Große ist nur des Kleinen Tiefe.
Hinter der Baumgruppe mit ihren ausladenden Armen, deren abendrotfeuriges Blätterkleid im Frühling die Flanierenden versöhnt, im Sommer, wenn die Blätter vergrünen, Schatten spendet, in deren Falllaub Igel und Spitzmäuse überwintern, dahinter also steht eine noch höhere Baumgruppe. Fünf Douglasien mit Wipfeln, welche die Blutbuchen weit überragen.
Wenn man unter dem Dipway Arch – so heißt die kleine Steinbrücke – hindurchgeht und dann unvermittelt vor dem Baumensemble steht, fallen einem merkwürdigerweise zuerst die turmhohen Spitzen der Douglasien ins Auge, nicht etwa die mächtigen Blutbuchen.
Es ist vielleicht zehn Jahre her, da spendierte ein chinesischer Telekomriese den New Yorkern einen ›Sichuan-Lebensbaum‹, eine äußerst seltene Koniferenart, die als ausgestorben galt und zufällig in einem unzugänglichen Gelände der Provinz Sichuan wiederentdeckt worden war. Bei einem Festakt – das Logo des Telekomriesen verdeckte den halben Prospekt der Blutbuchen – pflanzten zwei chinesische Gärtner und zwei von den NYC Parks die Kostbarkeit in gebührendem Abstand zu dem großen Baumensemble auf den Rasen, wobei Erde vom Fundort Chengkou Xian verwendet wurde. Das etwa zwei Meter hohe Gewächs, mehr Strauch als Baum, sollte zwanzig Meter hoch werden.
Spazierte man jetzt unter der einfachen Steinbrücke hindurch, sprang einem nicht zuerst der ampelgrün leuchtende Lebensbaum in die Augen, sondern das Buchenkleid. Die Zypresse konnte sich recken, wie sie wollte, flimmern und schillern, man bestaunte das Abendrotfeuer der Buchen. Bis das Bäumchen eines Tages ohne Fremdeinwirkung verdorrte. Über Nacht.
Nun sind es – seltsam – wieder die Wipfel der Douglasien, die man zuerst wahrnimmt.
Vom Reichtum
Ein wohlhabender Junge wohnte in einem weiten Haus mit einem prächtigen Garten, der von uralten Nussbäumen umstellt war. Das Haus lag an einem Abhang in der feinsten Gegend der Stadt. Das Kind hatte, was sich ein Kind nur wünschen konnte, weil Mutter und Vater alle Zeit und Liebe, die sie aufbrachten, an es verschwendeten. Die Leute wunderten sich, dass ein so verwöhnter Bengel, der mit Spielsachen überhäuft wurde, ein so ausgeglichenes Wesen hatte, denn sie glaubten, dass ein Mensch, der keine Entbehrung kennt, auch kein wertvolles Glied der Gesellschaft sein könne.
»Das Nein ist das wichtigste Wort im Leben. Die werden noch sehen, wie weit sie mit ihrer Erziehung kommen«, redeten die Leute in der Stadt. »Ein leerer Mensch wird aus ihm werden, der alles hatte und doch nur unglücklich war. Auf die schiefe Bahn wird er kommen oder noch schlimmer.«
Der Junge wuchs heran. Er hatte viele Freunde. Die meisten suchten seine Nähe, weil sie sich einen Vorteil davon erhofften. Einen Freund hatte er aber, dem das egal war. Er liebte seinen Klassenkameraden, weil man mit ihm so von Herzen froh sein konnte. Wenn er mit ihm spielte, waren die Sorgen wie weggeblasen. Denn sein eigenes Leben war von Ängsten durchzogen, von einer unsicheren Zukunft, von Entbehrungen und vom wichtigsten Wort, dem fortwährenden Nein.
Eines Tages fragte der reiche Junge den armen: »Wie ist es, arm zu sein? Ich würde einmal gern mit dir tauschen.«
Es kam, dass der Wunsch schneller in Erfüllung ging als gedacht. Im weiten Haus mit dem Garten wurden übers Jahr die Lüster und Gardinen abgehängt. Möbelpacker reichten einander die Klinke. Blau beanzugte Männer mit reglosen Mienen taxierten das Grundstück. Am Ende mussten sogar die Nussbäume weichen.
Die beiden Freunde, die jetzt erwachsen waren, verloren sich jedoch nicht aus den Augen.
»Nun weiß ich, wie es ist, arm zu sein«, sagte der ehemals reiche Junge. »Ich sehe aber keinen Unterschied.«
Der arme Junge, der auch ein armer Mann geblieben war, antwortete: »Wie sind doch die Sorgen weggeblasen, wenn wir beisammen sind!«
Das immerblühende Ahornblatt
I