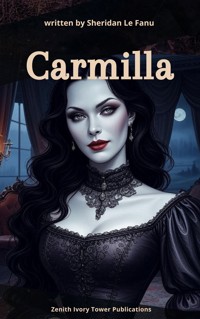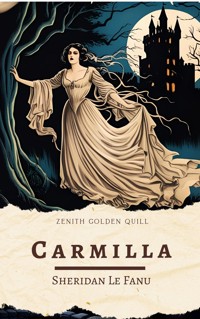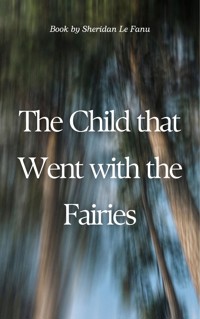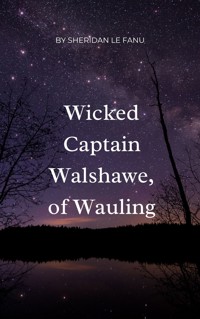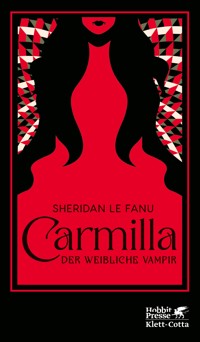
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein Klassiker der Vampire-Romance – so unsterblich wie Carmilla selbst. »Carmilla« gilt als einer der ersten und gleichzeitig besten Vampir-Romane überhaupt. Eine junge Frau namens Laura lebt mit ihrem Vater auf dessen österreichischen Landsitz, dem Schloss Karnstein, in der Steiermark. Doch Lauras friedliches Leben gerät schnell ins Wanken, als sie auf die rätselhafte und schöne Carmilla trifft. In einem abgelegenen Schloss tief in den österreichischen Wäldern führt Laura ein einsames Leben mit ihrem kranken Vater als einzigem Gefährten. Bis in einer mondhellen Nacht eine Pferdekutsche vorfährt, die einen unerwarteten Gast an Bord hat – die schöne Carmilla. Schnell beginnt eine fiebrige, an Besessenheit grenzende Freundschaft zwischen Laura und ihrer geheimnisvollen, bezaubernden Begleiterin. Doch während Carmilla immer seltsamer und unberechenbarer wird und zu unheimlichen nächtlichen Streifzügen neigt, plagen Laura eckzähnige Albträume und sie wird von Tag zu Tag schwächer... Sechsundzwanzig Jahre vor »Dracula« ist »Carmilla« die ursprüngliche Vampirgeschichte, durchdrungen von sexueller Spannung und Gothic-Romantik, die ihresgleichen sucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Sheridan Le Fanu
Carmilla
Der weibliche Vampir
Aus dem Englischen von Eike Schönfeld
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Carmilla« im Verlag Richard Bentley & Son, London
Für die deutsche Ausgabe
© 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: Birgit Gitschier, Augsburg
unter Verwendung der Daten von Pushkin Press © Cover design by Jo Walker
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98820-8
E-Book ISBN 978-3-608-12343-2
Inhalt
Vorwort
1.
KAPITEL
Ein früher Schreck
2.
KAPITEL
Ein Gast
3.
KAPITEL
Wir vergleichen Aufzeichnungen
4.
KAPITEL
Ihre Gewohnheiten – ein Bummel
5.
KAPITEL
Ein wunderbares Abbild
6.
KAPITEL
Eine sehr merkwürdige Seelenpein
7.
KAPITEL
Niedergang
8.
KAPITEL
Suche
9.
KAPITEL
Der Arzt
10.
KAPITEL
In Trauer
11.
KAPITEL
Die Erzählung
12.
KAPITEL
Ein Gesuch
13.
KAPITEL
Der Holzfäller
14.
KAPITEL
Das Treffen
15.
KAPITEL
Tortur und Hinrichtung
16.
KAPITEL
Schluss
Vorwort
Auf einem dem folgenden Bericht beigelegten Papier hat Doktor Hesselius sehr sorgfältige Ausführungen verfasst, die er mit einem Verweis auf seine Abhandlung über das mysteriöse, in dem Manuskript veranschaulichte Thema anfügt.
Dieses mysteriöse Thema behandelt er in jener Abhandlung mit gewohnter Gelehrsamkeit und Geisteskraft sowie mit bemerkenswerter Direktheit und Verdichtung. Sie wird in der Reihe der gesammelten Schriften dieses außerordentlichen Mannes lediglich einen Band einnehmen.
Indem ich den Fall in diesen Bänden veröffentliche, schlicht zum Nutzen der »Laienschaft«, werde ich der intelligenten Dame, welche ihn erzählt, in nichts vorgreifen und bin nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gelangt, mich jedweder gekürzten Darstellung der Folgerungen des gelehrten Doktors zu enthalten oder aus seiner Darlegung eines Themas zu zitieren, welches er als »gut und gern einige der tiefsten Geheimnisse unseres Doppellebens und seiner Mittler« beschreibt.
Bei der Entdeckung dieses Papiers war mir daran gelegen, die von Doktor Hesselius vor so vielen Jahren begonnene Korrespondenz mit der klugen und achtsamen Person, wie seine Informantin es offenkundig war, wiederaufzunehmen. Doch sehr zu meinem Bedauern erfuhr ich, dass sie zwischenzeitlich verstorben ist.
Wahrscheinlich hätte sie dem Bericht, welchen sie auf den folgenden Seiten, soweit ich sagen kann, gewissenhaft und derart präzise mitteilt, nur wenig hinzufügen können.
1. KAPITEL
Ein früher Schreck
In der Steiermark bewohnen wir, wenngleich gewiss nicht fürstlich, ein Schloss. In jenem Teil der Welt kommt man mit einem kleinen Einkommen sehr weit. Acht- oder neunhundert im Jahr bewirken Wunder. Das unsere hätte uns zu Hause wohl kaum zu den Reichen gezählt. Mein Vater ist Engländer, ich trage einen englischen Namen, obgleich ich England nie gesehen habe. Hier jedoch, in diesem einsamen, einfachen Land, wo alles so wunderbar billig ist, kann ich wirklich nicht erkennen, wie noch mehr Geld unsere Annehmlichkeit oder gar Üppigkeit materiell vergrößern würde.
Mein Vater stand in österreichischen Diensten und erwarb, nachdem er sich mit einer Pension und seinem Erbe zur Ruhe gesetzt hatte, diesen feudalen Wohnsitz sowie das dazugehörige kleine Gut zu einem vorteilhaften Preis.
Nichts könnte malerischer oder abgeschiedener sein. Es steht auf einer leichten Anhöhe in einem Wald. Die Straße, sehr alt und schmal, führt vor seiner Zugbrücke – zu meinen Lebzeiten nie hochgezogen – sowie an dem mit Barschen bestandenen Wassergraben vorbei. Auf dessen Oberfläche segeln viele Schwäne und treiben Flotten weißer Wasserlilien.
Über all dem zeigt das Schloss seine vielfenstrige Fassade, seine Türme und seine gotische Kapelle.
Vor seinem Tor öffnet sich der Wald zu einer regellosen und sehr malerischen Lichtung, zur Rechten trägt eine steile gotische Brücke die Straße über einen Bach, welcher sich in tiefem Schatten durch den Wald schlängelt.
Ich sagte, dies sei ein sehr einsamer Ort. Urteilen Sie selbst, ob ich die Wahrheit sage. Von der Eingangstür aus zur Straße hin erstreckt sich der Wald, in welchem unser Schloss steht, auf fünfzehn Meilen zur Rechten und zwölf zur Linken. Das nächste bewohnte Dorf liegt ungefähr sieben Ihrer englischen Meilen zur Linken. Das nächste bewohnte Schloss mit historischem Bezug ist das des alten Generals Spielsdorf, nahezu zwanzig Meilen weiter zur Rechten.
Ich habe gesagt »das nächste bewohnte Dorf«, denn nur drei Meilen westlich, also in Richtung General Spielsdorfs Schloss, liegen die Ruinen eines Dorfs mit seiner wunderlichen kleinen Kirche, nunmehr ohne Dach, in deren Mittelgang die modernden Gräber der stolzen, nunmehr ausgestorbenen Familie Karnstein liegen, der einstigen Besitzer des ebenfalls verlassenen Château, welches inmitten des dichten Waldes auf die stummen Ruinen des Dorfes blickt.
Davon, warum dieser eindrückliche, melancholische Ort aufgegeben wurde, berichtet eine Sage, die ich Ihnen ein andermal erzählen will.
Jetzt aber muss ich Ihnen erzählen, wie sehr klein die Schar der Bewohner unseres Schlosses ist. Darin schließe ich nicht die Dienerschaft ein, auch nicht die Abhängigen, welche Räume in den zum Schloss gehörigen Gebäuden bewohnen. Hören Sie mit Staunen! Mein Vater, der freundlichste Mann auf Erden, nun jedoch alternd, und ich, zum Zeitpunkt meiner Geschichte erst neunzehn. Seitdem sind acht Jahre vergangen. Mein Vater und ich bildeten die Familie im Schloss. Meine Mutter, eine steirische Dame, starb während meiner frühen Kindheit, aber ich hatte eine gutmütige Kinderfrau, die, fast möchte ich sagen von klein auf, bei mir gewesen ist. Ich könnte mich keiner Zeit entsinnen, da ihr dickes, freundliches Gesicht kein vertrautes Bild in meiner Erinnerung war. Es war Madame Perrodon, gebürtig aus Bern, deren Fürsorge und gutes Wesen den Verlust meiner Mutter, an die ich keinerlei Erinnerung habe, so früh habe ich sie verloren, teilweise ersetzte. Sie bildete ein Drittel unserer kleinen Tischgesellschaft. Es gab noch eine vierte, Mademoiselle De Lafontaine, eine Dame, welche Sie wohl »Gouvernante« nennen. Sie sprach Französisch und Deutsch, Madame Perrodon Französisch und gebrochenes Englisch, wozu mein Vater und ich Englisch beisteuerten, was wir, teils um zu verhindern, dass es bei uns zu einer untergegangenen Sprache wurde, teils auch aus patriotischen Gründen, täglich sprachen. Die Folge war ein Babel, worüber Fremde immer lachten und das ich in diesem Bericht nicht wiedergeben will. Zudem gab es auch noch zwei, drei junge Freundinnen, ziemlich genau meines Alters, die gelegentlich länger oder kürzer zu Besuch kamen, den ich zuweilen erwiderte.
Dies waren unsere regelmäßigen gesellschaftlichen Zerstreuungen, aber natürlich gab es auch gelegentlich Besuche von »Nachbarn« aus nur fünf oder sechs Wegstunden Entfernung. Gleichwohl war mein Leben ein recht einsames, das kann ich Ihnen versichern.
Meine Gouvernanten übten gerade so viel Aufsicht über mich, wie Sie von solch verständigen Personen hinsichtlich eines recht verwöhnten Mädchens, dessen einziges Elternteil ihm beinahe in allem seinen Willen ließ, annehmen würden.
Das erste Ereignis in meinem Leben, welches in meinem Gemüt einen fürchterlichen Eindruck hinterließ, der noch bis heute nicht getilgt ist, war überhaupt eines der frühesten, an die ich mich erinnern kann. Manche werden es für so banal erachten, dass es hier gar nicht aufgeführt werden sollte. Sie werden jedoch nach und nach erkennen, warum ich es erwähne. Die Kinderstube, wie sie hieß, obwohl ich sie ganz für mich allein hatte, war ein großer Raum im Obergeschoss des Schlosses mit einem steilen Eichendach. Ich kann nicht älter als sechs Jahre gewesen sein, als ich eines Nachts erwachte; ich blickte mich im Zimmer um, sah die Kindsmagd aber nicht. Auch meine Betreuerin war nicht da, sodass ich mich allein wähnte. Ich fürchtete mich nicht, da ich eines jener Kinder war, denen die Gespenstergeschichten, Märchen und derlei Sagengut, bei denen man sich die Decke über den Kopf zieht, wenn die Tür plötzlich knarrt oder das Flackern einer verlöschenden Kerze den Schatten eines Bettpfostens an der Wand vor dem Gesicht tanzen lässt, mit Bedacht vorenthalten wurden. Ich war verärgert und gekränkt darüber, dass ich, wie ich meinte, vernachlässigt wurde, und begann als Vorbereitung auf einen herzhaften Schreianfall zu wimmern, als ich zu meiner Überraschung ein ernstes, aber sehr hübsches Gesicht erblickte, das mich von der Bettkante her ansah. Es gehörte einer jungen Dame, welche, die Hände unter der Bettdecke, dort kniete. Ich musterte sie mit einer Art freudigem Staunen und hörte auf zu wimmern. Sie streichelte mich mit den Händen, legte sich neben mich ins Bett und zog mich lächelnd an sich; sogleich fühlte ich mich herrlich beruhigt und schlief wieder ein. Dann erwachte ich von einer Empfindung, als stießen zwei Nadeln gleichzeitig sehr tief in meine Brust, sodass ich laut aufschrie. Die Dame fuhr zurück, den Blick fest auf mich gerichtet, glitt dann hinab auf den Fußboden und, so glaubte ich, versteckte sich unterm Bett.
Nun erst fürchtete ich mich und schrie aus vollem Hals. Betreuerin, Kindsmagd, Haushälterin, alle kamen herbeigerannt und verharmlosten meine Geschichte, nachdem sie mich angehört hatten, wobei sie mich beruhigten, so gut sie konnten. Doch ich war ja ein Kind und sah daher, dass ihre Gesichter von einer ungewohnten Angst blass waren, ebenso, dass sie unters Bett schauten, unter Tische lugten und Schubladen aufzogen. Auch flüsterte die Haushälterin der Kindsmagd zu: »Legen Sie die Hand da in die Kuhle im Bett, da hat tatsächlich jemand gelegen, so sicher, wie Sie’s nicht waren. Die Stelle ist noch warm.«
Ich erinnere mich, dass die Kindsmagd mich hätschelte und alle drei meine Brust dort, wo ich, wie ich ihnen sagte, die Einstiche spürte, untersuchten und erklärten, es gebe keine sichtbaren Male, dass mir etwas Derartiges widerfahren sei.
Die Haushälterin und die beiden anderen Bediensteten, die für die Kinderstube verantwortlich waren, blieben die ganze Nacht bei mir sitzen, und ab da wachte stets eine bei mir, bis ich ungefähr vierzehn war.
Danach war ich lange Zeit sehr nervös. Ein Arzt wurde gerufen; er war blass und ältlich. Wie gut ich mich seines langen, schwermütigen, leicht pockennarbigen Gesichts entsinne und seiner kastanienbraunen Perücke. Eine gute Weile lang kam er jeden zweiten Tag und verabreichte mir eine Arznei, die ich natürlich verabscheute.
An dem Morgen, nachdem mir diese Frau erschienen war, befand ich mich in einem Angstzustand und ertrug es nicht, auch nur einen Augenblick lang allein zu sein, obgleich ja helllichter Tag war.
Ich erinnere mich, wie mein Vater heraufkam und am Bett heiter redete, der Betreuerin etliche Fragen stellte, über eine Antwort ganz herzlich lachte und mir die Schulter tätschelte, mich küsste und mir sagte, ich solle mich nicht fürchten, es sei nur ein Traum gewesen, der mir nicht schaden könne.
Ich aber war nicht beruhigt, denn ich wusste, dass der Besuch der seltsamen Frau kein Traum gewesen war, und ich fürchtete mich schrecklich.
Ein wenig tröstete mich, dass die Kindsmagd mir versicherte, sie selbst sei gekommen, habe mich angesehen und sich neben mich ins Bett gelegt, und dass ich halb geträumt haben müsse, sodass ich ihr Gesicht nicht erkannte. Dies, wenngleich von der Wärterin bestätigt, überzeugte mich jedoch nicht ganz.
Ich erinnere mich, wie im Laufe jenes Tages ein ehrwürdiger alter Mann in einem schwarzen Talar mit der Kindsmagd und der Haushälterin ins Zimmer kam und ein wenig mit ihnen sprach und auch sehr freundlich mit mir. Sein Gesicht war ganz reizend und sanft, und er sagte mir, sie wollten beten, legte meine Hände zusammen und bat mich, während sie beteten, leise zu sagen: »Herr, erhöre alle guten Gebete für uns, um Jesu willen.« Ich glaube, das waren genau die Worte, denn ich habe sie oft für mich selbst wiederholt, und meine Kindsmagd hat sie mich jahrelang in meinen Gebeten sprechen lassen.
Ich erinnere mich noch so gut an das achtsame, liebe Gesicht jenes weißhaarigen alten Mannes in dem schwarzen Talar, wie er in jenem hohen Zimmer stand, umgeben von dem klobigen Mobiliar einer dreihundert Jahre alten Mode, und an das spärliche Licht, das durch das kleine Gitterwerk in die schattenhafte Atmosphäre drang. Er kniete nieder und die drei Frauen mit ihm, und er betete lange Zeit, wie mir schien, laut mit ernster, bebender Stimme. Mein ganzes Leben vor diesem Ereignis habe ich vergessen, und auch einige Zeit danach ist alles dunkel, doch die Szenen, welche ich gerade beschrieben habe, stechen als die isolierten Bilder dieser von Finsternis umhüllten Phantasmagorie hervor.
2. KAPITEL
Ein Gast
Ich werde Ihnen nun etwas derart Eigenartiges erzählen, dass es Ihres gesamten Vertrauens in meine Wahrhaftigkeit bedarf, um meine Geschichte zu glauben. Doch ist sie nicht nur wahr, sondern eine Wahrheit, deren Augenzeuge ich selbst wurde.
Es war ein milder Sommerabend, und mein Vater fragte mich, wie er es zuweilen tat, ob ich mit ihm eine kleine Wanderung an jenem schönen Waldrand entlang machen wolle, der, wie schon erwähnt, vor dem Schloss lag.
»General Spielsdorf kann nicht so schnell zu uns kommen, wie ich hoffte«, sagte mein Vater, während wir gingen.
Er sollte uns auf mehrere Wochen besuchen, und wir hatten sein Eintreffen am folgenden Tag erwartet. Er sollte eine junge Dame mitbringen, seine Nichte und Mündel, Mademoiselle Rheinfeldt, welche ich noch nicht gesehen, die man mir aber schon als ganz reizende Dame geschildert, von deren Gesellschaft ich mir viele glückliche Tage versprochen hatte. Ich war enttäuschter, als eine junge Dame, die in der Stadt oder einem betriebsamen Viertel lebt, es sich nur vorstellen kann. Der Besuch sowie die neue Bekanntschaft, die er verhieß, hatte meine Tagträume viele Wochen ausgefüllt.
»Und wie bald kommt er nun?«, fragte ich.
»Erst im Herbst. Wohl in zwei Monaten«, antwortete er. »Und jetzt bin ich sehr froh, Liebes, dass du Mademoiselle Rheinfeldt gar nicht kennengelernt hast.«
»Warum das?«, fragte ich so gekränkt wie neugierig.
»Weil die arme junge Dame tot ist«, erwiderte er. »Ich habe ganz vergessen, dass ich es dir nicht gesagt habe, aber du warst nicht im Zimmer, als ich vorhin den Brief des Generals erhielt.«
Ich war zutiefst bestürzt. General Spielsdorf hatte in seinem ersten Brief, sechs oder sieben Wochen zuvor, erwähnt, dass es ihr nicht so gut gehe, wie er es für sie wünsche, doch nichts hatte auch nur im Entferntesten auf eine größere Gefahr hingedeutet.
»Hier ist der Brief des Generals«, sagte mein Vater und reichte ihn mir. »Leider ist er tief bekümmert; der Brief erscheint mir fast schon nahe dem Wahnsinn verfasst.«
Wir setzten uns auf eine klobige Bank unter einer Gruppe prächtiger Linden. Die Sonne ging in ihrer ganzen melancholischen Pracht hinter dem waldigen Horizont unter, und der Bach, der an unserem Heim vorbeifließt und weiter unter der erwähnten steilen alten Brücke hindurch, wand sich durch so manche Gruppe edler Bäume und warf in seinem Strom, fast zu unseren Füßen, das verblassende Karmesin des Himmels zurück. General Spielsdorfs Brief war so ungewöhnlich, dass ich ihn zweimal durchlas – das zweite Mal las ich ihn meinem Vater vor – und ihn mir noch immer nicht erklären konnte, außer dass die Trauer seinen Geist verstört hatte.
Er lautete:
»Ich habe meine teure Tochter verloren, denn als solche habe ich sie geliebt. Während der letzten Tage der Krankheit meiner lieben Bertha vermochte ich nicht zu schreiben. Davor hatte ich nichts von ihrer Gefahr erahnt. Ich habe sie verloren und erfahre nun alles