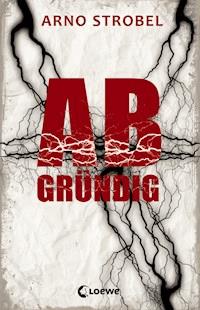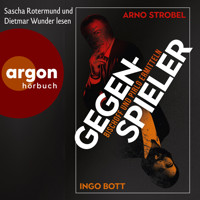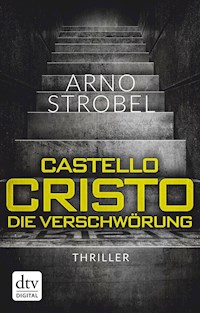
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der fesselnde Vatikan-Thriller von Bestsellerautor Arno Strobel Eine grausame Mordserie schockiert Rom: Mit den Leichen junger Männer wird der Kreuzweg Christi nachgestellt. Eine Station am Tag. Commissario Varotto ermittelt mit Matthias, einem Experten für religiös inspirierte Logen und Bruderschaften – wenige Jahre zuvor hat er die katholische Kirche vor dem sicheren Untergang bewahrt. Gemeinsam stoßen sie auf eine Spur: Alle getöteten Männer scheinen am selben Tag geboren zu sein. An einem Tag, an dem dieselbe Sternenkonjunktion am Himmel stand, wie sie vermutlich während Jesu Geburt zu sehen war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Arno Srobel
Castello Cristo
Thriller
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe 2009© Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MünchenDas Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.eBook ISBN 978-3-423-40125-8 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-21136-9Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de/ebooks
Inhaltsübersicht
3. NOVEMBER 1988
1
17. OKTOBER 2005
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18. OKTOBER 2005
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
19. OKTOBER 2005
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
20. OKTOBER 2005
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
VIER TAGE SPÄTER
76
DREI MONATE SPÄTER
77
DANKSAGUNG
Für meine Mutter
3.NOVEMBER 1988
Mailand
1
Der Alte zog den Kragen seines schmutzigen Mantels enger. Der Wind war eisig geworden in den letzten Tagen. Er wusste nicht, welches Datum war. Er wusste nicht einmal den Wochentag. Dinge wie ein Kalender spielten für ihn schon lange keine Rolle mehr. Es musste wohl Ende Oktober oder Anfang November sein, eindeutig zu früh jedenfalls für diese verdammte Kälte.
Früher, in einem anderen Leben, hatte er sich auf den Winter gefreut. Früher – da hatte es auch noch den Professore Edoardo Calgietti gegeben. Damals hatten die ersten Eisblumen an den Scheiben ihn noch mit Vorfreude erfüllt, Vorfreude auf lange Waldspaziergänge im dicken Mantel, während derer er seine Lungen mit kalter, klarer Luft fluten konnte, und auf den Advent mit seinen würzigen Düften und gemütlichen Abenden vor dem Kamin. Damals...
Das Geräusch, mit dem seine schwere Plastiktüte über den Boden der menschenleeren Straße schleifte, vertrieb die Bilder einer Vergangenheit, die mit der Zeit immer nebulöser wurden. Irgendwann würden sie ganz aus seinem Gedächtnis gelöscht sein. Der Schnaps würde es schon richten.
Edoardo dachte an die halb leere Flasche, die er in der Tüte mit sich trug, und augenblicklich wurde sein Gaumen trocken. Nur noch wenige Minuten, dann würde er den Bretterzaun erreichen, hinter dem, sorgsam vor den Blicken der achtbaren Bürger verborgen, der halb zerfallene Ziegelsteinbau lag, dessen Keller im Moment sein Zuhause war. Gleich könnte er auf sein Lager aus Styroporresten und alten Kartons sinken und die wertvolle Flasche auspacken, die ihm mit jedem Schluck ein weiteres Stück des Vergessens schenken würde. Er würde den Ratten bei ihrer Suche nach etwas Fressbarem zusehen, und irgendwann würde dann der gnädige Schlaf über ihn kommen...
Der Durst begann quälend zu werden, und Edoardo blieb stehen und hob den Kopf, um abzuschätzen, wie weit es noch bis zu seiner Behausung war. Er hatte sich angewöhnt, den Blick beim Gehen gesenkt zu halten, sich wie unter einer Glasglocke auf die abwechselnd unter ihm auftauchenden Spitzen seiner ausgetretenen Schuhe zu konzentrieren, auf ihr sinnloses Wettrennen, bei dem der führende im Sekundentakt wechselte. So ersparte er sich den Anblick einer Welt, von der er sich selbst ausgeschlossen hatte.
Im Licht der einsetzenden Abenddämmerung kam ihm ein Erstklässler entgegen. Der Junge trug einen Schulranzen und hatte die Hände tief in den Taschen seiner Jeans vergraben. Ein fröhliches Lied pfeifend, kickte er einen Stein vor sich her. Edoardo drückte sich in das Dunkel einer Toreinfahrt. Solche Rotzbengel machten ihm Angst.
Da stoppte neben dem Kleinen ein Wagen. Während sich Edoardo noch verwundert fragte, woher das Fahrzeug so schnell gekommen war, sprangen zwei kräftige, ganz in Schwarz gekleidete Männer heraus und stürzten sich auf den Jungen. Einer packte ihn unter den Achseln, der zweite an den Füßen, und schon waren sie wieder im Inneren des Wagens verschwunden, der sofort davonbrauste. Das Ganze hatte keine Minute gedauert, und nach weiteren dreißig Sekunden hatte sich das Motorengeräusch in einer Seitenstraße verloren.
Wie gebannt starrte Edoardo auf die Stelle, wo das Heck des Wagens hinter dem Eckhaus verschwunden war. Diese Männer in den schwarzen Anzügen – etwas stimmte hier nicht... Mein Gott, sagte eine Stimme von seltener Klarheit in ihm, diese Schurken haben gerade vor deinen Augen einen kleinen Jungen entführt. Aber da war noch etwas anderes gewesen. Etwas, das ihm seltsam vertraut vorkam, ohne dass er es hätte benennen können. Etwas, das nicht ins Bild passte...
Ungeachtet der Tatsache, dass er seine Schlafstelle noch nicht erreicht hatte, griff er in die Tüte und zog die Schnapspulle heraus. Er trank sonst nie auf der Straße; eines der letzten Relikte aus seinem früheren Leben. Doch daran dachte Edoardo in diesem Moment nicht. Mechanisch schraubte er den Verschluss ab und setzte die Flasche an die Lippen. Der Fusel rann brennend seine Kehle hinunter, und für einen kurzen Augenblick überkam ihn ein wahrhaft göttliches, allmächtiges Gefühl.
Plötzlich schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf, er versuchte ihn zu fassen und vergaß dabei zu schlucken, so dass er einen fürchterlichen Hustenanfall bekam. Weit nach vorne gebeugt stand er da, sein Körper krampfte sich mit jedem bellenden Husten zusammen, bis er endlich wieder zu Atem kam. Mit dem Ärmel seines verschlissenen Mantels wischte er sich den Mund trocken und starrte auf den Bürgersteig, auf dem er den Jungen hatte entlangkommen sehen.
Ein göttliches Gefühl. Das war es, was nicht gepasst hatte. Die schwarze Kleidung, der weiße Rand am Hals. Ein weißer Kragen. Diese Männer waren... Gottesmänner. Katholische Priester.
In diesem Moment, da ihm das klar wurde, schwor sich Edoardo, keinem Menschen jemals davon zu erzählen. Wozu auch? Man würde denken, er habe sich um den Verstand gesoffen. Und vielleicht stimmte das ja auch, und der Wagen, das Kind, die Männer, all das existierte nur in seiner Einbildung. Vielleicht war er seinem Ziel ja schon weit näher, als er gedacht hatte.
17.OKTOBER 2005
Ein Waldstück am nördlichen Stadtrand von Rom
2
Reflexartig trat Daniele Varotto auf das Bremspedal, als der stämmige Mann im Lichtkegel seiner Scheinwerfer auftauchte. Er musste irgendwo zwischen den Bäumen gestanden haben und erst im letzten Moment auf den Waldweg gesprungen sein, der von dem Platzregen eine Stunde zuvor ganz aufgeweicht war. Wahrscheinlich hatte er, an einen Baum gelehnt, ein Schläfchen gehalten.
Wüst fluchend öffnete der Commissario das Seitenfenster des BMWs.
»Sie verdammter Idiot! Sind Sie lebensmüde?!«, blaffte er den Carabiniere an. »Fast hätte ich Sie über den Haufen gefahren.«
»Entschuldigen Sie, Commissario«, stammelte der Polizist, nachdem er mit einer Taschenlampe den Ausweis angeleuchtet hatte, den Varotto ihm entgegenstreckte. Er hatte mindestens dreißig Kilo Übergewicht und schnaufte schwer, als hätte er gerade einen Hundert-Meter-Lauf hinter sich. »Ich... ich muss jeden Wagen kontrollieren, der hier durchwill. Ich konnte ja nicht ahnen, dass . . .«
»Dass Sie jemandem vor den Wagen springen, der nach 24Stunden ununterbrochenem Dienst erst gegen halb zwei ins Bett gekommen ist, aus dem ihn die Kollegen vier Stunden später wieder herausgeklingelt haben?«, wurde er schroff unterbrochen.
»Also... Gleich da vorne ist es, nach etwa vierhundert Metern, auf der rechten Seite«, antwortete der Carabiniere eingeschüchtert. »Sie werden . . .«
Varotto ließ ihn nicht ausreden. Er legte den ersten Gang ein und gab Gas, so dass die durchdrehenden Reifen matschige Erdklumpen nach hinten schleuderten. Mit einem Blick in den Rückspiegel sah er den Mann völlig verdreckt im schwachen Rot der Rückleuchten wild gestikulieren. Er grinste voll Genugtuung, während er auf den immer heller werdenden Lichtschein zufuhr, eine leuchtende Insel aus Scheinwerferlicht, in deren Zentrum mehrere Personen in weißen Schutzanzügen geschäftig hin und her liefen.
Hinter zwei Polizeifahrzeugen stellte er den Wagen ab und stieg aus. Einen Moment lang drehte er sich um und blickte zurück in den Wald. Die Finsternis war unergründlich. Plötzlich presste ihm eine unerklärliche Angst die Lungen zusammen. Varotto dachte an Dottore Parella und versuchte, tief und gleichmäßig zu atmen, als er spürte, dass der schlammige Weg unter seinen Füßen zu schwanken begann. Schweiß trat ihm auf die Stirn. Hilf mir, Francesca!,flehte er im Stillen. Und wusste doch, dass sie ihm nicht mehr helfen konnte. Intuitiv lehnte er sich gegen die Fahrertür des BMWs, während seine Sinne in einen Strudel gerieten, der ihn jegliches Gefühl für Zeit und Raum verlieren ließ.
»Kann ich Ihnen helfen?«
Die Worte kamen von weit her, wie das sanfte »Guten Morgen«, mit dem Francesca ihn so oft aus seinen Träumen in die Wirklichkeit zurückgeholt hatte.
»Signore! Was ist mit Ihnen?«
Zum Greifen nah waren die Worte jetzt, und Varotto griff nach ihnen wie nach einem Rettungsanker, an dem er sich hochziehen konnte, zurück in die Realität. Er öffnete die Augen, drehte aber gleich geblendet den Kopf zur Seite.
Der ältere uniformierte Mann, der ihn angeleuchtet hatte, senkte seine Taschenlampe.
»Kann ich Ihnen helfen, Signore?«, fragte er noch einmal.
Varotto schüttelte den Kopf und rieb sich mit Zeigefinger und Daumen die Augen.
»Nein, danke, alles in Ordnung. Ich bin nur hundemüde, hab kaum geschlafen.«
Der Carabiniere trat nun einen Schritt zurück und setzte eine strenge Miene auf, da ihm die Anweisungen seines Chefs wohl wieder in den Sinn gekommen waren.
»Darf ich fragen, was Sie hier zu suchen haben? Können Sie sich ausweisen?«
Varotto fühlte Ärger in sich aufsteigen. Erleichtert registrierte er, dass er wieder völlig in der Wirklichkeit angekommen war.
»Ich bin Commissario Varotto«, knurrte er den Polizisten an und hielt ihm seinen Ausweis vor die Nase. »Denken Sie, ich fahre um diese Zeit zum Spaß in den Wald?«
Der Carabiniere murmelte etwas Unverständliches und zeigte dann hinter sich.
»Vice Commissario Lucciani leitet den Einsatz. Sie finden ihn gleich da vorne.«
Varotto nickte. Lucciani leitete die Polizeidienststelle ganz in der Nähe dieses Waldstücks. Er stapfte auf die von mehreren Scheinwerfern angestrahlte Stelle zu.
Der junge Oberkommissar kam ihm schon entgegen und streckte die Hand aus, noch bevor er ihn erreicht hatte.
»Buongiorno! Sie müssen Commissario Varotto sein«, sagte er freundlich.
Trotz seiner schlechten Laune bemerkte Varotto den festen Händedruck, mit dem Lucciani ihn begrüßte. Er hatte kurze schwarze Haare wie Varotto, nur dass sein Schopf mittlerweile von silbernen Fäden durchzogen war, und war auch ein paar Zentimeter größer, vielleicht 1Meter 90.Varotto schätzte ihn auf höchstens 28.Viel zu jung für seinen Dienstgrad, dachte er mit leisem Neid gegenüber dem gut zwanzig Jahre jüngeren Kollegen; er selbst war erst kurz vor seinem 36.Geburtstag zum Vice Commissario befördert worden.
»Guten Morgen, Lucciani«, sagte er beschämt, als hätte ihn sein junger Kollege bei dem Gedanken ertappt. »Vielen Dank, dass Sie mich so schnell benachrichtigt haben.«
Lucciani nickte ernst. »Ich habe gestern von dieser bizarren Mordserie gehört und mich deshalb gleich an Sie erinnert. Kommen Sie, Commissario, ich zeig’s Ihnen.«
»Wer hat sie gefunden?«, wollte Varotto wissen.
»Ein junges Pärchen, das nach der Disco die Stelle für ein Schäferstündchen im Auto ausgesucht hat«, erklärte Lucciani. »Wir haben ihre Personalien aufgenommen, und dann habe ich sie ins Krankenhaus bringen lassen. Die beiden standen verständlicherweise unter Schock.«
»Ist die Todesursache schon bekannt?«
»Nein. Wir konnten keine äußeren Verletzungen entdecken.«
Daniele Varotto hatte schon viele Tatorte gesehen, und obwohl er zu wissen glaubte, was er hier vorfinden würde, erschien ihm das Bild, das sich ihm bot, vollkommen surreal.
Die Männer waren auf dem moosbewachsenen Boden neben einem umgestürzten Baum platziert worden. Einer – er mochte Mitte zwanzig sein – lag bäuchlings auf dem Boden, ein Bein war unter der beigen Kutte etwas angezogen, schmutzverklebte Strähnen seines langen blonden Haares wellten sich über seinen Schultern. In skurriler Haltung kniete ein älterer, dunkelhäutiger Mann vor ihm. Mit einer Hand schien er sich auf dem Boden abzustützen, während die andere unter die linke Schulter des Liegenden geschoben war. Es sah aus, als wollte er ihm helfen, sich aufzurichten. Varottos Augen blieben am Gesicht dieses Toten hängen, der trotz des stieren Blicks und einer eigenartig wächsernen Blässe irgendwie lebendig wirkte.
»O Gott«, entfuhr es ihm, »das ist ja wie im Wachsfigurenkabinett!«
Der junge Oberkommissar nickte. »Ja, wer immer das hier getan hat, war sehr bemüht, es so aussehen zu lassen, als ob sie noch atmen.«
Langsam ging Varotto um die Leichen herum, betrachtete die Szene von allen Seiten. Lucciani beobachtete ihn eine Weile, bevor er sagte: »Sie werden keine Stützen finden, die ihn in dieser Position halten, Commissario.«
Varotto zögerte einen Moment, dann streifte er sich die Handschuhe über, ging in die Hocke und tippte mit dem Zeigefinger vorsichtig an den nackten Unterarm des Dunkelhäutigen.
Lucciani schüttelte den Kopf. »Sie müssen schon richtig zupacken.«
Varotto folgte seiner Aufforderung und zuckte sofort zurück. »Himmel, das fühlt sich an wie Stein!«
»Ja. Der Mörder muss die Körper mit irgendwas behandelt haben. Was für eine Substanz das war, wird hoffentlich die Obduktion ergeben.«
Varotto richtete seine Aufmerksamkeit nun auf den am Boden liegenden Toten und schob die dichten blonden Locken ein wenig zur Seite, so dass sein Nacken sichtbar wurde. Direkt unter dem Haaransatz war eine stark verblasste Tätowierung zu erkennen. Über einem etwa zehn Zentimeter langen, nach oben gewölbten Bogen waren zwei Symbole gestochen: ein Fisch, der durch zwei gekrümmte Linien dargestellt wurde, die an einem Ende zusammentrafen und sich am anderen überschnitten und in ihrem Fortlauf die Schwanzflosse darstellten, und darüber eine Scheibe, von der strahlenförmig Striche ausgingen, so wie kleine Kinder die Sonne malten. Varotto stand auf.
»Ist es die gleiche Tätowierung wie bei den anderen?«, fragte Lucciani erwartungsvoll.
Varotto sah den Toten noch einmal an und nickte dann.
»Ja, exakt die gleiche, sogar an der gleichen Stelle. So wie’s aussieht, wurde sie gestochen, als er noch sehr jung war. Sie ist mit der Haut gewachsen.« Er machte eine kurze Pause, bevor er hinzufügte: »Genau wie bei den anderen.«
»Und haben Sie eine Vorstellung davon, was diese Szene darstellen soll?«
Statt einer Antwort ging Varotto nochmals um die Toten herum. Seine Augen suchten den Boden ab. »Wurden schon Spuren gesichert?«
Lucciani seufzte. »Die Kollegen von der Spurensicherung sind dabei. Nach dem Regenguss vorhin wird’s allerdings schwierig sein, noch irgendwas zu finden. Wonach suchen Sie?«
Wieder gab Varotto keine Antwort. Er bückte sich und schob seine Hand behutsam unter das Schulterblatt des liegenden Toten, dort, wo auch die Hand des Dunkelhäutigen verborgen war. Nach wenigen Sekunden richtete er sich auf und streckte Lucciani einen kleinen Gegenstand entgegen, den dieser erst erkannte, nachdem er einen Schritt näher getreten war.
»Markus 15,21«, brummte Varotto.
Verständnislos wanderten Luccianis Augen von Varotto zu dem kleinen hölzernen Kreuz und wieder zurück. Die beiden Männer standen sich jetzt dicht gegenüber.
»Ich habe eigentlich etwas anderes erwartet... Das hier, das ist die fünfte Station des Kreuzwegs, Lucciani«, erklärte Varotto. »Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen.«
Vatikan. Palazzo Sant’ Ufficio
3
Siegfried Kardinal Voigt legte den Brief vor sich auf den massiven Schreibtisch und sah Monsignore Bertoni nachdenklich an, der ihm gegenüber auf einem der schlichten Besucherstühle saß und gerade zum wiederholten Mal mit fahrigen Bewegungen seine Soutane über den Oberschenkeln glattstrich.
Der große schlanke Kardinal wirkte mit seinen kurzgeschorenen eisgrauen Haaren und der für seine 64Jahre außergewöhnlich glatten, leicht gebräunten Haut wie ein erfolgreicher Manager, der als »Macher des Jahres« das Cover eines Wirtschaftsmagazins hätte zieren können. Böse Zungen behaupteten insgeheim, diese charismatische Ausstrahlung hätte ihm geholfen, bis in die höchsten Ebenen der kirchlichen Hierarchie aufzusteigen; wäre ihm dies je zu Ohren gekommen, hätte er es allerdings weit von sich gewiesen, sah er sich selbst doch nur als demutsvollen Diener Gottes und der Kirche.
Voigt war als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre gleichzeitig auch Präsident der Päpstlichen Bibelkommission und somit Bertonis Vorgesetzter. Der 79-jährige zartgliedrige Monsignore war schon vier Jahre als Sekretär der Kommission unter Voigt tätig. In dieser Zeit hatten sie viele Gespräche geführt, aber der Kardinal konnte sich nicht erinnern, Bertoni jemals so nervös erlebt zu haben. Auch hatte es noch nie ein so frühes Treffen gegeben. Als Voigt um Punkt sieben seine Büroräume betrat, wartete Bertoni schon im Vorzimmer auf ihn und verstieß damit klar gegen die Order des Kardinalpräfekten, ihn nicht vor halb acht zu behelligen. Normalerweise nutzte Voigt die halbe Stunde der Ruhe, um seinen Tag zu planen, manchmal lehnte er sich aber auch nur zurück und ließ den Blick über die Einrichtung seines Arbeitszimmers gleiten. Die meisten der schweren Möbelstücke waren schon sehr alt, und es schien, als ließen sie ihn in diesen morgendlichen Minuten ein wenig an der geheimnisumwitterten Vergangenheit der Kongregation teilhaben, die einst als Sanctum Officium die Menschen in Angst und Schrecken versetzt hatte, ja vor der sich sogar die Päpste gefürchtet hatten. In solchen Momenten kam Siegfried Voigt oft in den Sinn, welch schwere Verantwortung er trug, besonders in Anbetracht der jüngsten Vergangenheit: Sein Vorgänger im Amt des Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre, Kurt Kardinal Strenzler, hätte die katholische Kirche als neugewählter Papst beinahe in den Abgrund geführt, wenn nicht durch das beherzte Handeln von... Der Kardinal seufzte.
»Monsignore Bertoni, warum, glauben Sie, hat man Ihnen diesen Brief zukommen lassen?«, fragte er mit ruhiger Stimme.
Bertoni zog die Schultern hoch. »Vielleicht, weil der Verfasser sicher sein wollte, dass der Text gleich verstanden wird?« Bevor der Kardinal etwas entgegnen konnte, fügte er schnell hinzu: »Und weil er davon ausgehen konnte, dass ich den Brief natürlich sofort an Sie weitergeben werde.«
Voigt nickte bedächtig. »Und? Was denken Sie über den Inhalt?«
Statt einer Antwort deutete Bertoni auf den Brief und sagte: »Darf ich . . .?«
Der Kardinal schob das Papier über den Schreibtisch, und Bertoni las den einzigen Satz laut vor, der darauf geschrieben stand:
Deshalb gebe ich ihm seinen Anteil unter den Großen, und mit den Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Denn er trug die Sünden von vielen und trat für die Schuldigen ein.
Bertoni ließ das Blatt sinken und wollte schon weitersprechen, doch kam ihm Voigt zuvor:
»Jesaja, Kapitel 53.Aber was hat das zu bedeuten?«
Bertoni zog ein blütenweißes Taschentuch aus seiner Soutane, mit dem er sich den kalten Schweiß von der Stirn wischte.
»Ich weiß es nicht, Eure Eminenz. Wie Sie wissen, beinhaltet das Kapitel 53 mehrere Prophezeiungen; darin geht es um Christi Geburt, sein Leben und seinen Tod. Und dieser Vers hier«, er deutete auf das Papier, »ist der zwölfte und letzte, der Jesu Tod beschreibt. Im Neuen Testament findet sich dazu ein Pendant bei Matthäus 27,38: ›Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken.‹«
Kardinal Voigt runzelte die Stirn. »Aber das erklärt nicht den Sinn der Botschaft. Sie sagten, man habe Ihnen das Schreiben in die Hand gedrückt, als Sie auf dem Weg ins Büro waren?«
Bertoni nickte eifrig. »Ja, Eure Eminenz. Als ich heute Morgen aus der Haustür trat, wartete ein Junge auf mich. Er sagte, eine Straße weiter hätte ihn ein Mann angesprochen und damit beauftragt, und er hätte fünf Euro dafür bekommen. Den Mann konnte er allerdings nicht näher beschreiben, weil er eine Mönchskutte trug mit einer Kapuze, die er tief ins Gesicht gezogen hatte.«
Gedankenverloren blickte der Kardinal an Monsignore Bertoni vorbei auf das deckenhohe Regal an der gegenüberliegenden Wand. Einige Sekunden saß er so da und schien angestrengt nachzudenken, dann beugte er sich vor und verschränkte die Hände auf der Arbeitsplatte des Schreibtischs.
»Nun gut... Ich denke, wir sollten der Sache keine allzu große Beachtung schenken. Wahrscheinlich war es nur ein harmloser Irrer, der sich berufen fühlt, als Mahner die göttliche Wahrheit zu verkünden. Davon laufen in Rom viele herum.«
Ungläubig starrte Bertoni ihn an. »Aber Eure Eminenz, warum der letzte Vers, der Jesu Tod beschreibt? Und weshalb bekomme ausgerechnet ich diesen Brief? Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl, ich . . .«
Der Kardinal winkte ungeduldig ab. Demonstrativ zog er einen Aktenordner zu sich heran und schlug ihn auf. »Lassen Sie es gut sein, Monsignore. Wir werden nichts mehr von diesem Menschen hören, da bin ich mir sicher.«
Selten hatte sich Siegfried Kardinal Voigt so geirrt.
Rom. Via Pietro Mascagni
4
Kurz vor halb acht setzte sich Varotto auf den Besucherstuhl vor Luccianis Schreibtisch, und während er seinem jungen Kollegen dabei zusah, wie dieser an einem niedrigen Aktenschrank Kaffee aus einer schwarzen Plastikkanne in zwei Tassen goss, spürte er, wie der Schmerz sich wieder an die Oberfläche seines Bewusstseins drängen wollte. Genau so eine Thermoskanne hatten Francesca und er... Heftig schüttelte er den Kopf, als könnte er so seine Gedanken durcheinanderbringen, damit sie den Faden zu Francesca nicht aufnehmen konnten. Lucciani warf ihm einen fragenden Blick zu.
»Die Müdigkeit«, erklärte Varotto ausweichend und sah sich demonstrativ in dem Büro um, dessen düstere, spartanische Einrichtung so gar nicht zu dem jungen dynamischen Vice Commissario passte, der nun eine der Tassen vor ihm abstellte, um den alten Schreibtisch herumging und sich auf seinen mit dunkelbraunem Kunstleder bezogenen Drehstuhl setzte.
»Sie sagten vorhin, Sie hätten etwas anderes erwartet, Commissario. Ich habe mir den ganzen Weg hierher den Kopf zerbrochen, was das sein könnte. Und noch etwas habe ich mich gefragt: Warum sind Sie sich so sicher, dass diese skurrile Szene die fünfte Kreuzwegstation darstellt? Klären Sie mich auf. Ich weiß bisher nur, dass wir es mit einer sehr ungewöhnlichen Mordserie zu tun haben.«
Varotto atmete schnaubend aus.
»Ungewöhnlich ist noch ein gelinder Ausdruck für das, was gerade vor sich geht! So etwas ist mir in meiner ganzen Laufbahn noch nicht untergekommen. Vier Mordfälle innerhalb von fünf Tagen, den von heute mitgerechnet, und alle tragen die gleiche Handschrift. Gestern hat dieser Irre entweder einen ›Ruhetag‹ eingelegt, oder aber das Opfer ist noch nicht gefunden worden. Wobei ich eher Letzteres befürchte.« Varotto machte eine kurze Pause, bevor er in seinen Ausführungen fortfuhr: »Den ersten Toten gab’s am Donnerstagmorgen in einer kleinen Nebenstraße der Piazza di San Paolo: ein Mann Mitte zwanzig, in einer langen Kutte, sein Rücken war übersät mit blutigen Striemen, er trug Handschellen und eine Dornenkrone, und sein Mörder hat ihm die Worte ›Markus 15,15‹ in die Brust geritzt. Ein eindeutiger Hinweis auf das Neue Testament: Um die Menge zufriedenzustellen, lässt Pilatus Barabbas frei und gibt den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. Die erste Station des Kreuzwegs: Jesus wird zum Tode verurteilt. Am Freitag dann ein Toter nahe des Vatikans, in der Via Orfeo, Ecke Via Borgo Pio. Sein Genick war gebrochen. Mit einem langen Nagel hat man ihm ein kleines Holzkreuz in die rechte Schulter geschlagen und einen Anhänger mit der entsprechenden Textstelle im Evangelium daran befestigt, als wäre er ein Gepäckstück. So war schnell klar, dass mit ihm die zweite Station nachgestellt worden ist: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Samstag früh hat man dann unter einer Brücke im Osten der Stadt, nur ein paar hundert Meter vom Friedhof Campo Verano entfernt, das dritte Opfer entdeckt. Man hätte denken können, der Mann hätte sich von der Brücke gestürzt, wäre da nicht das kleine Holzkreuz gewesen, das auf seinem Rücken lag. Die dritte Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Als Sie mich heute früh angerufen haben, habe ich fest damit gerechnet, in dem Waldstück die vierte Station vorzufinden: Jesus begegnet seiner Mutter. Wie sich gezeigt hat, sind wir mit den beiden Toten aber schon eine Station weiter. Deshalb, fürchte ich, muss es einen weiteren, bisher noch unentdeckten Mord geben.« Varotto starrte in seine Kaffeetasse und fügte mit leiser Stimme hinzu: »Ich will mir lieber nicht vorstellen, wie der inszeniert ist . . .« Er verstummte, riss sich dann aber zusammen und sah Lucciani in die Augen. »Der gesamte Kreuzweg besteht aus vierzehn Stationen. Folglich müssen wir mit zehn weiteren Morden innerhalb der nächsten Tage rechnen – wenn wir diesen Wahnsinnigen nicht stoppen können.«
Lucciani war blass geworden. Er stürzte seinen Kaffee hinunter und holte danach tief Luft. »Aber... schon das Präparieren der Leichen zur Darstellung der Station von heute Morgen muss Stunden gedauert haben. Und dann die ganzen Vorsichtsmaßnahmen, damit ihn keiner auf frischer Tat ertappt... Einer allein kann das doch eigentlich gar nicht schaffen!«
Varotto nickte. »Der Gedanke ist mir auch schon gekommen. Außerdem sind die Opfer ganz bewusst ausgewählt worden. Bei keinem wurde etwas gefunden, mit dem sich seine Identität klären ließe, mit Ausnahme des Dunkelhäutigen von heute waren sie alle im gleichen Alter, und zudem hatten alle diese stümperhafte Tätowierung im Nacken. Gehören sie einer Sekte an? Sind sie vielleicht sogar freiwillig in den Tod gegangen? Das ist schwer vorzustellen.«
»Wobei diese Tätowierung, wie Sie sagen, ja offensichtlich gestochen wurde, als die Männer noch sehr jung waren. Das würde bedeuten, dass sie bereits als Kinder im Einflussbereich dieser Sekte gestanden haben. Eine Sekte, die es schon so lange gibt, müsste aber bekannt sein. Das wäre ein Ansatzpunkt.«
Varotto trank einen Schluck Kaffee und verzog das Gesicht; er war inzwischen kalt und schmeckte fürchterlich.
»Fehlanzeige. Weder im Internet noch in der einschlägigen Literatur haben meine Männer bislang einen Hinweis auf die Zeichnung entdeckt. Daher haben wir uns gestern Abend entschlossen, der Presse von der Kreuzwegtheorie zu erzählen und die Tätowierung abdrucken zu lassen. Die Zeitungen müssten heute darüber berichten. Vielleicht meldet sich ja jemand, der zumindest einen der Männer identifizieren kann.«
Das Telefon klingelte. Lucciani hob ab. Erwartungsvoll beobachtete Varotto den jungen Kollegen, dessen Miene sich im Laufe des Gesprächs etwas erhellte.
»Die Spurensicherung«, erklärte Lucciani, kaum hatte er aufgelegt. »Der dunkelhäutige Mann hatte einen Ausweis in der Tasche. Er ist Libyer.«
Varottos Körper versteifte sich. So leise, dass Lucciani ihn kaum verstehen konnte, fragte er: »Kommt er aus einem Ort namens Schahhat?«
Lucciani hob verwundert die Augenbrauen. »Ja, so hieß der Ort. Woher wissen Sie das?«
In diesem Moment schrillte das Telefon erneut. Ein Anruf aus der Questura, Varottos Dienststelle.
Vatikan. Palazzo Sant’ Ufficio
5
Schon eine halbe Stunde nachdem Monsignore Bertoni sein Arbeitszimmer verlassen hatte, sollte es Kardinal Voigt dämmern, dass er sich in Bezug auf den seltsamen anonymen Brief vielleicht getäuscht hatte.
»Stellen Sie ihn bitte zu mir durch«, sagte er, als er von seinem Sekretär hörte, wer ihn dringend sprechen wollte.
»Eure Eminenz«, sagte der Anrufer, »es ist so weit: Wir brauchen ihn.«
»Ihn?... Warum?«, wollte Voigt mit tonloser Stimme wissen.
Während der Mann ihm von den Morden der letzten Tage berichtete, war es Voigt, als krampfte sich eine Faust um seinen Magen. Der Bericht endete mit dem Satz: »Sie wissen, dass Sie uns helfen müssen, Kardinal. Denken Sie an unsere Vereinbarung.«
Einige Sekunden verstrichen, in denen beide nur den Atem des anderen hörten. Die Vereinbarung. Die Kurie stand im Wort. Seine Bereitschaft, jederzeit zur Verfügung zu stehen, war die Bedingung gewesen, dass die italienische Justiz vier Jahre zuvor der Bitte der Kirche nachgekommen war.
»Ich werde sehen, was ich tun kann«, sagte Voigt. Dann legte er auf.
Vier Minuten später hatte er eine Ausgabe des ›Giorno e Notte‹ vor sich auf dem Schreibtisch liegen, eine von vielen Tageszeitungen, die der Untersekretär der Glaubenskongregation, Monsignore Ludwik Dzierwa, jeden Morgen auf Berichte über den Vatikan hin durchsah. Auch einige reißerisch aufgemachte Blätter waren dabei, denen kein Thema zu peinlich war und die der Chronistenpflicht eine eher untergeordnete Rolle beimaßen.
Die Schlagzeile in roten Lettern nahm fast die ganze erste Seite in Anspruch: »Kreuzwegmörder– Mordserie gibt Polizei Rätsel auf!« Im Aufmacher war von drei noch nicht identifizierten Leichen die Rede, mit denen der Mörder die ersten drei Stationen des Kreuzweges nachgestellt hätte. Daneben hatte man ein Foto abgedruckt, auf dem die Tätowierung zu sehen war, die dem Artikel zufolge den Nacken aller Opfer zierte. Der Artikel endete mit einem Aufruf an die Bevölkerung: »Wer hat eine solche Tätowierung schon einmal gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Questura oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.« Darunter waren mehrere Telefonnummern angegeben.
Nachdenklich schob der Kardinal die Zeitung zur Seite und griff sich eine weitere vom Stapel, den der Untersekretär ihm gebracht hatte.
»Alle Berichte haben den gleichen Tenor, Eure Eminenz«, erklärte Dzierwa, der vor dem Schreibtisch stehen geblieben war. »Offensichtlich ist die Polizei ratlos.«
Noch zwei Titelseiten überflog Kardinal Voigt, dann hatte er genug. Er wandte sich seinem Untersekretär zu. Das Licht der Schreibtischlampe spiegelte sich in den dicken Brillengläsern des jungen polnischen Geistlichen, so dass man die Augen des Mannes kaum erkennen konnte.
»Haben Sie das Zeichen schon einmal irgendwo gesehen, Monsignore?«
Dzierwa schüttelte den Kopf. »Nein, Eure Eminenz. Den Fisch als Erkennungszeichen der Urkirche natürlich schon. Aber auf einem... Berg? Über dem die Sonne scheint? Was für ein Sinnbild soll das sein?«
Kardinal Voigt wusste es auch nicht, doch schwante ihm nichts Gutes. »Monsignore Dzierwa, richten Sie Monsignore Bertoni bitte aus, dass er den Brief kopieren soll, den er heute Morgen bekommen hat. Das Original soll er sofort ins Polizeipräsidium schicken und dann mit der Kopie hierherkommen.«
Er wartete, bis der junge Geistliche den Raum verlassen hatte. Dann führte Kardinal Voigt zwei Telefonate. Das erste mit dem Privatsekretär des Papstes, den er um einen sofortigen Termin beim Heiligen Vater bat. Der zweite Anruf galt einem Kloster an den Hängen des Ätna auf Sizilien und dort einem Mann, der eigentlich im Gefängnis eine lebenslängliche Haftstrafe hätte verbüßen müssen.
Innenstadt von Rom
6
Varotto quälte sich durch den dichten Verkehr. Es war zwanzig vor neun.
Eine Viertelstunde zuvor war er losgefahren, gleich nachdem er den Anruf bekommen hatte. In der Via Macinghi Strozzi im äußersten Süden Roms hatte man ein weiteres Opfer gefunden. Zum Tatort brauche er nicht mehr zu fahren, hatte ihm sein Kollege Francesco Tissone kurz und knapp mitgeteilt, die Spurensicherung sei schon abgeschlossen. Er solle lieber zusehen, dass er schleunigst ins Präsidium komme, der Fall werde immer bizarrer.
Es regnete in Strömen. Die nasse Fahrbahn und das trübe Licht machten das Fahren zu einer Tortur. Varotto ließ das Fenster zur Hälfte herunter in der Hoffnung, die frische Luft würde seine bleierne Müdigkeit vertreiben, schloss es aber gleich wieder, da es so stark windete, dass ihm Regentropfen gegen die Wange schlugen.
Das verwunderte Gesicht des jungen Lucciani kam ihm in den Sinn, als er ihn gefragt hatte, ob das dunkelhäutige Opfer aus Schahhat kam. Dabei war das alles andere als Hellseherei gewesen. Er hatte sich am Sonntagabend intensiv mit den Kreuzwegstationen beschäftigt und irgendwo gelesen, dass Zyrene der alte Name des heutigen Schahhat war. Der oder die Täter hatten sich also tatsächlich die Mühe gemacht, einen Mann aus genau dieser Stadt für die Szene zu finden. Wie viele Libyer gab es in Rom, die aus Schahhat stammten? Doch sicher nur ein paar, und die mussten erst mal ausfindig gemacht werden. Die fünfte Station war folglich von langer Hand vorbereitet worden. Ein weiterer Hinweis darauf, dass eine ganze Organisation hinter der Sache stecken musste. Er dachte an das Telefonat mit Tissone. Der Fall werde immer bizarrer, hatte sein Kollege gesagt. Was hatte das zu bedeuten? Wie sollte noch zu steigern sein, was er wenige Stunden zuvor im Wald gesehen hatte?
Er fuhr sich mit der Hand über die Augen. Wenn er nicht bald eine Pause machte, würde er hinter dem Lenkrad einschlafen. Fünfzehn Minuten würden schon reichen. Angespannt suchten seine Augen nach einer Möglichkeit zu halten, bis er durch den Regenvorhang ein Schild erblickte, das zu einem Supermarkt führte. Aufatmend setzte er den Blinker.
Die Tiefgarage erwies sich als optimal. Varotto lenkte den BMW auf den Parkplatz, der am weitesten vom Aufzug entfernt war, und stellte den Motor ab. Dann nahm er seinen Schlüsselbund von der Konsole, kreuzte die Unterarme über dem Lenkrad und legte den Kopf darauf. Ein Trick, den ein Kollege ihm einmal verraten hatte. Je fester er schlief, umso mehr entspannten sich seine Muskeln. Irgendwann würde der Schlüsselbund ihm aus der Hand gleiten und mit klirrendem Geräusch zu Boden fallen. Varotto hatte diese simple Methode schon einige Male angewandt und war stets zuverlässig aus dem Schlaf aufgeschreckt.
Er schloss die Augen, froh, endlich ein wenig Ruhe zu finden. Während die Welt um ihn herum an Bedeutung verlor, lauschte er seinem Atem, den er immer deutlicher zu hören glaubte. Doch anstatt dadurch ruhiger zu werden, fiel ihm das Atmen seltsamerweise mit jedem Mal schwerer, er musste sich geradezu anstrengen, dem bedingungslosen Fordern seiner Lungen nach Sauerstoff gerecht zu werden. Plötzlich hörte er neben sich ein Stöhnen. Verwirrt öffnete er die Augen. Es herrschte Dunkelheit. Eine Dunkelheit von absoluter, undurchdringlicher Schwärze. Als er nach rechts blickte, sah er jedoch einen Frauenkörper, so deutlich, als würde er von einer geheimnisvollen Lichtquelle angestrahlt. Die Frau hatte langes, pechschwarzes Haar und war von geradezu übernatürlicher Schönheit. Francesca. Seine Francesca. Er lächelte. Er kannte keinen Menschen, der das Leben so bedingungslos liebte, der so unumstößlich an das Positive jeder Situation glaubte, auch wenn sie noch so unangenehm war. Selbst tot strahlte ihr Gesicht noch Sanftmut und Zärtlichkeit aus... Tot? Wie kam er darauf, dass sie tot war? Eben hatte sie doch noch gestöhnt. Er beugte sich über sie und drückte sein Ohr an ihre Brust. Nichts. Hastig packte er sie an den Schultern, schüttelte sie, rief ihren Namen, immer wieder. Doch sie hing nur schlaff in seinen Armen. Auf einmal hörte er es klappern. Er schreckte hoch – und starrte auf das Armaturenbrett seines BMWs. Er rieb sich die Augen und sah sich, noch ganz benommen, im Wagen um. Auf den CD-Hüllen, die er neben dem Schaltknüppel in die Ablage gestopft hatte, lag sein Schlüsselbund.
Ein Traum. Wieder einer dieser schrecklichen Träume. Er lehnte sich im Fahrersitz zurück. Als er sich über die Stirn wischte, war sein Handrücken nass. Er drehte den Zündschlüssel und warf einen Blick auf das Display des Autoradios. 9Uhr 20.Er hatte etwa fünfzehn Minuten geschlafen und fühlte sich trotzdem noch völlig ausgelaugt. So wie er sich fast jeden Morgen fühlte, wenn er schweißnass, manchmal schreiend, manchmal sich panisch aufsetzend, in seinem zerwühlten Bett aufwachte. Seit einem Dreivierteljahr ging das nun schon so; er hatte die Hoffnung fast aufgegeben, dass es irgendwann einmal besser würde, dass die Wunden verheilten, die jener fatale Tag vor zehn Monaten in seine Seele gebrannt hatte. Erschöpft schloss er die Augen, und die Bilder liefen wieder wie ein Film vor ihm ab.
Francesca. Das Dorf seiner Eltern, wo sie die Weihnachtsferien verbringen. Der Spaziergang mit seiner wunderbaren, einzigartigen Frau ... Lachend und eng umschlungen schlendern sie den schmalen Weg zwischen den Feldern entlang, bleiben alle paar Schritte stehen, küssen sich, reiben die Nasen zärtlich aneinander, sehen sich tief in die Augen. Trunken vor Glück merken sie nicht, dass sich am Himmel dunkle Gewitterwolken auftürmen, bis die ersten Regentropfen fallen. Hand in Hand laufen sie los, doch lachen sie noch immer, es macht ihnen nichts aus, nass zu werden.
Hinter einem Feld entdecken sie ein halb verfallenes Haus. Sie sehen sich nur kurz an, sie brauchen keine Worte. Die Grundmauern stehen noch, und auf dem verfaulten Gebälk liegen auch noch ein paar Ziegel, aber der immer stärker werdende Regen prasselt zwischen den Lücken hindurch, so dass Francesca einen Freudenschrei ausstößt, als sie am Boden eine geöffnete Luke entdeckt. Eine halbwegs stabil erscheinende Leiter führt nach unten. Er zögert, es ist viel zu gefährlich, doch Francesca ist im Nu unten. »Komm schon«, ruft sie ihm zu. »Hier ist es trocken. Komm und sieh, was ich für dich habe, mein Geliebter.« Er steigt die Leiter hinunter. Der Keller ist nicht besonders groß, unverputzt und ohne festen Boden. Es riecht erdig hier unten, ursprünglich. Im schwachen Licht, das durch die Luke herabfällt, sieht er Francesca, die an der sandigen Wand lehnt, vor sich einen Haufen nasser Kleider. Sie ist nackt. Sie ist wunderschön. Sand ist von der Wand auf ihre weißen Schultern gerieselt, und Francesca verreibt ihn nun langsam auf ihren kleinen Brüsten, wo er dunkle Streifen hinterlässt, und sieht ihn dabei an. Er spürt ein Ziehen in seinen Lenden, ein Verlangen nach ihrem Körper, das ihn fast den Verstand verlieren lässt. Er geht auf sie zu, sie küssen sich. Doch Francesca will mehr, sanft drückt sie ihn zu Boden. Flugs ist sie auf ihm, beginnt, sich mit schaukelnden Bewegungen an ihm zu reiben, stöhnt auf, als er in sie eindringt. Übergangslos wird aus dem zarten Wesen eine leidenschaftlich fordernde, ihre Lust herausschreiende Frau.
Sie vergessen, wo sie sind, geben sich ganz ihrer Leidenschaft hin. Bis ein gewaltiger Donner das Gemäuer erschüttert. Fast im gleichen Moment, in dem er den ohrenbetäubenden Donnerschlag vernimmt, bricht die Hölle über sie herein, Staub und Schutt prasseln auf sie herab, ihm schwinden die Sinne.
Als er wieder zu sich kommt, ist es stockfinster um ihn herum. Das Atmen fällt ihm schwer. Er kann sich nicht bewegen, spürt starke Schmerzen am ganzen Körper, keucht unter der Last, die auf ihm liegt. Etwas kitzelt sein Gesicht. Er braucht lange, bis ihm klar wird, dass es die Haare seiner Frau sind. Er flüstert ihren Namen, ruft ihn immer lauter, immer verzweifelter, versucht, eine Hand freizubekommen, ohne Erfolg.
Es dauert eine Ewigkeit, bis er sich eingesteht, dass Francesca tot ist. Eine Ewigkeit, bis man sie findet. 24Stunden ist er in dem eingestürzten alten Haus begraben. 24Stunden liegt seine tote, nackte Frau auf ihm. 24Stunden, in denen er sein Gottvertrauen verliert.
Gewaltsam öffnete Varotto die Augen. Über seine Wangen zogen sich feuchte Spuren. Heftig schüttelte er den Kopf, um die schrecklichen Bilder zu vertreiben.
Kurz darauf rannte er zum Aufzug, um sich oben im Supermarkt ein Sandwich zu kaufen, und fädelte sich fünfzehn Minuten später in den dichten Verkehr ein. Seine Gedanken kreisten nun wieder um die Morde.
Vatikan. Apostolischer Palast
7
Mit sorgenvollem Gesicht sah Seine Heiligkeit Papst Alexander IX. den Präfekten der Glaubenskongregation lange wortlos an, wie er es oft tat, wenn sie sich trafen.
Als vier Jahre zuvor der damalige Kardinalpräfekt der Kongregation für die Bischöfe, Massimo Kardinal Ferdone, als Papst aus dem denkwürdigsten Konklave der Kirchengeschichte hervorgegangen war, hatte er die Führung einer Kirche übernommen, die aufgrund der jahrzehntelangen Machenschaften einer geheimen Bruderschaft vor dem Abgrund stand. Papst Alexander IX., wie er sich fortan nannte, musste Hunderte von Sektenmitgliedern, von denen manche bis in die höchsten Ebenen der Römischen Kurie vorgedrungen waren, aus ihren Kirchenämtern entfernen, etliche davon sogar exkommunizieren. Und obwohl es ihm seinerzeit gelungen war, mithilfe weniger Getreuer die schlimmsten Dinge zu vertuschen, hatten antiklerikale Medien dennoch die Gunst der Stunde genutzt, um mit dem wenigen, was sie wussten, eine regelrechte Hetzkampagne gegen die katholische Kirche zu entfachen, die eine Welle von Kirchenaustritten ausgelöst hatte. Er hatte eine schwere Bürde übernommen, dieser Papst, und man sah es ihm an.
Siegfried Kardinal Voigt war in diesen schweren Jahren zu seinem engsten Vertrauten geworden. Und das, obwohl er – wie der Gründer und auch die späteren Führer dieser Bruderschaft– Deutscher war. In Momenten wie diesen, wenn die Kirche wieder einmal von der unseligen Vergangenheit eingeholt zu werden schien, tat ihm der müde alte Mann im weißen Papstgewand unendlich leid.
»Denken Sie, er ist für diese Aufgabe bereit?«, brach der Heilige Vater mit zitternder Stimme schließlich das Schweigen.
Kardinal Voigt zog die Schultern hoch. »Ich weiß es nicht, Eure Heiligkeit, ich habe noch nicht persönlich mit ihm gesprochen. Er lebt nun schon seit vier Jahren in dem Kloster und hat es während der ganzen Zeit kein einziges Mal verlassen. Wie mir der Abt versichert hat, weiß keiner seiner Mönche, wer dieser Mann wirklich ist, der sich seither Matthias nennt. Er führt ein sehr in sich gekehrtes, frommes Leben und hat sich mit Leib und Seele dem Studium obskurer Bruderschaften, Geheimbünde und Logen verschrieben. Sein Wissen darum muss inzwischen immens sein. Ich werde jedenfalls noch heute nach Sizilien fliegen, um zu sehen, ob er mittlerweile psychisch so gefestigt ist, dass wir es wagen können.« Er machte eine kurze Pause und seufzte. »Aber im Grunde bleibt uns und ihm eigentlich keine Wahl. Sie wissen, wie damals die Bedingungen lauteten: Die italienische Justiz hat das Recht, ihn zurate zu ziehen, wann immer es um die Aufklärung von Verbrechen geht, hinter denen eine religiöse Organisation stecken könnte.«
Die schon etwas trüben Augen des Papstes flackerten jetzt vor Angst. »Glauben Sie, das ist hier der Fall? Müssen wir uns Sorgen machen, Kardinal?... Nach dem Albtraum vor vier Jahren . . .«
»Ich hoffe nicht, Eure Heiligkeit. Aber lassen Sie mich zuerst mit ihm sprechen. Heute Abend bin ich wieder zurück und kann Ihnen berichten.«
Der Heilige Vater nickte mit kummervollem Gesicht und machte über dem Kardinalpräfekten das Kreuzzeichen.
Als er den Apostolischen Palast verließ, beschloss Voigt, trotz des schlechten Wetters einen Spaziergang durch die Vatikanischen Gärten zu machen. Er brauchte frische Luft. Die letzte Stunde hatte ihm mit ungeheurer Gewalt die schrecklichen Ereignisse vier Jahre zuvor in Erinnerung gerufen, und er sah sich wieder mit Bischof Corsetti in dessen Büro vor einem Stapel Tagebücher sitzen.
Rom. Questura, Via San Vitale 15
8
»Was soll diese Geheimniskrämerei, Francesco? Warum wolltest du mir am Telefon nicht sagen, was es mit dem neuen Fall auf sich hat?«
Francesco Tissone blickte von seinem Computermonitor auf. Wie unglaublich müde er aussieht, dachte er kurz, als er seinen Vorgesetzten auf sich zustürmen sah, und deutete auf den im rechten Winkel zum Schreibtisch stehenden Besucherstuhl.
»Erst einmal buongiorno, Daniele.«
»Buongiorno. Ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub«, grummelte Varotto, während er sich auf den Stuhl fallen ließ. »Ich möchte wissen, wie freundlich du noch wärst, wenn du vier Tage kreuz und quer durch Rom gehetzt wärst und jede Nacht höchstens eine Mütze voll Schlaf abbekommen hättest, weil man dich im Morgengrauen schon wieder mit der nächsten Hiobsbotschaft geweckt hat.«
Tissone verzog das schmale Gesicht mit der ausgeprägt römischen Nase zu einem breiten Grinsen. »Bestimmt freundlicher, denn ich bin gut zehn Jahre jünger als du und kann bedeutend mehr wegstecken.« Noch während er die letzten Worte sprach, bereute er sie auch schon. Schnell fügte er hinzu: »Entschuldige bitte, Daniele, das war gedankenlos von mir. Ich weiß ja, dass du . . .«
»Das gehört nicht hierher«, fiel Varotto ihm barsch ins Wort. »Also, was ist passiert?«
Tissone zog ein Blatt aus seiner Schreibtischschublade und legte es vor Varotto auf den Tisch, auf dem kein Krümel zu sehen war. Varotto hasste Tissones Ordnungswahn, aber er kannte seinen Kollegen lange genug, um zu wissen, dass dagegen kein Kraut gewachsen war. Er beugte sich über den Computerausdruck. Es war das vergrößerte Foto eines Toten. Der Mann saß aufrecht in einem Sessel, den Möbeln nach zu schließen, in einem Wohnzimmer. Um seinen Hals hing eine Kette mit einem kleinen Holzkreuz. Eine Verletzung war nicht erkennbar. Das Alter passte, er hatte lange blonde Haare, trug eine beige Kutte und einen geflochtenen Kranz aus Dornenzweigen.
»Hat man sonst noch was gefunden?«, fragte Varotto, ohne den Blick von dem Foto zu wenden. »Was ist mit der Tätowierung?«
»An der gleichen Stelle wie bei den anderen.«
Varotto sah auf. »Ich habe keine Ahnung, welche Station des Kreuzweges das darstellen soll. Hast du deshalb vorhin gesagt, dass das Ganze immer bizarrer wird?«
Tissone strich sich selbstgefällig über die kurzen schwarzen Locken. »Nein, das kommt noch«, verkündete er in der Gewissheit, eine große Überraschung präsentieren zu können. »Die Frau, die ihn so vorgefunden hat, ist seine Mutter.«
Varotto runzelte die Stirn. »Es ist wirklich furchtbar, dass ihr Sohn ermordet wurde, ohne dass sie etwas davon mitbekommen hat, Franco, aber ist das bizarr?«
»Nein, das allein nicht, das stimmt. Es ist ein großes Haus, Signora Costali schläft im obersten Stock und nimmt zudem ein Schlafmittel. Aber dass ihr Sohn als Achtjähriger entführt wurde und bis zum heutigen Tag verschollen war, das ist schon absonderlich, oder nicht?«
Varotto stutzte. »Moment! Du sagst, er wurde als Kind entführt, und heute, fast zwanzig Jahre später, ist er wiederaufgetaucht? In ihrem Haus? Als mittlerweile erwachsener, aber leider auch toter Mann? Habe ich das richtig verstanden?«
Tissone nickte ernst.
Varotto ließ sich gegen die Rückenlehne des Stuhls fallen. Eine ganze Weile sagte er kein Wort.
»Das kann nicht sein«, brummte er schließlich. »Das glaube ich einfach nicht. Wie will die Frau ihn denn wiedererkannt haben? Sie hat ihn als Achtjährigen zum letzten Mal gesehen!«
Tissone zuckte die Achseln. »Sie sagte, sie sei sich absolut sicher, dass der Tote ihr Stefano sei. Ich habe natürlich eine DNA-Analyse angeordnet... aber ich kann mir schon vorstellen, dass eine Mutter sich bei so was nicht täuscht.«
Nun endlich, da Tissone zum zweiten Mal das Wort »Mutter« aussprach, dämmerte es Varotto. Er stöhnte auf.
»Er ist ihr Sohn«, sagte er, erhob sich schwerfällig, ging mit hängendem Kopf zum Fenster und blickte hinunter auf den Bürgersteig.
»Wieso glaubst du jetzt auf einmal doch, dass er’s ist? Woher dieser plötzliche Sinneswandel?«, wollte Tissone verwundert wissen.
»Der Kreuzweg, Franco«, sagte Varotto ernst, während er sich wieder zu seinem Kollegen umdrehte. »Die vierte Station: Jesus begegnet seiner Mutter.«
Tissone starrte ihn an, als könnte sein Verstand die Worte nicht verarbeiten, die er gerade gehört hatte. Sekundenlang saß er so da.
»Mein Gott«, sagte er schließlich, »und wir dachten, dass der Täter die Kreuzwegstationen einfach willkürlich auswählt. Wir hielten es für die achte. Als Jesus auf die weinenden Frauen trifft. Denn geweint hat die Signora, das kann ich dir versichern.«
»Aber es war nur eine Frau«, erklärte Varotto. »Wer immer sich diesen Wahnsinn ausgedacht hat, ist ein Perfektionist. Und er will uns jede einzelne Station präsentieren. Wenn du dir die Bilder vom Waldstück mit der fünften Station angesehen hättest, statt hier alles bis zum letzten Bleistift im rechten Winkel auszurichten, wärst du selbst darauf gekommen... Na ja, vielleicht ja auch nicht.«
Tissone schnappte nach Luft, entgegnete aber nichts. So war Varotto eben. So war er früher schon gewesen, bevor er Francesca kennengelernt hatte, und so war er wieder geworden, seit...
Varotto deutete jetzt auf das Foto des Opfers, das noch immer auf dem Schreibtisch lag. »Das ist jedenfalls die vierte Station. Ist die Mutter vernehmungsfähig?«
»Nein, auf keinen Fall!« Tissone hob abwehrend die Hand, als müsste er Signora Costali vor Varotto beschützen. »Sie hat einen schweren Schock erlitten und ist in stationärer Behandlung. Wenn man sich das vorstellt: Sie findet ihren . . .«
»Und der Vater?«, fiel Varotto ihm ungeduldig ins Wort.
Tissone zog bedauernd die Schultern hoch. »Der ist seinerzeit mit der Entführung nicht fertig geworden. Er hat angefangen zu trinken und ist ein halbes Jahr nach Stefanos Verschwinden von einer Brücke gesprungen.« Er tippte auf einen dicken Ordner, der vor ihm auf dem Schreibtisch lag. »Steht alles hier drin. Das ist die Akte von damals.«
Varotto begann wütend im Büro umherzugehen. »Die arme Frau... Erst wird ihr kleiner Sohn entführt und bleibt zwanzig Jahre spurlos verschwunden. Und dann bringt man ihn um, weil der Mörder einen weiteren Hauptdarsteller für sein makabres Passionsspiel braucht. Das ist doch der reinste Irrsinn!« Plötzlich blieb er wie angewurzelt stehen. Sein Gesicht hatte alle Farbe verloren. »Aber... aber das würde ja bedeuten, dass